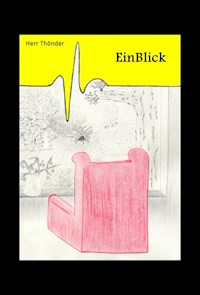Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unser Leben ist von schicksalhaften Momenten geprägt. Entscheidungen, Begegnungen oder Diagnosen haben Folgen, die wir manchmal nicht sofort absehen können. Wie sich unser Leben dadurch verändert, sehen wir häufig erst im Nachhinein. Herr Thönder hat solche schicksalhaften Momente gesammelt. Sein Wissen über andere Menschen hat er mit seiner Vorstellungskraft über ihre Gedankenwelt verbunden und so Geschichten erschaffen, die ebensolche schicksalhaften Momente im Leben darstellen. Krankheit, Sterben, Tod und Traurigkeit, Mobbing und Umweltzerstörung spielen thematisch ebenso eine Rolle wie Freude und Hoffnung. Denn über allem steht unser Grundbedürfnis nach dem einen, höchsten Gefühl: Liebe! Die Geschichten sind manchmal nicht leicht zu ertragen, regen aber immer zum Nachdenken an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herr Thönder
Was wird morgen sein?
Kurze Geschichten mitten aus dem Leben
Impressum
Texte: © 2021 Copyright by Herr Thönder
Umschlag:© 2021 Copyright by Herr Thönder
Verantwortlich
für den Inhalt:Herr Thönder
Druck:epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Inhalt
Vorwort
Grrk
Ferienende
Keine Tränen
Martha und Else
Der Brief
Abschied
Die Chefin
Was wird morgen sein?
Wie sag‘ ich’s…?
Wie sag ich’s…? – 2
Wie sag ich’s…? – 3
Glaube
Geburtstag
Nachwort
Vorwort
In meinem Sessel habe ich einen super Ausblick. Ein bisschen See, einige Bäume und Rasen. Hier tollen Eichhörnchen und Vögel durch die Gegend. Das ist immer entspannend und lustig.
Doch auch Straße, Parkplätze, Garagenhöfe und ein Hochhaus gehören zu meinem Ausblick. Was daran super sein soll?
Die Menschen.
Da, zum Beispiel, kommt Johnny. Wahrscheinlich möchte er mit dem Auto wegfahren. Doch Moment… ja, er muss nochmal ins Haus zurück und dreht um… oder doch nicht? Nein, er dreht erneut um und geht weiter zum Auto… aber jetzt? Ja, jetzt rennt er ins Haus zurück. Kurz darauf kommt er eiliger als zuvor zurück und hetzt zum Auto… nicht, ohne seine Taschen abzuklopfen und sich mehrfach umzudrehen… er fährt los… und bleibt noch einmal stehen, um zu Haus zu blicken… er überlegt… und fährt los.
Ich kenne Johnnys richtigen Namen nicht. Ich habe ihn Johnny getauft, Johnny Kontrolletti. Ich finde es interessant, ihn und die anderen aus dem Hochhaus zu beobachten, mir Geschichten auszudenken, ohne die Menschen wirklich zu kennen. Ich gebe ihnen Namen, um die Geschichten für mich schön zu machen. Diese Namen sind nicht politische korrekt, erfüllen aber den Zweck der Wiedererkennung. So kann ich mir die Geschichten besser merken.
Wohin Ernie und Bert wohl immer mit ihren Camouflage-Anzügen gehen?
Haben Barbie und Ken wirklich geerbt und können sich deshalb die Penthouse-Wohnung und drei Autos leisten?
Was Bob der Baumeister wohl wirklich arbeitet?
Ob der Auto-Freak wohl geschieden oder verwitwet ist?
Welche Grunderkrankung hat unser Läufer?
Was studiert Bubba wohl?
Welche Angst treibt diese beiden dazu, ständig ihr Auto zu reinigen? Und warum fallen mir zu ihnen keine Namen ein?
Solche Fragen stelle ich mir sehr oft. Nicht nur über die Menschen im Hochhaus, sondern über fast alle Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und über Tiere. Über nahezu alle Lebewesen.
Mein Kopf ist voll davon.
Ich will diese Gedanken festhalten und loswerden. Ich werde Geschichten schreiben. Ich werde Namen nehmen, ihnen eine Geschichte geben und diese aufschreiben. Die Geschichten werden an Menschen, Ereignisse oder einfach Gedanken angelehnt sein, die ich kenne. Viel wird dazu erfunden. Manche Menschen werden sich in diesen Geschichten wiedererkennen.
Ich hoffe, es sind nicht nur die, die in meinem Kopf sind, während ich schreibe…
Das ist der Plan. Und ich werde ihn durchziehen. Ich werde anfangen, zu schreiben.
Morgen…
Grrk
Warten. Das ist der schwerste Teil. Immer wieder warten.
Ich bin mir sicher, dass mein Opfer bald auftauchen wird. Dann heißt es, schnell und gnadenlos zuschlagen. Viele Gelegenheiten gibt es nicht mehr.
Das Kunststück ist, die Zeit zu überbrücken. Stillhalten und warten.
Ich halte gut still. Mittlerweile bin ich ein Meister darin. Ein Meister im Überleben. Ein Meister im Töten.
Um Stillzuhalten, habe ich mir angewöhnt, die Gedanken schweifen zu lassen. Ich erinnere mich an mein Leben. Ein besonderer Moment, ein Moment, an den ich mich oft zurückerinnere, ist, wie ich zum ersten Mal getötet habe. Ich erinnere mich, wie ich mein Opfer packte, es zu mir zog und zubiss, bis es tot vor mir lag.
Das habe ich von Mutter gelernt.
Die Gedanken an meine Mutter sind die schwersten. Sie, die ich so sehr geliebt habe. Sie hat mir alles beigebracht, mich ernährt und beschützt. Mich und meine Schwester.
Wir waren zwei Kinder, damals, als noch alles in Ordnung war.
Mutter ging voraus, als wir zum ersten Mal das Licht der Welt erblickten. Nach einer langen Zeit in der Dunkelheit einer kalten Höhle waren wir Kinder von der Helligkeit nahezu erschlagen. Ich konnte zunächst nichts tun als stehen und staunen. Dieser Moment war überwältigend, magisch, unbeschreiblich. Ich sog alles in mich auf. Die Helligkeit. Die Umgebung war strahlend schön. Die Ruhe war nicht mehr so dumpf wie zuvor. Alles war schöner als ich es mir nach den Erzählungen von Mutter vorgestellt hatte. Zum Erstarren schön. Deshalb erstarrte ich.
Bis meine Schwester mich umschubste und zum Spielen aufforderte: „Los, Grrk, wer stärker ist“. Schon bald tollten wir zwei immer mutiger umher. Alles, was wir sahen, gehörte jetzt uns. Wir blieben in Mutters Nähe, so wie sie es uns befahl. Wenn wir still sein sollten, blieben wir still. Der Respekt vor unserer Mutter war groß.
Sie war groß.
Manchmal entfernte sie sich ein wenig, erlaubte uns Kindern aber, ruhig weiterzuspielen. Nur nicht zu weit weggehen. Rufen, wenn jemand kam.
Jemand.
Was sollte das denn heißen? Ich verstand nicht, was sie damit meinte. Was sollte jemand sein? Es gab nichts außer uns dreien. Das Licht konnte Mutter nicht meinen, das war meistens da. Ich war total verwirrt, traute mich aber nicht, nachzufragen. So schwieg ich und wartete.
Auch damals konnte ich das schon. Ich bin der geborene Jäger.
Eines Tages rief meine Schwester ganz aufgeregt: „Ich glaube, das ist jemand!“
Sie blickte in eine Richtung. Ich tat es ihr nach und konnte in weiter Ferne jemand erkennen. Zwischen all dem Weiß bewegte sich etwas, oder besser jemand. Da war jemand. Jemand, der war wie wir. Jemand, der aussah, wie wir, und sich bewegte, wie wir. Jemand wurde immer größer. Ich wurde unruhig. Meine Schwester auch.
Deshalb riefen wir: „Mama, da ist jemand!“
Mutter war schnell da und befahl uns, still zu sein, uns möglichst nicht zu bewegen. Langsam ging sie ein paar Schritte auf jemand zu, machte sich groß und schnüffelte. Nach kurzer Zeit entspannte sie sich, drehte sich um und sagte: „Kommt, lasst uns Hörrr begrüßen.“
Wir waren verwirrt. Was sollten wir tun? Und was war Hörrr?
Also taten wir, was wir immer taten: Wir folgten unserer Mutter. Immer wieder lugten wir an ihr vorbei und erhaschten einen Blick auf jemand, oder besser: Hörrr. Hörrr sah aus wie Mutter. Hörrr bewegte sich wie Mutter. Wir entspannten uns, denn so jemand konnte nicht böse sein.
Und als wir ganz nah waren, sahen wir, dass auch Hörrr ein Kind dabeihatte. Während sich meine Schwester sofort ins Spiel mit dem Kind warf, hatte ich ein komisches Gefühl dabei. Ich mochte das Kind nicht.
Später erklärte mir Mutter, dass das ganz normal und völlig ok war. Ich beruhigte mich, denn ich hatte ein schlechtes Gewissen. Immerhin schienen Mutter und Schwester die beiden zu mögen.
„Das war ein Junge – kein Wunder, dass Du ihn nicht mochtest“, erklärte Mutter. „Es kann sein, dass ihr später so richtig Stress miteinander bekommt…“
Auch wenn ich nicht verstand, was sie mir erklärte, spürte ich doch instinktiv, dass sie recht hatte.
Als ich den Jungen eine Weile später wiedersah, endete es tatsächlich in einer wüsten Schlägerei. Durch die Spaßkämpfe mit meiner Schwester hatte ich damals noch Trainingsvorteile, sodass ich ihn besiegen und verjagen konnte.
Im Laufe meines Lebens kam es immer wieder zu Konfrontationen. Jede hatte einen anderen Ausgang, doch letztlich habe ich überlebt.
Mutter nicht.
Sie hatte uns das Töten beigebracht. Wir waren mittlerweile recht gut darin, uns selbst zu versorgen. Trotzdem suchten meine Schwester und ich weiterhin die mütterliche Nähe. Nur zum Spielen entfernten wir uns manchmal, weil Mutter auch zwischenzeitlich ihre Ruhe wollte. Unsere Spiele endeten immer häufiger tödlich. Nur nicht für uns.
Eines Tages waren wir zu zweit etwas entfernt ins Spiel vertieft, als wir viele komische Geräusche hörten. Alles zusammen klang wie eines der Gewitter, die wir schon kennengelernt hatten. Der Himmel war aber klar und wolkenlos, trotzdem hielt das Geräusch eine Weile an. Nach dem lauten und plötzlichen Beginn ebbte es dann immer mehr ab. Meine Schwester und ich beruhigten uns, waren jedoch neugierig geworden.
„Lass uns Mama fragen, was das war“, schlug ich vor und so rannten wir in die Richtung, wo wir unsere Mutter verlassen hatten.
Sie war nicht da.
Zumindest nicht ganz.
Alles, was wir sahen, als wir den letzten Hügel erklommen hatten, war ein Teil ihres Körpers. Sie hatte weder Hände noch Füße noch einen Kopf. Wir erkannten sie nur an einer Narbe am Rücken, die sie schon lange hatte.
Um sie herum war alles rot. Ihre Reste bewegten sich nicht mehr.
Meiner Schwester und mir war klar, dass wir nun auf uns allein gestellt waren.
Für eine Weile, denn irgendwann spürten wir es: Meine Schwester und ich mussten getrennte Wege gehen. Wir sprachen nie darüber. Wir stritten aber immer öfter. Und eines Tages ging sie nach links und ich nach rechts. Seitdem haben wir uns höchstens von weitem gesehen.
Selbst das war nicht sonderlich friedlich, aber wir ließen uns gegenseitig am Leben.
Getötet habe ich nur, um zu leben. Schnell, leise, effektiv, schmerzlos.
Nicht so, wie die komischen Figuren, die immer häufiger in unserer Gegend auftauchen. Komisches Fell, riesige Augen, langsam und unbeweglich. Mit seltsamen Hilfsmitteln, auf denen sie sich sitzend durch die Gegend bewegten. Dann waren sie schnell. Schnell und laut.
So beschrieb ich sie am Anfang.
In einer Phase des Friedens hörte ich die Geschichten anderer. Sie sagten, dass diese Wesen Menschen hießen. Dass sie nicht von hier waren. Dass sie hier nicht hingehörten.
Und dass sie gefährlich waren.
Aus allen Geschichten konnte ich heraushören: Es waren Menschen, die Mutter getötet hatten.
Menschen töten. Schnell. Laut. Brutal.
Sinnlos.
Ich hatte Angst vor ihnen. Ich wich ihnen aus, sobald ich sie roch oder hörte. Ich zog mich weiter in die ruhigen Gegenden zurück, wenn ich ahnte, dass sie kamen.
Eines Tages wurde ich überrascht. Ich war nach einer Mahlzeit müde und unaufmerksam geworden. Plötzlich spürte ich einen Stich im Nacken. Ich schrie auf, blickte mich rasend vor Schmerz um – und sah im letzten Moment Menschen. Schon wurde mir schwarz vor Augen.
Als ich erwachte und meine Sinne langsam wieder zu mir kamen, bekam ich wieder Panik. Menschen, ich muss schnell weg. Überall stank es nach ihnen, sie mussten noch ganz in der Nähe sein.
Und tatsächlich konnte ich sie noch sehen. Aber sie waren weiter weg, als ich dachte. Wo kam nur dieser Gestank her?
Egal, erstmal weg von ihnen. Auf ihren komischen Gefährten können sie nicht ins Wasser. Sie bewegten sich weg von mir, meine Panik wurde trotzdem nicht geringer. Es konnte eine Falle sein, sie konnten mir weiterhin auflauern. Ich war noch immer in Lebensgefahr. Ich wollte nur weg.
Ich rannte zum Wasser, um mich zu verstecken und zu reinigen. Auf dem Weg fiel mir dann aber auf, warum der Gestank einfach nicht weniger werden wollte: etwas hing um meinen Hals. Ich machte eine Vollbremsung und versuchte, es abzustreifen. Vergeblich.
Das Band um den Hals war stabil und fest. Nicht so, dass ich keine Luft mehr bekam, trotzdem engte es mich ein. Ich war Freiheit gewöhnt.
Die Freiheit war jetzt vorbei.
Die Menschen hatten sie mir genommen.
So sehr ich mich auch wusch, ich bekam den Gestank nicht aus der Nase. Ich würde diesen Gestank niemals vergessen.
Seit diesem Tag roch ich noch früher, wenn sie kamen.
Und sie kamen immer häufiger.
Sie kamen mir nie zu nah. Aber sie waren da.
Ich hasste sie. Ich wollte mich für den Tod meiner Mutter rächen. Sie leiden lassen. Ihnen Hände und Füße abtrennen, so wie sie es bei Mutter getan hatten. Ihre Köpfe als Spielzeug für die Kinder verwenden. Einfach auch sinnlos töten.
Leider hatte ich gleichzeitig Angst vor ihnen. Sie waren mächtiger als ich. Vor allem waren sie nie allein unterwegs. Sie waren immer im Rudel. Auch hatte ich gesehen, wie sie aus der Ferne töteten.
Also hielt ich mich fern. Zumindest tagsüber.
Nachts war ich im Vorteil. Ich hörte besser, ich roch besser. Nachts konnten sie mich nicht überraschen.
Aber ich konnte sie überraschen.
Ich schlich an ihren Sachen vorbei. Manchmal stieß ich etwas um und rannte schnell weg, damit sie mich nicht jagen konnten. Sie hätten mich erwischt. Erwischt und getötet. Deshalb durfte ich nur ihren Sachen, nicht aber ihnen zu nahekommen.
Aber stören konnte ich. Ich wollte sie verjagen, indem ich ihnen Angst machte.
Leider machte ich ihnen nicht so viel Angst, wie sie mir machten.
Die Zeit änderte sich. Die Menschen kamen häufiger. Dafür wurde es immer schwerer, mich zu versorgen. Meine Jagdgründe wurden kleiner. Ich musste improvisieren. Musste mehr schwimmen als früher.
Musste hungern.
Aber ich war schon immer ein Kämpfer.
Ich tötete weiter.
Ich überlebte weiter.
Der Kampf ums Überleben prägte zunehmend mein Leben. Vorbei die Zeiten, in denen ich mich treiben lassen konnte. Vorbei die Zeit, in der ich einmal Pause machen konnte. Vorbei die Zeit, in der ich friedlich mit anderen über längere Zeit zusammen war.
Ich muss überleben. Töten, um zu überleben. Warten, um zu töten.
Auch heute.
Ich sitze schon sehr lange und warte. Wann wird der Schwimmer auftauchen? Irgendwann tauchen sie immer auf. Dann muss ich bereit sein.
Sonst sterbe ich.
Vor Hunger oder Erschöpfung. Oder weil ich geschwächt vom Kämpfen bin. Schlägereien sind an der Tagesordnung. Wir sind alle gereizt. Geschwächt, ängstlich, gereizt. Die wenigen Kontakte, die ich habe, sind selten friedlich.
Wenn ich überhaupt mal jemanden treffe. Es scheint, als hätten die Menschen uns hier ersetzt. Je mehr von ihnen kommen, desto weniger sind wir. Nicht immer enden Begegnungen mit den Menschen tödlich. Immer mehr von uns tragen ähnliche Halsbänder wie ich.
Der Gestank ist langsam nicht mehr erträglich. Überall stinkt es nach Menschen.
Auch wenn sie uns nicht direkt töten: Sie machen den Boden kaputt, auf dem wir laufen. Mit immer größeren Geräten, auf denen sie kommen. Sie nutzen den Boden ab. Sie durchlöchern ihn, ohne dort zu jagen.
Schnell. Laut. Sinnlos.
Der Rest des Bodens geht einfach so weg. Ich muss schwimmen, wenn ich nicht springen kann. Beides ist unendlich anstrengend, wenn man nicht genug gegessen hat.
Ich bin schnell erschöpft, wenn ich lange unterwegs bin. Mir wird sehr warm, ich kriege oft kaum noch Luft.
Und dann brauche ich die Kraft, um zu jagen. Zu jagen und zu überleben.
Wie lange wird das noch möglich sein?
Wie lange habe ich noch meinen Raum?
Heute habe ich einen guten Platz gefunden. Ich bin sicher, dass ich heute überlebe.
Aber was ist morgen?
Ferienende
Jana warf sich noch etwas Wasser ins Gesicht und spülte sich erneut den Mund aus. Der Blick in den Spiegel verriet ihr: „Boh, siehst Du scheiße aus…“
Ein gequältes Lächeln erschien in dem Gesicht, das sie aus dem Spiegel anblickte. Sie sah wirklich schlimm aus: Ihre Haare standen in alle Himmelsrichtungen ab, ihre geröteten Augen waren von dunklen Ringen umgeben und der Bronzeton ihrer Haut war einem grünen Blass gewichen.
Dabei war sie so stolz gewesen, dass sie in diesem Sommer endlich einmal ein wenig Farbe bekommen hatte. In Lissabon war das auch kaum möglich gewesen, darum herum zu kommen.
Lissabon. Wie gerne erinnerte sich Jana im Nachhinein an diese Reise. Nun ja, nicht unbedingt an die Reise selbst. Immerhin war es eine Reise mit ihrer Familie gewesen. Das hieß Zeit mit Menschen zu verbringen, die uncool, nervig und in der Öffentlichkeit meistens peinlich waren. Nach ihren Recherchen war diese Meinung völlig normal für eine 16-jährige. Nicht normal war der Zwang, den ihre Eltern aufbauten, damit sie die Reise antrat.
Doch immerhin hatte die Reise alles verändert. Obwohl zunächst alles ganz anders aussah.