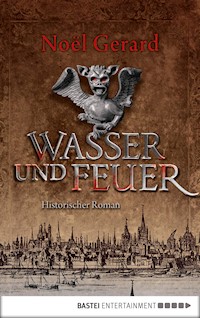
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Köln, 1525. Der junge Leonhart sieht verträumt den Schiffen nach, die den Rhein hinaufziehen. Doch sein Vater Tielman, ein Seidenhändler und Ratsherr der Stadt, hat für Träume nichts übrig. Es ist die Zeit der Reformation. Bauern ziehen gegen den Adel zu Felde. Auch in Köln begehrt das Volk gegen die Obrigkeit auf und als kriegerische Zustände in der Stadt ausbrechen, muss Tielman fliehen. Leonhart verschlägt es derweil nach Venedig. Als er Jahre später zurückkehrt, folgt er der Spur seines Vaters - und entdeckt ein dunkles Geheimnis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
NOËL GERARD
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2009 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus
Umschlaggestaltung: Ebert & Steidle, München
Einband-/Umschlagmotiv: © G. Westermann-Artothek; Photobusiness-Artothek
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-5750-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
INHALT
PROLOG
Der Nachtfalter
Basel, Oktober 1531
ERSTER TEIL
Das zerbrochene Fenster
Köln, Mai 1525
ZWEITER TEIL
Die toten Augen
Basel, Oktober 1531
DRITTER TEIL
Das falsche Spiel
Köln, Mai und Juni 1525
VIERTER TEIL
Das neugeborene Kind
Antwerpen, November 1531
FÜNFTER TEIL
Die Flucht
Köln, Samstag, 10. Juni 1525
SECHSTER TEIL
Das verlorene Haus
Köln, November und Dezember 1531
EPILOG
Ins Meer
Westenschouwen
/
Zeeland
Montag, 27. Mai 1532
NACHWORT
DANKSAGUNG
Wir haben mit der Vergangenheit abgeschlossen,
aber die Vergangenheit nicht mit uns.
Paul Thomas Anderson, Magnolia
PROLOG
DER NACHTFALTER
Basel, Oktober 1531
Mittwoch, 25. Oktober 1531
Vorwärts! Wollt ihr wohl voran!«
Mit lautem Geschrei feuerte Joerg, der Fuhrmann, vom Bock des Reisewagens herab das widerstrebende Vierergespann an. Der Wind riss ihm augenblicklich die Worte vom weit aufgerissenen, halb zahnlosen Mund; fast übertönte das Prasseln des Regens sogar den Peitschenknall.
»Vorwärts!«
Aber alles Antreiben half nichts. Der Leithengst scheute zurück, stieg auf, während das hinter ihm gehende Pferdepaar noch vorandrängte. Im Nu erfasste Unruhe das ganze Gespann, und der Reisewagen, dessen Räder sich ohnehin nur mühsam durch den tiefen Schlamm des Hohlwegs drehten, kam vollends zum Stehen.
Sogleich, ohne dass es eines Winks von Joerg bedurft hätte, sprang der Fuhrmannsknecht, ein rotschopfiger Bursche, vom Bock herunter. Keinen trockenen Faden mehr am Leib, watete er durch den Morast, um ins Halfter des Leittieres zu greifen. Hart über seinem Kopf ging Joergs Peitsche auf die nassen Pferdeleiber nieder, wirbelten die Hufe des Hengstes, der sich wieder und wieder aufbäumte.
Als der Knecht das Halfter endlich zu packen bekam, vermochte er das verstörte Tier kaum zu halten, das den Hals heftig hin und her warf und den Griff des Mannes abzuschütteln versuchte.
Da!
War da ein Krachen und Bersten gewesen? Ein Geräusch, das im Tosen des Sturms beinahe untergegangen war, aber dennoch deutlich zu hören?
Wieder drohten die Pferde auszubrechen. Joerg stemmte seine gestiefelten Füße fest in den Bock, riss die Zügel zurück. Lange würde er die Tiere nicht mehr halten können.
Sie hätten am Morgen nicht weiterfahren sollen, haderte Joerg. Sie hätten in dem Gasthof bleiben sollen, in dem sie die vergangene Nacht zugebracht hatten, und das aufziehende Unwetter abwarten. So, wie er es von seinem Fahrgast verlangt hatte.
Doch von Gemächlichkeit hatte der junge Herr, der Fuhrmann Joerg und dessen Knecht vor zwei Tagen auf dem Luzerner Marktplatz in Dienst genommen hatte, von Anfang an nichts hören wollen.
»Spannt an! Wir fahren!«, hatte der Fremde auch an diesem Morgen befohlen, trotz des sich verdunkelnden Himmels. In seinen Augen hatte Zorn geflackert, der selbst Joergs wettergegerbte Fuhrmannsseele aufgestachelt hatte.
Anfangs hatte Joerg nichts gegen Eile einzuwenden gehabt, war sie doch dienlich gewesen, dem Kriegsgetümmel zwischen papsttreuen Luzernern und den Lutherischen von Zürich und Bern zu entgehen, das seit Wochen hin und her wogte. Aber nun, da Basel nicht mehr weit war – wozu diese Hast? Seit Stunden tobte der Sturm, stürzten die Wasser des Himmels herab. Doch Joerg hätte nicht gewagt, die Räder auch nur einen Augenblick stillstehen zu lassen, zu gebieterisch war sein Passagier.
Da!
Wieder übertönte ein Krachen und Bersten den Sturm, lauter dieses Mal. Dann ein Lidschlag lang Stille, bis irgendetwas, eine unsichtbare Macht in seinem Rücken, den Knecht wie von der Feder geschnellt vom Gespann wegtrieb.
Eine gewaltige Eiche senkte sich knirschend und krachend auf den Hohlweg herab. Träge, jedoch unaufhaltsam fiel sie und ging mit donnerndem Aufprall, der die Krone durchschüttelte, zu Boden. Geröll und Erdbrocken kollerten hinterdrein.
Nun war kein Halten mehr: Der Leithengst tat einen Satz, strauchelte, stürzte; der Fuhrmann ging kopfüber vom Bock; die Wagendeichsel riss es herum, dass sie splitterte. Ein Knäuel aus Pferdeleibern suchte auseinanderzupreschen; die Augen der stampfenden und wiehernden Tiere rollten vor panischer Furcht, doch das Geschirr und die Enge des Hohlwegs hielten sie gefangen.
Inmitten des Wirrwarrs öffnete sich der Wagenschlag, und der schwarz gekleidete Fahrgast sprang heraus. Furchtlos, ohne Zögern trat er auf den Leithengst zu. Ehe der Fuhrmann sich vom Boden aufgerappelt hatte – und bis auch der Knecht sich endlich ein Herz fasste –, war der Schwarzgekleidete der Tiere Herr geworden, und bald standen sie, mit bebenden Flanken, still.
Die drei Männer verharrten im Regensturm, der um sie her tobte. Keine zehn Schritte vor ihnen lag der gestürzte Eichenstamm mit der ausladenden, kahlen Krone, eine unüberwindliche Barriere für Joergs Gespann. Ein Schauder überfiel den durchnässten Knecht und schüttelte ihn durch und durch.
»Hätten die Gäule nicht…«, begann Joerg, verstummte dann aber mitten im Satz. In seinem ledernen, sonst so ausdruckslosen Gesicht stand noch immer die Furcht vor der Fratze des Todes geschrieben, in die er so jäh geblickt hatte.
Im Unterschied zu Joerg wirkte sein Fahrgast beinahe ungerührt, obwohl der Regen ihm wütend ins Gesicht peitschte. Seine schwarze Kleidung verlieh dem jungen Mann, der wenig mehr als zwanzig Jahre alt sein mochte, etwas Unnahbares, ja Undurchdringliches.
»Wir hätten das Unwetter abwarten sollen, Herr«, brüllte Joerg dem Schwarzgekleideten über das Tosen des Sturms ins Ohr.
»Wozu?«, rief dieser bloß zurück. Im nächsten Augenblick machte er kehrt, raffte, schon bis auf die Haut durchnässt, Hut, Mantel und Reisebündel aus dem Wagen und drückte Joerg zwei venezianische Golddukaten in die schwielige Hand.
»Für den Wagen«, schrie er aus vollem Hals.
Joerg blieb der Mund offen. Es dauerte eine Weile, ehe er sich zusammenrappelte und ausrief: »Wohin, Herr Leonhart? Bleibt doch…!«
Im Toben des Unwetters jedoch drang Joergs Rufen nicht mehr ans Ohr des Fahrgasts. Behände durchstieg der junge Herr das schwarznasse Geäst der gestürzten Eiche und war rasch davon. Regenschleier hüllten ihn ein.
Das Zittern, das den armen Fuhrknecht erfasst hatte, wollte nicht enden. Auch nicht, als Joerg dem Jungen eine kräftige Maulschelle verpasste.
Stunde um Stunde stemmte Leonhart sich allein gegen das Wetter. Sturm und Regen peitschten ihm unerbittlich ins Gesicht, irgendwann riss eine Böe den breitkrempigen Hut mit sich fort. Wasserfluten schossen durch die tief in den Weg eingeschnittenen Wagengleise; die Stiefel versanken mehr als knöcheltief in Pfützen und Schlamm. Leonhart kam nur mühsam voran und drohte immer wieder auszugleiten. In den regendurchnässten Kleidern fröstelte ihn, obwohl die Herbstkühle noch nicht heran war.
Kein Innehalten. Wo auch? Keine Hütte, kein Baum hätte ihm Unterstand gewährt. Nein, kein Innehalten, nicht so kurz vor dem Ziel. Nicht einmal, als das Tageslicht allmählich schwand. Alle Widrigkeiten, alle Erschöpfung traten hinter einen einzigen Gedanken zurück.
»Ich komme, Vater. Ich komme.«
Seit Leonhart vor mehr als drei Wochen aus Venedig aufgebrochen war, trieb dieser Gedanke ihn voran: über die weiten Ebenen Oberitaliens, vorbei an Bologna und Mailand; über die steilen, schmalen Alpenpfade des Sankt Gotthard; durch die grünbraunen Matten der Voralpen hinab nach Luzern und schließlich dorthin, wo der Rhein sich in engem Bogen nach Norden wendet.
Tag und Nacht dieser Gedanke, wie eine schmerzhafte Wunde, stets gepaart mit der Furcht, dass es am Ende doch zu spät sein könnte.
»Ich komme, Vater. Ich komme.«
Endlich, als die Türme und Mauern von Basel im letzten, dunkelvioletten Abenddämmer vor ihm auftauchten, vermochte Leonhart mit diesem Gedanken nicht mehr Schritt zu halten; er eilte ihm voraus.
Zur neunten Abendstunde hatte der Himmel sich ausgeregnet, der Sturm sich ausgetobt. Über dem Sankt-Albans-Tor, dem Basler Südtor unweit des Rheinufers, stand der Vollmond am Himmel. Wolkenfetzen jagten daran vorüber. Ein steinernes, schattenschwarzes Fratzenpaar starrte vom Vorwerk des Tors auf den Wanderer herab, der an die verschlossene Pforte klopfte.
Sechs Jahre waren vergangen, seit Leonhart seinerzeit gemeinsam mit seinem Vater als Flüchtling nach Basel gekommen war. Bei Nacht hatten beide die Freie Reichsstadt Köln auf einem Oberländer Rheinschiff verlassen, der Vater als Aufrührer mit dem Tod bedroht. Voller Erleichterung, aber auch mit Bedrückung hatte Leonhart, damals vierzehnjährig, die Stadt betreten. Mutter und Schwester waren in Köln zurückgeblieben.
»Was wollt Ihr? Seid Ihr Basler Bürger? Ich kann Euch nicht einlassen.« Eine quäkende Stimme drang aus einer Mauerscharte, reichlich zwanzig Fuß über Leonharts Kopf. In der Scharte glomm schwacher Lichtschein.
»Wo ich herkomme, lässt man die Leute nachts ein«, gab Leonhart zurück. »Wenn sie dafür zahlen.«
»Macht keinen Lärm. Kommt in der Früh wieder her, Glock sechs«, kam es zurück. Und nach einer kurzen Pause: »Könnt Ihr denn überhaupt zahlen?«
Statt einer Antwort ließ Leonhart seinen Beutel am ausgestreckten Arm klingen.
»Und woher soll ich wissen, dass Ihr kein Betrüger, Dieb oder Halsabschneider seid? Solches Gelichter darf ich nicht einlassen. Geht ein paar Schritte zurück!«, befahl die quäkende Stimme vom Turm herab.
Widerstrebend tat Leonhart, wie ihm geheißen. Er trat aus dem Schatten von Mauer und Tor ins Mondlicht, zurück auf die hölzerne Brücke über dem stinkenden, vom Unwetter aufgewühlten Wassergraben. Das Schnarren einer aufgestörten Ente kam von irgendwo aus dem Abenddunkel.
»Ihr seht wie ein Herumtreiber aus«, quäkte die Stimme zu ihm herunter. »Packt Euch fort! Geht dahin zurück, wo Ihr hergekommen seid!«
Auf diese Unverfrorenheit stürzte Leonhart zur Torpforte zurück und hämmerte mit den Fäusten dagegen.
»Macht endlich das Tor auf!«
Keine Antwort.
»Um Christi willen. Mein Vater liegt auf den Tod.«
»Oh, Euer Vater also. Wie heißt er denn? Hat man in Basel je von ihm gehört?« Das Gequäke aus der Scharte klang belustigt, stieg ins Falsett hinauf.
»Doktor Tielman Scherfgin, der Medikus.« Leonhart musste seine Zunge hüten, diesen Worten keine Verwünschung hinterherzuschicken.
»Tielman Scherfgin? Wartet«, rief gleich darauf eine andere, wohlwollende Stimme vom Tor herab.
Lange Minuten vergingen, begleitet von Gepolter und Fußgetrappel, ehe ein Flügel der schweren Stadtpforte sich auftat. Eine Laterne leuchtete Leonhart ins Gesicht.
»Zwei Weißpfennige fürs Öffnen, so wollen’s die Herren vom Rat. Kein Trinkgeld, strengstens verboten. Sagt, wer hat Eure Kleider so zugerichtet?«
Kaum, dass Leonhart an sich halten konnte. Vor ihm stand der quäkende Wortführer der Torwache – eine Gestalt, die selbst den ärgsten Groll sofort verpuffen ließ: ein schmalbrüstiges Männlein, in einem unförmigen Brustharnisch steckend und von zwei Hellebardenträgern begleitet, das dem Eintretenden stolz seine schiefe Nase entgegenreckte.
In der engen, von zuckendem Fackellicht erhellten Wachtstube des Torturms musste Leonhart trotz eines Geleitbriefs aus Venedig, den er vorweisen konnte, argwöhnische Fragen nach Name und Stand, Woher und Wohin über sich ergehen lassen. Umständlich kratzte die Feder des Schmalbrüstigen sämtliche Auskünfte ins Torbuch, jedoch nicht, ohne diese vorher doppelt und dreifach mit dem Geleitbrief abgeglichen zu haben: »Herr Leonhart Scherfgin. Gehilfe des Seidenhändlers Gianluca Pacioli aus Venedig. Zahlt zwei Weißpfennige fürs Toröffnen.«
Ein Anflug von Erschöpfung dämpfte Leonharts fiebrige Ungeduld. Erst jetzt, im Licht, bemerkte er, dass an seinen Stiefeln dick der Morast klebte und dass sein Mantel über und über mit Schlamm bespritzt war.
Kein Wunder, dachte Leonhart, dass dieser Mensch mich für einen Landstreicher hielt.
»Ich kenne Euren Vater, Herr Leonhart. Er hat meiner Frau das Leben gerettet.« Einer der Hellebardenträger zog Leonharts Aufmerksamkeit auf sich. Er war ein Mann von hagerer Gestalt und mit wachem Blick, der die Fünfzig überschritten haben mochte. Wie seine Stimme erkennen ließ, war er es gewesen, der den Schmalbrüstigen umgestimmt hatte. »Ich bin Laurenz, der Barbier«, stellte er sich vor.
»Ich danke Euch«, gab Leonhart zurück, während er für einen kurzen Augenblick in seiner Erinnerung nach einer Spur dieses Mannes forschte, jedoch vergeblich.
Stärker als der Eindruck, den der Torwächter und Barbier auf Leonhart machte, war allerdings sein Zorn auf den Schmalbrüstigen, der sich nun daranmachte, die rasch hingeworfenen Weißpfennige des Torgeldes mittels einer Nadel peinlich auf ihren Silbergehalt zu prüfen.
»Die Welt ist schlecht«, murmelte er geschäftig. »Man muss vor minderen Pfennigen auf der Hut sein. Aber wie’s aussieht, seid Ihr wohl doch kein Betrüger und könnt durch…«
Ohne ein Abschiedswort machte Leonhart auf dem Absatz kehrt und verließ die Wachtstube mit eiligen Schritten.
Leonhart war dem Schmalbrüstigen für das lächerliche Schauspiel am Tor beinahe dankbar, hatte es ihn doch die Sorge um den Vater für kurze Zeit vergessen lassen. Nun aber, als er über die schlammige, von Regenpfützen übersäte Vorstadtgasse stapfte, kehrte sie zurück, machtvoller als je zuvor.
»Kommt nach Basel, Herr Leonhart«, hatte der Notarius Iselin, ein Freund des Vaters, ihm geschrieben. »Kommt, so schnell Ihr könnt. Und wolle Gott, dass Ihr Euren Vater noch unter den Lebenden antrefft.«
Leonhart fühlte sich beklommen. Während er im bleichen Mondlicht einen Schritt vor den anderen setzte, wünschte er sich zugleich, keiner dieser Schritte möchte ihn dem Spital und dem sterbenden Vater näher bringen, um nicht dessen Tod erleben zu müssen.
Als die Gasse sich teilte, wusste Leonhart für einen Augenblick nicht mehr, wo entlang. Zu fremd war die Stadt ihm geworden, die er als Junge durchstreift hatte. Dann aber gab er sich einen Ruck und schritt wieder voran. Bald öffnete die Gasse sich zur Freien Straße. Nur noch ein kurzes Wegstück, und er war am Ziel.
Der Wärter hieß Leonhart an der Spitalpforte warten. Eine Ewigkeit schien ihm vergangen zu sein, als der Vogt selbst, der Verwalter und Herr des Hauses, den späten Besucher einließ.
»Ihr seid Herr Leonhart Scherfgin, sagt Ihr?«, erkundigte sich der vogelgesichtige Mann. Misstrauen sprach aus seinem Blick.
»Lest selbst.«
Leonhart wies dem Spitalvogt die Zeilen des Notarius vor, die er auf der Reise stets bei sich getragen und manches Mal überflogen hatte, wenn er mit den Gedanken beim Vater gewesen war.
»Kommt.«
Ohne ein weiteres Wort geleitete der Vogt seinen jungen Besucher durch die Kapelle des Spitals, die sich düster, kahl und schmucklos darbot. Bilder, Heiligenfiguren, Schnitzwerk – alles war zerschlagen und verbrannt, seit die Basler sich zwei Jahre zuvor der Reformation angeschlossen hatten. Kein Gotteshaus war vom wütenden Eifer der Bilderstürmer verschont geblieben. Fremdartig, ja abweisend muteten Leonhart die weißgetünchten Wände an. Nichts war geblieben, nicht einmal ein Kruzifix, das ihm in seiner wachsenden Beklemmung hätte Trost spenden können.
Über das von Mauern umschlossene Geviert des Innenhofs führte der Weg in das zweistöckige Haupthaus des Spitals, wo der Vogt den Besucher zunächst ins Obergeschoss, dann über einen kurzen, dunklen Gang zu einer unscheinbaren Tür begleitete.
Hier angekommen, brach der Spitalmeister sein Schweigen und gab Leonhart mit knappen Worten zu verstehen, dass er den Vater nur auf dringliches Bitten des Notarius Iselin aufgenommen habe, wider die Regeln, denn Herr Tielman Scherfgin besitze das Basler Bürgerrecht nicht.
Leonharts Herz pochte heftig, als er die schmale Tür öffnete und hindurchtrat.
In das spärliche Licht eines Kienspans getaucht, lag ein ärmliches Kämmerchen vor Leonhart, und unter einem winzigen Fenster war eine Bettstatt auszumachen. In seinem Rücken schloss sich die Tür.
»Vater!«
Ein leiser Ruf entfuhr Leonhart, wie ein Hilferuf, doch es kam keine Antwort.
»Vater…?«
Er trat zwei, drei Schritte vor – und alles Bangen, auf der langen Reise tausend Mal durchlitten, wich tiefstem Erschrecken. Kaum dass er in der Gestalt, die auf der Pritsche vor ihm lag, noch den Vater erkannte: Der Mund war schief, der Blick leer, der linke Arm, neben dem Kopf ruhend, in groteskem Winkel abgeknickt.
Schmerz erfasste Leonhart, ein Schmerz so tief, dass er ihn beinahe stumm machte. Nur mit Mühe gelang es ihm, seiner Zunge Herr zu werden.
»Vater, ich bin’s. Leonhart.«
Doch der Bedauernswerte gab kein Zeichen des Erkennens.
»Leonhart, dein Sohn.«
Noch einmal dieselben Worte, und noch einmal.
Ein Auge drehte sich aufwärts; das Weiße darin quoll hervor.
Leonhart fuhr zurück.
Eine Erinnerung blitzte in ihm auf: das Weiße in den Augen der rasenden Pferde auf dem Hohlweg.
Tielman nahm den wirren Blick von seinem Sohn. Aus dem Mund des Sterbenden kam ein Grunzen.
Was hatte den kraftvollen Mann zerbrochen, als den Leonhart seinen Vater gekannt hatte? Ihn, der dem Sohn so ferngestanden hatte, als dieser Basel verließ? Der nun, kaum mehr als ein Bündel erlöschendes Leben, vollends unerreichbar geworden war?
Mit einem Gefühl unendlicher Hilflosigkeit tauchte Leonhart einen Zipfel des groben Bettzeugs in einen Wasserkrug nahe dem Bett. Er wrang den Tuchzipfel behutsam und tupfte damit das Gesicht des Vaters, sprach zu ihm, ergriff die Hand, die neben dem Kopf lag, drückte sie immer wieder. Wie viel Zeit dabei verstrich, hätte er selbst nicht zu sagen gewusst.
»Vater!«
War da ein Druck der Hand? Kaum spürbar, aber dennoch eine Regung? Oder spielten die überspannten Sinne ihm einen Streich? Wie gern hätte Leonhart sich täuschen lassen.
Aber da!
Wieder ein Druck der Hand, kein Zweifel diesmal. Dann ein Seufzer, langgezogen, wie aus einem Traum.
Triumphierend hielt Leonhart die Hand des Vaters, umfasste sie fest und fester und ließ sie nicht mehr los.
Donnerstag, 26. Oktober 1531
Ein Nachtfalter taumelte vorüber, die Flügel von samtenem Schwarzbraun. Er stieg langsam aufwärts, wie durch Wasser, stieg auf, bis er aus Leonharts Blick verschwand. Ein dröhnender Schlag…
Leonhart fand sich auf dem Steinboden liegend wieder, neben ihm der Schemel, auf dem ihn am frühen Morgen der Schlaf übermannt hatte. Nebeltrübes Licht, das kaum den Tag anzeigte, fiel durch das Kammerfenster. Ein Klappen und Murmeln war vor der Tür, wie von fern und doch ganz nah.
Sofort ging Leonharts Blick zum Vater, doch der schien zu schlafen. Sein Atem ging schwach, aber gleichmäßig.
Leonhart erhob sich lautlos, streckte die Glieder. Vorsichtig, jedes Geräusch vermeidend, tauchte er die Hände in den Wasserkrug neben dem Bett und benetzte sein Gesicht. In seinem Kopf war eine ungekannte Taubheit, die erst das kalte Wasser fühlbar machte.
Während er seine Kleider richtete, fiel sein Blick auf die morastverkrusteten Stiefel. Ihr Anblick, auch der am Boden liegende verschmutzte Mantel, machten ihn selbst vor dem hinfälligen Vater verlegen.
Mit raschem Griff raffte Leonhart den Mantel auf, faltete ihn umständlich, zupfte hier eine Schmutzkruste ab, wischte dort getrockneten Schlamm weg. In diese Beschäftigung versunken, glaubte er, ein Keuchen im Rücken zu vernehmen.
Noch einmal das Keuchen. Not lag darin und Qual.
Sein Vater!
Leonhart stürzt ans Bett, wo Tielman verzweifelt nach Atem ringt. Er umfasst den mageren Körper, richtet ihn behutsam auf. Tielmans Mund ist weit aufgerissen. Er röchelt, gurgelt und speit unverständliche Laute aus.
Leonhart ruft um Hilfe.
Im Nu verfärbt Tielmans Gesicht sich dunkelviolett. Ein Krampf erfasst ihn. Heftiges Zucken geht durch den Körper, wieder und wieder.
Leonharts Sinne können nicht fassen, was vor sich geht: tierhafte Laute aus dem Mund eines Menschen, hervorquellende Augen, aus denen Schmerz und Todesnot schreien, ein Körper, der sich ein allerletztes Mal aufbäumt.
Dann ein leises Zucken.
Der Leib erschlafft in Leonharts Armen.
Sein Vater ist tot.
Leonhart schickte den Wärter, der viel zu spät auf seinen Hilferuf erschienen war, sogleich wieder hinaus. Er wollte mit dem Vater allein sein, mit dem noch warmen Körper, den das Leben, einmal zerbrochen, nur widerwillig ganz zu verlassen schien. Erst nach längerer Zeit, als die purpurne Farbe aus dem Gesicht des Toten gewichen war, drückte Leonhart ihm die Augen zu und verschloss ihm den Mund.
Um die Hände Tielmans zu falten, fasste Leonhart den rechten, neben das Bett herabgesunkenen Arm. Erst jetzt entdeckte er voller Entsetzen, was ihm in der Nacht verborgen geblieben war: An der Hand des Vaters fehlte der Zeigefinger. Der Fingerstumpf war eine verkrustete Wunde.
Wer hatte das getan?
Leonhart stellte sich diese Frage mit einer Art stumpfen, empfindungslosen Erstaunens, denn sein Schmerz über den Tod des Vaters war zu groß, als dass die Verstümmelung seiner Trauer noch etwas hinzuzufügen vermochte.
Auch eine ferne, blasse Erinnerung, die der Anblick der verstümmelten Hand auslöste, begrub dieser Schmerz unter sich.
»Ihr müsst essen«, ermunterte Notarius Iselin, nachdem das Gebet gesprochen war, seinen Gast in das Schweigen am Mittagstisch hinein, das nur vom Zwitschern eines Finken in seinem Bauer unterbrochen wurde. »Greift zu, Herr Leonhart.«
Fügsam tauchte der Angesprochene seinen Löffel in die Suppe, die in einer irdenen Schale vor ihm dampfte. In seinem Innern stritten Taubheit und Erregung miteinander; das Schweigen der Tischrunde, von der Hausherrin mit wachsamen Blicken regiert, war ihm daher willkommen, obwohl er zugleich etwas Niederdrückendes darin empfand.
Leonhart schaute den Notarius Iselin an, blickte auf den hageren Schädel mit der fleischigen Unterlippe, die bisweilen leicht zitterte und bebte, wie von einem ungestillten Hunger – und mit einem Mal sah er das Totengesicht seines Vaters vor sich, aus dem nichts Friedvolles mehr gesprochen hatte.
Mit einem Schlag erlosch das Trugbild, und Leonhart spürte die lebhaften Blicke Annas auf sich, der jüngsten der drei Töchter des Notarius, die dem fein geschnitzten Elfenbeingriff seines Löffels galten. Die Augen der Sechsjährigen waren rabenschwarz, wie die ihrer Mutter, Frau Iselin, und voll flammender Neugier.
Doch als Anna das missbilligende Stirnrunzeln ihrer Mutter sah, tat sie es rasch den Schwestern gleich und wandte sich mit gesenktem Kopf wieder der Mahlzeit zu.
Aber der Tadel der Frau Iselin hatte nicht nur der Neugier des Kindes gegolten, sondern auch dem unziemlichen Luxus, den der Katholik an ihrem Tisch zur Schau stellte, indem er einen Löffel mit elfenbeinernem Griff benutzte. Frau Iselin, die wackere Protestantin, schien sich geschworen zu haben, alle Versuchungen von ihrem Haus fernzuhalten, namentlich von ihren unschuldigen Töchtern.
Schon am Vormittag, gleich als er das Haus des Notarius in der vornehmen Basler Spalenvorstadt betreten hatte, war Leonhart deutlich geworden, dass sein Besuch der Hausherrin nicht willkommen war. Auch der Empfang durch den Notarius selbst – immerhin der erste Basler Bürger, der vor Jahren sein Haus für Tielman und Leonhart geöffnet hatte – fiel zwar höflich, doch zurückhaltend aus. Erst Leonharts Nachricht vom Tod seines Vaters ließ diese Barriere sinken, wenngleich sie nicht vollends verschwand.
Nachdem Knechte aus dem Spital den Leichnam Tielmans in den Sarg gelegt hatten, war Leonhart sogleich zu Iselin geeilt, in der Hoffnung, Näheres über das Unglück seines Vaters zu erfahren. Doch der Notarius hatte dem Ungestüm seines jungen Besuchers nicht nachgegeben, sondern mit einiger Strenge darauf verwiesen, dass nun Tischzeit sei, und die stehe in seinem Haus unverrückbar fest. Leonhart hatte dem gebieterischen Auftritt Iselins nichts entgegenzusetzen gewusst, und sein Hunger tat ein Übriges.
Kaum dass das Dankgebet gesprochen und die Tafel aufgehoben war, sprang Anna auf Leonhart zu: »Ist es wahr, dass Ihr aus einer Stadt mitten im Wasser kommt?«
Ihre Augen leuchteten. Leonhart glaubte, seine kleine Schwester Clara vor sich zu sehen. Sie war im gleichen Alter wie Anna gewesen, als er sie zum letzten Mal gesehen hatte.
»O ja, das ist wahr«, gab er zurück. »Die Gassen Venedigs sind Kanäle, und man fährt mit Booten darin umher.«
Da aber fuhr Frau Iselin wie der Zorn Gottes zwischen den Fremden und ihre Tochter: »Wahr, mein Kind, ist allein das Wort unseres Herrn. Der Mensch ist allemal ein Lügner!«
Sprach’s und zog das widerstrebende Mädchen zur Stube hinaus, während die älteren Töchter ihr eilig mit dem Tischgeschirr folgten.
»Römer drei, Vers vier«, fügte Notarius Iselin den Worten seiner Gemahlin hinzu, wohl zur Besänftigung seines Gastes, denn jene hörte ihn schon nicht mehr.
Nunmehr allein mit Leonhart, wurde der Notarius zugänglicher und erklärte, er kenne durchaus den Schmerz eines Sohnes über den Tod des Vaters. Doch was die beklagenswerte Zerrüttung von Leib und Verstand des armen Tielman herbeigeführt habe, könne kein Arzt sagen. Nur so viel stehe wohl fest, dass Tielman der Schlagfluss getroffen haben müsse.
Er, Iselin, wisse ansonsten kaum mehr, als er Leonhart in seinem Brief mitgeteilt habe. Ein Hausknecht des Druckers Froben, der Tielman ein kleines Haus auf dem Nadelberg vermietet hatte, habe diesen vor gut fünf Wochen eines frühen Morgens am Boden liegend aufgefunden, nicht imstande, sich zu rühren oder anderes als unverständliche Laute von sich zu geben.
»Aber der Finger«, hielt Leonhart ihm entgegen. »Davon habt Ihr nichts geschrieben.«
Iselin hob die Hände.
»Ich wollte Euch der weiten und beschwerlichen Reise wegen nicht mehr Schmerz bereiten, als unvermeidlich war. Aber«, fügte er rasch hinzu, »da Ihr mich ohnehin danach fragen werdet: Als man Euren Vater fand, war sein Finger… nun, abgeschnitten.«
»Wollten sie ihn ermorden?«
Mit »sie« – denn darauf lief Leonharts Frage hinaus – war der Kölner Rat gemeint, der Tielman im Frühsommer 1525 des Aufruhrs bezichtigt. Verraten und von Hinrichtung bedroht, war er mit Leonhart nach Basel geflüchtet, wo er sich vor Verfolgung sicher wähnte, gehörte die Stadt doch seit einigen Jahren der Schweizerischen Eidgenossenschaft an und war de facto vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation unabhängig. War Tielman nun doch von jenem Verrat in Köln eingeholt worden?
Im gleichen Atemzug erkannte Leonhart jedoch, wie töricht diese Frage war: Wer seinen Vater töten wollte, hätte ihm nicht nur den Finger abgeschnitten.
»Wollte man ihn ausrauben?«
»Nun…« Iselin stockte. »Ihr wisst, Euer Vater war kein wohlhabender Mann mehr. Und Caspar, der Druckerknecht, fand alles unangetastet.«
»Sein Ring!«, entfuhr es Leonhart. »Am rechten Zeigefinger trug Vater seinen Wappenring. Ihr müsst ihn doch kennen.«
Leonharts Beharrlichkeit bereitete dem Notarius sichtliches Unbehagen. »Gewiss, ja, der Ring. In der Tat, er war verschwunden, und auch… nun ja, der Finger selbst. Übrigens mit einem Messer abgetrennt, das Eurem Vater gehörte.« Iselin schnaufte, ehe er eilig hinzufügte: »Irgendein Spitzbube muss ein Auge auf den Ring geworfen haben.«
»Warum hat er meinem Vater den Ring dann nicht einfach vom Finger gestreift!«, brach es in hilflosem Zorn aus Leonhart hervor.
»Euer Vater«, entgegnete Notarius Iselin, »hätte den Wappenring niemals hergegeben. Ihr, sein Sohn, solltet ihn einmal tragen.«
Wahre Worte, und doch schwangen Zweifel darin mit. Leonhart jedoch war taub dafür. Tränen schossen ihm in die Augen.
Begütigend legte der Notarius ihm die Hand auf die Schulter. »Gottes Wege sind unergründlich. Seine Vorsehung hat Euren Vater aus der Welt genommen.«
»Nein!« Empörung loderte in Leonhart auf: »Menschen haben meinen Vater zu Tode gebracht. Menschen, die selbst vor Mord nicht zurückschrecken. Habt Ihr nach ihnen gesucht? Ich muss sie finden und…«
»Schweigt!«, rief der Notarius aus. »Ihr versündigt Euch!« Unversehens stand ein Eiferer vor Leonhart, dessen Glaubensstrenge keinen Widerspruch duldete. »Wir stehen in der Allmacht des Herrn. Unser Wille vermag nichts, unsere Werke gelten nichts vor ihm. Er allein erwählt die Guten und verwirft die Bösen.«
In seiner Verzweiflung – denn nichts anderes war sein Aufbegehren gewesen – schwieg Leonhart.
»Kommt, junger Freund.« Von einem Augenblick zum nächsten kehrte Milde in Iselins Stimme zurück. »Wir müssen für das Begräbnis Eures Vaters sorgen und sollten Pastor Bertschi von Sankt Leonhard darum bitten.«
»Eines noch, Herr Notarius«, sagte Leonhart. »Wie konntet Ihr wissen, dass Ihr mich in Venedig findet? Ich wollte nach Spanien gehen, als ich Basel vor sechs Jahren verlassen habe.«
»Ich weiß, ich weiß. Aber im Frühjahr erzählte Euer Vater mir, dass Ihr beim Seidenhändler Pacioli in Venedig untergekommen wäret.«
»Woher hat er das gewusst?«
»Er hat Erkundigungen bei Kaufleuten eingeholt, die zur Messe hierherkamen. Aber von wem er die Nachricht über Euren Verbleib bekommen hatte, weiß ich nicht. Darüber hat er sich ausgeschwiegen.«
Leonhart musste sich mit dieser Antwort zufrieden geben und senkte den Kopf, geplagt von Bedauern, Reue und Schuld. Sein Verhältnis zum Vater war zerrüttet gewesen, als er aus Basel fortgegangen war. Er hatte ihn in Unwissenheit darüber gelassen, dass er die vergangenen Jahre in Venedig zugebracht hatte; nicht einen Brief hatte er geschrieben.
Marx Bertschi, Pastor und Protestant mit dem Bäuchlein und den vollen Wangen eines päpstlichen Prälaten, versprach Leonhart, den Leichnam des Vaters gleich am Vormittag des morgigen Freitags auf dem Spitalkirchhof zu bestatten. Bertschi hielt auf Abstand und hatte merkliche Eile, das Begräbnis hinter sich zu bringen.
Obwohl die kaum verhüllte Abneigung des Predigers gegen seinen Vater ihn verstimmte, schwieg Leonhart dazu, denn er verstand wohl: Ohne die Fürsprache des Notarius, der ihn begleitete, hätte Bertschi sich nie und nimmer zu dem Begräbnis bereitgefunden.
Noch vor dem Pastorenhaus trennte Leonhart sich von Iselin. Er lehnte das förmliche Anerbieten des Notarius ab, in seinem Haus zu Gast zu sein; stattdessen zog er es vor, sich in der verlassenen Wohnung des Vaters auf dem Nadelberg für die Nacht einzurichten.
»Dann also bis morgen«, verabschiedete sich Iselin – erleichtert, wie Leonhart aus seinen Abschiedsworten heraushörte.
Nachdem der Notarius gegangen war, wandte Leonhart sich der Freien Straße zu und passierte das verlassene, mit eingerissener Mauer daliegende Kloster der Barfüßer. Wie Schemen tauchten die Zwillingstürme des Münsters aus dem Nebel auf, der sich seit dem Morgen nur wenig gelichtet hatte und nun im schwindenden Nachmittagslicht wieder dichter wurde.
Im Spital holte Leonhart sein Reisebündel ab und beschloss, nicht gleich zum Nadelberg hinaufzugehen, sondern zuerst zu den Schiffländen, der Anlegestelle unterhalb des Rheintors, um dort ein wenig Ablenkung zu finden.
Mehrere Kähne lagen an der Kaimauer, als er dort anlangte. Schauerleute waren mit Laden und Löschen beschäftigt. Hier hatten der Vater und er seinerzeit das Oberrheinschiff verlassen, das sie beide von Mainz nach Basel gebracht hatte. Wo die Kaimauer endete, mündete das Birsigflüsschen, das durch Basel verlief, aus einer Kanalröhre in den Rhein.
Leonhart warf einen Blick hinauf zu der Brücke, die sich auf Pfeilern aus Holz und Stein über den Rhein spannte; dann machte er kehrt, ließ den sich leerenden Marktplatz hinter sich, überquerte unweit des Schlachthauses den übelriechenden Birsig und stieg zum Totengässlein hinauf, um beim Drucker Froben, dem Hauswirt seines Vaters, den Schlüssel für dessen Wohnung zu erbitten.
Froben, ein Mann mit grobem Gesicht und schütterem Haar, hatte bereits von Tielmans Tod gehört und sprach Leonhart ein geschäftiges, wenig teilnehmendes Bedauern aus. Über die Umstände, die zum Tod seines Mieters geführt hatten, wusste er nichts weiter zu sagen; stattdessen verlangte er, dringend über »gewisse Angelegenheiten« zu sprechen. Aber Leonhart, der – mit Recht, wie sich später herausstellen sollte – Schulden des Vaters vermutete, wehrte ab.
Totengässlein: Dieser Name ging Leonhart wenig später durch den Sinn, als er mit dem gewünschten Schlüssel die lange, steile Gassenstiege vor der Froben’schen Druckerwerkstatt erklomm und zur Wohnung des Vaters ging.
Eigentümliche Stille herrschte in dem geduckten Häuschen, als Leonhart eintrat. Nichts hier drinnen erinnerte an den wohlhabenden Seidenkaufmann, der Tielman Scherfgin einst gewesen war. Kasten, Schemel und Tisch waren zu leblosen Dingen geworden, seit Wochen von keiner Hand mehr angerührt.
Leonhart sah das Haus zum ersten Mal. Die wenigen gemeinsamen Monate nach der Flucht aus Köln hatten Vater und Sohn in einer großzügigen Wohnung in der Spalenvorstadt zugebracht, der westlichen Basler Vorstadt hinter dem Spalentor. Zuvor hatte Notarius Iselin, der Tielman schon damals von früheren Reisen nach Basel kannte, die Flüchtlinge für kurze Zeit in seinem Haus aufgenommen. Es war auch der Notarius gewesen, der Tielman bei seinem Bemühen unterstützt hatte, sich in Basel niederzulassen.
Eine seltsame Scheu, als rühre er an Geheimnisse, hinderte Leonhart, sich in der schlichten Behausung umzutun. Erst nach einer Weile wagte er, das Erdgeschoss zu durchstreifen.
In einem Zimmer fanden sich Bücher über Heilkunst und Medizin, dazu die Instrumente eines Arztes, Glaskolben für die Urinschau und verschiedenes Gerät, alles wohlgeordnet: Beweis dafür, dass Tielman seine einstige Profession als Medikus wieder aufgenommen hatte. Er hatte die Heilkunst in Italien studiert, den Beruf aber nur kurze Zeit in seiner Heimatstadt Augsburg ausgeübt, ehe er als Aufkäufer eines Augsburger Handelshauses nach Köln gegangen war, wo er sich als Seidenhändler etablierte.
Vom Erdgeschoss stieg Leonhart die schmale Treppe zum ersten Stock hinauf. Zwei winzige, unbewohnte Kammern befanden sich dort. Offensichtlich hatte Tielman allein gelebt.
Später warf Leonhart sich auf die Bettstatt des Vaters und lauschte in die Stille. Als er in einen Halbschlaf hinüberdämmerte, erschien ihm jedes Knistern und Knacken des Hauses als ein Zeichen dafür, dass dieses Gemäuer etwas vom erloschenen Leben seines Vaters in sich bewahrte.
In der Nacht fuhr Leonhart aus einem Traum auf, der ihm nach dem plötzlichen Erwachen für lange, von Angst gepeinigte Sekunden als Wirklichkeit erschien: Eine tauschimmernde Perle ruhte auf den zarten Fingern eines Farngewächses, doch die Perle erwies sich als starrendes Auge, die Pupille als ein schwarzes Loch.
»Vater!«, wollte Leonhart rufen, brachte aber nur einen stammelnden Laut hervor. Mit pochendem Herzen entzündete er ein Kerzenlicht, schwang sich aus dem Bett und leuchtete umher.
In der Kammer war niemand, und im Haus herrschte tiefe Stille. Draußen vor den Fenstern lag dichter, undurchdringlicher Nebel.
Plötzliche Unrast packte Leonhart. Er durchstöberte Kästen und Truhen, selbst den Bettkasten. Er fand Kleider, Hausrat, schließlich ein ledernes Futteral mit allem Anschein nach chirurgischem Werkzeug: eine kräftig gezahnte Knochensäge, allerlei große und kleine, eigentümlich geformte Messer, verschiedene Scheren, Kanülen und gebogene Nadeln.
An einem der Messer, dem größten, entdeckte er einen Fleck getrockneten Blutes. War dies das Messer, mit dem Tielman der Zeigefinger abgetrennt worden war? Welchem Grauen hatte der Vater gegenübergestanden? Welchem Schrecken, der ins Auge drang und die Seele zerrüttete?
Mit einem Mal glaubte Leonhart, hinter dem Fenster ein Augenpaar zu entdecken, das ihn aus der Nebelnacht anstarrte. Er erschrak, lief hinaus, konnte aber niemanden entdecken.
Leonhart verriegelte die Tür.
»Ich sehe Gespenster«, sagte er laut zu sich selbst, doch er spürte dabei, wie er zitterte.
Während er dastand, erschienen Bilder vor seinem inneren Auge, wuchsen und wucherten: Szenen des Grauens der vergangenen Tage, vermischt mit Bildern eines Schreckens, dem Leonhart längst entronnen zu sein glaubte.
Das leere, tote Auge des Vaters.
Die weißen, rotgeäderten Augen der rasenden Pferde.
Die finstere Abwasserröhre.
Das flackernde Licht einer Laterne.
Die funkelnden Teufelsaugen, die ihn anstarrten.
Unter der Wucht dieser Bilder taumelte Leonhart. Sein Atem ging keuchend, sein Puls raste, und er fiel und fiel, bis er in der Schwärze eines bodenlosen Abgrunds versunken war.
Freitag, 27. Oktober 1531
Vier Spitalknechte senkten den Sarg mit dem Leichnam Tielman Scherfgins in die Erde, und der Prediger Bertschi sprach ein Vaterunser – auf Deutsch, nicht auf Latein. In Basel war die Messe mit der Reformation als Götzendienst abgeschafft worden, samt dem Lateinischen, der Sprache der Römischen Kirche und des Papstes. Während die Trauergemeinde sogleich in das Gebet einfiel, musste Leonhart, der das Lateinische gewohnt war, die Worte stockend nachsprechen.
Wohl an die fünfzig Menschen standen am Grab auf dem Basler Spitalkirchhof, was dem Prediger sichtliches Missbehagen bereitete. Neben Notarius Iselin war auch Laurenz gekommen, der Barbier und Torwächter, mit seiner Ehefrau Kathryn; Iselin hielt allerdings Abstand zu den beiden. Alle anderen waren ihrem Äußeren nach arme Leute, die Tielman gekannt zu haben schienen und ihm nun die letzte Ehre erweisen wollten.
Nach dem Gebet zerstreute sich die Versammlung rasch im Nebel, der über Nacht noch dichter und feuchter herabgesunken war. Auch der Prediger hatte es eilig, den Kirchhof zu verlassen.
»Besucht uns doch einmal in der Sankt-Albans-Vorstadt, Herr Leonhart!«, baten Laurenz und Kathryn beim Abschied. Ihre Herzlichkeit tat Leonhart wohl.
Noch eine Weile verharrte er am Grab des Vaters, Taubheit im Kopf und im Herzen. Doch der Schmerz blieb, wie er verwundert bemerkte, aus.
Dann zog der Notarius ihn fort.
»Nun habt Ihr Eure Christenpflicht gegenüber Eurem Vater erfüllt«, begann Iselin, als die beiden Männer den Kirchhof verlassen hatten und über die Freie Straße gingen. »Seine Hinterlassenschaft gehört jetzt Euch. Was noch zu tun bleibt, solltet Ihr rasch…«
Leonhart ließ Iselin nicht weitersprechen. »Sagt frei heraus, Herr Iselin, was verschweigt Ihr mir?«
Wie vom Schlag gerührt blieb der Notarius stehen.
»Ich kannte Euch als Freund meines Vaters«, fuhr Leonhart fort. »Nun aber treffe ich Euch nicht mehr als Freund. Ihr seid höflich, doch Ihr haltet Abstand. Ihr gebt Euch hilfsbereit, führt mich aber hinters Licht.«
Iselin schwieg in fassungslosem Staunen.
Schließlich brach es aus Leonhart heraus: »Wer hat meinen Vater umgebracht? Ihr wisst es, aber Ihr sprecht nur die halbe Wahrheit.«
»Jetzt hört Ihr mir einmal zu!«, verschaffte der Notarius sich endlich Luft. »Nach allem, was ich Eurem Vater getan habe…«
»Ich weiß, was Ihr getan habt. Ihr habt meinen Vater ins Spital bringen lassen und einen Medikus zu ihm bestellt. Sagt, wie viel bin ich Euch schuldig?«
»Erlaubt, Herr Leonhart!« Iselin ließ seiner Empörung freien Lauf. »Euer Vater war mein Freund! Ich schätzte ihn über die Maßen. Er war ein Mann der Lehre Luthers, so wie ich es bin. Mit Feuereifer hat er sich für die Reformation in Basel eingesetzt, uneigennützig, so wie er als Medikus zu den Armen ging, ohne Geld zu verlangen. Aber er…« Iselin stockte. »Zum Schluss hat Euer Vater sich mit Menschen eingelassen, die…«
Leonhart blickte den Notarius herausfordernd an, bis dieser fortfuhr:
»Vor zwei Jahren kam ein junger Franziskanermönch hierher, ein Spanier, der sich Servetus nannte. Er gab vor, für die Reformation einzutreten. Doch was er lehrte, war Ketzerei: Er leugnete die Dreifaltigkeit Gottes. Niemand wollte diesen Menschen anhören. Er hätte es verdient gehabt, dass man ihm die Eingeweide aus dem Leib reißt! Nur Euer Vater öffnete ihm die Tür. Und als der Rat die Bücher dieses Ketzers verbrennen ließ, erhob Tielman Protest, wie er’s zuvor schon getan hatte, als man die Bildnisse und Figuren der Heiligen in den Kirchen zerschlug. Jawohl, Herr Leonhart, Euer Vater gab sich mit einem Gotteslästerer ab! Mit Werken der Finsternis…«
Hier hielt der Notarius inne. Heftige Erregung hatte ihn erfasst, und er bebte, als stünde er selbst am Abgrund jener Finsternis, die er heraufbeschwor.
»Mein Vater ist immer nur dem eigenen Willen, seinem eigenen Verstand und seinem Gewissen gefolgt«, empörte sich Leonhart. »Ich finde nichts Verwerfliches darin.«
Iselin holte tief Atem. »Ich habe mit Eurem Vater gebrochen«, gestand er ein. »Im Mai war’s. Ich hatte Tielman gedrängt, hatte ihn beschworen, von diesem Ketzer Servetus zu lassen, doch er wies mich zurück…«
Der Notarius verstummte, ließ den Blick umherschweifen, als wolle er sich vergewissern, dass niemand ihnen zuhörte; dann packte er heftig Leonharts Arm, zog ihn zu sich heran und flüsterte ihm drängend ins Ohr: »Euer Vater hatte ein Buch des Ketzers in seinem Haus, als der Druckerknecht ihn halb tot am Boden liegend fand! Ich habe das Buch an mich genommen, damit niemand es zu Gesicht bekam!«
Widerstreitende Empfindungen erfassten Leonhart: heftige Abneigung gegen den Notarius, zugleich Achtung für dessen trotz allem erwiesene Verbundenheit mit dem Vater.
»Ihr haltet die Seele meines Vaters für verloren, nicht wahr?«, sagte Leonhart. »Deshalb hattet Ihr solche Eile mit dem Begräbnis, Ihr und der Prediger Bertschi. Ist es nicht so?«
Iselins Schweigen war Antwort genug.
»Baut auf Gott, Leonhart«, sagte der Notarius schließlich und wandte sich zum Gehen.
»Eines noch«, rief Leonhart ihm nach. »Was habt Ihr mit dem Buch des Ketzers getan?«
»Ins Feuer geworfen.«
»Nachdem Ihr es gelesen habt?«
Es stand dem Notarius ins Gesicht geschrieben, dass er sich ertappt fühlte.
»Baut auf Gott«, wiederholte Iselin. »Und fürchtet die Finsternis. Wer einmal hineingeblickt hat, den lässt sie nicht mehr los.«
Mit diesen hastig gesprochenen Worten wandte er sich ab. Nach wenigen Schritten hatte der Nebel ihn verschluckt.
Noch lange nach dem Begräbnis und der Unterredung mit dem Notarius ließ Leonhart sich durch die Gassen treiben. Schemen tauchten aus dem Nebeldunst hervor, nahmen flüchtig menschliche Gestalt an, schlurften, schritten, hasteten an ihm vorüber, um Augenblicke später wieder ins Grau einzutauchen.
Wie Schattengebilde, gestaltlos und nicht zu greifen, waren auch Leonharts Gedanken: Welche Macht hatte nach seinem Vater gegriffen? Wer hatte Tielman den Finger abgeschnitten – und warum? War es ein Zeichen? Ein Zeichen wofür? Für irgendetwas, das nach Köln wies?
Ein altvertrautes Schreckensbild kehrte wieder: An dem Abend, als seinem Vater in Köln die Verhaftung gedroht hatte, war Leonhart um sein Leben gelaufen, in einem finsteren Abwassertunnel…
Er schauderte. Auf dem Marktplatz blieb er stehen, erleichtert, nicht allein zu sein. Doch das Marktgeschrei klang seltsam matt und kraftlos.
Wieder sah er Tielman auf der Bettstatt vor sich liegen, und Mutlosigkeit überkam ihn. Was dem Vater zugestoßen war, würde nun dessen ewiges Geheimnis bleiben, das er mit ins Grab genommen hatte.
Bei Anbruch der Abenddämmerung stand Leonharts Entschluss fest: Er würde den bescheidenen Nachlass des Vaters ordnen und Basel dann verlassen, so schnell er konnte, um nach Köln zu reisen und seiner Mutter Gertruyd die Todesnachricht zu überbringen.
Hier gab es nichts, was ihn noch hielt.
Vom Oberen Rheintor schlug die Uhr. Bald würden die Stadttore schließen, doch Leonhart zog es auf die Brücke über den Rhein. Als er dem Torbogen zustrebte, vermeinte er das Echo seiner Schritte hinter sich zu hören. Er blieb stehen, spähte in den Nebel, lauschte.
Kein Laut war mehr zu hören.
Leonhart schalt sich einen Narren, dass die Bangigkeit des Notarius und dessen Gerede von Finsternis, Ketzerei und ewiger Verdammnis ihn offenbar so sehr beeindruckt hatte, dass er nun Gespensterlaute vernahm.
Bald darauf durchschritt Leonhart unter den Augen der gelangweilten Wachen das Rheintor. Hohl klangen die Holzplanken, als er die Brücke betrat.
Unter seinen Füßen, vom Nebelgrau nahezu verhüllt, strömte das Wasser des Rheins träge dahin. Mutterseelenallein, ohne dass weit und breit jemand zu sehen war, ging Leonhart die ansteigende Brückentrasse hinauf. Auf dem Scheitel angekommen, machte er halt.
Hier hatte er oft gestanden, unweit der steinernen Kapelle mit der Marienfigur, der man wundertätige Heilkräfte nachsagte, namentlich bei Zahnweh: Wer die Schmerzen vertreiben wollte, musste das Heiligenhäuschen drei Mal umrunden und ein »Ave Maria« sprechen. Leonhart, damals vierzehn, hatte hier Hölzchen in den Rhein geworfen, damit sie zur Mutter hinabschwammen; an einem Herbsttag hatte er sogar Blut aus einem Finger in den Rhein tropfen lassen, sodass, wer aus dem Rheinwasser schöpfte – gleich wo, und sei es nur ein Fingerhut voll – eine Winzigkeit von seinem Blut mitschöpfte.
Auch die Mutter, die mit dem Schwesterchen Clara im fernen Köln geblieben war.
»Nichts geht im Wasser verloren«, hatte Wyrich gesagt, der Schiffer, auf dessen Rheinkahn Vater und Sohn Scherfgin aus Köln geflüchtet waren. »Nichts geht im Wasser verloren, auch das Geringste nicht. Alles strömt und wirbelt, vermischt sich, sinkt herab und taucht wieder auf.«
Ein plötzlicher Laut riss Leonhart aus seinen Gedanken, ein winziger Misston: der Atem eines Schattens in der Nebelluft – ein Schatten aus Fleisch, Blut und Knochen. Als Leonhart herumfuhr, war die Faust des anderen schon erhoben. Und aus dieser Faust ragte ein Dolch mit Silberknauf, ein grimmiges Löwenhaupt mit aufgerissenem Maul.
Leonhart bekam den Arm zu fassen, ehe dieser zustoßen konnte. Ging dem Mörder an die Gurgel. Starrte in ein Narbengesicht, in ein teuflisches Glühen aus tief verschatteten Augenhöhlen, als das Merkwürdige geschah: Einen Lidschlag lang erlosch die unheilige Glut, die Kraft des Angreifers erlahmte, und der Dolch entglitt seiner Hand.
Zwei Körper gingen krachend auf die Holzplanken nieder. Leonhart kam obenauf zu liegen. Ein stummes Ringen begann. Der Angreifer gewann seine Kräfte zurück. Mit Wucht stieß er Leonhart von sich, der mit dem Kopf gegen das Brückengeländer schlug, sodass ihm die Sinne schwanden. Während die Schattenhand nach dem Dolch mit dem silbernen Löwenhaupt tastete.
ERSTER TEIL
DAS ZERBROCHENE FENSTER
Köln, Mai 1525
Dienstag, 23. Mai 1525
Im Nachmittagslicht des milden Frühlingstages lag ein Schimmer über der Freien Reichsstadt Köln, ein Leuchten, als hätten die Sonnenstrahlen einen Schleier aus Gold ausgebreitet. Ein goldener Saum umgab die Türme und Zinnen der starken Mauern; im Rheinstrom funkelte Gold, glitzerte im Blinken der Wellen, schwirrte in der Luft über den lärmenden Märkten nahe dem Hafen und lag flimmernd auf den Häusern der Kaufherren, von denen die Marktgevierte des Altermarkts und Heumarkts umschlossen wurden.
Auch das Haus des ehemaligen Medikus und nunmehrigen Seidenkaufmanns und Ratsherrn Tielman Scherfgin am Nordosteck des Altermarkts, wo die Mühlengasse sich zum Hafen hinabsenkte, lag in diesem goldenen Licht.
Etwas Eigenwilliges ging von dem Scherfgin’schen Haus aus; kein anderes Haus am Marktplatz glich ihm: Auf der Fassade sprang ein Bogen zur Höhe des Treppengiebels empor, der Scheitel spitz wie die Mauerbögen des Domes; er umspannte zwei niedrigere, bis zum zweiten Obergeschoss hinaufragende Bögen und auf der Giebelfläche eine Rosette, deren Rippen wie Strahlen einer steinernen Sonne nach allen Seiten verliefen.
Ein Vierzehnjähriger – niemand anders als Leonhart, der Sohn des Hauses – sprang zur Tür heraus und tauchte sofort ins dichte Marktgedränge ein. Unweit der Haustür hockten Bäuerinnen auf Körben voller Äpfel; Fischweiber priesen lautstark ihren Hering an und wurden übertönt von Gezänk und Gekeife an der Butterwaage. Hühner gackerten in übereinander gestapelten Käfigen, manche mit heftigem Flügelflattern, und von Leitern hing allerlei Wildbret an zusammengebundenen Hinterläufen herab. Inmitten von Geschrei und Gedränge stand aufrechten Hauptes eine Hure am Pranger, kenntlich am roten Schleier.
Ohne ein Auge für das Marktgetriebe, das er seit jüngster Kindheit kannte, wischte Leonhart zwischen Apfelkörben, Heringstonnen und Hühnerkäfigen hindurch und ließ rasch die Lintgasse mit den Buden der Lederschneider hinter sich. Am Salz- und Flachsmarkt, wo der Altermarkt sich zum Heumarkt hin öffnete, kreiselte er und lief mit ausgebreiteten Armen zur Salzgasse hinunter.
Wyrich, der Schiffer, hatte im Hafen festgemacht!
Als diese Nachricht ins Kontor seines Vaters gelangt war, hatte Leonhart, der mit dem Lehrjungen Niclas dabei gewesen war, Briefe zu kopieren, die Arbeit sofort hingeworfen und war ungehindert losgestürmt. Sein Vater hatte das Haus zur Ratssitzung verlassen, und Diederich, der Kontorgehilfe, konnte Leonhart nicht zurückhalten; er hätte dergleichen nicht gewagt.
Auf der Salzgasse ging ein Mädchen, einen Fischkorb auf dem Kopf. Im Laufen drehte Leonhart sich nach ihr um: Wie hübsch ihr Gesicht war, wie stolz ihr Blick! Während sein Blick an dem Mädchen hing, überhörte er das Schwein, das hinter seinem Rücken jämmerlich quiekend herangaloppierte, dichtauf von johlenden Gassenjungen verfolgt. Leonhart stürzte über das Borstenvieh und fand sich unversehens im Gassendreck wieder.
»Hat der junge Herr sich schmutzig gemacht?« Ein sehniger Bursche mit flinkem Mienenspiel, nicht älter als Leonhart selbst, blickte auf den Gestrauchelten hinunter. Schadenfreudiges Gelächter seiner Gefährten quittierte seinen Spott.
»Wozu du dein Maul hast, weiß ich jetzt«, gab Leonhart zurück und streckte dem Spötter die Rechte entgegen. »Wozu hast du deine Hand? Hilf mir auf.«
Doch der Bursche setzte nur ein Grinsen auf, und ehe Leonhart sich versah, war er mitsamt seiner Bande schon wieder davon. Ein Schlachter, der, ein Messer in der erhobenen Hand, außer Atem und hoffnungslos hinterdrein noch immer dem Schwein nachjagte, japste: »Weg da!«
Mit flüchtig ausgeklopften Kleidern schob sich Leonhart weiter durchs Gassengedränge. Vor der Salzgassenpforte, wo die Fähre zum rechten Rheinufer an- und ablegte, stieß er auf ein wirres Knäuel aus Kohlenkärrnern, Fuhrwerken, Salzknechten mit Fässern, Bauern, die Kälber führten, und neugierigen Müßiggängern. Alle schrien und lärmten, die Kälber blökten ängstlich.
Seine Ellbogen benutzend, zwängte Leonhart sich durchs Gewühl zum Hafenkai.
In einer Reihe, dicht an dicht, lagen Schiffe an der Kaimauer: stromabwärts die hochbordigen Niederrheinfahrer mit großem Mast und Segel; stromaufwärts, von den Niederländern durch den Fähranleger und eine hölzerne, aus dem trüben Hafenwasser aufragende Barriere getrennt, die eigentümlich anzusehenden Oberrheinfahrer, deren flaches Schiffsdeck mit niedrigem Treidelmast und gewölbtem Laderaumverdeck sich zum Bug hin neigte, während das gerundete Heck doppelt so hoch aufragte.
Es wimmelte von Schauerleuten, Fuhrknechten und Lastenträgern. Ballen, Kisten, Fässer stapelten sich. Vom Werthchen, der kleinen, stromauf gelegenen Rheininsel, klangen die Axtschläge der Schiffszimmerer herüber. Über dem gesamten Hafenkai lagen die Gerüche von Fisch und Teer, Holz und Abfällen.
Leonhart hielt nach Wyrichs Oberländerschiff Ausschau. Er lief den Kai hinauf, stromaufwärts. Unter dem größten der Hafenkräne, dem turmartigen Hauskran, entdeckte er es schließlich. Wyrich saß im Heck, missmutig zusammengekauert. So kannte Leonhart ihn; denn der Schiffer glaubte jedes Mal, den schlechtesten aller Liegeplätze erwischt zu haben.
»Wyrich!«
Leonhart stürmte zu der schmalen Holzplanke, die vom Kai aufs Schiff führte.
Wyrich wandte sich um, und mit einem Schlag glätteten sich die tiefen Falten seines Gesichts.
»Leonhart!«
Mehr Worte brauchte es nicht, dann lag Leonhart dem Schiffer auch schon in den Armen, stumm und überglücklich. Wie lange hatte er auf Wyrich gewartet! Wie oft war er während der vergangenen Tage zum Hafen hinuntergelaufen, um nach dem Kahn des Freundes Ausschau zu halten!
Schon als kleiner Junge hatte Leonhart sich ganz und gar dem alten Schiffer anvertraut, denn sein Vater war für Gefühlsdinge unempfänglich. Gertruyd wiederum, Leonharts Mutter, hatte ihren einzigen Sohn ganz der Obhut Tielmans überlassen. »Bete darum, deinem Vater ein guter Sohn zu sein«, mahnte sie ihn oft.
Der schweigsame Schiffer Wyrich jedoch wusste um die Nöte des Jungen und hörte ihm zu, während der vertäute Kahn auf den Wellen schaukelte.
In den zurückliegenden vier Jahren hatte Leonhart den väterlichen Freund jedoch nur zwei oder drei Mal zu Gesicht bekommen. Nach dem Willen des Vaters hatte er die Partikularschule in Emmerich besucht, um seine Kenntnisse im Schreiben und Rechnen zu erweitern und Latein zu lernen. Während dieser Schuljahre hatte er das Kölner Elternhaus nur in den Ferien und zu den Weihnachts- und Osterfeiertagen besucht und auch Wyrich nie getroffen, dem als Oberrheinschiffer das Niederrheinrevier von Köln stromabwärts verboten war.
»Man kommt nicht an Bord, Kaufmannssöhnchen, ehe der Schiffer einen einlädt«, sagte Wyrich milde und löste die Umarmung.
»Verzeih«, bat Leonhart. Doch er konnte das freudige Grinsen nicht unterdrücken. »Woher kommst du?«, fragte er aufgeregt.
»Woher wohl.«
»Koblenz? Mainz? Frankfurt?«
»Von Frankfurt.«
»Hast du Seide geladen? Natürlich. Und dazu….« Leonhart rätselte.
»Ans Einfachste denkst du wohl nie«, sagte Wyrich.
Das Einfachste? Wein! Leonhart brauchte es gar nicht mehr auszusprechen.
»Und du?«, fragte Wyrich wie nebenbei. Nur die grauen Augen, die wach und klar unter dichten Brauen hervorblickten, verrieten seine Freude.
»Ich bin von Emmerich zurück. Seit Ostern.«
Leonhart kam nicht mehr dazu, Wyrich zu sagen, wie sehr er dessen Ankunft herbeigesehnt hatte, denn auf dem Kai erhob sich Gezeter. Ein wütender Schiffer packte den Kranmeister Tost beim Kragen und schüttelte ihn. Im Nu kamen andere Schiffer hinzu, und rasch prasselten Kohlenbrocken auf den Kranherrn nieder.
»Kranmeister Tost!«, rief Leonhart aufgeregt.
»Hat wohl aufs Krangeld seinen Anteil draufgeschlagen, wie er’s immer tut, der Lump«, sagte Wyrich wie nebenhin.
»Mehr sagst du nicht dazu?«
»Alle wissen, dass Tost sich die eigene Tasche stopft, nicht nur beim Krangeld. Er lässt sich von Kaufleuten schmieren, damit er’s beim Aufschreiben der Ladung nicht so genau nimmt.«
Leonhart horchte auf. »Was meinst du damit?«
»Wenn Tost weniger Ladung aufschreibt, spart der Kaufmann Krangeld und außerdem die Akzise. Man braucht natürlich noch einen Fuhrmann dazu, der die Ware an der Akzisenwaage vorbeischmuggelt. Wenn du’s noch genauer wissen willst, frag deinen Vater.«
»Was? Willst du damit sagen, dass mein Vater…«
»Nein, natürlich nicht.«
Unterdessen war auf dem Kai hoch zu Ross der Hafenmeister herangekommen. Sofort ließ der aufgebrachte Schiffer vom Kranmeister ab, und auch den Kohlenwerfern glitten die aufgeklaubten Brocken flugs aus den Händen.
»In Frankfurt, da geht’s anders zu«, sagte Wyrich. »In Frankfurt zittern den Herren vom Rat die Knie. Da muckt das Volk auf – die Handwerker, die Armen, die kleinen Leute. In Köln wird’s genauso kommen, und dann geht’s Halunken wie Tost an den Kragen. Dann steht ihm keiner mehr bei.«
»Glaubst du?«
»Warum gibt es auf der Welt Herren und Knechte? Arme und Reiche? Weißt du’s? Ich versteh’s jedenfalls nicht.« Wyrichs Augen leuchteten. »Überall am Oberen Rhein stehen die Bauern auf. Alle Gewalt soll dem gemeinen Mann gegeben werden – genau das wollen sie.«
Leonhart war verwirrt. Zwar hatte er den Vater von aufrührerischen Bauern reden hören, die der Leibeigenschaft ledig sein wollten und sich weigerten, den Zehnten zu zahlen und Frondienste zu leisten. Aber das Württembergische, Elsässische und Kurpfälzische, wo die Aufstände wüteten, waren weit weg. Nun also Frankfurt? Von Frankfurt hatte der Vater nichts gesagt.
Doch zum Fragen blieb Leonhart keine Zeit. Kranmeister Tost kam wutschnaubend aufs Schiff gestampft, seinen unansehnlichen Wanst vor sich herschiebend. Hinter ihm folgten die Schauerleute, die »Vierzehner«.
Tost baute sich vor Wyrich auf.
»Nun, Wyrich, dann lass sehen, was du für mich hast.«
»Sieh im Laderaum nach.«
»Weißt schon, was ich meine.«
Wyrich kramte umständlich ein paar Weißpfennige aus seinem Beutel.
»Meinst du die?« Er warf dem Kranmeister die Münzen vor die Füße. »Da, nimm sie dir!«
Tost schnaubte wütend. Einer seiner Knechte bückte sich flink, um nach den Pfennigen zu greifen, doch ein Wink von Tost, und hastig zog er die ausgestreckte Hand zurück.
»Sieh dich vor, Wyrich«, presste Tost zwischen den Zähnen hervor. »Beim nächsten Mal wartest du aufs Entladen, bis du schwarz wirst.«
Ein neuerlicher Wink des Kranmeisters, und die Vierzehner tauchten in den Laderaum hinab.
»Geh jetzt lieber, Junge«, sagte Wyrich. »Komm morgen wieder.«
Leonhart ging nur widerwillig von Bord. Über seinem Kopf senkte sich das Kranseil herab. Ketten und Klauen hingen daran, um die Last aus dem Schiff zu heben. Wenige Handgriffe der Schauerleute, ein Ruf des Kranmeisters, und am Kai stemmten sich die Radstößer in die doppelt mannshohen Windentrommeln des Krans, worauf das Seil sich straffte.
Leonhart ging zum Altermarkt hinauf, als die Glocke der Benediktinerkirche Groß Sankt Martin, deren mächtiger Turm das Markt- und Hafenviertel überragte, vier Mal schlug. Eher dürftig, beinahe verschämt, mischte sich das Glöckchen von Sankt Brigida, Leonharts Taufkirche unmittelbar neben den Benediktinern, in das Geläut.
Vier Uhr! Zeit für die tägliche Italienischlektion bei Signor Scartanelli, die der Vater befohlen hatte. Leonhart eilte über den Altermarkt, umsichtig diesmal, und tauchte ins Gewirr der Handwerkergassen jenseits des Marktviertels ein. Signor Scartanelli wohnte am Marsilstein, jenseits des alten Mauerrings. Leonhart musste die Beine in die Hand nehmen, wollte er nicht zu spät kommen.
Er kam rechtzeitig.
»Buon giorno, Signor Leonardo!«, rief Scartanelli überschwänglich, als er seinem außer Atem geratenen Schüler die Tür seines ärmlichen Kämmerchens öffnete. »Entrate, entrate! Kommt herein!«
Nachdem die Ratssitzung geendet hatte, ging Tielman Scherfgin vom Rathaus nicht geradewegs nach Hause, sondern nahm einen Umweg über den Heumarkt, der sich nach Süden hin an den Altermarkt anschloss, vorbei an der alten Wollküche, den Fleischbänken und der Brothalle.
»Ist das etwa alles?«
»Wie viel willst du denn noch für den einen Heller?«
»Los! Wieg noch mal!«
»Lass gut sein«, mischte Tielman sich in das Gezerre zwischen dem Bäcker und einem vierschrötigen Kerl ein, den rissigen, grau verfärbten Händen nach ein Steinmetz. »Heriberts Waage stimmt, der betrügt dich nicht.«
»Da hörst du’s«, trumpfte der Bäcker auf. »Außerdem, wer macht das Brot denn teuer? Ich etwa? Ich zahle dem Rat Akzise zuerst aufs Mehl, und dann noch mal aufs Brot. Verzeiht, Herr Scherfgin… Ich weiß, an Euch liegt’s nicht.«
Selbst ohne schwarzes Obergewand und Barett eines Kölner Ratsherrn war Tielman ein Mann von Achtung gebietendem Äußeren. Die breite Stirn, das kräftige Kinn und die ansehnliche, leicht gebogene Nase verliehen seinem Gesicht etwas Energisches, Kraftvolles – ein Eindruck, der durch den wachen Blick der grauen Augen und die schmale, in den Mundwinkeln strichdünne Oberlippe noch verstärkt wurde. Sein schwarzes, ergrauendes Haar fiel kinnlang unter der Kopfbedeckung hervor.
»Trotzdem«, knurrte der Käufer rechthaberisch. »Ihr vom Rat, Herr Scherfgin«, wandte er sich an Tielman, »müsst endlich das Brot billiger machen, und das Fleisch auch. Wenn ihr nicht dafür sorgt, wer dann?«
»Hab Geduld«, erwiderte Tielman.
»Geduld! Geduld!« Grummelnd warf der Steinmetz dem Bäcker seinen Heller hin und trollte sich.
Tielman schaute ihm nach. Ausgerechnet er mahnte zur Geduld! Nicht mehr lange, und Leuten wie diesem Steinhauer würde die Geduld ausgehen. Und von seinesgleichen gab es viele.
Diesen Gedanken noch im Kopf, betrat Tielman wenig später sein Haus am Altermarkt.
Schlag sechs stand Leonhart wieder auf der Gasse am Marsilstein, die sich merklich geleert hatte. Während der Italienischlektion war ihm die Arbeit im Kontor durch den Kopf gegangen, die er – obwohl vom Vater aufgetragen – unfertig zurückgelassen hatte, um stattdessen zum Hafen zu laufen. Und der Vater hatte die unerledigten Briefe bestimmt längst entdeckt, nachdem er vom Rathaus ins Kontor zurückgekehrt war.
Doch Leonhart schlug nicht den Heimweg ein, sondern wandte sich dem Mauritiussteinweg zu. Nach seiner Gewohnheit durchquerte er zuvor den bröckelnden Mauerbogen, der als das Grabmal des Volkshelden Marsilius galt, tatsächlich aber, wie Leonhart wusste, das Überbleibsel einer Wasserleitung der Römer war. Bald hatte er das Kloster Sankt Pantaleon erreicht, und dann dehnten sich auch schon die Getreidefelder vor ihm, die sich unter der Abendsonne zwischen altem und neuem Mauerring ausbreiteten.
Wieder dachte Leonhart an Wyrich. Endlich war er gekommen! Insgeheim hatte Leonhart auf die Ankunft des Freundes gefiebert; denn nun konnte er dem Vater eröffnen, was er ihm mitzuteilen hatte. Ich will Euch ein guter Sohn sein, Vater, würde er sagen, aber ich will etwas anderes, als Ihr für mich vorgesehen habt. Ich will die Neue Welt sehen.
Wie der Vater es verlangte, hatte Leonhart sich nach der Heimkehr aus Emmerich der Kontordisziplin unterworfen. Doch jeder Tag hatte ihm aufs Neue gezeigt, dass er im Laufe der langen Schulzeit ein anderer geworden war. Was dem Zehnjährigen noch größtes Vergnügen bereitet hatte – neben dem Vater im Kontor zu sitzen, mit ihm zur Waage oder ins Tuchkaufhaus zu gehen –, war dem Vierzehnjährigen unendlich schal geworden.
Vor einer Wegkreuzung hielt Leonhart an, mit einem Mal zögernd, unschlüssig. Er sah den Vater vor sich. Hörte ihn ohne Zorn fragen: Haben also die Nachrichten von der Neuen Welt jenseits des Ozeans die Köpfe der Emmericher Schüler erhitzt? Welche Märchen haben die Kindsköpfe hinter den Schulmauern dir aufgetischt? Sag es mir, Sohn.
Vom Keckern einer Elster aus seinen Gedanken gerissen, folgte Leonhart ziellos einem Weg. Nein, keine Märchen von Urwäldern, Goldschätzen und fremdartigen Menschen, dachte er unwillig. Aber wie konnte er seinem Vater jenes Erlebnis im vergangenen Sommer begreiflich machen? Und den Wunschtraum, der daraus entstanden war?
Letzten Sommer hatte Leonhart einen Niederrheinsegler nach Emmerich genommen, wie stets, wenn er von Köln zur Schule zurückkehrte. Wie jedes Mal hatte er am Bug gestanden, den Blick voraus gerichtet, das sanft auf- und niedergehende Schiffsdeck unter den Füßen. Mit einem Mal – was der Anlass gewesen war, wusste er bis heute nicht – war ihm das träge Dahingleiten zwischen den nahen, von Sträuchern und Bäumen bestandenen Flussufern unerträglich erschienen, eintönig und trist.
In Emmerich angekommen, hatte er gar nicht vom Schiff herunter wollen. Seitdem war Leonhart jeden Tag zum Rhein gegangen, um auf das Wasser hinauszuschauen, das sich mit der Nordsee mischte und schließlich mit dem großen Meer, welches die Alte und die Neue Welt ebenso trennte, wie es sie verband. Leonhart wünschte sich, er könnte sich an eines der Schiffe klammern, das den Emmericher Hafen rheinabwärts verließ, und sich mitschleppen lassen, wie seine Schulkameraden es beim Schwimmen im Rhein gelegentlich taten. Doch er konnte nicht schwimmen und fürchtete sich vor den heimtückischen Strudeln, von denen die Freunde oft sprachen.
Leonhart blickte auf. Er hatte die Klosterkirche von Sankt Severin bereits hinter sich gelassen. Nicht mehr weit, und er würde vor dem Severinstor und dem äußeren Mauerring stehen.
Er machte kehrt.
Im späten Abenddämmer erreichte Leonhart den Altermarkt. Über dem menschenleeren Marktplatz mit den verrammelten Buden ragte der Kirchturm von Groß Sankt Martin auf, an den sich vier Flankentürmchen schmiegten – ein massiges Schattengebilde vor dem tiefdunklen Blau des Abendhimmels. Als Leonhart den Marktplatz überquerte, straffte er sich und versuchte, Wyrichs Nähe in seinem Innern heraufzubeschwören, doch es wollte ihm nicht gelingen.
Er hatte das elterliche Haus kaum betreten, als Diederich, der Gehilfe des Vaters, stumm zur Tür des Kontors wies und dabei sein Mondgesicht zu einer schiefen Grimasse verzog: Diederich liebte so etwas. Festen Schrittes trat Leonhart ins Kontor und grüßte. Tielman saß hinter dem Kontortisch, Rechnungsbuch, Papiere und Briefe vor sich, ohne Leonharts Gruß zu erwidern.
»Hat mein Sohn die Lektion bei Signor Scartanelli genommen?« Wie Leonhart erwartet hatte, lag kein Zorn in der Stimme des Vaters.
»Ja.«
»Hast du die Briefe kopiert, wie ich es dir aufgetragen hatte?«
»Nein.«
»Warum bist du zum Hafen gelaufen? Niemand hatte dir erlaubt, das Kontor zu verlassen.«
»Lasst mich nach Spanien gehen, Vater, nach Sevilla!«, brachte Leonhart jene Worte hervor, die er sich zurechtgelegt hatte. »Ich will Euren Seidenhandel nicht lernen. Ich will auf ein Schiff gehen, das zu der Neuen Welt segelt. Ich bin vierzehn. Ich bin erwachsen.«
Wortlos winkte Tielman seinen Sohn zu sich und streifte seinen Wappenring vom Zeigefinger: golden mit grünem Stein, drei schwarze Balken darin. Er fasste Leonharts rechte Hand, schob den noch zu weiten Ring über den Zeigefinger des Jungen und umschloss die Hand fest.
»Gewiss, ein Vierzehnjähriger gilt für erwachsen. Wer sagt aber, dass ein Sohn seinem Vater nicht mehr zu folgen hat?«, sagte Tielman ruhig. »Zum Pfingstfest wird Signor Neri nach Köln kommen und dich nach Antwerpen mitnehmen, und du wirst bei ihm den Seidenhandel lernen. Mein einziger Sohn wird mein Erbe antreten. Punktum!«
»Bitte, Vater, lasst Euch erklären…«
»Nichts wirst du erklären!«
In den Augen des Vaters sah Leonhart den Jähzorn blitzen, der ihm eigen war. Wie stets erschrak er davor – und wie stets löschte dieses Erschrecken jeden Gedanken und jede andere Empfindung aus.
»Geh jetzt«, sagte Tielman.
Leonhart zögerte.
»Geh!«
Er gehorchte. Nachdem er das Kontor verlassen hatte und über die Diele im Erdgeschoss huschte, hörte er gedämpftes Gemurmel aus der Küche: Dort saßen die Hausarmen zu Tisch, die seine Mutter Gertruyd zusammen mit Entgen, der Küchenmagd, tagtäglich verköstigte. Er hörte auch die Stimme der Mutter, lief aber rasch die Spindeltreppe zu den Obergeschossen hinauf.





























