
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Rena ist schuld am Tod ihres Freundes Joe. Niemand möchte mehr etwas mit ihr zu tun haben. Niemand außer dem Unbekannten, der ihr über WhatsApp seltsame Aufgaben schickt. Jede hat etwas mit einer Todsünde zu tun. Wenn sie diese nicht erfüllt, wird einer ihrer Liebsten dafür büßen. Rena bleibt keine andere Wahl, sie muss gehorchen. Doch das Sündenspiel wird immer grausamer und für Rena gibt es kein Entkommen. Wer steckt hinter den Nachrichten? Wie hängt das Ganze mit Joes Tod zusammen? Und vor allem: Wie kann sie das teuflische Spiel beenden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
Du sollst (nicht) lügen. Rena ist schuld am Tod ihres Freundes Joe. Das wissen alle.
Niemand möchte mehr etwas mit ihr zu tun haben.
Niemand außer dem Unbekannten, der ihr seltsame Aufgaben schickt. Jede hat etwas mit einer Todsünde zu tun.
Erfüllt Rena die Aufgaben nicht, wird einer ihrer Liebsten dafür büßen.
Sie hat keine Wahl, sie muss gehorchen. Doch das Sündenspiel wird immer grausamer.
Kann sie es stoppen, bevor alles zu spät ist?
»›Watched‹ steckt voller Gefühle, Spannung und Nervenkitzel. Ein Buch, welches man gar nicht mehr aus der Hand legen möchte« – Nils von bunteschwarzweisswelt
»Ein perfides Spiel rund um die Sieben Todsünden, aus dem es kein Entrinnen gibt und bei dem man einfach jeden verdächtigt.« – Stefanie Hasse
Für meine Eltern. Weil.
Rena
3. August, 10.08 Uhr
(7 Tage, 13 Stunden und 23 Minuten danach)
Im Beichtstuhl ist es dunkel und stickig. Es riecht muffig, nach Holz und so, als hätte jemand eine Ladung nasse Handtücher in der Waschmaschine vergessen.
Auf der anderen Seite des schweren Samtvorhangs findet Joes Beerdigungsgottesdienst statt. Pfarrer Sailes Stimme dringt nur gedämpft bis zu mir in den Beichtstuhl.
Ich schlucke. Mein Mund fühlt sich an, als hätte ich den Vorhang mit der Zunge vom Staub befreit. Ich schlucke erneut. Schmirgelpapier meets Kehle.
Angestrengt ignoriere ich das, was der Pfarrer draußen über Joe zu sagen hat. Und was soll das schon sein? Er kannte ihn überhaupt nicht, und das nicht nur, weil die Deckers erst letzten Winter hergezogen sind.
Am liebsten würde ich mir die Finger in die Ohren stecken und summen, wie ein Kind, das sich vor dem Donner fürchtet. Aber ich bin kein Kind mehr, ich kann die Realität nicht wegsummen. Keine Ahnung, warum ich überhaupt hergekommen bin.
Vereinzeltes Flüstern ist zu hören. Und obwohl ich kein Wort von dem verstehe, was getuschelt wird, weiß ich sehr genau, worüber die da draußen sich das Maul zerreißen. Oder besser gesagt, über wen.
Mich.
Rena Winterstein. Siebzehn Jahre alt. Mörderin.
Sie wissen nicht, dass ich hier drin sitze. Hoffe ich. Ich bin extra eine halbe Stunde früher gekommen. Aber wenn sie es wüssten, wären sie bestimmt zufrieden. Der Beichtstuhl ist genau der richtige Ort, um über meine Sünden nachzudenken.
Und mit denen könntest du die Hölle tapezieren!, schnurrt die Besserwisserin. Seit Kurzem hat sie sich in meinem Kopf eingenistet, thront auf dem Berg aus Lügen, der sich in mir angestaut hat. Um gnadenlos genau die Dinge zu kommentieren, die ich versuche, in der hintersten Ecke zu verstecken. Wegzuschließen. Dumm nur, dass die Besserwisserin einen Generalschlüssel hat. Nichts ist sicher vor ihr. Sie ist wie ein sprechender Spiegel, der einem nur die hässlichen Dinge entgegenschreit. Die Dinge, die sonst keiner sehen kann.
Orgelmusik setzt ein. Drama pur. Die dunklen Holzwände rücken näher, drohen, mich zu zerquetschen. Mir ist heiß. Der Schweiß läuft zwischen meinen Schulterblättern runter, das Atmen fällt mir zunehmend schwerer, und die Luft ist zähflüssig wie Sirup.
Durch einen schmalen Spalt zwischen Vorhang und Beichtstuhl kann ich die vorderste Kirchenbank sehen. Dort sitzen Joes Eltern, sein bester Kumpel Aaron, sein Bruder Pascal und … Olivia. Ausgerechnet. Sogar nach Joes Tod kann sie es nicht lassen. Hat sie nicht begriffen, dass es nichts mehr zu holen gibt? Jeder konnte sehen, dass sie ein Auge auf Joe geworfen hatte.
Und du hast sie deutlich spüren lassen, was du davon hältst!
Joes Mutter dreht sich ruckartig zu mir um, als hätte sie die Besserwisserin gehört. Mein Herzschlag setzt aus, nur um dann mit doppelter Geschwindigkeit weiterzurasen. Ihr Blick ist so kalt. Kann sie mich sehen? Ich fühle mich, als wäre ich in einen zugefrorenen Fluss eingebrochen. Die Strömung reißt mich fort von dem Loch, das zurück zur rettenden Oberfläche führt.
Frau Decker ist schon immer schlank gewesen, aber jetzt treten ihre Wangenknochen spitz hervor, und ihre Bluse sitzt um die Schultern locker. Ihr Oberkörper schwankt leicht. Wie das Pendel einer Standuhr. Hin. Her. Hin. Her. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie im nächsten Moment einfach von der Bank auf den Steinboden kippt. Still und leise, so wie ihre Wut auf mich. Ihre Augen sind tiefe Gräber.
Ich fröstle. Der Moment dehnt sich aus, als hätte jemand mit besonderem Hang zur Dramatik die Zeit angehalten. Frau Deckers Lippen werden zu einem schmalen Strich, sonst ändert sich nichts in ihrem Gesicht. Die Kälte bleibt, die Grabesaugen auch. Innerlich zähle ich die Sekunden, höre aber meine eigenen Gedanken nicht. Halte es aus. Halte ihnen stand. Das bin ich ihr schuldig.
Du bist ihr noch viel mehr schuldig!
Sie sieht weg. Endlich.
Pascal legt den Arm um seine Mutter. In den letzten zehn Tagen habe ich ihn nur in seiner Polizeiuniform gesehen – doch heute wirkt sie eher wie ein Statement.
Ich denke an die unzähligen Stunden, die ich in den vergangenen Tagen damit verbrachte, das Telefon anzustarren oder auf der Straße vor dem Haus der Deckers rumzulungern. Am Ende reichte mein Mut nur für einen Brief, den ich gestern Nacht heimlich in den Postschlitz neben ihrer Haustür gesteckt habe. So, dass eine Ecke des Kuverts noch rausschaute. Als Notbremse. Falls ich es mir im Laufe der Nacht doch noch anders überlegen sollte.
Gezogen habe ich sie nicht, die Notbremse. Wahrscheinlich haben Joes Eltern das Kuvert nach einem Blick auf den Absender ungeöffnet zerrissen und danach verbrannt. Ganz nach dem Motto: Doppelt hält besser. Mit einer Antwort brauche ich also nicht zu rechnen.
Ich beuge mich ein Stück nach vorne und kann einen Blick auf Tilli und Adina erhaschen, die direkt hinter den Deckers sitzen.
Meine besten Freundinnen für immer. Na ja, fast immer. Früher war ich ihr Mittelpunkt. Ihre Sonne, um die sie kreisten.
Adina schiebt ständig ihre Brille die Nase hoch. Natürlich hat sie sich auf Tillis Seite geschlagen. Sie hat schon früher ständig den Weg des geringsten Widerstands gesucht.
Du hättest es nicht anders gemacht!
Tillis Schultern beben, und ich sehe, wie sie sich mit einem Taschentuch übers Gesicht wischt. Was geht in ihr vor? Zum ersten Mal weiß ich es nicht. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe immer nur geglaubt, es zu wissen.
Eigentlich heißt Tilli Matilda, aber diesen Namen findet sie zu omamäßig. Ich kenne sie, seit ich denken kann, und genauso lange wohnt sie auch im Haus neben unserem. Sie ist wie eine Schwester für mich … gewesen. Wir klebten so sehr aneinander, dass nicht nur unsere Lehrer anfingen, uns zu verwechseln – und das, obwohl wir uns kein bisschen ähnlich sehen. Deshalb wurde mit der Zeit alles, was wir taten, zu einer Challenge. Ein geheimer Wettkampf, von dem nur wir wussten. Zu gewinnen gab es nichts außer einem Gefühl. Für mich war es wie ein Augenblick im Sonnenlicht. Nur für einen winzigen Moment. Danach in den Schatten zurückzukehren, war, wie nach Hause zu kommen, weil ich wusste, dass meine beste Freundin dort auf mich wartete.
Jetzt ist Tilli eine Fremde für mich. Und ich bin eine Fremde für sie. Das, was früher mal tiefe Freundschaft war, ist in Hass umgeschlagen. Nur weiß ich nicht genau, wer von uns beiden die andere mehr hasst.
Zwar kann ich die restlichen Besucher vom Beichtstuhl aus nicht sehen, weiß aber, dass mein ganzer Jahrgang gekommen ist. Joe war beliebt, keine Frage. Kapitän der Schwimmmannschaft, nicht auf den Kopf gefallen und absoluter Mädchenschwarm. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum jeder ihn mag … mochte, verdammt! – sondern, dass er einfach nett war.
Eine Träne kämpft sich meine Wange hinunter. Wütend wische ich sie weg. Es war so einfach gewesen, Joe zu lieben. Und darum umso schwerer zu begreifen, dass es vorbei war. Dass es kein Wir mehr gab, vielleicht sogar nie gegeben hatte. Dass sich hinter dem netten Jungen noch ein anderer Joe verbarg, einer, den sonst keiner kannte. Der Fleck auf der weißen Weste.
Seit 7 Tagen, 13 Stunden und 35 Minuten sind sie nicht mehr da, Joe und der Fleck. Ich weiß das, ich habe damals auf die Uhr gesehen. Keine Ahnung, warum. Den Sarg kann ich vom Beichtstuhl aus nicht sehen, ist vermutlich besser so.
In fünfeinhalb Wochen geht die Schule wieder los. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich jemals dorthin zurückkehren soll. Ohne Tilli. Ohne Joe. Nur mit mir allein. Denn ich bin die Einzige, die keinen großen Bogen um mich machen kann.
Meine rechte Hand schmerzt. Ich bemerke, dass ich sie zur Faust geballt habe. Darin steckt eins der Gedenkblätter. Ich öffne die Faust. Das sonnengelbe Papier ist zerknittert, was aussieht, als hätte Joe wütende Falten auf der Stirn.
Über seinem Foto steht: In Gedenken an Johannes Decker. Unvergessen.
Ja, vergessen wird ihn von den Anwesenden sicher niemand. Und auch nicht, wie er ums Leben gekommen ist. Dafür hat die Stille Post gesorgt, die in diesem Fall gar nicht so still gewesen ist. Kleinstadtleben eben.
Die Orgelmusik verstummt, das Tuscheln nicht. Was sie wohl über mich reden? Die meisten von ihnen kennen mich nicht mal richtig! Aber … tue ich das überhaupt selbst? Weiß ich, wer Rena Winterstein ist?
Pfarrer Sailes Worte drohen in meinen Verstand durchzudringen. Aber ich will sie nicht hören. Mein Hals wird eng, ich muss mich ablenken, also krame ich einen Kugelschreiber aus meiner Tasche. Ich drehe das Blatt um, lege es auf mein rechtes Knie und streiche es glatt.
Ganz oben schreibe ich #10factsaboutme.
Das letzte Mal, als ich bei Instagram online war, hat Tilli mich zu #10factsaboutme getagged. Damals waren die Sommerferien in greifbarer Nähe, kurz bevor alles außer Kontrolle geriet. Bevor ich außer Kontrolle geriet. Seitdem habe ich mich nicht mehr als Rena_Steinreich eingeloggt.
Die Therapeutin, zu der Mam und Paps mich seit letzter Woche schicken, hat mir dazu geraten, eine Social-Media-Pause einzulegen. Damit ich das Schlachtfeld in den Kommentaren unter meinen Bildern nicht sehe.
Meine kleine Schwester Lou hat gewettet, dass ich mich nicht daran halten kann. Wenn ich es bis Weihnachten durchhalte, muss sie ein Jahr lang meinen Spülmaschinendienst übernehmen. Wenn ich verliere, habe ich ihren Mülldienst an der Backe. Also habe ich sämtliche Social-Media-Apps vor ihren Augen von meinem Handy gelöscht und sie bis heute nicht wieder installiert. Nicht nur wegen der Wette. Mir ist klar, dass Lou mich nur motivieren wollte, damit ich durchhalte.
Über die zehn Fakten nachzudenken, beschäftigt mich. Das ist gut. Es treibt meine Gedanken raus aus dem stickigen Beichtstuhl. Dabei ganz oldschool Stift und Papier zu benutzen, macht es irgendwie … real.
Ich schreibe, als würde mein Leben davon abhängen. Jeder Fakt entspricht der Wahrheit. Und ich hasse mich für jeden einzelnen davon.
Ich bin ein schlechter Mensch …
… und eine Lügnerin.
In der Hölle ist ein Platz für mich reserviert …
… weil Joe ohne mich noch leben würde.
Alle hassen mich dafür, dass er tot ist.
Ich nehme es ihnen nicht übel.
Joe hat mich durchschaut. Und ich ihn. Trotzdem hat er nicht kommen sehen, was ich ihm und Tilli antun würde.
Ich zähle die Tage, Stunden und Minuten, seit er tot ist. Weil es wehtut, und genau das soll es.
Ich habe meine Familie mit in den Abgrund gerissen.
Mir ist klar, dass ich nach den Ferien für Joes Tod büßen werde.
Lucifer
Sündenspiel
Als der Sarg durch den Mittelgang hinausgetragen wird, gibt Lucifer vor, sich den Schuh zubinden zu müssen. Die Trauernden ziehen an ihm vorbei, folgen dem Sarg im Gänsemarsch hinaus auf den Friedhof.
Die Stille, die nun die Kirche einnimmt, ist trügerisch. Lucifer weiß, dass die Sünderin noch im Beichtstuhl sitzt, er kann ihre Füße unter dem Vorhang sehen. Das perfekte Versteck für eine wie sie. Würde jede ihrer Lügen in einer Waagschale landen, könnte kein Gegengewicht der Welt die Waage ausbalancieren.
Er huscht hinter eine der Marmorsäulen, an denen die Weihwasserschalen angebracht sind. Von hier aus hat er den Beichtstuhl gut im Blick, wird aber selbst nicht gesehen.
Er starrt auf ihre Füße, sie bewegen sich nicht. Ist sie etwa dadrin eingepennt? Wenn es sein muss, wird er den ganzen restlichen Nachmittag hier verbringen. Er will sie sehen, wenn sie sich aus dem Beichtstuhl schleicht.
Da! Das Knarzen von Holz ist zu hören.
Der Vorhang des Beichtstuhls zuckt, wird leise zur Seite geschoben.
Endlich! Selbst heute ist die Sünderin wunderschön. Typisch. Schwarzer Rock, schwarze Bluse, schwarze Schuhe. Neben all dieser Dunkelheit wirkt ihre Haut beinahe kalkig, als würde sie von innen heraus leuchten. In der Hand hält sie eins der Gedenkblätter. Ihr Blick huscht umher. Sie erinnert ihn an ein verletztes Katzenbaby, das er als Kind mal bei sich aufgenommen hatte – ängstlich und verschüchtert. Keine Sekunde lang kauft er ihr diese Show ab.
Sünder müssen büßen. Und Rena ist eine Sünderin. Auch wenn sie versucht, nach außen das brave, reumütige Mädchen zu geben, weiß Lucifer ganz genau, dass Rena in ihrem Inneren hässlich ist. Verdorben. Abschaum. Eine dreckige Lügnerin. Sie bereut nichts! Denn sonst würde sie die Wahrheit sagen. Über das, was vor acht Tagen wirklich geschehen ist.
Stattdessen hat sie gelogen. Eiskalt. Und ist damit durchgekommen.
Am liebsten würde Lucifer sie anschreien. Sie packen. Schütteln. Ihr Schmerzen zufügen. Aber das darf er nicht. Noch nicht. Er hat einen Plan.
Er muss dafür sorgen, dass die Leute in diesem Provinznest nicht vergessen, was dieses dumme Mädchen getan hat. Und wozu es fähig ist. Die Lügnerin will das Unschuldslamm spielen? Na gut! Mal sehen, wie lange sie diese Maskerade aufrechthalten kann. Und was sie ihr wert ist.
Rena verlässt den Beichtstuhl und schleicht geduckt in Richtung Ausgang. Lucifer geht ein paar Schritte um die Säule, gerade so viele, dass sie ihn nicht bemerkt. Er sieht ihr nach, ballt seine Hände zu Fäusten, zwingt sich, ruhig zu bleiben.
Bald erfahren alle die Wahrheit über sie, denn Lucifers Gericht ist gnadenlos. So etwas wie Vergebung existiert bei ihm nicht. Sein Zorn ist unermesslich, und seine Rache wird grausam sein.
Sobald die Schule wieder losgeht.
Joe
Wie meinst du das, ich darf noch nicht vorbei? Bist du hier so eine Art Türsteher, oder was? Lässt nur die coolen Kids in den Club? Ich weiß ja nicht mal, ob ich überhaupt durch dieses Tor gehen will. Was ist denn auf der anderen Seite? Kannst du es mir nicht sagen – oder willst du nicht?
Äh, ernsthaft jetzt, soll ich mich etwa irgendwo anstellen?
Willst du Kohle? Nein? Puh! Ich hätte eh keinen Cent dabeigehabt. Wer nimmt schon Kleingeld mit zum Schwimmen? Hätte ich gewusst, dass ich draufgehe, hätte ich mir was anderes angezogen. Zum Glück ist es warm hier oben. Wenn das überhaupt oben ist? Und hell ist es. Echt verdammt hell.
Hallo?! Hätte ich ein Ticket ziehen müssen? Oder bin ich hier vielleicht falsch? Ich meine, gibt’s noch ein anderes Tor? Eins, das nach unten führt – du weißt schon, wohin. Wobei das schon krass wär. Klar, ich hab hin und wieder mal Mist gebaut, aber dafür gleich in die Höll–
Wie bitte? Was willst du hören? Meinen … Weg? Soll heißen? Wie ich hierhergekommen bin? Na ja, müsstest du das nicht besser wissen als ich? Im einen Moment bin ich noch in der Schwimmhalle, und im nächsten – ZACK – steh ich hier.
Ach so, du meinst, ich soll dir erzählen, was davor passiert ist? Mann, das ist aber ’ne verdammt lange Geschichte!
Du hast Zeit? Na ja, schätze, ich auch. Und danach? Lässt du mich dann vorbei?
Bist keiner von der gesprächigen Sorte, was?
Also gut, mir bleibt wohl keine Wahl. Wo soll ich anfangen?
Was? Beim Anfang vom Ende? Okay, da kommt eigentlich nur ein Tag infrage. Der, an dem ich Rena kennengelernt hab. Letzten Dezember. Ohne sie wär ich jetzt nicht hier.
Jedenfalls hat dieser Tag angefangen wie jeder, seit wir an den Arsch der Welt gezogen sind: beschissen. Heiligabend stand schon mit halbem Fuß in der Tür. So hatte ich noch die Weihnachtsferien, bevor ich in die neue Schule musste. Und glaub mir, der Neue zu sein, darauf war ich echt nicht scharf. Ich wollte keine neuen Freunde, ich hatte welche. Nur eben nicht am Arsch der Welt …
Was uns in dieses Kaff verschlagen hat? Mein Großvater. Oder besser gesagt, seine Abwesenheit. Knapp drei Monate war es her, seit er den Löffel abgegeben hatte. Mistkerl. Er muss dir doch eigentlich auch begegnet sein, oder? Nein? Fällt wahrscheinlich unter die Schweigepflicht … oder so.
Unser Verhältnis war jedenfalls … wie soll ich das sagen, ohne beleidigend zu klingen? Mies? Unterirdisch? Abgefuckt? Kurz gesagt: Er war der geborene Kotzbrocken und Geizkragen.
Aber dass er mir noch mit seinem Testament auf den Sack gehen würde, hätte ich nicht gedacht. Warum? Na, weil er meiner Mutter ausgerechnet sein Ein und Alles vermachen musste. Seine Tanke. Ja, du hast richtig gehört – eine verdammte TANKSTELLE!
Ich hab echt mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Wäre mein Großvater der Oberschurke in einem Marvel Comic gewesen, hätte er Sprengkörper an beiden Tanksäulen deponiert und sie mit seinem Herzschrittmacher verbunden. Herzstillstand … BOOM! Seine Geliebte und er, im Tode vereint. Leider war die Realität vom Inhalt eines Comics ungefähr so weit entfernt wie die Erde vom beschissenen Rand des Universums. Die Tankstelle steht also noch. Toll.
Das einzig Gute am Umzug war, dass ich meinen Bruder öfter sehen würde. Er arbeitet als Polizist in der Stadt, musst du wissen.
Na ja, du kannst dir also vorstellen, dass meine Laune am Tag der Neueröffnung phänomenal war. Glaub mir, beim Anblick der Tanke hättest auch du losschreien können. Überall waren Lichterketten aufgehängt, die in allen Regenbogenfarben geblinkt haben. Ein Freifahrtschein in die Notaufnahme für jeden Epileptiker.
Viel war nicht los. Ich meine: Es gab Benzin. Und Diesel. Hammer! Du kannst dir also vorstellen, dass die Leute Besseres zu tun hatten, als uns die Bude einzurennen.
Es war um die Mittagszeit, als ein Mädchen reinkam: Lou, Renas Schwester, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sie war in eine schwarze Daunenjacke gepackt, den schwarzen Schal bis unter die Nase hochgezogen. Sah aus, als wollte sie uns ausrauben. In ihren Haaren und dem Schal hing Schnee. Nicht die Sorte, die locker flockig vom Himmel kommt – wenn du verstehst, was ich meine. Ihre Augen waren schwarz umrandet, der Blick war irgendwie … gehetzt. Dauernd hat sie sich umgedreht und nach draußen geschaut, als wäre sie auf der Flucht oder so.
Zuerst dachte ich, sie hätte bloß die Nummer ihrer Tanksäule vergessen. Passiert fast jedem dritten Kunden. Aber dann hab ich kapiert, dass sie viel zu jung war, um Auto zu fahren. Wahrscheinlich sogar für einen Roller.
Keine Ahnung, warum, aber meine schlechte Laune war wie weggeblasen. Dagegen kam nicht mal der zweitausendste Werbeblock an, der aus den Boxen über uns gequakt hat. Mal unter uns: Wer zum Teufel hört noch Radio? Hier oben empfängt man bestimmt keine Sender, sei froh. Falls die Leute aus der Hölle mal nach neuen Foltermethoden fragen: Radiowerbung ist der Shit schlechthin.
Aber zurück zu diesem Mädchen.
»Ist alles in Ordnung?«, hab ich über das Süßigkeitenregal hinweg gefragt. Ich war nämlich gerade dabei, die Schokoriegel zu sortieren. Ja, so langweilig war mir …
Sie ist zusammengezuckt, so als hätte ich sie angebrüllt. Zuerst hat sie mich angeschaut, dann wieder raus in den Schnee. Ihre Zähne haben sogar geklappert, so sehr war sie am Zittern. »Kann ich … kurz … telefonieren?«, hat sie gestottert und ein Handy aus der Jackentasche gezogen. Es hat getropft. Klar, dass das kein gutes Zeichen war, oder?
Natürlich hab ich ihr mein Smartphone gegeben. Ich wollte nicht lauschen, echt nicht, aber der Laden ist halt einfach kein Ort, an dem man Verstecken spielen kann. Also bin ich nicht drum rumgekommen, zu hören, wie sie jemanden gebeten hat, sie abzuholen.
Dann hat sie mir das Handy zurückgegeben und mich angelächelt. Ein bisschen gequält, aber immerhin. Schnell hat sie ihren Schal wieder bis zur Nase hochgezogen und ein »Danke« reingenuschelt. Wahrscheinlich, weil sie nicht wollte, dass ich ihre Zahnspange sehe.
Ich hab abgewunken, einen Schokoriegel aus dem Regal genommen und ihr hingehalten. Sie sah echt fertig aus und – keine Ahnung – ich wollte sie einfach aufmuntern. Ist ja nicht so, als hätte ich wahnsinnig spannendes Zeug zu tun gehabt.
»Endorphine?«, hab ich gesagt.
Sie hat geschaut wie ein Auto. Also hab ich ihr erklärt, dass Schokolade Glückshormone freisetzt. Zuerst sind ihre Augen ganz groß geworden, vielleicht dachte sie, ich will mich über sie lustig machen. Zu der Zeit war sie nämlich noch ziemlich rundlich, musst du wissen. Aber als sie gemerkt hat, dass ich nur nett sein wollte, hat sie sich wieder entspannt. Den Schokoriegel wollte sie trotzdem nicht, hat nur den Kopf geschüttelt.
Sie hat mir erzählt, dass sie Lou heißt. Von Louisa. Also hab ich gesagt, dass ich auch lieber Joe genannt werden will. Ich meine, Johannes war vielleicht vor dreißig Jahren mal angesagt.
»Kommt dich jemand abholen?«, hab ich gefragt.
»Meine Mam und Rena, meine Schwester.« Wieder hat sie ihr Handy rausgeholt und übers Display gewischt, als würde das irgendwas bringen.
»Reis.« Keine Ahnung, warum ich das gesagt hab, ich wollte sie wohl einfach ein bisschen auf andere Gedanken bringen. Oder mich selbst, such’s dir aus.
»Ich bin eher der Spaghetti-Typ«, hat sie gemeint. Es war irgendwie süß, wie überrascht sie selbst von ihrer Antwort war.
Ich musste lachen, und zum ersten Mal seit Tagen hat es sich echt angefühlt, verstehst du? Dazu hat sogar der Song gepasst, der gerade im Radio kam. Happy. Und irgendwie war ich das auch. Komisch, findest du nicht? Weil ich doch eigentlich sie aufmuntern wollte.
Na ja, jedenfalls hab ich ihr erklärt, dass sie das Handy in Reis legen soll – kennst du bestimmt, den Trick. Nein? Ach, egal.
Sie wollte wissen, ob ich neu in der Stadt bin. Ich hab ihr erzählt, dass wir gerade hergezogen sind und mein erster Schultag nach den Ferien ist. »Die Galgenfrist läuft also noch«, hab ich gesagt und so getan, als würde ich einen unsichtbaren Strick packen, der um meinen Hals gebunden ist.
Ich konnte sie hinter ihrem Schal glucksen hören. Die Türglocke hat gebimmelt, und Rena ist reingekommen. Das Mädchen, das mich töten sollte. Den unsichtbaren Strick hatte ich immer noch um den Hals. Irgendwie passend, findest du nicht?
Du wolltest hören, was mich zu dir geführt hat. Tja, das war er: Der Anfang vom Ende. Keine Panik, es geht noch weiter. Ich hoffe, du hast Zeit. Aber die spielt hier oben wahrscheinlich eh keine Rolle mehr …
Rena
Montag, 13. September, 6.55 Uhr
(48 Tage, 10 Stunden und 10 Minuten danach)
Ich liege im Bett, keine Ahnung, wie lange ich schon wach bin. Meine Gedanken sind der Meinung, ich hätte genug geschlafen.
Was wäre, wenn?
Drei Worte. Sie geistern durch meinen Kopf. Ein nerviger Bildschirmschoner, der sich einfach nicht wegklicken lässt.
Was wäre, wenn Lou an jenem Tag im Dezember nicht in diese blöde Tankstelle gegangen wäre?
Wenn ich Joe nie kennengelernt hätte?
Wenn ich meine Wut besser im Griff gehabt hätte?
Wenn ich nicht so ein Miststück gewesen wäre?
Was. Wäre. Wenn.
Ursache und Wirkung.
Die Fragen kreisen und kreisen. Ziellos. Sinnlos. Ich kenne die Antworten auf die meisten davon. Und die gefallen mir ganz und gar nicht. Man kann die Vergangenheit nicht korrigieren. Trotzdem wünsche ich mir nichts sehnlicher. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Sogar in meinen Träumen.
Mein Wecker kräht. Mister Gockel. Ein weißer Plastikhahn, den Lou mir dieses Jahr zum Siebzehnten geschenkt hat. Mit einem beherzten Schlag auf seinen Kopf bringe ich ihn zum Schweigen.
Eine Erinnerung im Handy sagt mir, dass ich heute Therapie habe. Ich schiebe sie weg und lösche die Terminserie.
Hättest du der Seelenklempnerin von mir erzählt, hätte sie bestimmt nicht zugelassen, dass du die Therapie zum Ende der Ferien abbrichst.
Gähnend quäle ich mich aus dem Bett. Aus dem Augenwinkel nehme ich eine Bewegung wahr und fahre herum. Ein Zombie blickt mir aus dem großen Spiegel an meinem Schminktisch entgegen. Keiner von uns rührt sich.
Wenn Augenringe der neue Look wären, hättest du heute den Styling-Jackpot geknackt.
Wie immer in den letzten 48 Tagen, 10 Stunden und 18 Minuten sitzt die Besserwisserin kichernd auf dem Lügenberg, der seit ihrem Einzug stetig wächst. Es scheint, als hätte sie einen Nageldetektor. Ganz gezielt spürt sie die Dinger auf und versenkt sie mit einem Schlag tief in meinem Nervenzentrum.
Ich mustere den Zombie im Spiegel genauer. Sein Gesicht wirkt irgendwie zu kantig, die kurze Schlafanzughose sitzt locker auf den Hüften, und das Shirt schlackert, als hätte er es aus einem von Lous Säcken für die Kleiderspende geklaut.
Jemanden umzubringen oder die Schwester einer Mörderin zu sein, scheint eine Top-Diät zu sein. Du solltest einen Ratgeber schreiben: Mit einem Mord zur Traumfigur.
Die Besserwisserin und ich haben offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen von einer Traumfigur. Und es gibt noch eine Sache, in der sie unrecht hat: Lou hat nicht erst nach Joes Tod abgenommen, sondern schon viel früher. Seit Beginn des Jahres ist sie fast um vier Kleidergrößen geschrumpft.
Auf der Brust des Zombies kleben die #10factsaboutme. Also nicht wirklich auf seiner Brust, sondern an meinem Schminkspiegel. Sie sollen mich daran erinnern, wie ich es ans unterste Ende der Nahrungskette geschafft habe.
Ich gehe zum Fenster und ziehe die Vorhänge zur Seite. Gegenüber, keine fünfzehn Meter entfernt, tut Tilli das Gleiche.
Wir bleiben beide reglos stehen und starren einander an. Tilli sieht in ihrem hellblauen Nachthemd mindestens genauso zerknittert aus wie der Zombie. Eine Millisekunde lang wünsche ich mir, wir könnten einfach unser jahrelang praktiziertes Morgenritual durchführen. Dazu müsste ich nur mein Fenster öffnen, nach dem Dosentelefon greifen und »Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag« reinsprechen.
Bevor wir das Dosentelefon hatten, haben Tilli und ich einfach quer über den Garten gebrüllt. Montags bis freitags um halb sieben, pünktlich wie ein Pickel, der mitten auf der Nase sprießt, kurz bevor man ein Date hat. Allerdings war Herr Kazemi, der Apotheker, der im Haus schräg hinter unserem wohnt, nicht ganz so begeistert von unserem Ritual. Er taufte uns »Die Gockel vom Lilienweg« und drückte uns zwei Dosen in die Hand. Der Hauptgrund, weshalb Lou mir Mister Gockel geschenkt hat.
Tilli wendet sich ab. Ein heißes Stechen brennt in meiner Brust. Ich ignoriere es und öffne mein Fenster, um den Schlafmief gegen Frischluft zu tauschen. Dabei fällt mein Blick auf den Draht, der eigentlich straff zwischen unseren Fensterbänken gespannt sein sollte, nun aber locker nach unten baumelt. Meine Dose – Tilli hatte sie in einem knalligen Pink angemalt und mit Glitzer bestreut – baumelt wie immer am Haken direkt neben dem Fenstersims. Ganz vorne ist ein Glöckchen befestigt, sodass man nur am Draht rütteln muss, um einen Anruf zu machen.
Mit dem Blick folge ich dem Draht. Er hat sich in den Ästen der alten Eiche verfangen, die auf der Grundstücksgrenze zwischen unseren beiden Häusern steht. Von Tillis blauer Glitzerdose ist weit und breit nichts zu sehen. Sie muss sie abgerissen und den Draht achtlos fallen gelassen haben.
Heute ist wohl kein guter Tag für einen guten Tag, was?
In meinem Bauch verknotet sich etwas. Am liebsten würde ich zurück in mein Bett kriechen, die Decke über den Kopf ziehen und mich tot stellen.
Ich höre die Dusche laufen. Eine Schwester zu haben, in deren Kleiderschrank Schwarz die einzige Farbe ist, hat einen entscheidenden Vorteil: Sie braucht nie lange im Bad.
Lou wird heute vermutlich die Einzige sein, die mich nicht mit ihrem Blick steinigen will. Im Gegenteil, ihrer wird eher vor Mitleid für ihre große Schwester triefen, die so tief gefallen ist, dass selbst Lou im Vergleich zu den Angesagten der Schule zählt.
Und das will etwas heißen.
Ich war Tilli schon immer näher als meiner eigenen Schwester. Lou und ich sind nie ein Herz und eine Seele gewesen, haben uns gegenseitig die Haare geflochten oder uns unsere tiefsten Geheimnisse anvertraut. Dafür sind wir einfach zu verschieden.
Lou ist eine Einzelkämpferin. Sie gehört zu den Menschen, denen es nichts ausmacht, alleine zu sein. Früher hat sie mir irgendwie leidgetan, jetzt beneide ich sie um diese Fähigkeit. Ständig schleppt sie ein anderes Buch mit sich herum, ihr Ausweg aus dieser Welt, in die sie nicht so recht zu passen scheint.
Ab und zu machen Mam und Paps sich Sorgen um Lou – aber meistens verfliegt das ziemlich schnell wieder. Wie zum Beispiel, als sie sich letztes Weihnachten die linke Kopfhälfte rasiert hat. Den Rest, der noch übrig war, hat sie schwarz gefärbt.
Mann, war dir das peinlich!
Ich ignoriere die Besserwisserin. Lou und ich mögen unterschiedlich sein, aber das ist okay. Sie ist trotzdem meine Schwester.
Jetzt kannst du dich sogar fast mit ihr sehen lassen. Wenn sie weiter so abnimmt, passt sie bald in deine Klamotten.
Als Lou ihre abendliche heiße Schokolade zu Beginn des Jahres abgesetzt hat, dachten wir zuerst, sie wäre krank. Aber dann hat sie auch noch angefangen zu joggen! Ich glaube, das war die Zeit, in der sie mit Ivar zusammengekommen ist. Da wussten wir aber noch nichts von ihm. Seit Mitte der Sommerferien bekommt man Lou aber nur noch mit Anhang zu Gesicht. Ivar scheint ihr gutzutun. Die Haare auf ihrer linken Kopfhälfte sind schon richtig gut nachgewachsen, und manchmal ertappe ich Lou sogar dabei, wie sie lächelt.
Wie aufs Stichwort ertönt draußen ein Quietschen. Das muss Ivar sein. Der Keilriemen seines Hondas klingt immer wie eine Maus, der man auf den Schwanz tritt. Bestimmt will er Lou abholen. Er geht zwar auf die Schule in der Stadt, aber offenbar hält er es keinen Tag ohne Lou aus.
Höre ich da etwa Eifersucht?
Ich schlüpfe in meine Kleider. Wenn ich vor Lou aus dem Haus bin, kommt sie nicht auf die Idee, mich zur Schule mitnehmen zu wollen. Ich weiß, sie meint es nur gut, aber sie sollte sich wirklich nicht mit mir sehen lassen. Zumindest nicht in nächster Zeit. Außerdem habe ich echt keinen Bock, den beiden beim Knutschen zuzuschauen.
Zum ersten Mal fühle ich beim Gedanken an Lou einen Stich im Herzen. Sie wird nicht von allen begafft. Keiner hasst sie für einen Fehler, der das Leben eines Menschen beendet und das mehrerer anderer zerstört hat. Niemand wünscht ihr die Pest an den Hals. Merkwürdig, worauf man alles neidisch sein kann.
Ich mache mich auf den Weg in die Küche, entscheide mich aber im Flur um. Auf ein gemeinsames Frühstück habe ich jetzt wirklich keine Lust, vielleicht sollte ich einfach auf dem Weg beim Bäcker vorbeigehen.
Mam und Paps tun zwar so, als hätten hätte der Vorfall im Sommer keine Auswirkungen auf den Ruf ihrer Zahnarztpraxis gehabt, aber mir können sie nichts vormachen. Ich bin nicht blind. Und dumm auch nicht. Mir ist nicht entgangen, dass Mam in letzter Zeit nur noch halbtags arbeitet. Weniger Arbeit bedeutet weniger Patienten. Und man muss wirklich kein Genie sein, um den Grund dafür rauszufinden.
Ich schlüpfe in meine Chucks und schnappe mir meine Umhängetasche.
Rena
Montag, 13. September, 7.45 Uhr
(48 Tage, 11 Stunden und 0 Minuten danach)
Ich betrete mein Klassenzimmer. Drinnen wird es so schlagartig still, als hätte jemand die Tonspur für diese Szene meines Lebens zerrissen. Fast alle Tische sind schon besetzt, was ziemlich untypisch ist, vor allem für den ersten Tag nach den Sommerferien.
Fehlt nur noch, dass sie Popcorn mitgebracht haben!
Ich entdecke Tilli in der ersten Reihe, zwischen Adina und Mara. Ausgerechnet!
Wie immer trägt Mara ihre langen glatten Haare zu einem Dutt zusammengeknotet. Er ist das absolute Gegenteil vom Messy Bun, den seit einer regelrechten Dutt-Revolution alle Mädels tragen. Wobei die Bezeichnung ganz schön trügerisch ist. Einen Haarknoten so richtig schön messy aussehen zu lassen, kann ewig dauern. Man muss daran herumzupfen, bis alles perfekt durcheinander ist. Als hätte man die Haare nur mal eben schnell zusammengeknotet. Keine große Sache.
Na ja, an Mara ist dieser Trend jedenfalls vorbeigegangen. Bei ihr lugt keine einzige Strähne heraus, alles ist streng nach hinten gebürstet und mit einer Tonne Haarspray und Klammern am Kopf festgetackert. Da kann ein Orkan kommen … und gehen – die Frisur sitzt.
Dann ha… ha… hat sie we… we… wenigstens ihre Ha… Haare im … im Gr… Gr… Griff. Die Besserwisserin klingt genauso wie ich noch vor ein paar Monaten. Dabei stottert Mara schon längst nicht mehr wie in der Sechsten. Jahrelanger Sprachtherapie sei Dank.
Tilli ist die Einzige, die nicht aufsieht, als ich den letzten freien Tisch ansteuere. Eisern haftet ihr Blick auf ihren Fingernägeln, als würde es im Moment nichts Spannenderes geben, als den roten Lack abzukratzen.
Adina flüstert ihr etwas zu. Ein Tuscheln geht durch die Reihe hinter mir. Ich fühle, wie sich meine Muskeln anspannen – bereit wegzulaufen.
»Psycho!«, höre ich jemanden rufen und halbherzig als Niesen tarnen.
Ich schaue in die Richtung, aus der das Psycho-Niesen kam, und entdecke Jurij. Meinen Ex. Der Tag wird immer besser.
»Gesundheit«, sage ich, sehe ihm direkt in die Augen und schenke ihm ein strahlendes Lächeln. Er sieht weg. Letztes Jahr hätte mich das fertiggemacht. Na ja, zumindest, solange mich die Schmetterlinge in meinem Bauch davon ablenken konnten zu bemerken, dass Jurijs Schädel nur ein einziges großes Vakuum umschließt. Unsere Trennung war hässlich, aber nötig.
Jetzt ist er bestimmt froh, dich los zu sein!
Als ich mich an den letzten freien Tisch setze, sehe ich, dass ein Wort ins helle Holz der Tischplatte geritzt wurde.
MÖRDERIN
Jap, kein Zweifel, das ist dein Platz!
Ich spüre die Blicke der anderen, die wie Nadeln in meine Haut stechen. Genauso gut hätte ich mein Gesicht unter eine laufende Tätowiermaschine halten können. Ich weiß, dass sie auf eine Reaktion warten. Aber eigentlich ist es egal, was ich tue, jedes Detail wird später ausgeschmückt und in der Gerüchteküche weiterverarbeitet werden. Da war der Vorfall letzten Herbst im Schlachthof nichts dagegen. Alle Schweine wurden freigelassen und die Wände mit Blut besudelt. Wochenlang gab es kein anderes Thema. Wie lange es wohl dauern wird, bis sie müde sind, mich anzustarren? Monate? Jahre? Für immer?
Mit dem Zeigefinger fahre ich die tiefen Rillen in der Tischplatte nach. Jeder Buchstabe ist leicht nach rechts geneigt, als würden sie gegen einen Sturm ankämpfen. Und dort, wo eigentlich die Ö-Punkte sein sollten, ist ein langer Dachstrich.
Diese Schrift habe ich oft genug gesehen. Auf den Nachrichten, die wir im Unterricht heimlich geschrieben haben, während Herr Gustavo verzweifelt versucht hat, uns Integralrechnung beizubringen. Oder auf einer Klausur, wenn ich mal wieder zu wenig gelernt hatte und abschreiben musste. Eins ist klar: Tilli wird nie wieder freiwillig neben mir sitzen, geschweige denn mich bei sich abschreiben lassen.
Seit unserem allerersten Schultag hatten wir zusammengesessen. Jahr für Jahr war ein Tisch für uns reserviert. Immer der gleiche. Zweite Reihe am Fenster. Egal, ob wir das Klassenzimmer wechselten oder ein neues Schuljahr begann, die anderen wussten, dass dieser Tisch uns gehörte.
Klar, nach dem, was du in der Sechsten mit Mara angestellt hast.
Ich hasse die Besserwisserin dafür, dass sie mich daran erinnert. Mara war neu in unserer Klasse und hat sich aus Versehen an unseren Tisch gesetzt. Ein Wort aus ihrem Mund hat gereicht, um zu wissen, wo ihr wunder Punkt lag. Das Fiese am Stottern ist, dass es unter Stress meistens schlimmer wird.
Und da hast du beschlossen, deine Finger noch tiefer in ihren wunden Punkt zu bohren.
Damals fühlte ich mich wie eine Siegerin. Als würde ich im Ring stehen mit einer Gegnerin, die mich vor Kampfbeginn über all ihre Schwachstellen aufklärt. Das kaputte Knie, die schon zweimal gebrochene Nase, die Haltungsfehler bei der Deckung. Ich habe den Kampf gewonnen, noch bevor der erste Gong ertönte – oder bevor Mara überhaupt ahnte, dass sie sich mitten in einen Boxring gesetzt hatte. Und trotzdem schlug ich zu. Mit Worten. Dass die manchmal mehr wehtun können als wirkliche Treffer, weiß jeder.
Ich habe mal ein Foto gesehen, auf dem ein Mann mit einem Gewehr abgebildet ist. Neben ihm sitzt ein Löwe mit gefletschten Zähnen. Darunter steht: Die gefährlichste Bestie der Welt. Und daneben ein Löwe.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich dafür, den Mann zu ersetzen. Durch ein Kind. Am besten ein kleines Mädchen mit Zöpfen, rosa Kleidchen und Lackschuhen. Niedlich … und böse.
Und du warst ein seeeeeehr niedliches Kind.
Ich widerspreche der Besserwisserin nicht.
Aber das war einmal. Jetzt bin ich die mit der Zielscheibe auf der Stirn. Jeder Schuss ein Treffer. Ich blute, in einem Becken voller Haie.
Rena
Montag, 13. September, 10.15 Uhr
(48 Tage, 13 Stunden und 30 Minuten danach)
Ich starre auf die Tischplatte und pule mit den Fingernägeln Holzsplitter von den eingeritzten Buchstaben. Sie werden immer größer und ausgefranster. Ich könnte sie verschwinden lassen, die Buchstaben so deformieren, dass man sie nicht mehr lesen kann. Will ich aber nicht.
»Rena?«
Ich schrecke hoch. »Ja?«
Mo streckt mir seine Baseballcap hin. Eine Handvoll zusammengefalteter Zettel liegt darin. Ah, richtig, die Klassensprecherwahl! Schnell kritzle ich Mara auf ein Stück Papier und falte es zusammen.
Als ich es in Mos Cap werfen will, bleibt mein Blick an ein paar dunklen Verfärbungen hängen, die sich an der Innenseite befinden. Gänsehaut überkommt mich.
Fünf Jahre ist es inzwischen her, seit Mo das erste Mal mit der Cap in die Schule gekommen ist. Keiner der Lehrer hat ihn je aufgefordert, sie abzusetzen – obwohl ein fetter Totenkopf vorne drauf ist. Uns ist allen klar, warum. Jeder kennt die Geschichten und Zeitungsartikel über den schrecklichen Unfall. Ein Mann war nachts beim Überqueren der Straße vor Pepes Pizzeria überfahren worden. Dieser Mann war Mos Vater. Und er trug in dem Moment, in dem er den Kampf gegen seine inneren Verletzungen verlor, genau diese Totenkopfcap.
Ewig geisterte der Fall durch die Nachrichten und durch die Gerüchteküche, aber der Täter wurde nie gefasst.
Anfangs kam es mir so vor, als würde Mo sein wahres Ich unter der Baseballcap seines Vaters verstecken. Monate vergingen, dann Jahre, und mit der Zeit wurde die Cap ein Teil von Mo. Ohne sie bekam man ihn nicht mehr zu Gesicht.
»Wird das heute noch was?«, blafft er mich an.
Vor Schreck lasse ich meinen den Stimmzettel fallen und verfehle mein Ziel. Genervt bückt sich Mo, um ihn aufzuheben.
Selbst der Klassenfreak kann dich nicht ab!
Mein Blick bleibt an seinem Kopf hängen. So ganz ohne Cap wirkt er unnatürlich kahl, was aber auch an seinen kurz rasierten Haaren liegen könnte.
»Gut.« Gustavo, unser Klassenlehrer, räuspert sich. Ich vermeide es, ihn direkt anzusehen. Joe war sein Liebling. Natürlich würde er das nie zugeben, aber ich weiß es. Er war das Rennpferd in Gustavos Stall, denn der ist – trotz der stattlichen Kugel, die er vor sich herschiebt – auch Trainer der Schwimmmannschaft. »Dann zählen wir jetzt die Stimmen au –«
Der Klang einer Mundharmonika unterbricht ihn. Vier schrille Töne, die mir sofort Gänsehaut über den Nacken jagen. Sie klingen ganz nah. Zu nah. Ist das ein Handy? Nervöses Gekicher schwappt durch die Reihen.
»Ich weiß, in sechs Wochen Sommerferien gehen bei einigen von euch gerne ein paar Millionen Gehirnzellen flöten, also noch mal zur Erinnerung: Handys aus!«
Erneut ertönt die Mundharmonika. Ein langer hoher Ton, gefolgt von drei kürzeren. Irgendwie … bedrohlich. Die Melodie kommt mir bekannt vor, aber ich kriege nicht zu fassen, wo ich sie schon mal gehört habe.
»Leute, letzte Warnung!«
Erneut setzt die Melodie ein und zerreißt das gespannte Schweigen. Sie klingt so nah, als würde jemand unter meinem Tisch sitzen und Mundharmonika spielen. Gustavo scheint das auch bemerkt zu haben, denn er steuert direkt auf mich zu.
Schnell schiebe ich meinen Notizblock über den Mörder-Schriftzug, da macht Gustavo schon vor meinem Tisch halt.
»Rena?« Seine Stimme hat einen gereizten Unterton angenommen.
»Ist nicht meins!« Ich hebe das Mäppchen hoch und zeige ihm mein Handy. Wie aufs Stichwort setzt die Mundharmonika wieder ein.
Gustavo bewegt sich nicht vom Fleck. »Es kommt eindeutig von deinem Platz. Hast du noch ein zweites Handy?«
Ich schüttle den Kopf. Mam und Paps verdienen mit ihrer Praxis zwar nicht schlecht, aber ein zweites Handy würden sie mir niemals kaufen. Wozu auch?
Die Mundharmonika gibt alles. Es kommt mir so vor, als würde sie mit jedem Mal lauter und nervtötender werden. Woher kenne ich nur diese Melodie?
Gustavos Gesicht läuft dunkelrot an, und sein Schnauzbart vibriert, was ein deutliches Zeichen dafür ist, dass man möglichst bald in Deckung gehen sollte. Sein Geduldsfaden war noch nie besonders robust, und in diesem Fall ist das Handyklingeln wie eine Rasierklinge.
»Das gibt es doch nicht!« Er bückt sich und sieht unter den Tisch. Als er wieder hochkommt, mustert er mich durchdringend. »Findest du das lustig?«
Was? Verwirrt schiebe ich meinen Stuhl nach hinten, um selbst zu sehen, was er meint. »Wie zum Teufel …?« Im Metallgitter für Bücher, das an der Unterseite der Tischplatte befestigt ist, liegt ein Smartphone.
Ich nehme es und lege es auf meinen Block. Das Display leuchtet auf, und die Mundharmonika gibt ihr Bestes.
Ich sehe Gustavo an. »Da… das«, stottere ich, die Worte wollen einfach nicht aus meinem Mund kommen.
Jetzt weißt du, wie Mara sich gefühlt hat.
Meine Wangen brennen. Ich räuspere mich, um meiner Stimme Nachdruck zu verleihen. »Das ist nicht meins!«
Gustavo sieht mich streng an. »Rena, glaubst du wirklich, du befindest dich in einer guten Position, um zu lügen?« Er deutet auf das Handy.
Ich starre darauf, kapiere aber nicht, was ich da sehe. Das kann nicht stimmen! Auf dem Display leuchtet ein Foto. Von Joe und MIR. Joe grinst in die Kamera, und ich drücke ihm einen Kuss auf die Wange. Es ist ein Selfie. Ich erkenne es sofort, immerhin habe ich es gemacht und direkt danach in meine Insta-Story gepostet.
Ein nervöses Kichern entweicht mir, was meine Lage nicht gerade verbessert. »Aber … Ich meine … das kann nicht … Wer würde denn … Also …«
Gustavo bedenkt mich mit seinem Enttäuschter-Lehrer-Blick, den er auch dann immer aufsetzt, wenn er mir meine verhauenen Mathearbeiten zurückgibt. »Leider muss ich dir einen Eintrag ins Klassenbuch schreiben. Störung des Unterrichts.«
Und weil du ihm sein Rennpferd weggenommen hast! Näher wird er olympischem Gold nicht mehr kommen. Er hätte als Joes Mentor in die Geschichte der Schule eingehen können.
Ich will protestieren, aber mir fehlen die Worte. Was zum Teufel ist hier los? Warum hat jemand ein Foto von Joe und mir als Sperrbildschirm? Und warum liegt dieses Handy unter meinem Tisch?
Gustavo dreht mir den Rücken zu und verdeutlicht damit, dass die Diskussion für ihn beendet ist. Er ist noch keine zwei Schritte weit gekommen, als die Mundharmonika abermals einsetzt. Dann wieder und wieder. Als würde direkt hintereinander Nachricht an Nachricht eintreffen, sodass der Klingelton sich beinahe überschlägt.
Ich kann förmlich sehen, wie einzelne Stränge von Gustavos Geduldsfaden reißen. Zip. Zip. Zip. »Ich verstehe, dass das Ende der Sommerferien schrecklich sein muss, aber so schlimm dann wohl auch wieder nicht, oder?«
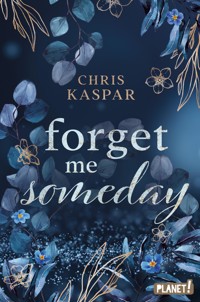
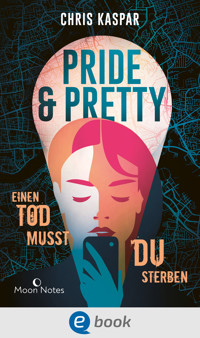













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













