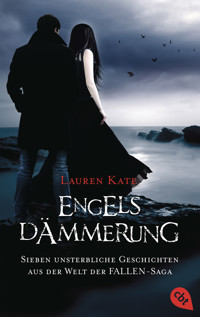13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Teardrop-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eureka kann die Welt retten. Doch dafür muss
sie auf alles verzichten.
Dank Eurekas Tränen hat sich der verlorene Kontinent Atlantis aus der Versenkung erhoben – und mit ihm sein durch und durch böser Herrscher, König Atlas. Jetzt ist Eureka die Einzige, die die Welt vor Tod und Zerstörung retten kann. Zusammen mit dem mysteriösen Ander macht sie sich auf eine atemberaubende Reise, um Solon zu finden – jenen rätselhaften, verschollenen Saathüter, der alle Antworten auf ihre Fragen kennt. Da kommt Eureka hinter ein Geheimnis, das sie vor eine folgenschwere Entscheidung stellt: Ist sie bereit, für den Sieg über Atlas alles aufzugeben – auch die Liebe?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Lauren Kate
Waterfall
Aus dem Englischen
von Michaela Link
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2014 by Lauren Kate
Published by Arrangement with Lauren Kate Morphew
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem
Titel »Waterfall« bei Delacorte Press,
an imprint of Random House Children’s Books, New York
© 2015 für die deutschsprachige Ausgabe by cbt Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück, 30287 Garbsen.
Aus dem Englischen von Michaela Link
Lektorat: Carola Henke
Covergestaltung: © Carolin Liepins
unter Verwendung eines Motivs von © Shutterstock (Aleshyn Andrei, Daz Stock)
MG · Herstellung: KW
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-15336-6V002
www.cbt-buecher.de
Für Venice
Es ist ein angenehmer Gedanke,
dass zwischen dem Gewicht des Meeres
und dem Gewicht von Bedeutung
eine Verbindung bestehen könnte.
Joe Wenderoth,
»The Weight of What Is Thrown«
Kapitel 1
Die dritte Träne
Der Himmel weinte. Kummer überflutete die Erde.
Starling öffnete den Mund, um die Regentropfen aufzufangen, die durch das Loch in ihrem Kordon fielen. Der durchsichtige Schutzschild der Saathüterin spannte sich wie ein gemütliches Campingzelt über das Lagerfeuer. Es hielt die Sintflut draußen; nur oben war eine kleine Öffnung, durch die der Rauch des Feuers entweichen und eine Probe des Regens hineingelangen sollte.
Einige Tropfen fielen Starling auf die Zunge. Sie waren salzig.
Sie schmeckte alte, entwurzelte Bäume, Meere, die das Land zurückeroberten. Sie schmeckte schwarzes Wasser an Küsten, überschwemmte Buchten. Verwelkende Wildblumen, verdorrtes Hochland, alles vom Salzwasser zerstört. Eine Million verwesender Leichen.
Das hatten Eurekas Tränen getan – und noch mehr.
Starling schmatzte und untersuchte den Regen auf etwas anderes. Sie schloss die Augen, dann ließ sie sich die Tropfen über die Zunge rollen wie ein Sommelier, der Wein verkostete. Noch konnte sie keine atlantischen Türme schmecken, die in den Himmel ragten. Sie konnte Atlas, den Bösen, nicht schmecken.
Das war gut, aber verwirrend. Die von dem Tränenbrunnenmädchen vergossenen Tränen waren dazu bestimmt, Atlantis zurückzubringen. Die Verhinderung dieser Tränen war der Zweck der Saathüter gewesen.
Sie hatten versagt.
Und was war geschehen? Die Flut war da, aber wo war ihr Herrscher? Eureka hatte das Pferd gebracht, aber nicht seinen Reiter. War etwas völlig falsch gelaufen?
Starling beugte sich über das Feuer und studierte ihre Seekarten. Tränen liefen in breiten Bahnen an den Wänden des Kordons herab und betonten die Wärme und Helligkeit des nach Zitronellöl duftenden Raums. Wäre Starling jemand anders gewesen, hätte sie sich vielleicht mit einem Becher Kakao und einem Roman zusammengerollt und von dem Regen in eine andere Welt versetzen lassen.
Wäre Starling jemand anders gewesen, wäre sie schon vor Jahrtausenden an Altersschwäche gestorben.
Es war Mitternacht im Nationalforst Kisatchie im Herzen von Louisiana. Starling wartete seit Mittag auf die anderen. Sie wusste, dass sie kommen würden, obwohl sie nicht über diesen Ort gesprochen hatten. Das Mädchen hatte so plötzlich geweint. Ihre Flut hatte die Saathüter über diesen scheußlichen neuen Sumpf verteilt, und es war keine Zeit gewesen, einen Treffpunkt abzusprechen, wo sie sich wieder sammeln würden. Aber es würde hier sein.
Gestern, bevor Eureka geweint hatte, war dieser Ort noch hundertfünfzig Meilen vom Golf entfernt gewesen. Jetzt war er nur noch ein Punkt einer untergehenden Küstenlinie. Der Bayou – mit seinen Ufern, Lehmstraßen und Tanzlokalen, seinen knorrigen Lebenseichen, Antebellum-Villen und Pick-up-Trucks – lag in einem Meer selbstsüchtiger Tränen begraben.
Und irgendwo dort draußen schwamm Ander, verliebt in das Mädchen, das dies angerichtet hatte. Ärger kochte in Starling hoch, als sie an den Verrat des Jungen dachte.
Jenseits des Feuerscheins, in dem schrägen Regen, tauchte eine Gestalt aus dem Wald auf. Kritias trug seinen Kordon wie einen Regenmantel, nur für Saathüter sichtbar. Starling dachte, dass er kleiner aussah. Und sie wusste, was ihm durch den Kopf ging:
Was ist schiefgegangen? Wo ist Atlas? Warum sind wir noch am Leben?
Als er den Rand von Starlings Kordon erreichte, blieb Kritias stehen. Sie wappneten sich beide gegen den rauen Windstoß, der die Verschmelzung ihrer Kordons anzeigen würde.
Der Moment ihrer Vereinigung war wie der Einschlag eines Blitzes. Starling stemmte sich mit verschränkten Armen gegen den Sturm; Kritias kniff die Augen zusammen und kämpfte sich vorwärts. Ihr Haar wehte ihr wie Spinnweben um den Kopf; seine Wangen flatterten wie Fahnen.
Starling bemerkte diese wenig schmeichelhaften Züge bei Kritias und sah, dass er das Gleiche bei ihr wahrnahm. Sie tröstete sich damit, dass Saathüter nur dann alterten, wenn sie Zuneigung empfanden.
»Venedig existiert nicht mehr«, sagte Starling, während Kritias sich die Hände am Feuer wärmte. Sie hatte das, was ihre Geschmacksknospen ihr verraten hatten, mit ihren Karten abgestimmt. »Der größte Teil von Manhattan, der ganze Golf …«
»Warte auf die anderen.« Kritias deutete mit dem Kopf in die Dunkelheit. »Sie sind hier.«
Chora kam von Osten auf sie zugetaumelt und Albion von Westen, von ihren Kordons nur notdürftig vor dem Sturm geschützt. Sie näherten sich Starlings Kordon und versteiften sich, wappneten sich gegen den unangenehmen Eintritt. Als Starlings Kordon sie aufgenommen hatte, wandte Chora den Blick ab, und Starling wusste, dass ihre Cousine es nicht riskieren wollte, Wehmut oder Rührung zu empfinden. Sie wollte es nicht riskieren, überhaupt etwas zu fühlen. So hatte sie Tausende von Jahren gelebt und nie älter ausgesehen oder sich älter gefühlt als ein Sterblicher in mittleren Jahren.
»Starling zählt die gefallenen Länder auf«, erklärte Kritias.
»Es spielt keine Rolle.« Albion setzte sich. Sein silbernes Haar war nass, sein feiner grauer Anzug zerrissen und schlammbespritzt.
»Eine Million Tote spielen keine Rolle?«, fragte Kritias. »Habt ihr auf eurem Weg hierher nicht die Zerstörung gesehen, die ihre Tränen angerichtet haben? Ihr habt immer gesagt, wir seien die Beschützer der Wachen Welt.«
»Was jetzt zählt, ist Atlas!«
Starling wandte den Blick ab, peinlich berührt von Albions Ausbruch, obwohl sie seinen Ärger teilte. Tausende von Jahren hatten die Saathüter sich bemüht, den Aufstieg eines Feindes zu verhindern, dem sie nie begegnet waren. Lange hatten sie unter den Plänen seines schrecklichen Verstandes gelitten.
Eingeschlossen in dem versunkenen Reich der Schlafenden Welt waren Atlas und sein Königreich weder gealtert noch gestorben. Wenn Atlantis auftauchte, würden seine Bewohner wieder ins Leben zurückgerufen werden und genauso sein, wie sie es beim Untergang ihrer Insel gewesen waren. Atlas würde zwanzig Jahre alt sein, ein starker Mann auf dem Höhepunkt seiner jugendlichen Kraft. Mit dem Aufstieg würde die Zeit für ihn von Neuem beginnen.
Er würde frei sein, um die Füllung fortzuführen.
Aber bis Atlantis auftauchte, regten sich in der Schlafenden Welt nichts als träumende, ränkeschmiedende, kranke Geister. Im Laufe der Zeit hatte Atlas’ Verstand viele dunkle Reisen in die Wache Welt unternommen. Wann immer ein Mädchen die Bedingungen des Tränenbrunnens erfüllte, begab Atlas’ Verstand sich in ihre Nähe und versuchte ihren Augen Tränen zu entlocken, um seine Herrschaft wiederherzustellen. Gerade steckte er in Brooks, einem Freund des Mädchens.
Die Saathüter waren die Einzigen, die Atlas erkannten, wenn er den Körper eines dem Tränenbrunnenmädchen nahestehenden Menschen in Besitz genommen hatte. Atlas hatte nie Erfolg gehabt – zum Teil, weil die Saathüter sechsunddreißig Tränenmädchen ermordet hatten, bevor Atlas sie hatte zum Weinen bringen können. Dennoch hatte jeder seiner Besuche seine einzigartige Bösartigkeit in die Wache Welt gebracht.
»Wir alle erinnern uns an die gleichen dunklen Geschehnisse«, sagte Albion. »Wenn Atlas’ Verstand in anderen Körpern schon so zerstörerisch gewesen ist, Kriege geführt und Unschuldige ermordet hat, stellt euch nur vor, wie es ist, wenn sein Geist und sein Körper in unserer Welt wieder wach und vereint sind. Stellt euch vor, wie es ist, wenn er mit der Füllung Erfolg hat.«
»Also«, erwiderte Kritias, »wo ist er? Worauf wartet er?«
»Ich weiß es nicht.« Albion hielt die Faust über das Feuer, bis der Geruch von brennendem Fleisch ihm sagte, dass er sie wegnehmen musste. »Wir waren alle da. Wir haben sie weinen sehen!«
Starling dachte an jenen Morgen zurück. Als Eurekas Tränen geflossen waren, war ihr Kummer endlos erschienen, als würde er nie versiegen. Es hatte den Eindruck gemacht, als würde jede vergossene Träne den Schaden an der Welt verzehnfachen …
»Wartet«, sagte sie. »Sobald die Bedingungen ihrer Prophezeiung erfüllt waren, mussten drei Tränen fließen.«
»Das Mädchen hatte einen richtigen Heulkrampf«, tat Albion ihre Überlegung ab. Niemand nahm Starling ernst. »Die drei erforderlichen Tränen sind ohne jeden Zweifel vergossen worden.«
»Und nicht nur die.« Chora schaute in den Regen.
Kritias kratzte sich die silbernen Bartstoppeln am Kinn. »Sind wir uns sicher?«
Es folgten eine Pause und ein Donnerschlag. Regen sprühte durch das Loch des Kordons.
»Eine Träne, um die Wache Welt zu zerschmettern.« Kritias sang leise die Zeile aus den Chroniken, überliefert durch ihren Vorvater Leander. »Das ist die Träne, die die Flut ausgelöst hat.«
»Eine zweite, um durch die Wurzeln der Erde zu sickern.« Starling konnte schmecken, wie sich der Meeresboden ausbreitete. Sie wusste, dass die zweite Träne vergossen worden war.
Aber was war mit der dritten, der wichtigsten Träne?
»Eine dritte, um die Schlafende Welt zu wecken und alte Königreiche wieder aufzurichten«, sagten vier Saathüter wie aus einem Mund. Das war die Träne, auf die es ankam. Das war die Träne, die Atlas zurückbringen würde.
Starling schaute die anderen an. »Ist die dritte Träne auf die Erde gefallen oder nicht?«
»Irgendetwas muss sie aufgefangen haben«, murmelte Albion. »Ihr Donnerstein, ihre Hände …«
»Ander.« Kritias fiel ihm ins Wort.
Albions Stimme klang schrill vor Nervosität. »Selbst wenn er daran gedacht hat, sie aufzufangen, würde er nicht wissen, was er damit tun muss.«
»Er gehört jetzt zu ihr, nicht zu uns«, warf Chora ein. »Falls die dritte Träne vergossen und aufgefangen wurde, kontrolliert der Junge ihr Schicksal. Ander weiß nicht, dass der Tränenbrunnen an den Mondzyklus geknüpft ist. Er wird nicht auf Atlas vorbereitet sein, der über Leichen gehen wird, um die dritte Träne vor dem nächsten Vollmond an sich zu bringen …«
»Starling«, unterbrach Albion sie scharf. »Wohin hat der Wind Ander und Eureka gebracht?«
Starling zog die Zunge ein, kaute und schluckte und rülpste dann leise. »Sie wird durch den Stein beschützt. Ich kann sie kaum schmecken, aber ich glaube, dass Ander nach Osten unterwegs ist.«
»Es ist klar, wohin er gegangen ist«, sagte Chora, »und nach wem er auf der Suche ist. Abgesehen von uns vieren kennt nur einer die Antworten, die Ander und Eureka finden wollen.«
Albion starrte finster ins Feuer. Als er ausatmete, loderte die Flamme hoch auf.
»Verzeiht mir.« Er atmete vorsichtig ein, um das Feuer zu zähmen. »Wenn ich an Solon denke …« Er bleckte die Zähne, unterdrückte etwas Hässliches. »Es geht mir gut.«
Starling hatte den Namen des verlorenen Saathüters seit vielen Jahren nicht mehr laut ausgesprochen gehört.
»Aber Solon ist verschwunden«, wandte sie ein. »Albion hat gesucht und konnte ihn nicht finden …«
»Vielleicht wird Ander gründlicher suchen«, meinte Kritias.
Albion packte Kritias im Genick, hob ihn von den Füßen und hielt ihn übers Feuer. »Denkst du, ich habe nicht nach Solon gesucht, seit er geflohen ist? Ich würde ein weiteres Jahrhundert altern, wenn ich ihn dafür finden könnte.«
Kritias trat um sich. Albion ließ ihn los. Sie richteten ihre Kleider.
»Beruhige dich, Albion«, bat Chora. »Verfalle nicht in alte Rivalitäten. Ander und Eureka müssen irgendwann hochkommen, um Luft zu holen. Starling wird feststellen, wo sie sich aufhalten.«
»Die Frage ist«, sagte Kritias, »ob Atlas ihr zuvorkommt? Im Körper von Brooks wird er Möglichkeiten haben, sie herauszulocken.«
Blitze zuckten um den Kordon. Wasser umspülte die Knöchel der Saathüter.
»Wir müssen einen Weg finden, die Situation auszunutzen.« Albion funkelte ins Feuer. »Nichts ist so mächtig wie ihre Tränen. Ander darf nicht im Besitz einer solchen Macht sein. Er ist nicht wie wir.«
»Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir wissen«, schlug Chora vor. »Wir wissen, dass Ander Eureka gesagt hat, alle Saathüter sterben, wenn ein Saathüter stirbt.«
Starling nickte; es war die Wahrheit.
»Wir wissen, dass er sie vor uns beschützt, indem er unsere Artemisia verwendet, der uns alle auslöschen würde, wenn einer von uns ihn einatmet.« Chora zupfte an den Lippen. »Eureka wird keine Artemisia benutzen. Sie liebt Ander zu sehr, um ihn zu töten.«
»Heute liebt sie ihn«, wandte Kritias ein. »Nichts ist so sprunghaft wie die Gefühle eines jungen Mädchens.«
»Sie liebt ihn.« Starling prüfte die Luft. »Die beiden sind verliebt. Ich schmecke es auf dem Wind um diesen Regen.«
»Gut«, sagte Chora.
»Wie kann Liebe gut sein?« Starling war überrascht.
»Man muss lieben, damit einem das Herz gebrochen werden kann. Liebeskummer verursacht Tränen.«
»Wenn noch eine weitere Träne auf die Erde trifft, taucht Atlantis auf«, stellte Starling fest.
»Aber was ist, wenn wir Eurekas Tränen in unseren Besitz bringen, bevor Atlas sie findet?« Chora ließ die anderen die Frage verdauen.
Ein Lächeln machte sich auf Albions Gesicht breit. »Atlas würde uns brauchen, um den Aufstieg zu vollenden.«
»Wir wären für ihn sehr wertvoll«, meinte Chora.
Starling schnippte etwas Schlamm von einer Falte an ihrem Kleid.
»Schlägst du vor, dass wir uns auf Atlas’ Seite stellen?«
»Ich glaube, Chora schlägt vor, dass wir den Bösen erpressen.« Kritias lachte.
»Nenn es, wie du willst«, sagte Chora. »Es ist ein Plan. Wir spüren Ander auf und nehmen alle Tränen in Besitz; vielleicht erzeugen wir weitere. Dann benutzen wir sie, um Atlas zu verführen, der uns für das große Geschenk seiner Freiheit wird danken müssen.«
Donner erschütterte die Erde. Schwarzer Rauch stieg aus dem Luftloch des Kordons auf.
»Du bist wahnsinnig«, sagte Kritias.
»Sie ist ein Genie«, sagte Albion.
»Ich habe Angst«, sagte Starling.
»Angst ist etwas für Verlierer.« Chora hockte sich hin und schürte das Feuer mit einem nassen Stock. »Wie viel Zeit ist noch bis zum Vollmond?«
»Zehn Nächte«, antwortete Starling.
»Zeit genug« – Albion grinste in die Ferne – »dass sich mit dem letzten Wort alles ändern kann.«
Kapitel 2
Landung
Die silberne Meeresoberfläche tanzte über Eurekas Kopf. Sie stieß sich mit schnellen Beinschlägen nach oben – der Drang, aus dem Wasser an die Luft zu kommen, war unwiderstehlich – aber sie bremste sich.
Dies war nicht die warme Vermilion Bay von zu Hause. Eureka schwamm in einer durchsichtigen Kugel in einem dunklen, chaotischen Meer am anderen Ende der Welt. Die Kugel und die Reise, die Eureka darin unternommen hatte, waren möglich wegen des Donnersteinanhängers, den sie um den Hals trug. Eureka hatte den Donnerstein geerbt, als Diana gestorben war, ihre Mutter, aber sie hatte seine Magie erst vor Kurzem entdeckt: Wenn sie die Kette unter Wasser trug, bildete sich um sie herum eine ballonförmige Kugel.
Der Grund, warum der Donnersteinschild sie jetzt umgab, verwirrte Eureka. Sie hatte genau das getan, was sie nicht tun sollte. Sie hatte geweint.
Sie war in dem Wissen aufgewachsen, dass Tränen verboten waren, ein Verrat Diana gegenüber, die Eureka beim letzten Mal, als sie geweint hatte, eine Ohrfeige verpasst hatte. Das war vor acht Jahren gewesen. Sie war neun Jahre alt gewesen und ihre Eltern hatten sich getrennt.
Du wirst nie, nie wieder weinen.
Aber Diana hatte ihr nicht gesagt, warum sie das nicht sollte.
Dann war sie gestorben und Eureka hatte sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Sie hatte entdeckt, dass ihre ungeweinten Tränen mit einer Welt verbunden waren, die unter dem Meer gefangen lag. Wenn diese Schlafende Welt sich erhob, würde sie die Wache Welt zerstören, ihre Welt, die sie zu lieben lernte.
Sie hatte nicht verhindern können, was als Nächstes geschehen war. Sie war in den Garten gegangen, wo sie William und Claire fand, ihre vierjährigen Zwillingsgeschwister, die von Monstern, die sich Saathüter nannten, geschlagen und geknebelt worden waren. Sie hatte mitansehen müssen, wie Rhoda, Dads zweite Frau, bei dem Versuch, die Zwillinge zu retten, gestorben war. Sie hatte Brooks, ihren ältesten Freund, an eine unermesslich dunkle Macht verloren.
Die Tränen waren gekommen. Eureka hatte geweint.
Es war eine Sintflut gewesen. Die Gewitterwolken am Himmel und der Bayou hinter ihrem Haus hatten in ihren Kummer eingestimmt und waren explodiert. Alles und jeder waren in einem wilden, neuen, salzigen Meer mitgerissen worden. Wundersamerweise hatte der Donnersteinschild auch das Leben der Menschen gerettet, die ihr am meisten bedeuteten.
Eureka betrachtete sie jetzt, wie sie unsicher neben ihr herstolperten. William und Claire in ihren gleichen Superman-Schlafanzügen. Trenton, ihr einst gut aussehender Vater mit seinem gebrochenen Herzen, das sich nach seiner Frau verzehrte, die vom Blitz getroffen wie ein Regentropfen aus Blut und Knochen vom Himmel gefallen war. Cat, Eurekas Freundin, die sie noch nie so ängstlich gesehen hatte. Und der Junge, der sich in der Nacht zuvor mit einem einzigen magischen Kuss vom Schwarm zum Vertrauten gewandelt hatte – Ander.
Eurekas Schild hatte sie vor dem Ertrinken gerettet, aber Ander war derjenige gewesen, der sie über das Meer zu einer versprochenen Zuflucht geführt hatte. Ander war ein Saathüter, aber er wollte keiner sein. Er hatte sich von seiner grausamen Familie abgewandt, hatte sich Eureka zugewandt und geschworen, ihr zu helfen. Als Saathüter war sein Atem, den man den Zephyr nannte, mächtiger als der stärkste Wind. Er hatte sie mit einer unmöglichen Geschwindigkeit über den Atlantik getrieben.
Eureka hatte keine Ahnung, wie lange die Reise gedauert hatte oder wie weit sie gekommen waren. In der Tiefe war das Meer gleichbleibend dunkel und kalt, und Cats Handy, das einzige im Schild, hatte vor einer Weile den Geist aufgegeben. Eurekas einzige Mittel, um die Zeit zu messen, waren die Fältchen in Cats Mundwinkeln, das Knurren von Dads Magen und Claires kauernder Tanz in der Hocke, was bedeutete, dass sie dringend mal musste.
Ander brachte den Schild kraulend näher an die Oberfläche heran. Eureka konnte es gar nicht erwarten, den Schild zu verlassen, doch sie hatte Angst vor dem, was sie auf der anderen Seite vorfinden würde. Die Welt hatte sich verändert. Ihre Tränen hatten sie verändert. Unter der Meeresoberfläche waren sie sicher. Darüber konnten sie ertrinken.
Eureka hielt still, als Ander ihr eine Haarsträhne aus der Stirn strich.
»Wir sind fast da«, sagte er.
Sie hatten bereits darüber gesprochen, wie sie an Land kommen würden. Ander erklärte, dass die Meeresbrandung trügerisch sein würde, daher musste genau geplant werden, wie sie ihre schützende Kugel verließen. Er hatte den Saathütern einen besonderen Anker gestohlen, mit dem sie an einem Stein festmachen würden – aber dann mussten sie die Grenzen des Schildes überwinden.
Claire war der Schlüssel. Während alle anderen mit ihrer Berührung auf steinähnlichen Widerstand trafen, glitten Claires Hände durch den Schild wie ein Irrlicht durch den Nebel. Sie wippte auf den Fersen, ließ die Hände über die Oberfläche des Schildes kreisen und malte mit den Fingern einen unsichtbaren Ausstieg. Sie ließ die Handgelenke durch den Schild gleiten, so wie Gespenster durch Türen griffen.
Ohne Claires Macht würde der Schild wie eine Blase platzen, wenn er an die Oberfläche stieg und mit der Luft in Kontakt kam. Alle, die sich darin befanden, würden wie Asche über dem Meer verstreut werden.
Also würde Claire, sobald Ander einen passenden Stein gefunden hatte, zu ihrem Wegbereiter werden. Ihre Hände würden durch den Schild stoßen und den Anker an dem Stein befestigen. Bis die anderen an Land waren, würde Claire in dieser Position verharren, die Arme halb innerhalb, halb außerhalb des Schildes, um den Durchgang offen zu halten und um zu verhindern, dass der Schild im Wind zersprang.
»Hab keine Angst, William«, sagte Claire zu ihrem Bruder, der neun Minuten älter war als sie. »Ich bin magisch.«
»Ich weiß.« William saß im Schneidersitz auf Cats Schoß und zupfte Fusseln von seinem Schlafanzug. Durch den durchscheinenden Boden des Schildes sah man die Trümmerlandschaft im Meer. Schwarze Algensträhnen klatschten wie zottelige Bärte gegen den Schild. Korallenäste schrammten daran entlang.
Cat legte William die Arme um die Schultern. Eurekas Freundin war klug und mutig – sie waren zusammen nach New Orleans getrampt, Cat nur bekleidet mit einem Bikinioberteil und abgeschnittenen Jeans, und sie hatte dreckige Seemannslieder gesungen, die ihr Dad ihr beigebracht hatte. Eureka wusste, dass Cat den Plan mit Claire für eine schlechte Idee hielt.
»Sie ist ein kleines Kind«, wandte Cat ein.
»Da.« Ander zeigte auf einen großen, mit Muscheln bedeckten Steinbrocken drei Meter über ihnen. »Der ist gut.«
Weiße Gischt funkelte unter seinen Spalten. Der Stein lag oberhalb des Wassers.
Eureka half Ander dabei, den Schild höher hinauf zu bringen. Das Wasser wechselte von Schwarz zu Dunkelgrau. Als sie sich dem Steinbrocken nicht weiter nähern konnten, ohne die Wasseroberfläche zu durchbrechen, umklammerte Eureka ihren Donnerstein und sandte ein Gebet an Diana, dass sie es sicher hinausschafften.
Obwohl nur Eureka den Schild errichten konnte, in dem sie reisten, konnte Ander ihn für eine Weile aufrecht halten. Er würde der Letzte sein, der ihn verließ.
Er betrachtete Eureka. Sie sah nach unten und fragte sich, wie sie in seinen Augen aussah. Die Intensität seines Blicks hatte sie nervös gemacht, als sie ihm auf der Straße vor New Iberia zum ersten Mal begegnet war. Dann hatte er ihr in der vergangenen Nacht erzählt, dass er sie jahrelang von klein auf beobachtet habe. Er hatte alles verraten, was man ihm über sie erzählt hatte. Er sagte, er liebe sie.
»Wenn wir über dem Meer sind«, sagte er, »werden wir schreckliche Dinge sehen. Du musst dich darauf vorbereiten.«
Eureka nickte. Sie hatte das Gewicht ihrer Tränen gespürt, als sie ihre Augen verlassen hatten. Sie wusste, dass ihre Flut furchtbarer war als jeder Albtraum. Was immer dort lauerte, sie war verantwortlich dafür, und sie hatte vor, Wiedergutmachung zu leisten.
Ander zog den Reißverschluss seines Rucksacks auf und nahm etwas heraus, das wie ein zwanzig Zentimeter langer Silberpflock aussah, an dessen oberem Ende ein Ring von der Größe eines Eherings saß. Ander legte einen Schalter um, worauf vier gebogene Haken unten aus dem Pflock herausklappten, und verwandelte ihn in einen Anker. Als er an dem Ring zog, kam oben eine feine Kette mit silbernen Ösen heraus.
Eureka berührte den seltsamen Anker und staunte über seine Leichtigkeit. Er wog weniger als ein halbes Pfund.
»Hübsch.« William berührte die funkelnden Haken des Ankers, die sich an den Rändern gabelten und eine schuppenartige gehämmerte Struktur hatten, die sie wie kleine Meerjungfrauenschwänze aussehen ließ.
»Er besteht aus Orichalcum«, erklärte Ander, »einer uralten Substanz, die in Atlantis gewonnen wurde, stärker als alles in der Wachen Welt. Als mein Vorfahr Leander Atlantis verließ, nahm er fünf Stücke Orichalcum mit. Meine Familie hat sie jahrtausendelang aufbewahrt.« Er klopfte auf seinen Rucksack und brachte ein geheimnisvolles, sexy Lächeln zustande. »Bis jetzt.«
»Gibt es noch mehr Spielzeuge?« Claire stellte sich auf die Zehenspitzen und schob eine Hand in den Rucksack.
Ander hob sie hoch und lächelte, als er den Reißverschluss seiner Tasche schloss. Er drückte Claire den Anker in die Hände. »Das hier ist sehr kostbar. Sobald der Anker den Felsen gefasst hat, musst du die Kette so fest halten, wie du nur kannst.«
Die Ösen aus Orichalcum klirrten in Claires Händen. »Ich werde gut festhalten.«
»Claire …« Eureka strich ihrer Schwester übers Haar; sie musste ihr klarmachen, dass dies kein Spiel war. Sie dachte an das, was Diana gesagt haben würde. »Ich glaube, du bist sehr mutig.«
Claire lächelte. »Mutig und magisch?«
Eureka kämpfte den seltsamen, neuen Drang, zu weinen, nieder. »Mutig und magisch.«
Ander hob Claire über den Kopf. Sie stellte die Füße auf seine Schultern und stieß eine Faust hoch, dann die andere, genau wie er es ihr gesagt hatte. Ihre Finger glitten durch den Donnersteinschild und sie schleuderte den Anker in Richtung des Felsens. Eureka beobachtete, wie er nach oben segelte und verschwand. Dann zog die Kette sich stramm, und der Schild zitterte wie ein Spinnennetz, das von einem Tropfen getroffen wurde. Aber er ließ kein Wasser herein und er zerbrach nicht.
Ander prüfte die Kette. »Perfekt.«
Er zog sie weiter in den Schild hinein und hob ihn dadurch näher an die Oberfläche. Als sie dicht unter den krachenden Wellen waren, rief Ander: »Los!«
Eureka packte die glatten, kalten Glieder der Kette. Sie griff an Claire vorbei und begann zu klettern.
Ihre Beweglichkeit überraschte sie. Adrenalin strömte durch ihre Arme wie ein Fluss. Als sie die Grenze des Schildes passierte, lag die Oberfläche des Meeres genau über ihr. Eureka begab sich in ihren Sturm.
Er war ohrenbetäubend. Er war alles. Er war eine Reise in ihr gebrochenes Herz. Jede Traurigkeit, jede Unze Zorn, die sie jemals verspürt hatte, manifestierten sich in diesem Regen. Er traf sie wie Kugeln aus tausend nutzlosen Kriegen. Sie biss die Zähne zusammen und schmeckte Salz.
Wind peitschte von Osten. Eurekas Finger rutschten ab, dann klammerte sie sich an die kalte Kette und griff nach dem Fels.
»Gut festhalten, Claire!«, versuchte sie ihrer Schwester zuzurufen, aber ihr Mund füllte sich mit Salzwasser. Sie drückte das Kinn tief auf die Brust und drängte mit einer nie gekannten Entschlossenheit weiter nach oben.
»Mehr hast du nicht drauf?«, rief sie gurgelnd durch den heftigen Schmerz.
Die Luft roch wie nach einem Blitzschlag. Eureka konnte jenseits der Sintflut nichts erkennen, aber vermutlich gab es außer Wasser nichts zu sehen. Wie schaffte Claire es, diesen kochenden Wellen standzuhalten? Eureka malte sich aus, wie sie die letzten Menschen, die sie liebte, ans Meer verlor, wie Fische an ihren Augen knabberten. Ihr schnürte sich die Kehle zu. Sie ließ entscheidende Zentimeter der Kette durch die Hände schlüpfen und stand bis zur Brust im Meer.
Irgendwie fanden ihre Finger den oberen Rand des Steins und hielten sich fest. Sie dachte an Brooks, ihren besten Freund, seit sie denken konnte, ihren Nachbarn aus Kindertagen, den Jungen, der sie in den vergangenen siebzehn Jahren dazu gebracht hatte, ein interessanterer Mensch zu werden. Wo war er? Das Letzte, was sie von ihm gesehen hatte, war ein beherzter Sprung ins Meer gewesen, nachdem die Zwillinge aus seinem Boot gefallen waren. Er war nicht er selbst gewesen. Er war … Eureka konnte nicht ertragen, was er gewesen war. Sie vermisste den alten Brooks. Fast konnte sie seinen Bayou-Akzent in ihrem gesunden Ohr hören und musste grinsen: Als würde man auf einen Pekannussbaum klettern, Tintenfisch.
Eureka stellte sich vor, dass der kalte, glitschige Stein ein einladender Zweig im Dämmerlicht war. Sie spuckte Salz aus. Sie schrie und kletterte.
Sie stemmte die Ellbogen auf den Fels. Sie schwang ein Knie darauf. Sie tastete hinter sich, um sich davon zu überzeugen, dass die rote Tasche mit dem Buch der Liebe – dem anderen Teil ihres Erbes von Diana – noch da war. Sie war es.
Eureka hatte einige Seiten des Buches von einer alten Frau namens Madame Blavatsky übersetzt bekommen. Madame B. hatte sich verhalten, als sei Eurekas Kummer voller Hoffnung und Versprechen. Vielleicht war es das, was Magie war – in die Dunkelheit zu schauen und ein Licht zu erblicken, das den meisten Menschen entging.
Jetzt war Madame Blavatsky tot, ermordet von Anders Tanten und Onkeln, den Saathütern, doch als Eureka sich das Buch unter den Arm klemmte, spürte sie, wie die Mystikerin sie anspornte, alles in Ordnung zu bringen.
Es regnete so stark, dass es schwer war, sich zu bewegen. Claire klammerte sich an die Kette und hielt den Schild für ihre kleine Gruppe durchdringbar. Eureka warf sich auf den Felsen.
Vor ihr erstreckten sich Berge, umgeben von einem schimmernden Nebel. Ihre Knie rutschten auf dem Felsen aus, als sie sich umdrehte und den Arm in das aufgewühlte Meer stieß. Sie tastete nach Williams Hand. Ander sollte ihn zu ihr heraufheben.
Kleine Finger fühlten und fassten dann nach Eurekas Hand. Der Griff ihres Bruders war überraschend fest. Sie zog, bis sie unter seine Arme greifen und ihn über die Wasseroberfläche ziehen konnte. William blinzelte und versuchte, in dem Sturm etwas zu sehen. Eureka beugte sich über ihn; sie musste ihn vor der Brutalität ihrer Tränen schützen, obwohl sie wusste, dass es kein Entrinnen gab.
Cat kam als Nächste. Sie schwang sich praktisch aus dem Wasser und in Eurekas Arme hinein. Als sie auf den Felsen glitt, stieß sie ein Freudengeheul aus und umarmte William und Eureka.
»Die Katze überlebt!«
Dad heraufzuholen, war wie eine Exhumierung. Er bewegte sich langsam, als verlange das Hochziehen eine Kraft, die er nie zu besitzen gehofft hatte, obwohl Eureka ihn über die Ziellinie dreier Marathons angefeuert hatte und er beim Bankdrücken daheim in der stickig heißen Garage sein eigenes Gewicht stemmte.
Schließlich erhob sich Claire in Anders Armen über die Wellen. Sie hielten die Orichalcum-Kette fest. Der Wind peitschte an ihnen vorbei. Der Schild um sie schimmerte bis zu dem Moment, als Claires Zehen aus ihm herausglitten. Dann zerstob er zu Nebel und verschwand. Eureka und Cat zogen Ander und Claire auf den Felsen hinauf.
Regentropfen prallten von Eurekas Donnerstein ab und spritzten an die Unterseite ihres Kinns. Wasser sprühte von den Wellen empor und vom Himmel herab. Der Fels, auf dem sie standen, war schmal, rutschig und fiel steil ins Meer ab, aber zumindest hatten sie es alle an Land geschafft. Jetzt brauchten sie Schutz.
»Wo sind wir?«, rief William.
»Ich glaube, das ist der Mond«, meinte Claire.
»Auf dem Mond regnet es nicht«, widersprach William.
»Geht weiter nach oben«, rief Ander, während er den Anker von dem Felsen losmachte und auf den Schalter drückte, um die Haken wieder einzuziehen, dann schob er ihn zurück in seinen Rucksack. Er zeigte landeinwärts, wo sich das dunkle Versprechen eines Berges erhob. Cat und Dad nahmen jeder einen der Zwillinge. Eureka sah ihrer Familie nach, die über die Steine rutschte und schlitterte. Bei ihrem Anblick, wie sie stolperten und einander aufhalfen, während sie sich einer Zuflucht näherten, von deren Existenz sie nichts wussten, hasste Eureka sich selbst. Sie hatte ihnen – und dem Rest der Welt – dies eingebrockt.
»Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist?«, rief sie Ander zu, noch während sie bemerkte, dass der Fels, auf dem sie gelandet waren, wie eine kleine Halbinsel in das Meer hinausragte. In jeder anderen Richtung war weißes Wasser. Es erstreckte sich endlos, ohne Horizont.
Für einen Moment ließ sie den Blick über das Meer treiben. Sie lauschte auf das Klingeln in ihrem linken Ohr, taub seit dem Autounfall, bei dem Diana ums Leben gekommen war. Dies war ihre Depressionshaltung: geradeaus zu schauen, ohne etwas zu sehen, und auf das einsame, endlose Klingeln zu lauschen. Nach Dianas Tod hatte Eureka ganze Monate so verbracht. Brooks war der Einzige gewesen, der sie in diese Trauertrancen fallen ließ und sie sanft aufzog, wenn sie durch war: Du bist eine Nachtclubnummer ohne Nachtclub.
Eureka wischte sich Regen vom Gesicht. Sie konnte sich den Luxus von Traurigkeit nicht mehr leisten. Ander hatte gesagt, sie könne die Flut aufhalten. Sie würde es tun oder bei dem Versuch draufgehen. Sie fragte sich, wie viel Zeit ihr blieb.
»Wie lange regnet es schon?«
»Erst seit einem Tag. Gestern Morgen waren wir zu Hause in deinem Garten.«
Noch vor einem Tag hatte sie keine Ahnung gehabt, wozu ihre Tränen in der Lage waren. Sie sah konzentriert aufs Meer, aufgewühlt vom Regen eines einzigen Tages. Dann beugte sie sich vor, kniff die Augen zusammen und betrachtete etwas, das auf den Wellen hüpfte.
Es war ein menschlicher Kopf.
Eureka hatte gewusst, dass ihr über der Wasseroberfläche schreckliche Dinge drohten. Trotzdem, zu sehen, was ihre Tränen angerichtet hatten, dieses zerstörte Leben … sie war noch nicht bereit. Aber dann …
Der Kopf bewegte sich, von einer Seite zur anderen. Ein braun gebrannter Arm streckte sich aus dem Wasser. Jemand schwamm. Der Kopf drehte sich in Eurekas Richtung, holte Luft und verschwand. Dann tauchte er wieder auf, dicht gefolgt von einem Körper, der die Wellen ritt.
Eureka kannte diesen Arm, diese Schultern, diesen dunklen, nassen Haarschopf. Seit sie klein waren, hatte sie Brooks zugesehen, wie er zu den Wellenbrechern schwamm.
Alle Vernunft löste sich in Luft auf; Erstaunen siegte. Sie legte die Hände um den Mund, aber bevor Brooks’ Name ihren Lippen entfuhr, beugte Ander sich dicht zu ihr.
»Wir müssen gehen.«
Sie drehte sich zu ihm um, überschäumend von der gleichen unbändigen Aufregung, die sie immer erlebt hatte, wenn sie als Erste die Ziellinie überquerte. Sie zeigte auf das Wasser …
Brooks war fort.
»Nein«, flüsterte sie. Komm zurück.
Dumm. Sie hatte sich so sehr gewünscht, ihren Freund zu sehen, dass ihre Einbildung ihn in die Wellen gemalt hatte.
»Ich dachte, ich hätte ihn gesehen«, flüsterte sie. »Ich weiß, dass das unmöglich ist, aber er war da.« Sie streckte schwach die Hand nach der Stelle aus. Sie wusste, wie sie sich anhörte.
Anders Blicke folgten ihren zu dem dunklen Ort in den Wellen, wo Brooks gewesen war. »Lass ihn los, Eureka.«
Als sie zusammenzuckte, wurde seine Stimme weicher. »Wir sollten uns beeilen. Meine Familie wird nach uns suchen.«
»Wir haben ein Meer überquert. Wie sollen sie uns hier finden?«
»Meine Tante Starling kann uns im Wind schmecken. Wir müssen es zu Solons Höhle schaffen, bevor sie uns entdecken.«
»Aber …« Sie suchte das Wasser nach ihrem Freund ab.
»Brooks ist weg. Verstehst du das?«
»Ich verstehe, dass es für dich bequemer ist, wenn ich ihn loslasse«, sagte Eureka. Sie drehte sich um und folgte den Umrissen von Cat und ihrer Familie im Regen.
Ander holte sie ein und versperrte ihr den Weg. »Deine Schwäche für ihn ist für mehr Leute als mich unbequem. Menschen werden sterben. Die Welt …«
»Menschen werden sterben, wenn ich meinen besten Freund vermisse?«
Sie sehnte sich danach, in der Zeit zurückzureisen, in ihrem Zimmer zu sein und die nackten Füße an den Bettpfosten zu lehnen. Sie wollte den Feigenduft der Kerze auf ihrem Schreibtisch riechen, die sie immer nach dem Joggen anzündete. Sie wollte Brooks eine SMS über die merkwürdigen Flecken auf der Krawatte ihres Lateinlehrers schicken und sich über eine gemeine Bemerkung von Maya Caise aufregen. Ihr war nie bewusst gewesen, wie glücklich sie früher war, was für ein Luxus ihre Depression gewesen war.
»Du bist in ihn verliebt«, bemerkte Ander.
Sie schob sich an ihm vorbei. Brooks war ihr Freund. Ander hatte keinen Grund, eifersüchtig zu sein.
»Eureka …«
»Du hast gesagt, dass wir uns beeilen sollen.«
»Ich weiß, dass es schwer ist.«
Das ließ sie innehalten. Schwer war das Wort, mit dem Leute, die Eureka nicht kannten, früher von Dianas Tod gesprochen hatten. Es weckte in ihr den Wunsch, das Wort auszulöschen. Eine Prüfung in Biochemie war schwer. Eine tolle Klatschgeschichte für sich zu behalten, war schwer. Einen Marathon zu laufen, war schwer.
Jemanden loszulassen, den man liebte, war nicht schwer. Es gab kein Wort dafür, was es war, denn selbst wenn man ihn nicht losließ, war er trotzdem tot. Eureka ließ den Kopf hängen und spürte, wie ihr Regentropfen von der Nasenspitze glitten. Ander konnte noch nie einen so großen Verlust erlitten haben. Sonst hätte er nicht so gesprochen.
»Du verstehst es nicht.«
Sie hatte ihn damit davonkommen lassen wollen, aber sobald es heraus war, hörte Eureka, wie schroff es klang. Sie hatte das Gefühl, als existierten keine Worte mehr; sie waren alle so unzureichend und armselig.
Ander drehte sich zum Wasser um und stieß einen verärgerten Seufzer aus. Eureka sah deutlich, wie der Zephyr Anders Lippen verließ und ins Meer hineinfuhr. Er baute eine riesige Welle auf, die sich über Eureka wölbte.
Sie sah aus wie die Welle, die Diana getötet hatte.
Eureka fing Anders Blick auf und sah Schuld seine Augen weiten. Er sog scharf die Luft ein, als wolle er es zurücknehmen. Als ihm klar wurde, dass er das nicht konnte, sprang er auf sie zu.
Für einen Moment berührten sich ihre Fingerspitzen. Dann glitt die Welle über sie hinweg und rollte an Land. Eureka wurde fortgerissen und wirbelte von Ander weg in die aufgepeitschte See.
Wasser schoss ihr in die Nase, krachte ihr gegen den Schädel, warf ihr Haar von einer Seite zur anderen. Sie schmeckte Blut und Salz. Das gurgelnde Stöhnen, das aus ihrem Mund kam, war ihr fremd. Als das Wasser unter ihr wegbrach, fiel sie aus der Welle. Für einen Moment lief sie auf einem Pfad aus Himmel. Sie konnte nichts sehen. Sie dachte, sie müsse sterben. Sie schrie nach ihrer Familie, nach Cat, nach Ander.
Als sie auf dem Felsen landete, sagte ihr nur das Echo ihrer Stimme in dem kalten, unablässigen Regen, dass sie lächerlicherweise immer noch am Leben war.
Kapitel 3
Der verlorene Saathüter
Im zentralen Gewölbe seiner unterirdischen Grotte nahm Solon einen Schluck teerdicken türkischen Kaffee und runzelte die Stirn.
»Er ist kalt.«
Filiz, seine Assistentin, griff nach dem Keramikbecher. Ihre Mutter hatte ihn für Solon auf ihrer Scheibe getöpfert, hatte ihn in ihrem Brennofen zwei Höhlen weiter östlich gebrannt. Der Becher war zweieinhalb Zentimeter dick und eigens dazu gemacht, in Solons poröser Travertinhöhle, in der es beständig kalt bis auf die Knochen war, die Hitze länger zu halten.
Filiz war sechzehn, mit gewelltem, ungebändigtem Haar, das sie in einem feurigen Orangeton färbte, und Augen von der Farbe einer Kokosnussschale. Sie trug ein enges, leuchtend hellblaues T-Shirt, schwarze Jeans und einen Choker, der mit kurzen Silberstacheln besetzt war.
»Als ich ihn vor einer Stunde aufgebrüht habe, war er heiß.« Filiz arbeitete seit zwei Jahren für den exzentrischen Einsiedler und hatte gelernt, mit seinen Launen umzugehen. »Das Feuer brennt noch. Ich werde neuen machen …«
»Spar dir die Mühe!« Solon warf den Kopf in den Nacken und kippte den Kaffee herunter. Er würgte melodramatisch und wischte sich mit einem bleichen Arm über den Mund. »Dein Kaffee ist kaum schlechter, wenn er kalt ist, als würde man von Alcatraz nach Sibirien verlegt werden.«
Hinter Solon lachte Basil in sich hinein. Solons zweiter Assistent war neunzehn, groß und dunkel, mit glattem schwarzem Haar, das er in einem Pferdeschwanz trug, und einem schelmischen Funkeln in den Augen. Basil war nicht wie die anderen Jungen in ihrer Gemeinschaft. Er hörte alte Country-Musik, keine Electronica. Er vergötterte den Graffiti-Künstler Banksy und hatte mehrere der nahen Felsformationen mit farbenprächtig verzerrten Superhelden bemalt. Er dachte, er hätte die Graffiti anonym geschaffen, aber Filiz wusste, dass er der Künstler war. Er gab gern mit seinem Englisch an, indem er in Sprichwörtern redete, aber er übersetzte sie nie richtig. Solon hatte sich angewöhnt, ihn den »Dichter« zu nennen.
»Du kannst ein Pferd zur Tränke führen, aber dein Kaffee schmeckt echt scheiße«, sagte der Dichter und kicherte in Filiz’ wütende Augen.
Der Dichter und Filiz sahen älter aus als ihr Boss, dessen blasses und fein geschnittenes Gesicht glatt wie das eines Kindes war. Solon wirkte wie fünfzehn, war aber weitaus älter. Er hatte sengende blaue Augen und kurz geschorenes blondes Haar, das mit einem schwarzbraunen Leopardenmuster gefärbt war. Er stand über einem silbernen Roboter, der auf einem langen Holztisch lag.
Der Roboter hieß Ovid. Er war einsachtzig groß und hatte beneidenswert menschliche Proportionen, ein schönes Gesicht und den leeren Blick einer griechischen Statue. Filiz hatte noch nie etwas wie ihn gesehen, und sie hatte keine Ahnung, woher er kam. Er bestand ganz aus Orichalcum, einem Metall, von dem weder der Dichter noch Filiz zuvor gehört hatten, von dem Solon jedoch behauptete, es sei unbezahlbar und selten.
Ovid war kaputt. Solon verbrachte lange Tage mit dem Versuch, ihn wiederzubeleben, wollte aber Filiz nicht sagen, warum. Solon war voller Geheimnisse, die sich an der Grenze zwischen Magie und Lüge bewegten. Seine Verrücktheit war von der Sorte, die das Leben interessant machte – und gefährlich.
In den fünfundsiebzig Jahren seit seiner Ankunft in der entlegenen türkischen Gemeinschaft hatte Solon nur selten das gewaltige Labyrinth schmaler Gänge verlassen, die in die Höhle, von ihm die Bittere Höhle genannt, führten. Im unteren Stockwerk der Grotte hatte er eine Werkstatt. Von dort führte eine Wendeltreppe zum Wohnbereich – seinem Salon – und dann über eine weitere Treppenflucht zu einer kleinen Veranda. Sie bot einen Panoramablick auf eine Gruppe kegelförmiger Felsen, die die Dächer der Höhlen von Solons Nachbarn bildeten.
Das Magischste in der Bitteren Wolke war Solons Wasserfall. Er stürzte über fünfzehn Meter in die Tiefe, überspannte zwei hohe Stockwerke und nahm die Rückwand der Höhle ein. Sein salziges Wasser war taubenweiß und donnerte unablässig, ein Geräusch, das Filiz noch im Ohr hatte, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam. Auf dem Gipfel des Wasserfalls klammerte sich eine pinkfarbene Orchidee an den steinernen Vorsprung und zitterte in der Strömung. Am Fuß des Wasserfalls grenzte ein dunkelblauer Teich an Solons Werkstatt. Der Dichter hatte Filiz erzählt, dass ein langer Kanal den Teich mit dem Meer verband, das Hunderte von Kilometern entfernt war. Filiz sehnte sich danach, ein Bad in dem Teich zu nehmen, war aber klug genug, nicht um Erlaubnis zu bitten. So vieles war in der Bitteren Wolke verboten.
Türkische Teppiche hingen über kleinen Nischen im Salon und teilten zwei Schlafzimmer und eine Küche ab. Kerzen flackerten auf Kronleuchtern aus Stalagmiten und bildeten mit ihren Tropfen klebrige Wachsberge. Totenschädel säumten die Wände in kunstvollen Zickzackmustern. Solon hatte jeden Schädel sorgfältig in seiner Grinse-Galerie positioniert und sie nach Größe, Form, Farbe und vermuteter Persönlichkeit ausgewählt.
Solon war außerdem der Schöpfer eines gewaltigen Fußbodenmosaiks, das die Vereinigung von Tod und Liebe darstellte. In den meisten Nächten, nachdem er einmal mehr seine Arbeit an Ovid aufgegeben hatte, durchsuchte er einen Haufen spitzer Steine nach der richtigen Schattierung eines durchscheinenden Blaus für Amors Hochzeitsschleier oder das richtige Rot für die bluttriefenden Reißzähne des Todes.
Filiz spezialisierte sich darauf, diese rostroten Steine an nahen Bachufern zu finden. Wann immer sie Solon einen akzeptablen Stein brachte, erlaubte er Filiz, einige Momente durch den geheimen Schmetterlingsflur hinter seinem Schlafzimmer zu gehen. Eine heiße Quelle sprudelte darin, sodass der Flur ein natürliches Dampfbad war. Millionen geflügelter Insekten irrten durch die feuchte Kammer und gaben Filiz das Gefühl, als befände sie sich in einem Gemälde von Jackson Pollock.
»Wisst ihr, wo es echten Kaffee gibt?«, fragte Solon, während er in einem zerbeulten Werkzeugkasten wühlte.
»In Deutschland«, antworteten Filiz und der Dichter und verdrehten die Augen. Solon verglich alles mit Deutschland. Es war das Land, in dem er alt und verliebt gewesen war.
Solon wurde wie alle Saathüter von einem uralten Fluch verfolgt: Liebe entzog ihm das Leben und ließ ihn rapide altern. Dieses Wissen hatte ihn nicht daran gehindert, sich vor sechsundsiebzig Jahren verzweifelt in ein schönes deutsches Mädchen namens Byblis zu verlieben. Nichts hätte das verhindern können, wie Solon Filiz oft gesagt hatte; es war sein Schicksal. Er war um zehn Jahre gealtert, als er sich zu ihrem ersten Kuss vorgebeugt hatte.
Byblis war ein Tränenbrunnenmädchen und sie war dafür gestorben. Ihr Tod hatte Solon so schnell wieder verjüngt, wie ihre Liebe ihn hatte altern lassen. Ohne Byblis war er zu ewiger Kindheit zurückgekehrt, indem er seine Gefühle vollständiger ausblendete, als es je ein Saathüter getan hatte. Filiz hatte ihn dabei erwischt, wie er sein Spiegelbild in dem Teich am Grund seiner Grotte bewundert hatte. Solons Gesicht verströmte jugendliche Schönheit, aber sie war porentief, ohne eine Andeutung von Seele.
Solon stieß die Hand in Ovids Schädel und tastete die Ränder des Orichalcum-Gehirns ab. »Ich erinnere mich nicht, ob ich jemals diese beiden Kreisläufe hier eingeschaltet habe …«
»Das hast du letzte Woche versucht«, rief der Dichter ihm ins Gedächtnis. »Große Geister denken gleich.«
»Nein, du irrst dich.« Solon klemmte sich eine Zange zwischen die Zähne. »Das waren andere Drähte«, erwiderte er und schaltete sie ein.
Dem Roboter sprang der Kopf von den Schultern und flog in die dunkle Wildnis ans andere Ende der Höhle. Für einen Moment lauschten Solon und seine Assistenten dem Tropfen eines Stalaktiten auf die immer offenen Augen Ovids.
Dann erklang das Windspiel, das als Türglocke diente. Seine flachen Seilrollen und die dreieckigen Zahnräder, die sie verbanden, zuckten an der Höhlendecke vor und zurück.
»Lasst sie nicht hier herein«, sagte Solon. »Findet heraus, was sie wollen, und schickt sie dann weit weg.«
Filiz schaffte es nicht bis zur Tür. Sie hörte das verräterische Summen, dann Solons Fluch. Die Tratschhexen hatten sich selbst Einlass verschafft.
Heute waren es drei: eine sah aus wie sechzig, die nächste wie hundert, die dritte nicht älter als siebzehn. Sie trugen bodenlange Kaftane aus amethystfarbenen Orchideenblättern, die raschelten, als sie im Gänsemarsch Solons Wendeltreppe hinunterstiegen. Ihre Lippen und Augenlider waren passend zu ihren Gewändern geschminkt. In ihren Ohren steckten vom Ohrläppchen bis zur Spitze hauchdünne Silberringe. Die Hexen waren barfuß und hatten lange, schöne Zehen. Ihre Zungen waren leicht gegabelt. Eine Bienenwolke schwärmte jeder Hexe über den Schultern und umkreiste ständig ihre Köpfe – deren Rückseiten man niemals sah.
In den Bergen um Solons Höhle lebten zwei Dutzend Tratschhexen. Sie reisten immer in Gruppen zu dritt oder zu einem Vielfachen von drei. Sie betraten einen Raum stets vorwärts im Gänsemarsch, aber aus irgendeinem Grund verließen sie ihn, indem sie rückwärts flogen. Jede einzelne besaß eine fesselnde Schönheit, aber die jüngste war außerordentlich. Ihr Name war Esme, obwohl nur eine andere Tratschhexe eine Tratschhexe mit Namen ansprechen durfte. Sie trug einen glänzenden Kristalltropfen an einer Kette um den Hals.
Esme lächelte verführerisch. »Ich hoffe, wir haben bei nichts Wichtigem gestört.«
Solon betrachtete die Spiegelung des Kerzenlichts auf der Kette der jungen Hexe. Er war größer als die meisten Tratschhexen, aber Esme hatte ihm etliche Zentimeter voraus. »Ich habe euch gestern drei Libellen geschenkt. Das erkauft mir mindestens einen Tag, ohne dass ihr mich verfolgt.«
Die Hexen zogen die fein geschwungenen Augenbrauen hoch. Ihre Bienen umschwärmten sie in emsigen Kreisen.
»Wir sind gegenwärtig nicht hier, um zu sammeln«, sagte die älteste der drei. Die Falten auf ihrem Gesicht waren faszinierend, hübsch, wie eine von einem starken Wind geformte Sanddüne.
»Wir bringen Neuigkeiten«, fügte Esme hinzu. »Das Mädchen wird in Kürze eintreffen.«
»Aber es regnet nicht einmal …«
»Woher will ein eremitischer Furzhammer wie du das wissen?«, zischte die mittlere Hexe.
Ein Spritzer Meereswasser schoss aus dem Teich des Wasserfalls und durchweichte den Dichter, prallte aber von Solons Saathüterhaut ab.
»Wie lang wird es dauern, bis du sie vorbereitet hast?«, wollte Esme wissen.
»Ich bin dem Mädchen nie begegnet.« Solon zuckte die Achseln. »Selbst wenn es nicht so dumm ist, wie ich vermute, brauchen diese Dinge Zeit.«
»Solon.« Esme befingerte das Amulett an ihrer Kette. »Wir wollen nach Hause.«
»Das ist kristallklar«, antwortete Solon. »Aber die Reise in die Schlafende Welt ist derzeit unmöglich.« Er hielt inne. »Weißt du, wie viele Tränen vergossen wurden?«
»Wir wissen, dass Atlas und die Füllung nah sind.« Esmes gegabelte Zunge zischte.
Was war die Füllung? Filiz sah Solon schaudern.
»Als wir dein Heim glasiert haben, hast du versprochen, dass es sich für uns lohnen würde«, rief die älteste Hexe Solon ins Gedächtnis. »All diese Jahre haben wir dich vor den Augen deiner Familie verborgen gehalten …«
»Und ich bezahle euch für diesen Schutz! Erst gestern waren es drei Libellen.«
Filiz hörte Solon etwas darüber brummeln, in der Schuld dieser Bestien zu stehen. Er hasste es, ihren unablässigen Bitten um Flügelwesen aus seinem Schmetterlingsflur nachzukommen. Aber er hatte keine Wahl. Die Glasur der Hexen machte die Luft um Solons Höhle für die Sinne nicht wahrnehmbar. Ohne sie würden die anderen Saathüter seinen Aufenthaltsort durch den Wind feststellen. Sie würden den Bruder jagen, der sie verraten hatte, indem er sich in ein Tränenmädchen verliebte.
Was machten die Hexen mit den flatternden Libellen, den Monarchfaltern und den gelegentlichen Himmelsfaltern, die Solon ihnen in kleinen Schraubgläsern überreichte? Den hungrigen Augen der Tratschhexen nach zu urteilen, wenn sie die Gläser an sich rissen und in die langen Taschen ihrer Kaftane gleiten ließen, war es etwas Schreckliches, wie Filiz vermutete.
»Solon.« Esme hatte eine Art, zu sprechen, die es so klingen ließ, als sei sie gleichzeitig eine Galaxie entfernt und in Filiz’ Gehirn. »Wir werden nicht ewig warten.«
»Denkt ihr, diese Besuche beschleunigen den Prozess? Überlasst mich meiner Arbeit.«
Automatisch schauten alle zu dem kopflosen Ovid, der mit den Drähten, die ihm aus dem Hals ragten, einen jämmerlichen Anblick bot.
»Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, Solon«, flüsterte Esme und zog etwas aus der Tasche ihres Kaftans. Sie legte eine kleine Blechdose auf den Boden. »Wir haben dir etwas Honig mitgebracht, Süßer. Gehab dich wohl.«
Die Hexen feixten, als sie die Arme hinter den Kopf streckten, die Füße vom Boden hoben und rückwärts flogen, den Wasserfall hinauf und aus der feuchten, dunklen Höhle hinaus.
»Glaubst du ihnen?«, fragte Filiz Solon, als sie und der Dichter den Kopf des Roboters zu dessen Körper legten. »Wegen des Mädchens, das auf dem Weg hierher ist? Du hast das letzte Tränenmädchen gekannt. Wir haben ja nur die Geschichten gehört, aber du …«
»Sprich niemals von Byblis«, unterbrach Solon sie und wandte sich ab.
»Solon«, bedrängte Filiz ihn, »glaubst du den Hexen?«
»Ich glaube gar nichts.« Solon machte sich daran, Ovids Kopf wieder zu befestigen.
Filiz seufzte und beobachtete, wie Solon so tat, als vergesse er, dass es sie gab. Dann schlich sie nach oben zum Eingang der Höhle. Auf ihrem Weg zur Arbeit hatte der Himmel eine seltsam silbrige Farbe gehabt, die sie an ein wildes Fohlen erinnert hatte, das sie früher oft in den Bergen gesehen hatte. Es war frisch draußen gewesen und sie war schnell gegangen und hatte sich die Arme gerieben. Sie war nervös gewesen und hatte sich allein gefühlt.
Als sie jetzt aus der Höhle trat, fiel ein großer Schatten über sie. Eine gewaltige Sturmwolke beherrschte den Himmel wie ein riesiges schwarzes Ei kurz vor dem Zerbrechen. Filiz spürte, wie ihr Haar sich zu kräuseln begann, und dann …
Ein Regentropfen fiel auf ihren Handrücken. Sie betrachtete ihn. Sie kostete ihn.
Salzig.
Es war wahr. Ihr Leben lang hatten die Älteren sie vor diesem Tag gewarnt. Ihre Vorfahren hatten in diesen Berghöhlen gelebt, seit die großen Fluten sich vor Jahrtausenden zurückgezogen hatten. Ihre Leute besaßen eine trübe kollektive Erinnerung an Atlantis – und eine tief verwurzelte Furcht, dass eines Tages eine weitere Flut kommen würde. Würde es jetzt wirklich geschehen, bevor Filiz auf dem Eiffelturm gewesen war oder gelernt hatte, mit manueller Gangschaltung zu fahren, oder etwas Liebesähnliches empfunden hatte?
Ihr Schuh zertrat ihr Spiegelbild in einer Pfütze, und sie wünschte, sie würde das Mädchen, das diesen Regen gemacht hatte, zertreten.
»Wo liegt dein Problem, Fusselbirne?« Die Stimme der mittleren Tratschhexe war unverkennbar. Ihre gegabelte Zunge flackerte, während die Hexen über Filiz in der Luft hingen.
Filiz hatte nie verstanden, wie die flügellosen Hexen flogen. Die drei schwebten mit schlaff herabhängenden Armen im Regen und machten keinerlei sichtbare Anstrengung, oben zu bleiben. Sie sah, wie sich Tröpfchen salzigen Wassers wie Diamanten auf Esmes schwarz glänzendem Haar absetzten.
Filiz fuhr sich durch ihr eigenes Haar, dann bereute sie es. Sie wollte nicht, dass die Hexen dachten, sie lege Wert auf ihr Aussehen. »Dieser Regen wird uns umbringen, nicht wahr? Unsere Brunnen vergiften, unsere Ernten vernichten …«
»Woher sollen wir das wissen, Kind?«, fragte die älteste Hexe.
»Was werden wir trinken?«, fragte Filiz. »Stimmt es, was man sagt, dass ihr einen unendlichen Vorrat an Süßwasser habt? Man nennt ihn …«
»Unser Glimmering ist nicht zum Trinken, und er ist sicher nicht für dich«, unterbrach Esme sie.
»Sind die Tränen des Mädchens wirklich so mächtig, wie behauptet wird?«, fragte Filiz. »Und … was habt ihr damit gemeint, als ihr Atlas und seine Füllung erwähnt habt?«
Die schönen, bunten Kaftane der Hexen bildeten einen Kontrast zu der riesigen Wolke über ihnen. Sie sahen einander mit amethystfarben geschminkten Augen an.
»Sie denkt, wir wüssten alles«, stellte die älteste Hexe fest. »Ich frage mich, warum …«
»Weil«, sagte Filiz nervös, »ihr Prophetinnen seid.«
»Es ist Solons Aufgabe, sie vorzubereiten«, erwiderte die Älteste. »Geh mit deiner Angst vor der Sterblichkeit zu ihm. Wenn er das Mädchen nicht vorbereiten kann, schuldet dein Boss uns seine Höhle, seinen Besitz und all diese hübschen kleinen Schmetterlinge …«
»Solon wird uns sein Leben schulden.« Esmes Augen verdunkelten sich, und mit einer plötzlich Furcht einflößenden Stimme fügte sie hinzu: »Er wird uns sogar seinen Tod schulden.«
Das Gelächter der Hexen hallte über die Berge, als sie rückwärtsschwebten und in dem stärker werdenden Regen verschwanden.
Kapitel 4
Neues Blut
Regen nagelte Eureka an den Felsvorsprung. Sie war auf ihrem lädierten Handgelenk gelandet. Das sie sich bei dem Unfall gebrochen hatte, bei dem Diana ums Leben gekommen war. Es schwoll bereits an. Der Schmerz war vertraut; sie wusste, dass sie es sich erneut gebrochen hatte. Sie kämpfte sich auf die Knie, während der Rest der Welle über sie zurückströmte.
Ein Schatten fiel auf sie. Der Regen schien nachzulassen.
Ander war bei ihr. Mit einer Hand umfasste er ihren Hinterkopf; mit der anderen strich er ihr über die Wange. Seine Wärme machte es Eureka schwer, zu Atem zu kommen. Seine Brust berührte ihre. Sie spürte seinen Herzschlag. Seine Augen waren von einem so leuchtenden Blau, dass sie sich vorstellte, sie würden türkisfarbenes Licht auf ihre Haut werfen und sie aussehen lassen wie einen versunkenen Schatz. Ihre Lippen waren nur Zentimeter voneinander entfernt.
»Bist du verletzt?«
»Ja«, flüsterte sie, »aber das ist nichts Neues.«
Ander hatte sich dicht an sie geschmiegt, so dass kein Regen auf Eureka fiel. Schwere Wassertropfen sammelten sich über ihnen in der Luft, und sie begriff, dass sein Kordon sie bedeckte. Sie hob die Hand und berührte ihn. Er fühlte sich glatt und leicht an, etwas schwammartig. Er schien da und doch nicht da zu sein, wie der Duft von nachtblühendem Jasmin, wenn man im Frühling um die Ecke bog. Regentropfen glitten an den Seiten des Kordons hinab. Eureka schaute Ander in die Augen und lauschte auf den Regen, der überall auf die Erde fiel, nur nicht auf sie. Ander war die Zuflucht; sie war der Sturm.
»Wo sind die anderen?«, fragte sie.
Bilder der ins Meer gerissenen Zwillinge schossen Eureka in den Kopf. Sie sprang auf und trat aus Anders Kordon. Regen strömte ihr übers Gesicht und tropfte von ihren Ärmeln auf die Schuhe.
»Dad!«, rief sie. »Cat!« Sie konnte sie nirgends entdecken. Der Himmel sah aus wie das tiefe Ende eines Schwimmbeckens, das immer tiefer wurde.
Es war nur ein süßer Moment gewesen, in dem sie Schutz in Anders Armen gefunden hatte, aber er machte Eureka Angst. Sie durfte sich nicht durch Verlangen von der Arbeit ablenken lassen, die vor ihr lag.
»Eureka!« Williams Stimme klang, als käme sie aus weiter Ferne.
Sie stolperte darauf zu. Die Welle hatte den letzten Teil ihres Pfades vom Felsen zum Land überflutet, daher musste Eureka wieder ins Wasser springen und drei Meter gegen die Strömung waten, um das Ufer zu erreichen. Ander war neben ihr. Das Wasser ging ihnen bis an die Rippen, kam aber nicht an den Donnerstein heran. Ihre Hände fanden sich unter Wasser und hielten sich fest, bis sie sich gegenseitig herausziehen konnten.
Vor Eureka erstreckten sich seltsame hellgraue Felshänge. In der Ferne bildeten höhere Felsen eine merkwürdige Silhouette aus schmalen Kegeln, als hätte Gott riesige Steinzipfel auf eine Töpferscheibe geworfen. Ein blauer Farbklecks erschien zwischen den Steinen – William in seinem nassen Superman-Schlafanzug schwenkte den Arm.
Eureka überwand die Entfernung zwischen ihnen. Will steckte sich den Daumen in den Mund. Seine Stirn und seine Hände waren blutbefleckt. Sie fasste ihn an den Schultern, suchte ihn nach Wunden ab und drückte ihn dann an sich.
Er legte ihr den Kopf an die Schulter und hakte dabei wie immer den Zeigefinger in ihr Schlüsselbein ein.
»Dad hat sich wehgetan«, berichtete William.
Eureka ließ den Blick über die Felsen schweifen, eisiges Wasser bis zu den Knöcheln. »Wo?«
William zeigte auf einen Steinbrocken, der sich wie eine Insel aus einer Pfütze erhob. Mit ihrem Bruder auf dem Arm und Ander an ihrer Seite watete Eureka um den Felsen herum. Sie sah die Rückseite von Cats schwarzer Jeans und ihren Häkelpullover. Die Lackstilettos, für die Cat sechs Monate lang das Babysittergeld gespart hatte, steckten im Schlamm. Eureka hockte sich auf den Boden.
»Was ist passiert?«, fragte sie.
Cat wirbelte herum. Schlamm verkrustete ihr Gesicht und ihre Kleider. Regen tropfte von ihren sich auflösenden Zöpfen. »Du bist okay«, hauchte sie, dann trat sie zur Seite und gab den Blick auf zwei Leute hinter sich frei. »Dein Dad …«
Dad lag am Fuß des Steinbrockens auf der Seite. Er hielt Claire so eng an sich gedrückt, dass sie wie ein einziges Wesen aussahen. Seine Augen waren fest geschlossen. Ihre waren aufgerissen.
»Er hat versucht, sie zu beschützen«, sagte Cat.
Als Eureka zu ihnen eilte, ging sie in Gedanken die Tausende von Malen durch, da Dad sie beschützt hatte: in seinem alten blauen Lincoln, als er bei jeder Vollbremsung den rechten Arm über Eureka auf dem Beifahrersitz geworfen hatte. Wenn sie über die Baumwollfelder von New Iberia gegangen waren, hatte seine Schulter Eureka vor der Staubfahne eines Treckers beschirmt. Als sie Dianas leeren Sarg in die Erde hinabgelassen hatten und Eureka ihm folgen wollte, hatte Dad vor Anstrengung gezittert, während er sie zurückhielt.
Sanft hob sie seinen Arm von Claire.
»Die Welle hat sie auf den Stein geworfen und …« Cat schluckte und konnte nicht weitersprechen.
Claire befreite sich, dann änderte sie ihre Meinung und versuchte zurück in Dads Arme zu kriechen. Als Cat sie festhielt, ließ Claire die Fäuste fliegen und jammerte: »Ich vermisse Squat!«
Squat war ihr Labradoodle. Die Zwillinge benutzten ihn meistens als Sitzsack. Einmal war er gegen die Strömung durch den Bayou geschwommen, um Eureka und Brooks in einem Kanu einzuholen. Als er aus dem Wasser gekommen war und sein Fell ausgeschüttelt hatte, hatte er die Farbe von dünnem Kakao gehabt. Gott allein wusste, was in dem Sturm aus ihm geworden war. Eureka hatte ein schlechtes Gewissen, dass sie seit Einsetzen der Flut kein einziges Mal an Squat gedacht hatte. Sie musterte Claire, die nackte Angst in ihren Augen, und erkannte sofort, was ihre Schwester nicht auszusprechen wagte: Sie vermisste ihre Mutter.
»Ich weiß«, sagte Eureka.