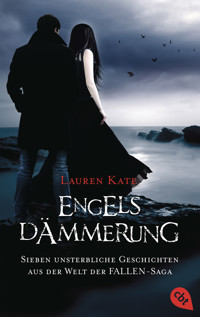Inhaltsverzeichnis
Inschrift
Am Anfang
Eins – Vollkommen Fremde
Zwei – Eingewöhnung
Drei – Nachtschatten
Vier – Grabpflege
Fünf – Der innere Kreis
Sechs – Keine Erlösung
Sieben – Mehr Licht
Acht – In die Tiefe
Neun – In aller Unschuld
Zehn – Wo Rauch ist …
Elf – Unsanftes Erwachen
Zwölf – Staub zu Staub
Dreizehn – Elternliebe
Vierzehn – Wenn man vom Teufel spricht
Fünfzehn – In der Höhle des Löwen
Sechzehn – In der Schwebe
Siebzehn – Ein offenes Buch
Achtzehn – Der Krieg der Welten
Neunzehn – Im Verborgenen
Zwanzig – Tagesanbruch
Epilog
Danksagung
Copyright
Doch das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns; wir müssen die Reise um die Welt machen und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist.
Heinrich von Kleist: Über das Marionettentheater
Am Anfang
Helston, England
September 1854
Um Mitternacht zeichnete er dann ganz zuletzt die Augen. Ihr Blick war der einer Raubkatze, halb zögernd, halb wild entschlossen – voller Glut. Ja, er hatte sie genau getroffen. Es waren ihre Augen. Sie standen leicht schräg in ihrem Gesicht, und über ihnen wölbten sich zarte, elegant geschwungene Augenbrauen. Lange dunkle Haare fielen ihr bis über die Schultern herab.
Er hielt die Zeichnung am ausgestreckten Arm von sich weg, um sie noch einmal auf sich wirken zu lassen. Um zu überprüfen, ob er Fortschritte gemacht hatte. Ein Porträt von ihr zu zeichnen, ohne sie vor sich zu haben, war nicht leicht. Andererseits hatte er in ihrer Gegenwart noch nie zeichnen können. Seit er aus London gekommen war – nein, das war nicht richtig, seit er sie das erste Mal gesehen hatte, war er stets darauf bedacht gewesen, sie auf Abstand zu halten.
Nun aber suchte sie mit jedem Tag mehr seine Nähe, und mit jedem Tag wurde es schwieriger für ihn. Deshalb würde er am Morgen auch abreisen – nach Indien, nach Amerika, er wusste es noch nicht, und es war ihm auch gleichgültig. Wohin auch immer das Schicksal ihn führte, überall würde es für ihn leichter zu ertragen sein als hier, in ihrer Gegenwart.
Er beugte sich noch einmal über die Zeichnung auf seinen Knien, seufzte tief und fuhr mit dem Daumen weich über den Kohlestrich, sodass ihre Lippen nun voll und sinnlich wirkten. Dieses tote Blatt Papier – welch armseliger Ersatz – war das Einzige, was er von ihr mitnehmen würde.
Mit einem Mal richtete er sich in dem schweren Ledersessel auf. Er spürte es. Ein warmer Hauch, der über seinen Nacken strich.
Sie.
Allein ihre Nähe rief in ihm eine höchst eigenartige Empfindung hervor, eine Hitze durchströmte ihn, wie er sie von den Holzscheiten im Feuer kannte, kurz bevor sie in der Glut bersten und zu Asche zerfallen. Er wusste es, ohne sich umdrehen zu müssen: Sie war da. Er bedeckte hastig ihr Ebenbild auf dem Papier, aber ihr selbst konnte er nicht mehr entfliehen.
Seine Augen fielen auf das hell gepolsterte Kanapee an der gegenüberliegenden Wand des Salons, wo sie vor ein paar Stunden erst gesessen hatte, nachdem sie unerwartet und spät doch noch bei der Abendgesellschaft aufgetaucht war. In einem rosa Seidenkleid hatte sie der ältesten Tochter ihres Gastgebers applaudiert, die den Gästen ein Stück auf dem Cembalo vorgespielt hatte. Danach wanderte sein Blick weiter durchs Fenster zur Terrasse, wo sie sich ihm am Tag zuvor leise von hinten genähert hatte, um ihn zu überraschen, in der Hand einen Strauß weißer Pfingstrosen. Sie dachte immer noch, die Anziehungskraft, die sie immer wieder in seine Nähe trieb, sei ein reines, unschuldiges Gefühl und ihre häufigen Begegnungen in der Gartenlaube seien … bloßer Zufall. Ach, wie naiv sie doch war! Aber nie würde er ihr alles erzählen, was er wusste – er musste die Bürde ihres gemeinsamen Geheimnisses allein tragen.
Er stand auf und drehte sich um, das Skizzenbuch mit den vielen Porträts ließ er zugeklappt auf dem schweren Ledersessel zurück. Und da stand sie wirklich, in ihrem weißen Morgenmantel neben dem dunkelroten Samtvorhang, ihr langes schwarzes Haar hatte sich aus dem Zopf gelöst. Der Ausdruck in ihrem Gesicht war so, wie er ihn immer wieder gezeichnet hatte. Da war das Feuer, das ihr in die Wangen stieg. War sie wütend? Fühlte sie sich ertappt? War sie verlegen? Er hätte es gerne gewusst, aber er durfte sie nicht fragen.
»Was tun Sie hier?« Er bemerkte den harschen Tonfall, mit dem er sie anfuhr, und bedauerte ihn sofort. Nie würde sie den Grund dafür erfahren.
»Ich – ich konnte nicht schlafen«, stammelte sie. »Ich habe in Ihrem Zimmer Licht gesehen und dann« – sie hielt inne, blickte scheu auf ihre Hände – »dann Ihren Schrankkoffer vor der Tür. Verlassen Sie uns etwa?« Sie machte einen Schritt auf das Kaminfeuer und den Sessel zu.
»Ich wollte es Ihnen gestern Abend bereits mitteilen -« Er unterbrach sich. Besser, er log sie nicht an. Er hatte ihr von seinen Plänen nie erzählen wollen. Das würde alles nur noch schlimmer machen. Er war sowieso schon viel zu weit gegangen, von der irrwitzigen Hoffnung getrieben, dieses eine Mal würde alles anders sein.
Sie kam näher und ihre Augen fielen auf das Skizzenbuch. »Haben Sie mich etwa gezeichnet?«
Ihr halb überraschter, halb verlegener Tonfall verdeutlichte ihm erneut, wie groß die Kluft zwischen ihnen war. Selbst nach den vielen Stunden, die sie in den vergangenen Wochen miteinander verbracht hatten, ahnte sie noch nicht einmal dunkel, was das Geheimnis ihrer gegenseitigen Anziehung war.
Gut so. Oder zumindest: besser so. In den vergangenen Tagen, seit er beschlossen hatte, den Landsitz zu verlassen, hatte er gegen diese mächtige Kraft angekämpft. Er musste sich von ihr lösen. Diese Anstrengung erschöpfte ihn tagsüber so sehr, dass er dem lange gehegten Wunsch, sie zu zeichnen, an den Abenden schließlich nachgegeben hatte. Die Seiten seines Skizzenbuchs waren mit Zeichnungen von ihr gefüllt – von ihrem langen gebogenen Hals, ihrem marmorweißen Schlüsselbein, der schwarzen Flut ihrer Haare.
Jetzt fühlte er sich nicht nur wie bei etwas Verbotenem ertappt, weil er sie gezeichnet hatte, nein, es war viel schlimmer. Ein Schauder durchfuhr ihn, als er begriff, dass ihre Entdeckung sie vernichten würde. Sie durfte nicht erfahren, welche Gefühle er für sie hegte. Er hätte vorsichtiger sein müssen. Es fing immer so an.
»Warme Milch mit einem Teelöffel Melasse«, murmelte er. »Das hilft beim Einschlafen.« Seine Stimme klang traurig.
»Woher wissen Sie das? Genau das hat meine Mutter mir immer -«
»Ich weiß«, sagte er ruhig. Ihre Verblüffung überraschte ihn nicht, aber er durfte ihr nicht erklären, woher er das wusste, oder ihr erzählen, wie oft er ihr in der Vergangenheit diesen Trank verabreicht hatte, wenn die Schatten kamen. Wie oft er sie so lange in den Armen gehalten hatte, bis sie eingeschlafen war.
Er spürte ihre Berührung, als würde sie ihm durch sein Hemd hindurch die Haut verbrennen. Ihre Hand lag sanft auf seiner Schulter, und sein Atem ging schwer. Sie hatten sich in diesem Leben noch nicht berührt, und wenn es das erste Mal geschah, musste er immer nach Luft ringen.
»Bitte antworten Sie mir«, flüsterte sie. »Haben Sie wirklich vor, uns zu verlassen?«
»Ja.«
»Dann nehmen Sie mich mit«, stieß sie mit einem Mal hervor. Er hörte, wie sie scharf die Luft einsog, nichts wünschte sie sich jetzt mehr, als die Bitte zurückzunehmen. An der Falte zwischen ihren Augen konnte er die Abfolge ihrer Gefühle ablesen: erst überrascht, dann verwirrt, dann verlegen wegen der Unbedachtheit ihrer Äußerung. Das war bei ihr immer so, und bereits viel zu viele Male hatte er den Fehler begangen, sie in diesem Augenblick zu trösten.
»Nein«, flüsterte er, während er sich erinnerte … sich viel zu gut erinnerte … »Ich werde morgen das Segelschiff besteigen, und wenn Sie wirklich Gefühle für mich hegen, dann sagen Sie jetzt bitte kein Wort mehr.«
»Wenn ich Gefühle für Sie hege«, sagte sie wie zu sich selbst. »Ich … ich liebe …«
»Sagen Sie es nicht.«
»Ich muss es sagen. Ich … ich liebe Sie, da bin ich mir gewiss, und wenn Sie jetzt abreisen -«
»Wenn ich jetzt abreise, rette ich Ihnen das Leben.« Er sprach langsam, versuchte jene Schicht von ihr zu erreichen, die sich vielleicht erinnerte. Irgendwo in ihr, tief in ihr vergraben, musste es doch so sein. »Es gibt Wichtigeres als die Liebe. Sie werden das jetzt vielleicht noch nicht verstehen, aber Sie müssen mir vertrauen.«
Ihre Augen bohrten sich in ihn. Sie trat ein paar Schritte zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Auch diesen Fehler machte er immer wieder – er redete mit ihr stets viel zu sehr von oben herab, wogegen sie sich dann wehrte. Sie war eine Kämpferin.
»Wollen Sie mir wirklich sagen, dass es Wichtigeres gibt, als das hier zu spüren?« Sie nahm seine Hände und legte sie auf ihr Herz.
Ach, da stand sie vor ihm und hatte keine Ahnung, was nun folgen würde. Wenn er doch nur einmal über sich hinauswachsen würde und in der Lage wäre, sie aufzuhalten! Wenn er sie jetzt nicht aufhielt, dann würde sie nie begreifen – und die Vergangenheit würde sich in einem fort wiederholen, wieder und wieder würden sie dieselbe Qual durchleben müssen.
Er spürte unter seinen Händen die vertraute Wärme ihrer Haut, warf den Kopf in den Nacken und stöhnte. Wenn es ihm doch nur gelänge, ihre körperliche Nähe auszublenden, sich nicht daran zu erinnern, wie sich ihre Lippen auf seinen Lippen anfühlten – und dass danach unweigerlich ein bitteres Ende folgen würde. Ihre Finger berührten sanft seine Finger. Unter ihrem weißen Morgenmantel hob und senkte sich ihre Brust, ihr Herz musste bis zum Zerspringen klopfen.
Sie hatte recht. Es gab nichts Wichtigeres. Nie hatte es etwas Wichtigeres gegeben. Er wollte gerade nachgeben und sie in die Arme nehmen, als er den merkwürdigen Blick in ihren Augen bemerkte. Als ob sie ein Gespenst gesehen hätte.
Und dann wich sie vor ihm zurück und fuhr sich mit der Hand über die Stirn.
»Mir ist so seltsam«, flüsterte sie.
Nein, nein – war es tatsächlich schon zu spät?
Ihre halbgeschlossenen Augen nahmen die Form an, die er ihnen auf seiner Zeichnung gegeben hatte. Sie näherte sich ihm wieder, beide Hände auf die Brust gelegt, die Lippen erwartungsvoll geöffnet. »Vielleicht halten Sie mich jetzt für verrückt, aber ich könnte schwören, das alles schon einmal erlebt zu haben.«
Es war zu spät. Er blickte auf. Ihn schauderte, denn er spürte, wie die Finsternis sich über sie beide herabsenkte. Hastig legte er ein letztes und einziges Mal die Arme um sie, umarmte sie so fest, wie er das seit Wochen ersehnt hatte.
Sobald ihre Lippen sich auf seine legten, waren sie beide machtlos. Der honigsüße Geschmack ihres Mundes verwirrte und betäubte ihn. Je stärker sie ihren Körper gegen seinen presste, desto heftiger wogte die Erregung und breitete sich gleichzeitig eine Lähmung in ihm aus. Ihre Zunge berührte seine Zunge, und das Feuer zwischen ihnen brannte mit jeder neuen Geste, jeder neuen Berührung heller, heißer und mächtiger. Doch das alles war ihm schon vertraut und bekannt.
Der Raum erbebte. Um sie herum erglühte ein heller Schein.
Sie bemerkte nichts davon, nahm nichts wahr, wusste nichts, spürte nichts als den Kuss.
Die Schatten wirbelten jetzt direkt über ihren Köpfen. So nahe, dass er mit der Hand danach hätte greifen können. So nahe, dass er sich fragte, ob sie wohl verstand, was sie flüsterten. Die Finsternis legte sich langsam über ihr Gesicht. Er bemerkte ihr Erstaunen, sah in ihren Augen plötzlich die Erkenntnis aufblitzen.
Dann war nichts mehr. Nichts.
Eins
Vollkommen Fremde
Zehn Minuten zu spät. Luce stürzte in die neonweiß beleuchtete Eingangshalle der Sword & Cross Schule. Ein Schrank von einem Menschen, mit kurzen Haaren, rotem Gesicht und einem Klemmbrett, das unter den mächtigen Bizeps geschoben war, erteilte Befehle – was bedeutete, dass ihre Abwesenheit schon aufgefallen war.
»Und denkt immer daran! Hier an unserer Schule gilt: Pillen, Zellen, Rotlicht!«, bellte eine raue Stimme drei Schüler an, die mit dem Rücken zu Luce standen. »Haltet euch an die Regeln und niemandem passiert was.«
Luce schlüpfte schnell hinter die kleine Gruppe. In ihrem Kopf herrschte ein einziges Durcheinander. Sie war sich nicht sicher, ob sie die Stapel Anmeldeformulare auch wirklich richtig ausgefüllt hatte; ob die kahl rasierte Person vor ihr eigentlich ein Mann oder eine Frau war; ob irgendwer ihr mit der schweren, großen Reisetasche helfen würde; ob ihre Eltern, die sie hierhergebracht hatten, ihr heiß geliebtes Auto, ihren Plymouth Fury, nicht sofort verkaufen würden, sobald sie wieder zu Hause waren. Sie hatten bereits den ganzen Sommer lang damit gedroht und jetzt verfügten sie über einen weiteren Grund, gegen den Luce nicht mehr ankam: An Luces neuer Schule war es nämlich nicht erlaubt, ein Auto zu haben. Ohne Ausnahme. Vielleicht sollte man ergänzen, dass es sich bei ihrer neuen Schule um eine sogenannte Besserungsanstalt handelte.
Luce hatte sich an die Bezeichnung immer noch nicht gewöhnt.
»Könnten Sie, ähm, könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen?«, fragte sie. »Wie war das mit dem Medcenter -?«
»Na, was hat der Wind denn da zu uns hereingeblasen?«, sagte die Person mit dem kahl rasierten Schädel. Um dann langsam und deutlich fortzufahren: »Medcenter. Wenn du eine der Schülerinnen bist, die regelmäßig Medikamente nehmen, dann kriegst du dort, was du brauchst, um dich aufzumuntern, ruhiger zu werden, deine Atembeschwerden zu lindern, was auch immer.« Eine Frau, entschied Luce. Kein Mann würde es fertigbringen, das alles gleichzeitig so böse und so zuckersüß zu sagen.
»Ich hab’s kapiert.« Luce drehte sich fast der Magen um. »Medcenter.«
Sie nahm jetzt schon seit Jahren keine Medikamente mehr. Nach dem Vorfall im vergangenen Sommer hatte Dr. Sanford, ihr Spezialist in Hopkinton – und der Grund, weshalb ihre Eltern sie bis nach New Hampshire in ein Internat geschickt hatten -,sie wieder auf Tabletten setzen wollen. Sie hatte ihn schließlich davon überzeugen können, dass ihr Zustand stabil war, doch es hatte sie einen ganzen Monat Therapiestunden gekostet, nur um die schrecklichen Antipsychotika nicht nehmen zu müssen.
Deshalb begann sie nun ihr letztes Jahr an der Highschool einen ganzen Monat, nachdem das Schuljahr angefangen hatte. Ihr Schuljahr in der Besserungsanstalt. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, neu an eine Schule zu kommen. Es hatte Luce richtig nervös gemacht, dass sie nun in Kurse kommen würde, wo alle anderen sich bereits kannten. Aber wie es so aussah, war sie nicht die einzige Neue, die an diesem Morgen angekommen war.
Sie warf einen verstohlenen Blick zu den drei anderen Jugendlichen. In ihrer alten Schule, der Dover Prep, hatte sie bei ihrer Erkundungstour am ersten Tag gleich ihre beste Freundin Callie kennengelernt. Alle anderen Schüler waren seit ihrer Kindheit miteinander aufgewachsen, was schon ausgereicht hätte, um Luce und Callie zusammenzuschweißen. Aber sie entdeckten auch schnell, dass sie dieselbe Leidenschaft für dieselben alten Filme teilten – vor allem solche mit Albert Finney wie »Zwei auf gleichem Weg«. Nachdem sie dann auch noch entdeckt hatten, dass keine von ihnen beiden Popcorn zubereiten konnte, ohne Feueralarm auszulösen, waren sie unzertrennlich gewesen. So lange bis … so lange, bis sie sich trennen mussten.
Neben Luce standen zwei Jungen und ein Mädchen. Mit dem Mädchen war es ziemlich einfach, sie war blond und auf die Weise hübsch, wie Mädchen in Werbespots für Handcreme hübsch sind, mit pastellrosa Nagellack, der zu ihrem Haarband passte.
»Ich bin Gabbe«, flüsterte sie und schenkte Luce ein strahlendes Lächeln, das ebenso schnell wieder verschwand, wie es aufgetaucht war. Luce hatte noch nicht einmal Zeit, ihren eigenen Namen zu sagen. Das mangelnde Interesse des Mädchens erinnerte sie an viele Mädchen in Dover, nur in der Südstaatenvariante. In der Sword & Cross hätte sie das allerdings nicht erwartet. Luce konnte genauso wenig entscheiden, ob sie das eher beruhigend oder beunruhigend finden sollte, wie sie sich vorstellen konnte, was ein solches Mädchen in einer Besserungsanstalt zu suchen hatte.
Rechts neben Luce war ein Junge mit kurzen braunen Haaren, braunen Augen und ein paar Sommersprossen auf der Nase. Er vermied es, ihrem Blick zu begegnen, und zupfte nervös an dem Nagelhäutchen seines Daumens herum, was Luce vermuten ließ, dass er genauso wie sie immer noch ganz geschockt war, hier zu sein, und sich am liebsten verkrochen hätte.
Der Junge links neben ihr passte dagegen nur zu gut zu dem Bild, das sie sich von diesem Ort gemacht hatte. Fast zu perfekt. Er war groß und mager, hatte eine DJ-Tasche über der Schulter hängen, unordentliche schwarze Haare und große, tief liegende grüne Augen. Für seine geschwungenen rosenroten Lippen hätten die meisten Mädchen wahrscheinlich einen Mord begangen. An seinem Nacken war über dem Halsausschnitt seines schwarzen T-Shirts ein schwarzes Tattoo zu erkennen, eine aufgehende Sonne, deren Strahlen auf seiner blassen Haut leuchteten.
Anders als die beiden anderen erwiderte der Junge ihren Blick, als er sich zu ihr umdrehte, und schaute nicht gleich wieder weg. Seine Lippen zeigten nicht das kleinste Lächeln, aber seine Augen waren warm und lebendig. Er sah sie ruhig an und stand dabei reglos wie eine Statue da, weshalb Luce sich plötzlich mit dem Boden wie verwurzelt fühlte. Sie hielt einen Moment den Atem an. Der Blick aus diesen Augen war intensiv und verlockend und, ja, auch entwaffnend.
Mit einem lauten Räuspern unterbrach die Frau ihren tranceähnlichen Zustand. Luce errötete und fuhr sich nervös über den Kopf, als müsse sie sich dringend kratzen.
»Diejenigen von euch, die die erste Lektion begriffen haben, können jetzt gehen, nachdem sie ihre Waffen hier abgeliefert haben.« Die Frau deutete auf eine große Pappschachtel, über der ein Schild mit der Aufschrift VERBOTENE GEGENSTÄNDE hing. »Und wenn ich sage, sie können jetzt gehen, Todd -«, sie umklammerte die Schulter des sommersprossigen Jungen mit einem so harten Griff, dass er zusammenzuckte, »- dann meine ich damit, ihr könnt jetzt gehen, um hier in der Schule eure persönlichen Betreuer zu treffen. Keinesfalls dürft ihr das Gelände verlassen. Du -«, sie zeigte auf Luce, »- gibst deine Waffen ab und bleibst danach bei mir.«
Alle vier trotteten zur Pappschachtel und Luce beobachtete verdutzt, was die anderen drei Jugendlichen alles aus ihren Taschen leerten. Das Mädchen zog ein dickes Schweizer Armeemesser hervor. Der Junge mit den grünen Augen trennte sich widerwillig von einer Farbspraydose und einem Cuttermesser. Sogar der unglückliche Todd ließ mehrere Streichholzschachteln und einen kleinen Behälter mit Feuerzeugbenzin in den Karton fallen. Luce schämte sich fast schon, dass sie selbst keine Waffe bei sich trug – aber als sie dann sah, dass die anderen auch noch ihre Handys hervorholten und in die Schachtel legten, musste sie schwer schlucken.
Sie beugte sich vor, um auf dem Schild mit der Aufschrift VERBOTENE GEGENSTÄNDE auch das Kleingedruckte zu lesen, und stellte fest, dass Handys, Pager sowie Funkgeräte aller Art streng verboten waren. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass sie kein Auto haben durfte! Luce umklammerte mit schwitzender Hand das Handy in ihrer Hosentasche, ihre einzige Verbindung zur Außenwelt. Als die Frau ihren Gesichtsausdruck bemerkte, gab sie ihr schnell ein paar Klapse auf die Wangen. »Werd mir nicht ohnmächtig, Mädchen. Sie zahlen mir hier nicht genug, als dass Wiederbelebungsversuche auch drin wären. Außerdem darfst du dich einmal in der Woche auf dem Apparat in der Eingangshalle anrufen lassen.«
Ein … ein Mal in der Woche? Aber -
Sie blickte ein letztes Mal auf ihr Handy und bemerkte, dass sie zwei neue Nachrichten erhalten hatte. Unmöglich konnten das ihre letzten beiden SMS sein! Die erste kam von Callie.
Ruf mich sofort an! Werde die ganze Nacht für dich aufbleiben, also bereite dich schon mal auf einen langen Tratsch vor. Und denk immer an das Mantra, das ich für dich ausgesucht habe. Du wirst überleben! Ach ja, hier haben übrigens fast alle schon ganz vergessen, was du …
Typisch Callie! Sie hatte wieder mal so viel geschrieben, dass Luces bescheuertes Handy die Nachricht nach vier Zeilen einfach abgeschnitten hatte. Aber Luce fühlte sich auch erleichtert. Sie wollte gar nicht lesen, was fast alle an ihrer Schule inzwischen vergessen hatten … was ihr zugestoßen war … was sie getan hatte, um an diesen schlimmen Ort verbannt zu werden.
Sie seufzte und öffnete die zweite Nachricht. Sie war von ihrer Mutter, die erst vor ein paar Wochen ihre Leidenschaft fürs SMS-Schreiben entdeckt und bestimmt nicht geahnt hatte, dass hier nur ein Mal in der Woche ein Anruf erlaubt war. Denn sonst hätte sie ihre Tochter doch niemals hier zurückgelassen. Oder?
Meine liebe Kleine, wir denken an dich. Sei brav und iss immer genug Proteine. Wir telefonieren, sobald wir können. Viele liebe Grüße, M&P
Mit einem Seufzer gestand Luce sich ein, dass ihre Eltern es gewusst haben mussten. Wie sonst waren ihre traurigen, müden Gesichter zu erklären, als sie ihnen zum Abschied am Schultor zuwinkte, in der anderen Hand die Reisetasche. Beim Frühstück hatte sie noch versucht, Witze darüber zu machen, dass sie nun bestimmt ihren unerträglichen New-England-Akzent verlieren würde, den sie sich in Dover angewöhnt hatte. Aber sie hatte damit ihren Eltern nicht mal ein Lächeln entlocken können. Sie hatte geglaubt, sie seien ihr immer noch böse. Ihre Eltern gehörten nicht zu den Leuten, die andere anbrüllten, was bedeutete, dass sie, immer wenn Luce etwas wirklich Schlimmes tat, die alte Schweigenummer abzogen. Doch jetzt verstand sie das seltsame Verhalten ihrer Eltern am Frühstückstisch: Sie betrauerten bereits, dass sie von nun an fast allen Kontakt zu ihrer einzigen Tochter verlieren würden.
»Wir warten noch auf eine Person«, sagte die Frau. »Wer das wohl sein mag?« Luce wurde aus ihren Gedanken herausgerissen und blickte erschrocken zur Pappschachtel, die inzwischen vor verbotenen »Waffen« überquoll, von denen sie nicht einmal die Namen kannte. Sie spürte, wie der schwarzhaarige Junge mit den grünen Augen sie anstarrte. Als sie hoch sah, bemerkte sie, dass alle sie anstarrten. Sie war jetzt dran. Sie schloss die Augen, öffnete dann langsam einen Finger nach dem anderen und ließ ihr Handy los. Das Geräusch, mit dem es auf dem Haufen aufschlug, klang traurig. So hörte sich die Einsamkeit an.
Todd und die geklonte Blondine Gabbe stürzten zur Tür, ohne noch einmal zu Luce zu blicken, aber der dritte Junge wandte sich an die Frau.
»Ich kann ihr alles zeigen«, sagte er.
»Das gehört nicht zu unserer Abmachung«, antwortete die Frau sofort, als hätte sie diesen Wortwechsel schon erwartet. »Du bist jetzt wieder neu hier – mit all den Einschränkungen, die für neue Schüler gelten. Zurück zum Start. Das passt dir nicht? – Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Bevor du das zweite Mal deinen Hafturlaub eigenmächtig verlängert hast.«
Der Junge stand stocksteif da und sein Gesicht zeigte keine Regung, während Luce, die bei dem Wort »Hafturlaub« zusammengezuckt war, von der Frau zur Tür auf der anderen Seite der neonbeleuchteten Eingangshalle geschoben wurde.
»Weitergehen«, sagte sie, als sei nichts. »Da schlaft ihr.« Sie zeigte durch das Fenster auf ein graues Gebäude. Gabbe und Todd gingen gerade darauf zu. Der dritte Junge trottete langsam hinterher, als wollte er unter allen Umständen vermeiden, die beiden einzuholen.
Das Wohnheim war groß und eckig, ein massiver Betonklotz mit schweren Doppeltüren. Keine Spuren von Leben. Eine große Steintafel stand davor auf dem toten Rasen, und Luce erinnerte sich jetzt, auf der Website der Schule gesehen zu haben, dass dort die Worte WOHNHEIM PAULINE eingemeißelt waren. In der dunstigen Vormittagssonne sah es noch hässlicher aus als auf dem Schwarz-Weiß-Foto im Internet.
Selbst aus der Entfernung konnte Luce erkennen, dass die Fassade hässlich gealtert war. Sämtliche Fenster waren mit dicken Eisenstäben vergittert. Sie kniff die Augen zusammen. Konnte es sein, dass da auf dem Zaun rings um das Gebäude tatsächlich Stacheldraht angebracht war?
Die Frau blätterte in ihren Unterlagen, fuhr mit dem Finger eine Liste entlang, bis sie Luces Namen fand. »Zimmer dreiundsechzig. Stell dein Gepäck erst mal in meinem Büro ab, wie die anderen auch. Auspacken kannst du dann heute Nachmittag.«
Luce schleppte ihre schwere Reisetasche in das Büro, wo sie sie neben drei schwarzen Koffern auf den Boden plumpsen ließ. Danach griff sie reflexhaft in die Hosentasche, um ihr Handy hervorzuholen, auf dem sie normalerweise alles eintippte, was sie keinesfalls vergessen durfte. Aber ihre Hosentasche war leer. Sie seufzte und versuchte, sich die Zimmernummer einzuprägen.
Warum sie nicht einfach bei ihren Eltern wohnen konnte, wollte ihr immer noch nicht einleuchten. Ihr Haus in Thunderbolt war nicht einmal eine halbe Stunde von der Sword & Cross entfernt. Wie schön es gewesen war, wieder zu Hause in Savannah zu sein, wo sogar der Wind träger wehte, wie ihre Mutter immer zu sagen pflegte. Der sanftere, ruhigere Gang des Lebens in Georgia gefiel Luce. Sie fühlte sich hier viel wohler als in New England.
Nur dass sich die Sword & Cross so überhaupt nicht wie Savannah anfühlte. Ehrlich gesagt, fühlte sich die Sword & Cross wie nirgendwo sonst auf der Welt an, so leblos und farblos, wie ein Ort außerhalb der normalen Welt. Aber hier sollte sie nun in die Schule gehen, dazu hatte das Gericht sie verurteilt.
Sie hatte zufällig mitgehört, wie ihr Vater damals mit dem Schulleiter telefoniert hatte. Leicht verwirrt, immer etwas der zerstreute Biologie-Professor, hatte er genickt und gesagt: »Ja, ja, wahrscheinlich haben Sie recht, es wird nur zu ihrem Besten sein, wenn sie die ganze Zeit überwacht wird. Nein, nein, wir wollen uns nicht in Ihre Erziehungsmethoden einmischen.«
Eins war klar: Ihr Vater hatte bestimmt nicht geahnt, wie weit die Überwachung seiner einzigen Tochter gehen würde. Dieser Ort war keine Schule, sondern ein Hochsicherheitsgefängnis.
»Und was meinten Sie mit – wie haben Sie gesagt? Ach ja, mit dem Rotlicht?«, fragte Luce die Frau, um die Einführungsrunde möglichst schnell hinter sich zu bringen.
»Rotlicht«, sagte die Frau und deutete auf ein kleines elektrisches Gerät mit Kabel, das an der Decke angebracht war: eine Linse mit einem blinkenden roten Licht. Luce war das vorher nicht aufgefallen, aber nachdem die Frau sie darauf hingewiesen hatte, bemerkte sie die Geräte überall.
»Kameras?«
»Sehr gut«, sagte die Frau gönnerhaft. »Wir haben sie so deutlich sichtbar angebracht, damit ihr stets daran erinnert werdet, dass ihr hier unter Überwachung steht. Wir beobachten euch immer und überall. Deshalb solltet ihr besser versuchen, alles richtig zu machen, und nicht ausrasten – soweit ihr dazu in der Lage seid, natürlich.«
Jedes Mal, wenn jemand mit Luce sprach, als wäre sie ein totaler Psychopath, fing sie selbst fast an zu glauben, dass sie tatsächlich einer war.
Den ganzen Sommer über hatten sie die Erinnerungen gequält und verfolgt, in ihren Träumen und in den seltenen Augenblicken, in denen ihre Eltern sie allein ließen. Irgendetwas war damals in der Umkleidekabine geschehen, und alle (Luce eingeschlossen) hätten nur allzu gerne gewusst, was.
Die Polizei, die Richter, die Sozialarbeiter – sie alle hatten versucht, ihr die Wahrheit und ein Geständnis zu entlocken, aber sie selbst war genauso ratlos wie alle anderen. Sie hatte keine Ahnung, was damals wirklich geschehen war. Trevor und sie hatten den ganzen Abend miteinander herumgeflirtet und schließlich waren sie hinunter zu den Umkleidekabinen am See gerannt, weg vom Rest der Party. Sie hatte allen versucht zu erklären, dass dies einer der schönsten Abende ihres Lebens gewesen war – bis er diese schreckliche Wendung nahm.
Wieder und immer wieder hatte sie den Abend in Gedanken an sich vorbeiziehen lassen, hatte Trevors Lachen gehört, seine Hände auf ihren Hüften gespürt und sich bemüht, ihrem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen. Hatte sich bemüht, daran zu glauben, dass sie unschuldig war.
Aber jede Regel, jede Vorschrift und jedes Verbot in der Sword & Cross widerlegten jetzt dieses Bauchgefühl, alles schien ihr nur zu bestätigen, dass sie gemeingefährlich war und streng beaufsichtigt werden musste.
Luce spürte eine kräftige Hand auf ihrer Schulter.
»Mädchen, eins kann ich dir sagen, vielleicht hilft dir das ja: Du bist noch bei Weitem nicht der schlimmste Fall hier.«
Es war die erste menschliche Geste, die die Frau ihr gegenüber an den Tag legte, und Luce war überzeugt, dass sie es gesagt hatte, damit sie sich besser fühlte. Aber trotzdem. Luce war auf die Sword & Cross geschickt worden, weil der Junge, in den sie verliebt gewesen war, auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen war und man sie des Mordes verdächtigte – und da sollte sie »noch bei Weitem nicht der schlimmste Fall« sein? Sie fragte sich, womit die hier sonst noch zu tun hatten.
»Okay, das reicht erst mal zur Einführung«, sagte die Frau. »Ab jetzt musst du selbst zurechtkommen. Hier ist ein Plan zur Orientierung.« Sie gab Luce die Fotokopie eines mit der Hand gezeichneten Lageplans, dann schaute sie auf die Uhr. »Du hast noch eine Stunde, bis deine erste Unterrichtsstunde anfängt, aber meine Lieblingssoap kommt in fünf Minuten und deshalb«, sie machte eine Handbewegung, »verschwinde jetzt. Und vergiss nicht«, sie deutete noch ein Mal nach oben auf die Kamera, »das Rotlicht sieht alles.«
Luce hatte keine Zeit mehr zu antworten, denn ein zierliches, dunkelhaariges Mädchen war vor ihr aufgetaucht und wedelte mit ihren langen Fingern vor ihrem Gesicht herum.
»Oooooh, aaaaaaah«, sang sie wie bei einer Geisterbeschwörung und tanzte im Kreis um Luce herum. »Das Rotlicht sieht alles.«
»Zisch ab, Arriane, bevor ich dich einer Gehirn-OP unterziehe«, sagte die Frau. Aber an ihrem kurzen, aufrichtig wirkenden Begrüßungslächeln war zu erkennen gewesen, dass sie diesem verrückten Mädchen tatsächlich so etwas wie Zuneigung entgegenbrachte.
Genauso deutlich war aber auch zu erkennen, dass Arriane diese Liebe nicht erwiderte. Sie zeigte der Frau kurz den Mittelfinger, dann starrte sie herausfordernd Luce an, wie um zu testen, ob die Neue sich leicht provozieren ließ.
»Das reicht, Arriane«, sagte die Frau und machte wütend einen Vermerk in ihr Heft. »Dafür darfst du jetzt den ganzen Tag unsere neue Little Miss Sunshine betreuen und ihr hier alles zeigen.«
Mit dem kleinen Sonnenschein meinte sie Luce, die in schwarzen Jeans, schwarzen Stiefeln und schwarzem Oberteil alles andere als sonnig wirkte. Unter der Überschrift »Kleiderordnung« war auf der Website der Sword & Cross fröhlich behauptet worden, die Schüler dürften bei guter Führung ihre Kleidung frei wählen – mit nur zwei kleinen Einschränkungen: kein übertriebener Luxus und nur eine Farbe, nämlich schwarz. Das nannte man hier Freiheit.
Der weite Rollkragenpullover, der Luce von ihrer Mutter an diesem Morgen aufgedrängt worden war, ließ nicht viel von ihrer Figur erahnen, und was ihr an sich selbst immer am Besten gefallen hatte, nämlich ihr dickes, hüftlanges schwarzes Haar, war auch verschwunden. Das Feuer in der Badekabine hatte ihr die Haare bis auf wenige einzelne Büschel versengt, und nach der langen, schweigenden Rückfahrt von Dover hatte ihre Mutter sie in die Badewanne gesetzt, Dads elektrischen Rasierapparat hervorgeholt und Luce wortlos den Kopf kahl geschoren. Den Sommer über waren ihre Haare wieder ein kleines bisschen gewachsen, gerade so viel, dass ihre Locken, um die sie vorher so viele beneidet hatten, sich nun verlegen hinter den Ohren kringelten.
Arriane legte den Finger an ihre blassen Lippen und musterte Luce. »Perfekt«, sagte sie dann, machte einen Schritt auf sie zu und hakte sich bei ihr ein. »Ich könnte sowieso gerade einen neuen Sklaven gebrauchen.«
Die Flügeltür der Eingangshalle ging auf und der Junge mit den grünen Augen kam wieder herein. Kopfschüttelnd sagte er zu Luce: »Die scheuen hier wirklich vor nichts zurück und schauen sogar in deiner Unterhose nach. Wenn du also auch noch irgendwo Waffen versteckt haben solltest«, mit hochgezogener Augenbraue ließ er mehrere unidentifizierbare Teile in die Schachtel fallen, »dann spar dir lieber den Ärger.«
Hinter Luce kicherte Arriane leise. Der Kopf des Jungen fuhr hoch, und als er Arriane bemerkte, öffnete er erst den Mund und schloss ihn dann wieder, als wüsste er nicht so recht, wie nun fortfahren.
»Arriane«, sagte er schließlich.
»Cam«, erwiderte sie.
»Du kennst ihn?«, sagte Luce erstaunt, die sich fragte, ob es in Besserungsanstalten wohl auch Cliquen wie an ihrer privaten Highschool in Dover gab.
»Erinnere mich nicht daran«, sagte Arriane und zog Luce zur Tür hinaus. Hinaus in einen grauen und feuchten Vormittag.
An der Rückseite des Hauptgebäudes führte ein Weg mit rissigem Asphalt entlang. Dahinter erstreckte sich eine freie Fläche, die so hoch von Gras überwuchert war, dass sie eher an ein unbebautes Grundstück als an den Sportplatz einer Schule erinnerte. Aber eine verblichene Anzeigetafel und Zuschauertribünen behaupteten etwas anderes.
An dieser Freifläche befanden sich vier schmucklose Gebäude: der Betonblock des Wohnheims ganz links an der Seite, eine riesige, hässliche alte Kirche ganz rechts und in der Mitte zwei weitere Gebäude, in denen Luce die Klassenzimmer vermutete.
Und das war es dann auch. Ihre ganze Welt beschränkte sich von nun auf das, was sie hier vor Augen hatte. Auf diesen erbärmlichen Anblick.
Arriane schwenkte sofort vom Weg ab, überquerte die freie Fläche und setzte sich mit Luce auf eine der feuchten Holzbänke der Zuschauertribüne.
In Dover hatte das Spielfeld nach dem harten Training für die Aufnahme in eine der Mannschaften der Ivy-League-Universitäten gerochen, deshalb hatte Luce es immer vermieden, dort herumzuhängen. Aber diese leere Fläche mit den verrosteten, verbogenen Toren erzählte eine vollkommen andere Geschichte. Eine Geschichte, die für Luce nicht leicht zu entziffern war. Drei Truthahngeier schwebten am Himmel und ein scheußlicher Wind fuhr durch die nackten Äste der Eichen. Luce vergrub das Kinn im Rollkragen ihres Pullovers.
»Sooo«, sagte Arriane schließlich. »Nun hast du Randy kennengelernt.«
»Ich dachte, er heißt Cam.«
»Von dem rede ich doch nicht«, sagte Arriane hastig. »Ich meine diese Mannfrau da drin.« Sie deutete mit dem Kopf in Richtung des Büros, wo sie den Wachhund vor dem Fernseher allein gelassen hatten. »Was glaubst du – Mann oder Frau?«
»Ähm, Frau, oder?«, sagte Luce. »Ist das ein Test?«
Arriane musste lachen. »Der erste von vielen. Und du hast ihn bestanden. Zumindest glaube ich, dass du ihn bestanden hast. Das Geschlecht der meisten Aufsichtspersonen und Lehrer hier an der Schule ist immer wieder Stoff für lange Diskussionen. Aber keine Sorge, das packst du schon.«
Luce beschloss, das für einen Witz von Arriane zu halten – und dass ihr solche Witze gefielen. Aber was für ein riesengroßer Unterschied zu ihrer alten Schule in Dover. Dort waren die zukünftigen Senatoren mit Seitenscheitel, Pomade im Haar und grün-gestreiften Krawatten diskret durch die Gänge gehuscht, die Schritte durch Teppiche und viel Geld gedämpft.
Nicht selten hatten die anderen Jugendlichen in Dover Luce Blicke zugeworfen, die ihr zu verstehen gaben: Pass bloß auf, dass du unsere weißen Wände nicht mit deinen Fingern beschmutzt! Luce versuchte sich Arriane in dieser Umgebung vorzustellen: auf den Bänken herumlungernd, mit ihrer rauen Stimme laut einen dreckigen Witz reißend. Sie versuchte sich vorzustellen, was Callie wohl von Arriane halten würde. So ein Mädchen hatte es in Dover nicht gegeben.
»Okay, jetzt spuck’s schon aus«, befahl Arriane. »Was hast du denn angestellt, dass sie dich hierher verbannt haben?«
Arriane fragte das ganz locker, aber Luce wurde plötzlich leicht schwindelig. So lächerlich das vielleicht sein mochte, sie hatte trotzdem gehofft, den ersten Schultag hinter sich zu bringen, ohne von der Vergangenheit eingeholt zu werden. Sie wollte nicht, dass die dünne Schutzschicht, die sie um sich gelegt hatte, so schnell zerstört wurde. Aber natürlich würden die Leute hier wissen wollen, was mit ihr los war.
Sie spürte das Blut an ihren Schläfen pochen. Das geschah immer, wenn sie sich an jene Nacht zu erinnern – wirklich zu erinnern – versuchte. Sie fühlte sich schuldig an dem, was Trevor widerfahren war; dieses Gefühl begleitete sie ständig. Aber sie wehrte sich mit aller Kraft dagegen, von den Schatten verschlungen zu werden, die das Einzige waren, woran sie sich noch erinnern konnte. Sie waren auch vor dem Zwischenfall da gewesen. Jene düsteren, unnennbaren Gestalten, von denen sie niemals irgendjemandem würde erzählen können. Niemals.
Nein, falsch – sie war kurz davor gewesen, Trevor von der seltsamen Aura zu erzählen, die sie um sich herum spürte, von den ineinander verschlungenen Schemen, die dunkel über ihren Köpfen dräuten. Die ihren wunderschönen gemeinsamen Abend zu vernichten drohten. Aber da war es bereits zu spät gewesen. Und jetzt war Trevor tot, sein Körper bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und sie, Luce … war sie … war sie schuldig?
Niemand wusste von den verschwommenen Gestalten, die sie manchmal in der Dunkelheit sah. Sie waren schon immer zu ihr gekommen. Sie kamen und gingen – so lange schon, dass Luce sich nicht mehr erinnern konnte, wann sie das erste Mal aufgetaucht waren. Aber sie konnte sich noch genau daran erinnern, wann sie das erste Mal begriffen hatte, dass die Schatten nicht zu allen Menschen kamen – oder genauer, dass sie nur zu ihr kamen. Als sie sieben Jahre alt war, hatten ihre Eltern mit ihr Ferien auf Hilton Head Island gemacht und sie waren alle zusammen in einem Boot aufs Meer hinausgefahren. Kurz vor Sonnenuntergang waren dann die Schatten über das Wasser gewandert, und sie hatte sich zu ihrem Vater umgedreht und gesagt: »Was machen wir, wenn sie zu uns kommen, Dad? Habt ihr keine Angst vor den Monstern?«
Ihre Eltern hatten ihr erklärt, es gebe keine Monster und es seien hier auch keine zu sehen. Aber Luce hatte auf der Anwesenheit von einem dunklen, wabernden Etwas beharrt, was zu mehreren Terminen beim Augenarzt und zu einer Brille führte. Und danach, als sie den Fehler begangen hatte, das heisere Flüstern und Zischeln zu beschreiben, das die Schatten manchmal von sich gaben, zu mehreren Terminen beim Ohrenarzt. Und schließlich zu Therapiestunden und immer noch mehr Therapiestunden, und als alles nicht helfen wollte, zur Verschreibung von Antipsychotika.
Nichts davon führte jemals dazu, dass die Schatten verschwanden.
Als sie vierzehn war, weigerte Luce sich, noch länger ihre Medikamente zu nehmen. Damals hatten ihre Eltern Dr. Sanford aufgetrieben, dessen Klinik ganz in der Nähe der Dover Highschool lag. Sie flogen alle zusammen nach New Hampshire und fuhren danach eine lange kurvenreiche Straße einen Berg hoch, bis sie zu einer großen Villa kamen, die Shady Hollows hieß. Sie stellten Luce einen Mann in einem weißen Kittel vor und fragten sie, ob sie immer noch ihre »Erscheinungen« habe. Die Hände ihrer Eltern waren feucht und kalt, als sie sich von Luce verabschiedeten. Auf ihren Gesichtern war die Angst zu lesen, dass mit ihrer Tochter womöglich etwas ganz und gar nicht stimmte.
Niemand hatte Luce groß erklären müssen, was für sie auf dem Spiel stand. Dass sie in ihrem Leben noch viele Shady Hollows von innen sehen würde, wenn sie Dr. Sanford nicht erzählte, was man von ihr hören wollte. Als sie anfing zu lügen und sich wie alle anderen verhielt, erlaubte man ihr, auf die Dover Highschool zu gehen, und sie musste nur noch zwei Mal im Monat zu Dr. Sanford.
Die schrecklichen Medikamente musste Luce nicht mehr nehmen, seit sie behauptet hatte, keine Schatten mehr zu sehen. Was aber nicht hieß, dass sie kontrollieren konnte, wann sie auftauchten. Alles, was sie wusste, war, dass es eine Reihe von Orten gab, an denen sie bereits von ihnen bedrängt worden war – tief im Wald, in der Nähe von trüben Gewässern -, und dass sie solche Orte nun mied. Alles, was sie wusste, war, dass sich unter ihrer Haut ein kaltes Frösteln ausbreitete, wenn die Schatten kamen, und sie von einem entsetzlichen, unerträglichen Gefühl gepackt wurde, das mit keiner anderen Empfindung vergleichbar war.
Luce rutschte auf der Bank ein Stück von Arriane weg und massierte sich die Schläfen. Wenn sie diesen ersten Tag hier überstehen wollte, musste sie die Vergangenheit in den hintersten Winkel ihres Gedächtnisses verbannen. Sie ertrug es kaum, die Erinnerung an diese Nacht in sich wachzurufen, wenn sie allein war, und erst recht nicht konnte sie da einer rätselhaften, überdrehten Fremden alle schaurigen Einzelheiten des Vorfalls anvertrauen.
Sie gab keine Antwort und blickte Arriane nur stumm an, die sich inzwischen auf dem Rücken ausgestreckt und eine riesige schwarze Sonnenbrille hervorgezogen hatte, die den größten Teil ihres Gesichts verdeckte. Schwer zu sagen, aber sie musste Luce gleichfalls aufmerksam beobachtet haben, denn eine Sekunde später sprang sie auf und lächelte Luce an.
»Ich will auch so einen Haarschnitt wie du«, sagte sie. »Mach ihn mir.«
»Was?« Luce war entsetzt. »Aber du hast doch so schöne Haare.«
Was stimmte. Arriane hatte die prächtigen langen Haare, denen Luce so nachtrauerte. Lange, gelockte Haare. Schwarz mit einem leichten rötlichen Schimmer. Luce machte eine Geste, wie um eine Strähne hinters Ohr zurückzustreichen, auch wenn das bei ihren kurzen Haaren vergeblich war.
»Schööön lang und langweilig«, sagte Arriane. »Wie du sie hast, das ist sexy-hexy. Das will ich auch.«
»Ähm, na ja, wenn du meinst«, sagte Luce. War das als Kompliment gemeint? Sie wusste nicht, ob sie sich geschmeichelt fühlte oder eher genervt war, dass Arriane offensichtlich glaubte, sie könnte alles haben, was sie wollte, auch wenn es jemand anders gehörte. »Aber wie sollen wir denn -«
»Tata!« Arriane griff in ihre Tasche und zog das Schweizer Armeemesser hervor, das Gabbe kurz vorher abgeliefert hatte. »Super, was? Ich nutze immer die Gelegenheit und wühle mit meinen Schmutzfingern ein bisschen in dem Karton herum, wenn neue Schüler angekommen sind. Darauf habe ich mich schon wochenlang gefreut. Der bloße Gedanke daran rettete mich durch die Hundstage meines Gefängnisaufenthalts in der Sword & Cross … ähm, ich meine natürlich mein Sommercamp.«
»Du … du hast den ganzen Sommer hier verbracht?« Luce glaubte ihren Ohren nicht zu trauen.
»Ha! Das kann nur ein absoluter Neuling fragen. Wahrscheinlich freust du dich schon auf Weihnachten und die Frühjahrsferien.« Sie reichte Luce das Schweizer Armeemesser. »Vergiss es. Du kommst aus diesem Loch nie mehr raus. Nie mehr. Und jetzt schneid mir die Haare.«
»Was ist mit den Überwachungskameras?«, fragte Luce. Sie blickte sich mit dem Messer in der Hand um. Irgendwo waren bestimmt auch hier Kameras versteckt.
Arriane schüttelte den Kopf. »Mit Angsthasen will ich nichts zu tun haben. Kannst du mit so einem Messer umgehen oder nicht?«
Luce nickte.
»Und erzähl mir jetzt nicht, dass du noch nie jemandem die Haare geschnitten hast.« Arriane schnappte sich das Messer noch einmal, klappte die kleine Schere aus und reichte Luce das Messer zurück. »Ich will kein Wort mehr hören. Erst wenn du mir sagen kannst, dass ich mit meiner neuen Frisur supertoll aussehe.«
Als Luce damals in der Badewanne saß, die einen Frisiersalon ersetzen musste, hatte ihre Mutter die spärlichen Überreste ihrer langen Haare zu einem Zopf zusammengedreht, den sie dann mit einer großen Schere abschnitt. Luce war sich sicher, dass es noch andere, sorgfältigere Methoden des Haareschneidens geben musste, aber da sie sich ihr ganzes Leben lang geweigert hatte, zum Friseur zu gehen, war der abgeschnittene Pferdeschwanz alles, was sie kannte. Sie fasste Arrianes Haare zu einem Zopf zusammen, zog von ihrem Handgelenk ein Gummi, das sie um die Haare wickelte, und machte sich mit der kleinen Schere des Schweizer Armeemessers ans Werk.
Schließlich war es geschafft, der Pferdeschwanz fiel zu Boden. Arriane seufzte, fuhr herum, bückte sich, hob ihn auf und hielt ihn triumphierend hoch. Der Anblick tat Luce im Herzen weh. Sie trauerte immer noch ihren eigenen langen Haaren nach – die ihr zum Symbol für so vieles geworden waren, das sie verloren hatte. Aber Arriane lächelte. Sie fuhr mit den Fingern noch einmal durch die abgeschnittenen Haare, dann ließ sie den Pferdeschwanz in ihrer Tasche verschwinden.
»Großartig«, sagte sie. »Mach weiter.«
»Arriane«, flüsterte Luce erschrocken, »was ist mit deinem Hals?« Die Frage war ihr herausgerutscht, bevor sie lange nachdenken konnte.
»Du meinst die große Narbe?«, fragte Arriane zurück.
Ein breiter Streifen Haut an ihrem Hals – vom linken Ohr bis hinunter zum Schlüsselbein – war unregelmäßig verwachsen und schimmerte weiß. Luce musste an Trevor denken, an die schrecklichen Fotos von ihm. Sogar ihre eigenen Eltern hatten ihr nicht mehr in die Augen schauen können, nachdem sie die Fotos gesehen hatten. Es war für Luce schier unerträglich, jetzt Arriane anzublicken.
Arriane griff nach Luces Hand und presste sie auf die Narbe. Die Haut war heiß und kalt, glatt und rau.
»Ich fürchte mich nicht davor«, sagte Arriane. »Und du?«
»Nein«, sagte Luce. Aber in Wahrheit wünschte sie sich nichts sehnlicher, als dass Arriane ihre Hand wegnehmen würde, damit sie ihre Hand auch schnell wegziehen konnte. Ihr war ganz flau im Magen bei dem Gedanken, als sie sich fragte, ob sich Trevors Haut wohl auch so angefühlt hätte.
»Fürchtest du dich vor dir selbst, Luce? Davor, wer du wirklich bist?«
»Nein«, sagte Luce erneut hastig. Es musste für Arriane so was von klar sein, dass sie log. Sie schloss die Augen. Alles was sie sich von der Sword & Cross wünschte, war die Möglichkeit zu einem Neuanfang, sie wollte einen Ort, an dem die Menschen sie nicht so ansahen, wie Arriane es jetzt gerade tat. Am Schultor heute Morgen, als ihr Vater ihr schnell noch das Familienmotto ihrer Großmutter ins Ohr geflüstert hatte – »Eine mit so viel Kraft wie wir gibt nie auf« -, hatte es sich noch so angefühlt, als könnte es möglich sein. Aber inzwischen kam sie sich nur noch schutzlos und ausgeliefert vor. Sie zog die Hand weg. »Wie ist das passiert?«, fragte sie und schaute auf den Boden.
»Als du vorhin auf meine Frage keinen Pieps geantwortet hast, habe ich dich da bedrängt?«, fragte Arriane.
Luce schüttelte den Kopf.
Arriane deutete auf das Schweizer Armeemesser. »Und jetzt mach weiter, okay? Ich will richtig hübsch aussehen. Ich will so aussehen wie du.«
Aber auch mit identischem Haarschnitt hätte Arriane immer noch wie eine stark unterernährte Version von Luce gewirkt. Während Luce sich bemühte, dem ersten Haarschnitt, den sie je einer anderen Person verpasst hatte, eine halbwegs ansehnliche Form zu geben, fuhr Arriane mit ihrer privaten Einführung in das Leben an der Sword & Cross fort.
»Der Zellenblock da drüben, das ist Augustine. Da finden am Mittwochabend immer unsere sogenannten Veranstaltungen statt. Und unser gesamter Unterricht auch.« Sie deutete auf ein Gebäude in der Farbe gelblicher Zähne, das dritte Gebäude von links. Bestimmt war es von demselben Sadisten entworfen worden, der auch für Pauline verantwortlich war.
»Kleine Warnung«, sagte Arriane. »Du wirst den Unterricht hier hassen. Du wärst kein Mensch, wenn du es nicht tätest.«
»Warum? Was ist so schlimm daran?«, fragte Luce. Vielleicht mochte Arriane Schule ja grundsätzlich nicht. Mit den schwarz lackierten Fingernägeln, dem dicken schwarzen Lidstrich und der schwarzen Tasche, in die gerade mal ihr neues Schweizer Armeemesser zu passen schien, wirkte sie nicht wie jemand, der Spaß am Lernen hatte.
»Der Unterricht ist total seelenlos«, sagte Arriane. »Und viel schlimmer, sie rauben dir auch noch deine eigene Seele. Von den achtzig Schülern hier gibt es vielleicht noch drei mit einer Seele.« Sie blickte auf. »Aber das bleibt unter uns …«
Klang alles nicht besonders vielversprechend. Aber Luce hatte bei etwas anderem aufgehorcht. »Wie? In der ganzen Schule gibt es nur achtzig Schüler?« Bevor sie nach Dover gegangen war, hatte Luce das dicke Handbuch für künftige Schüler genau studiert, sie erinnerte sich noch an die vielen Statistiken. Mit nichts von dem, was sie bisher über die Sword & Cross erfahren hatte, hatte sie gerechnet, und sie merkte, dass sie völlig unvorbereitet gekommen war.
Arriane nickte, was dazu führte, dass Luce aus Versehen eine spitze Ecke in ihre Haare schnitt. Huch! Hoffentlich bemerkte sie es nicht oder wenn – vielleicht fand sie es ja besonders cool.
»Acht Jahrgänge, jeder Jahrgang zehn Jugendliche. Da kriegt man ziemlich schnell mit, was für einen Scheiß alle so draufhaben«, sagte Arriane. »Und die anderen über einen selbst natürlich auch.«
»Klar, kann ich mir denken«, meinte Luce und kaute nervös auf ihrer Lippe herum. Arriane hatte das witzig gemeint, doch Luce fragte sich, ob sie immer noch mit diesem lässigen Grinsen im Gesicht dasitzen würde, wenn sie Luces Geschichte kannte. Je länger Luce einen Mantel des Schweigens über ihre Vergangenheit breiten konnte, desto besser.
»Und wenn ich dir eins raten darf: Halte dich von den wirklich harten Fällen fern.«
»Die wirklich harten Fälle?«
»Die Jugendlichen mit den elektronischen Fesseln am Handgelenk«, sagte Arriane. »Ungefähr ein Drittel der Schüler.«
»Und das sind diejenigen -«
»Mit denen du besser nichts zu tun haben solltest. Glaub mir.«
»Was haben die denn angestellt?«, fragte Luce.
So sehr Luce ihre eigene Geschichte lieber geheim halten wollte, so wenig mochte sie es, von Arriane wie ein dummes, kleines Mädchen behandelt zu werden. Was auch immer diese Jugendlichen getan hatten, es konnte kaum viel schlimmer sein als das, was ihr vorgeworfen wurde. Oder doch? Was wusste sie über diesen Ort und die Jugendlichen hier? So gut wie nichts. Sie bekam allmählich Angst, ein kaltes, graues Frösteln stieg in ihr empor.
»Ach, du weißt schon«, plauderte Arriane weiter, »Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zu Terrorakten. Die Eltern zerstückelt und am Bratspieß geröstet.« Sie wandte den Kopf und grinste Luce an.
»Hör auf«, sagte Luce, »und sag so was nicht.«
»Ich meine es ernst. Diese Psychos haben noch viel strengere Vorschriften aufgebrummt bekommen als der Rest der Durchgeknallten hier. Wir nennen sie die Gefesselten.«
Luce musste über ihren dramatischen Tonfall lachen.
»Dein Haarschnitt ist fertig«, sagte sie und fuhr mit den Fingern durch Arrianes Haare, damit sie lockerer fielen. Tatsächlich sah das Ganze jetzt richtig cool aus.
»Super«, sagte Arriane und drehte sich ganz zu Luce um. Als sie sich selbst mit den Fingern durch die Haare fuhr, rutschten die Ärmel ihres Sweaters hinunter und Luce bemerkte an ihrem linken Handgelenk ein schwarzes Lederarmband, das mit Silbernägeln verziert war, und an ihrem rechten ein weiteres Armband, das mehr … mehr nach einem elektronischen Gerät aussah. Arriane bemerkte ihren Blick.
»Hab ich doch gesagt«, meinte sie. »Die totalen Psychos.« Sie grinste teuflisch. »Jetzt komm weiter. Ich zeig dir noch den Rest.«
Luce hatte keine andere Wahl. Sie kletterte hinter Arriane die Zuschauertribüne hinunter. Als einer der Truthahngeier zu einem gefährlich tiefen Sturzflug ansetzte, duckte sie sich instinktiv. Arriane, die den Geier nicht zu bemerken schien, zeigte auf das Gebäude ganz rechts, die Kirche, deren weißer Verputz eine moosgrüne Färbung angenommen hatte.
»Dort drüben sehen Sie unsere modern ausgestattete Turnhalle«, sagte sie im näselnden Tonfall eines Reiseführers. »Für ein ungeübtes Auge mag das Gebäude wie eine Kirche aussehen, doch das war früher einmal. Wir können in der Sword & Cross eine architektonische Höllenfahrt beobachten, eine Abkehr von der Religion. Vor ein paar Jahren kreuzte hier ein Psychiater mit einer Vorliebe für Fitnessübungen auf und wetterte über die mit Tabletten vollgestopften Jugendlichen, die noch unsere Gesellschaft ruinieren werden. Er spendete einen Riesenhaufen Geld, und deshalb wurde dann die Kirche in eine Turnhalle verwandelt. Die Machthabenden hier glauben, dass wir unsere ›Frustrationen‹ jetzt auf eine ›natürlichere und produktivere Weise abreagieren können‹.«
ENDE DER LESEPROBE