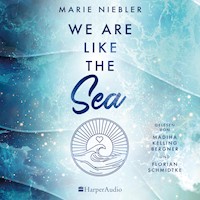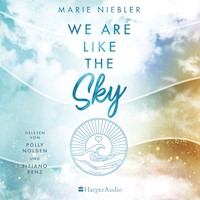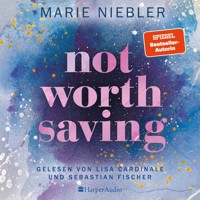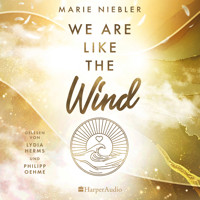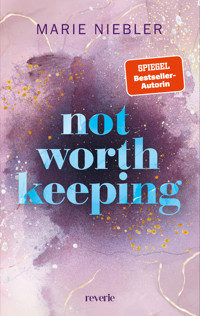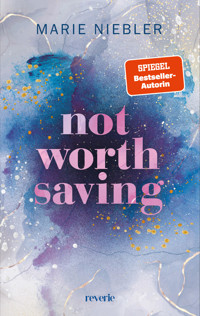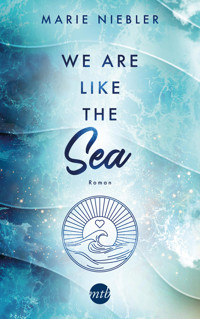
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Like Us
- Sprache: Deutsch
Nur wer sich der Vergangenheit stellt, gibt auch der Zukunft eine Chance
Der Sturm, der in Lavender tobt, ist heftiger als das Unwetter, das bei ihrer Ankunft über Malcolm Island fegt. Eigentlich wollte sie die kanadische Insel nie wieder betreten, zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an den tragischen Unfall vor zwölf Jahren. Selbst zur Beerdigung ihres Onkels brachte sie es nicht über sich, zurückzukehren. Dennoch hat er ihr sein Haus vererbt, und ausgerechnet dieses ist nach Lavenders gescheitertem Studium ihr letzter Zufluchtsort. Die Begegnung mit dem Coast Guard Jonne ist ihr einziger Lichtblick – bis er erfährt, wer sie ist, und sein Lächeln verschwindet. Wo vorher Wärme war, sieht sie in seinen schieferblauen Augen jetzt nur noch Wut.
Eine Liebe, so stürmisch wie der Ozean – der Auftakt zur »Like Us«-Trilogie
»Ich bin verliebt in die atmosphärische Stimmung und die authentischen Charaktere. Eine Reihe, die man unbedingt lesen muss!« SPIEGEL-Bestsellerautorin Antonia Wesseling
»Von Mut, Liebe und Träumen, die selbst die stärksten Stürme überstehen. Die Like Us-Reihe nimmt das Leser*innenherz von der ersten bis zur letzten Seite im malerischen Kanada gefangen. Eine Empfehlung für alle, die sich nach Ruhe und Hoffnung sehnen.« Justine Pust
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Auch wenn einige Schauplätze real existieren, sind alle handelnden Personen und die Handlung in diesem Roman frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Originalausgabe © 2022 by Marie Niebler © 2022 by MIRA Taschenbuch in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Der Abdruck aus dem Gedicht Highway Heart von David Jones erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Autors. Covergestaltung von Alexander Kopainski Coverabbildung von shlyapanama, Ksenia Zu, MVolodymyr, Boonchuay1970, Nataliia K, Ivan Kurmyshov, kaisorn, Ratomich, SWEviL / Shutterstock E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783745703351www.harpercollins.de
Hinweis
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieses Buch behandelt Themen, die potenziell triggernd sein können. Falls du glaubst, möglicherweise betroffen zu sein, findest du auf der letzten Seite eine genaue Auflistung. Achtung: Diese Auflistung enthält Spoiler für die Handlung.
Zitat
And I was Never sure Whether you Were the Lighthouse or The storm.
– DAVID JONES, HIGHWAY HEART
Widmung
Für Fam Du bist Leuchtturm durch und durch
Playlist
Gregory Alan Isakov – Salt And The Sea
Fatherson – The Rain
Birdy – Second Hand News
SYML– DIM
George Ogilvie – Grave
The Ninth Wave – Come Down Forever
SYML– Clean Eyes – Acoustic
Son Lux – A Different Kind of Love
HEAVN– Throw Me a Line
TENDER – Vow
SYML– Take Me Apart
Bon Iver, St. Vincent – Rosyln
The Lumineers – Caves
TENDER– Melt
Vlad Holiday – So Damn Into You
HAEVN – Sinner Love
Au/Ra – Panic Room – Acoustic
SYML– Fear of the Water
flora cash – I Wasted You
SYML– STAYCLOSE
HAEVN – Back in the Water
BANKS– If We Were Made of Water – Live and Stripped
Foals – Into the Surf
Olivia Dean – Slowly
BANKS – Contaminated
Novo Amor – I Make Sparks
Birdy – Lighthouse
Kapitel 1
LAVENDER
Die Westküste begrüßt mich mit strömendem Regen. Er flutet die Windschutzscheibe meines alten Golfs und lässt es aussehen, als wäre er auf Tauchgang. Weltuntergangsstimmung. Passend zu dem flauen Gefühl in meinem Magen.
Das Prasseln auf dem Autodach hat das Radio übertönt, weshalb ich es schon vor einer Stunde ausgeschaltet habe. Die Scheibenwischer laufen auf Hochtouren, aber meine Sicht ist dennoch bis zur Unkenntlichkeit verschwommen.
Port McNeill ist mit seinen rund zweitausend Einwohnern eigentlich beschaulich. In der kleinen Hafenstadt kann man sich gar nicht verfahren – dachte ich. Wie sich herausstellt, ist es sehr wohl möglich, wenn man nur zwei Meter weit sehen kann und aufgeregter ist als vor einem Vorstellungsgespräch.
Ich hasse das. Diesen ganzen verfluchten Tag.
Verzweifelt halte ich nach den Schildern zum Hafen Ausschau. Die Fähre legt in zehn Minuten ab, und obwohl ich sehr viel Wasser sehe, ist da keine Spur von einem Ozean. Wenn ich sie verpasse, muss ich zwei Stunden auf die nächste warten. Und ich weiß nicht, ob ich das durchstehe, ohne mich vor Nervosität zu übergeben. Nicht, dass es besser wäre, auf diese schwimmende Blechbüchse zu steigen und mich von den Wellen durchschütteln zu lassen.
Der Gedanke an die Insel hat mittlerweile sämtliche meiner Eingeweide verknotet und macht sich nun daran, meine Kehle zuzuschnüren. Ich wollte nie zurückkommen. Ich wollte diese Küste nie wieder betreten. Ich wollte …
War das ein Schild?
Ich reiße den Kopf herum und recke den Hals, bin aber bereits daran vorbei. Da stand Hafen, oder? In welche Richtung zeigte der Pfeil? Geradeaus?
Okay, ich bin spät dran, vielleicht fahre ich besser noch einmal zurück und …
Ich schaue wieder nach vorn und schreie erschrocken auf. Irgendwie schafft es mein überfordertes Gehirn, den Befehl zum Bremsen zu geben, während der Rest meines Körpers in Schockstarre ist. Der Golf kommt mit einem Ruck zum Stehen, der Gurt schneidet schmerzhaft in meine Schulter, der Motor geht stotternd aus. Mein Herz hingegen beschleunigt nach dem kurzen Aussetzer, den es zweifelsohne hatte, auf doppelte Geschwindigkeit.
Wie betäubt starre ich die Gestalt an, die knapp vor meiner Motorhaube auf der Straße steht. Ich hätte fast jemanden überfahren! Wenn das kein schlechtes Omen ist, weiß ich auch nicht. Erst der Regen und jetzt das. Gott schreit gerade ganz laut hau ab. Wenn ich das nur könnte.
Die Person steht da wie angewurzelt. Ich glaube, es ist ein Mann, zumindest lassen die breiten Schultern und seine hochgewachsene Statur darauf schließen. Und er hat sicher einen noch größeren Schrecken bekommen als ich.
Mit zitternden Fingern lasse ich das Autofenster herunter. Sofort prasselt der kalte Regen über die Innenseite der Tür, meinen Ärmel und meinen linken Oberschenkel. Toll. Gar kein Problem, ich verbringe gern die nächste Stunde durchnässt.
»Ist alles in Ordnung?«, rufe ich und versuche den Kopf aus dem geöffenten Fenster zu strecken.
Der Mann löst sich aus seiner Starre und kommt um den Wagen herum auf mich zu. Ohne den Sturzbach auf meiner Windschutzscheibe, der alles verschwimmen lässt, erkenne ich, dass er die navyblaue Uniform der Küstenwache trägt. Und er ist nass bis auf die Knochen. Seinen Kopf kann ich nicht sehen, weil er über dem Autodach verschwindet.
»Alles bestens«, erwidert er. Seine tiefe Stimme hat etwas Beruhigendes. Sie klingt völlig unbeeindruckt, als würde ihm so was ständig passieren. Im Gegensatz zu mir scheint er die Fassung bewahrt zu haben. Dabei ist er derjenige, der fast im Krankenhaus gelandet wäre. »Aber bei dem Wetter solltest du nicht auf der Straße sein, das ist gefährlich.«
Er meint wahrscheinlich eher »Du bist gefährlich«. Und ich möchte auch wirklich nicht auf der Straße sein. Doch leider habe ich keine Wahl. »Ich suche den Hafen«, sage ich hilflos. »Meine Fähre geht gleich.«
Der Mann erreicht mich und beugt sich zu mir herunter. Sein Gesicht erscheint vor dem offenen Fenster, und ich blinzle verdattert. Er ist jünger, als ich dachte. Eher in meinem Alter, Anfang zwanzig. Die Haare kleben ihm tropfnass in der Stirn, ein dunkler Bartschatten bedeckt sein Kinn, und er mustert mich aus seinen schieferblauen Augen.
Einen Moment lang bin ich sprachlos. Vielleicht liegt es daran, dass dieses ganze Szenario wirkt wie aus einem Hollywood-Blockbuster, in dem er die Hauptrolle spielt, doch ich glaube, das ist der schönste Mann, dem ich je begegnet bin. Ein Schmunzeln stiehlt sich auf seine Lippen. Keine Ahnung, was er so lustig findet. Ob schon mal jemand klischeehaft in Ohnmacht gefallen ist, nur weil er gelächelt hat?
»Wohin willst du denn?« Sein Tonfall ist wärmer als eben. Ein angenehmer Schauer läuft mir über die Arme, und die Gänsehaut kommt nicht mehr von der Kälte.
»Nach Sointula.« Der Name bleibt bleiern auf meiner Zunge liegen, selbst nachdem ich ihn ausgesprochen habe. Ich versuche, nicht das Gesicht zu verziehen, doch ich glaube, es gelingt mir nicht ganz.
Mr. Hollywood hebt die Brauen. »Bei dem Wetter? Perfekter Zeitpunkt für einen Tagesausflug. Ich will nicht behaupten, das sei keine gute Idee, aber …« Er lacht.
»Aber eigentlich schon?«, scherze ich verlegen. Keine gute Idee, ja. Wohl eher die schlimmste Idee aller Zeiten. Ein Tagesausflug … Ich wünschte, dem wäre so.
Das Schmunzeln wächst zu einem Grinsen. »Nimm es mir nicht übel, aber Malcolm Island ist nicht mehr als ein Stückchen Wald umgeben von Wasser. Bei diesem Wetter überflutet von noch mehr Wasser. Ehrlich gesagt hätte es mich weniger gewundert, wenn du gesagt hättest, du willst dir unsere Riesenmaserknolle anschauen, die hat wenigstens einen touristischen Mehrwert.«
»Eure … was?«
Er stützt einen Unterarm auf dem Fensterrahmen ab, und sein Gesicht kommt meinem so nah, dass ich ein paar vereinzelte Sommersprossen auf seiner Nase erkennen kann. »Port McNeill hat die größte Maserknolle der Welt. Wie kannst du das nicht wissen?« Er zwinkert mir zu.
Hitze steigt mir ins Gesicht. »Da bin ich wohl schlecht informiert.«
»Sieht so aus. Sag Bescheid, falls du einen Fremdenführer brauchst. Hier um die Ecke gibt es auch noch einen Mülleimer, der seit dreißig Jahren nicht geleert wurde. Wir haben schon bei Guinness angerufen, zwei Weltrekorde sind immerhin besser als einer, aber sie sind leider verhindert.«
Ich schnaube. »Klingt ja romantisch.«
»Nur mit der richtigen Begleitung.« Er grinst verwegen, und mein Herz legt noch einmal an Tempo zu. Flirtet Mr. Hollywood mit mir? Ich glaube schon. Doch dafür habe ich leider wirklich keine Zeit.
»Ich würde ja gern mehr über euren übervollen Mülleimer hören, aber meine Fähre geht in fünf Minuten«, stammle ich.
Sein Gesichtsausdruck wird ernster. »Ah. Klar. Du bist schon auf dem richtigen Weg. Einfach weiter die Straße runter und bei der großen Abzweigung rechts. Ist nicht zu übersehen. Wenn du willst, kann ich die Fährenleute anpiepen und ihnen sagen, dass sie kurz auf dich warten sollen.«
»Oh. Das wäre toll!«
»Alles klar.« Er lächelt und richtet sich wieder auf. »Fahr vorsichtig und viel Spaß auf der Insel. Falls du Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du mich findest.« Er weist auf das Coast-Guard-Abzeichen an seiner Brust und klopft zum Abschied aufs Autodach. Dann dreht er sich um und überquert die Straße.
»Danke!«, rufe ich. Wie benommen schaue ich ihm hinterher – oder vielmehr auf seinen Hintern, der in der nassen Hose viel zu gut zur Geltung kommt. Bis mir wieder einfällt, dass der Regen gerade meinen Wagen unter Wasser setzt und ich zu dieser verfluchten Fähre muss. Kopfschüttelnd lasse ich das Fenster hoch und starte den Motor.
Ich weiß nicht mal, was eine Maserknolle ist. Es klingt absolut unspektakulär, von dem Mülleimer ganz zu schweigen. Aber wenn dieser Kerl sie mir zeigt, bin ich interessiert.
Vielleicht sollte ich einen Ausflug nach Port McNeill machen. Je mehr Gründe ich finde, um die Insel wieder zu verlassen, je mehr Ablenkung, desto besser. Aber erst mal muss ich dort ankommen. Und irgendwie das Unwetter überleben, das sich in meinem Inneren zusammenbraut und spätestens dann über mich hinwegfegen wird, wenn ich über die Schwelle meines neuen Hauses trete.
Malcolm Island wirkt vom Meer aus, als stünde die Insel kurz vor dem Weltuntergang. Der Sturm wütet hier noch heftiger als in Port McNeill. Die Wellen schlagen gefährlich hoch, und die Bäume hinter den wenigen Häusern des Fischerdorfes Sointula biegen sich im Wind. Beim Anblick des Ortes breitet sich Gänsehaut auf meinen Armen aus. Ich fühle alles und gleichzeitig nichts. Es ist ein skurriles Déjà-vu. Ich weiß, ich war schon mal hier, doch ich kann mich so schlecht daran erinnern, dass ich es genauso gut geträumt haben könnte.
Die Fähre hat tatsächlich auf mich gewartet. Womöglich nur, weil ich die einzige Passagierin bin und sie ansonsten leer gefahren wäre, aber der Grund ist mir egal. Eine halbe Stunde nach meinem Beinahe-Unfall mit Mr. Hollywood docken wir in Sointula an.
Gerade mal fünfzehn Meilen ist Malcolm Island lang. Und obwohl die Insel geschützt in der Queen Charlotte Strait, der Meerenge zwischen Vancouver Island und dem Festland British Columbias, liegt, ist dieser Spätsommersturm heftiger als alles, was ich in Edmonton je an Unwettern erlebt habe.
Das Runterfahren von der Fähre ist eine Ruckelpartie, und ich atme erleichtert auf, als ich endlich wieder festen Boden unter den Rädern habe. Ich bin kein Inselmädchen mehr. Die Wellen machen mir eine Scheißangst. Und wenn ich daran denke, dass ich erneut auf dieses Schiff muss, um wieder hier wegzukommen, fühle ich mich noch gefangener als ohnehin schon. Malcolm Island ist ein Käfig mit Ozean-Gitterstäben. Die Gefängniszelle, in der ich für alles büßen muss, was ich in den letzten Jahren verbrochen habe. Und das ist einiges.
Beruhig dich, Lavender. Es ist okay.
Ich sage es mir wieder und wieder, während ich den Golf auf dem kleinen Fährenparkplatz zum Stehen bringe. Die Bürgermeisterin wollte mich hier treffen, doch es würde mich nicht wundern, wenn der Sturm sie weggeweht hat.
Missmutig lasse ich den Blick schweifen. Der Platz ist menschenleer, aber ein paar Meter weiter ist ein Supermarkt. Brenda’s Choice steht da in großen gelben Lettern. Wenn meine Verabredung nicht auftaucht, könnte ich dort nach dem Weg fragen. Kann ich. Nur dass ich das nicht tun will. Es gibt keinen effektiveren Weg, um die Aufmerksamkeit des ganzen Dorfs auf mich zu lenken. Und damit auch ihren Ärger.
Ich beiße mir auf die Unterlippe und wäge meine anderen Optionen ab. Blind draufloszufahren, um die Straße zu finden, scheint mir nach dem Zwischenfall in Port McNeill nicht empfehlenswert. Und Google Maps wird teuer, wenn ich bedenke, dass mein Datenvolumen aufgebraucht ist. Verdammt …
In diesem Moment geht die Glastür des Supermarkts auf, und jemand in quietschgelber Regenjacke eilt durch den Sturm auf mich zu. »Lavender Whitcomb?«, ruft eine Frauenstimme.
»Ja!«, schreie ich zurück und will das Fenster runterlassen. Doch die Frau rennt schon um den Wagen herum und steigt auf der Beifahrerseite ein, wobei sie einen regelrechten Schwall Wasser mit ins Innere bringt. Jetzt ist es offiziell. Ich muss den Golf später trockenlegen.
»Hui!«, macht die Fremde und zieht sich die Kapuze vom Kopf. Wilde aschgraue Locken kommen darunter zum Vorschein, und sie wendet mir ihr wettergegerbtes Gesicht zu. »Du bringst aber ein Mistwetter mit! Gehört sich das in Edmonton so?« Lachend streckt sie mir eine nasse Hand entgegen. »Sally Oberg! Falls du dich nicht erinnerst.«
Ich schüttle ihre Hand. »Mit Ihnen habe ich telefoniert, oder?«
»Ja. Aber wir kennen uns schon, wenn man es genau nimmt. Nur dass du damals ein blonder Zwerg mit Zahnlücken warst.«
Mir wird mulmig zumute. Sie erinnert sich an mich. »Nein, tut mir leid.«
»Kein Problem. Ist ja schon etwas her, und Kinder haben andere Prioritäten als alte Frauen wie mich. Fahr mal weiter, da die Straße lang. Ich zeig dir das Haus. Die Besichtigung der restlichen Insel verschieben wir vielleicht lieber, außer du hast ein Schlauchboot im Kofferraum.« Sie lacht wieder.
»Ich habe leider nur eine Schwimmnudel«, scherze ich halbherzig und starte den Motor. Diesmal fahre ich bewusst langsam. Nicht, dass sich noch mehr attraktive Männer vor meine Motorhaube stürzen. Wobei man in diesem Kaff wohl kaum damit rechnen kann. Um ehrlich zu sein, will ich nur nicht beim Haus ankommen. Nie. Ich will umdrehen. Flüchten.
Es ist merkwürdig genug, dass ich jemanden brauche, der mir den Weg dorthin zeigt. Merkwürdig, dass ich mich an so wenig erinnere, was diese Insel betrifft. Zwölf Jahre ist es her, doch sie fühlen sich an wie hundert.
»Sind das deine echten Haare?«, fragt Ms. Oberg ungeniert und mustert meine pastelllila Wellen von der Seite.
Ich werfe ihr einen flüchtigen Blick zu, aber sie wirkt unvoreingenommen. »Ja. Also, sie sind gefärbt. Keine Perücke.«
»Wie alt bist du jetzt? Einundzwanzig?«
»Ja.«
»Mh. Bei euch jungen Leuten ist so was in, oder?«
»Ich schätze …« Eigentlich habe ich sie wegen Mom gefärbt. Weil das ihre Lieblingsfarbe war, und sie mir deswegen diesen Namen gegeben hat. Ich fühle mich ihr so näher, auch wenn ich sie nie gekannt habe.
Ms. Oberg nickt. »Ich kann mich an deinen letzten Sommer hier erinnern. Du hast dir immer diese bunten Strähnen reingebunden. Da hätten wir es ahnen müssen.«
In mir zieht sich alles zusammen. Die Erinnerung kommt ungebeten. Ich weiß noch, wie ich damals mit Onkel Jenson einkaufen war, das erste Mal die Strähnen im Haar, stolz wie Oskar. Mein Cousin Brad war neidisch und wollte sich daraufhin die Haare lang wachsen lassen, doch dazu ist es nie gekommen. Eilig wische ich den Gedanken beiseite.
»Hm«, mache ich nur.
»Manche Dinge ändern sich eben nie, was? Da vorn links, die kleine Abzweigung rein. Erkennst du es wieder?«
Ich setze den Blinker, und wir ruckeln eine matschige Einfahrt entlang. Wir sind außerhalb des Dorfkerns, hier liegen die Häuser weiter auseinander. Zwischen den Bäumen vor uns lugt der Ozean hindurch, und am Ende des Weges taucht ein kleines altes Holzhaus in unserem Sichtfeld auf.
Ich kann mich kaum an die Sommer erinnern, die ich hier verbracht habe. Nur Bruchstücke, Fragmente, die tief unter haufenweise Schuld und Schmerz begraben liegen. Aber der Anblick des Hauses ist so vertraut, als wäre ich nie weg gewesen. Als wäre es nur zwölf Monate her und nicht zwölf Jahre. Es sticht. So sehr, dass mir für einen Augenblick die Luft wegbleibt.
»Park mal so nah wie möglich an der Veranda«, fordert Ms. Oberg. »Ich bin zwar schon nass, aber du musst mein Schicksal ja nicht teilen.«
Kaum dass der Motor aus ist, hechtet die Dame mit einer beeindruckenden Schnelligkeit unter das schützende Dach. Ich folge ihr etwas vorsichtiger und fühle ich mich wie ein begossener Pudel, bis ich die Veranda erreiche. Doch das Gefühl weicht schnell wieder der Übelkeit, die mich seit Tagen begleitet. Ms. Oberg hält mir einen Schlüssel vor die Nase, und auch ihr Gesichtsausdruck hat etwas von seiner Leichtigkeit eingebüßt. Das gehört sich wohl so, wenn man das Haus eines Verstorbenen übergibt.
»Das ist jetzt deiner«, sagt sie bedeutungsvoll.
Hastig nehme ich ihn entgegen, und beinahe wäre mir das kalte Metall durch die Finger gerutscht. Ich beeile mich mit Aufsperren, damit Ms. Oberg das Zittern meiner Hände nicht bemerkt. Das Bedürfnis, mich zu übergeben, wird mit jeder Sekunde stärker, doch ich reiße mich zusammen. Die Tür geht mit einem Klacken auf, und mein Magen überschlägt sich.
Die Bürgermeisterin betritt das Haus zuerst. Ich muss mich am Türrahmen festklammern, um es hinter ihr über die Schwelle zu schaffen. Aufrecht stehen zu bleiben. Nicht einzuknicken. Zum Glück bekommt sie es nicht mit. Sie hat mir den Rücken zugewandt, das Licht angeknipst und lässt den Blick über die alte Wohnküche schweifen, in der wir stehen.
Das Innere des Hauses sieht heruntergekommener aus, als ich es mir vorgestellt habe. Die meisten Möbel sind mit Laken abgedeckt. Auf der Kommode neben der Tür liegt eine dicke Staubschicht, fast als hätte hier seit meinem Verschwinden niemand mehr gewohnt. Als würde dem Haus schon viel länger das Leben fehlen. Dabei ist Onkel Jensons Tod doch erst vier Monate her.
Vielleicht nehme ich es nur wegen meiner Schuldgefühle so wahr. Denn gleichzeitig meine ich, ihn noch lachen zu hören. Es kommt mir so vor, als müsste ich nur den Kopf drehen, um ihn und Brad auf dem Sofa sitzen zu sehen. Als würde es noch nach seinem geliebten Kaffee und dem Rührei mit Frühlingszwiebeln duften, das er immer für uns gekocht hat.
»Wir haben nichts angerührt«, reißt Ms. Oberg mich aus meinen Gedanken und schaut mich an. Hektisch blinzle ich die Tränen weg. Sie scheint es nicht zu bemerken. »Alles ist so, wie er es zurückgelassen hat. Na ja, bis auf die Laken und ein paar grundlegende Dinge.«
»Okay.« Meine Stimme klingt brüchig. Falls ihr das auffällt, sagt sie nichts dazu.
»Warmwasser und Strom funktionieren. Aber ich glaube, das Telefon ist abgestellt oder abgesteckt, das müsste sich vielleicht mal jemand anschauen. Wie lange bleibst du denn?«
Ich zucke hilflos mit den Schultern. Wenn es nach mir ginge, wäre ich ja nie zurückgekehrt. Doch ich kann nirgendwo anders hin. Nicht ohne Job, Geld oder einen Plan. Und obwohl mir seit Wochen klar war, dass das Studentenwohnheim mich rauswerfen würde, habe ich mich um nichts davon gekümmert. Irgendwie dachte ich, Dad würde auf wundersame Weise seine Meinung ändern. Seinen Charakter. »Eine Weile«, murmle ich.
»Und du willst wirklich verkaufen?« Ist das Enttäuschung in ihrer Stimme? Nein, bestimmt nicht.
»Besser, als wenn es leer steht.«
Ms. Oberg antwortet nicht sofort. Sie mustert mich, und ich frage mich, was sie wohl denkt. Ob sie das Mädchen von damals damit vergleicht, wie ich jetzt bin. Und wenn ich so darüber nachdenke, war es vielleicht doch Enttäuschung, die ich da eben gehört habe. Enttäuschung über mich.
»Wird viel Arbeit, alles auf Vordermann zu bringen«, meint sie. »Oder willst du es günstig loswerden …? Die Preise für alte Immobilien sind hier nicht berauschend, das sage ich dir gleich. Das Grundstück hingegen …«
»Mal sehen«, sage ich nur vage. Ich habe doch keine Ahnung. Ich will daran gar nicht denken. Ich will zurück zu dem viel angenehmeren Zustand des Verdrängens.
Ms. Oberg nickt und tritt hinüber in die Küche. »Komm mal her. Ich hab etwas für dich.« Sie zieht vorsichtig das Laken vom Esstisch und hängt es über einen der Stühle. Dann nimmt sie eine Papiertüte von der Arbeitsfläche und stellt sie vor mir ab. »Ich hab dir ein bisschen was eingekauft. Milch. Einen Tee …« Sie holt alles nacheinander aus der Tüte und legt es auf den Tisch. »Brot. Den Kühlschrank habe ich angestellt. Dort drin sind noch Aufschnitt und Käse. Und was Süßes.« Sie holt eine Tafel Schokolade hervor. »Aber das isst du nicht so, was?« Ihr Blick wandert über meinen Körper.
»Doch, schon.« Ich zögere einen Moment. Will ich dieser Frau etwas Persönliches von mir erzählen? Sie wirkt nett. Und das, obwohl sie weiß, wer ich bin. Persönlicher geht sowieso nicht mehr. »Aber ich jogge gern«, füge ich hinzu.
»Ah. Hoffentlich magst du dabei Gesellschaft.«
»Wie meinen Sie das?«
Sie lächelt. »Na ja, Hirsche, Vögel, Nerze und wenn du am Strand joggst, vielleicht sogar ein paar Wale …«
»Ach so. Mal schauen, ob die mit mir mithalten können.«
Ms. Oberg lacht laut. »Ich sehe schon, du hast Humor. Das ist gut, den braucht man, um mit all den Witzbolden hier im Dorf auszukommen. Benötigst du sonst noch was? Soll ich dir helfen deine Sachen reinzubringen? Wobei jetzt vielleicht kein idealer Zeitpunkt ist …« Sie blickt aus dem Fenster über der Küchenspüle, gegen das der Regen peitscht.
»Ich komme zurecht«, lehne ich ab. »Soll ich Sie wieder ins Dorf fahren?«
»Ach was. Ist nicht weit. Ich bin ohnehin schon nass. Wenn man hier wohnt, gewöhnt man sich dran, das wirst du dann schon merken. Ach ja. Hier habe ich dir ein paar Sachen aufgeschrieben.« Sie nimmt einen Zettel vom Kühlschrank. »Die Ladenöffnungszeiten, meine Telefonnummer, Fährenfahrplan. Wenn du irgendetwas brauchst, ruf an, ja? Oder komm vorbei. Ich kenne jeden auf der Insel. Die Leute hier sind sehr hilfsbereit, also versuch bitte gar nicht erst, irgendwelche großen Möbel allein zu tragen oder so.«
Ich lächle, auch wenn es sicher genauso gequält aussieht, wie es sich anfühlt. Ich glaube nicht daran, dass die Leute hier nett sein werden. Zumindest nicht die, die mit meinem Onkel befreundet waren. Dementsprechend werde ich gar nicht erst einen Gedanken daran verschwenden, die Möbel zu verschieben. Am besten, ich lasse alles so, wie es ist. Mische mich nicht ein. Bloß keine Aufmerksamkeit. »Danke, Ms. Oberg.«
»Ach.« Sie winkt ab, aber ihre Miene verfinstert sich kaum merklich. »Ich bin einfach froh, dass du jetzt hier bist. Wie du schon sagtest … besser, als wenn es leer steht.« Sie klopft mir im Vorbeigehen auf die Schulter und setzt ihre Kapuze wieder auf. Mit Mühe versucht sie, ihre Locken darunterzukriegen. »Mach’s gut, Lavender. Und mein Beileid.«
Ich schlucke schwer und bringe nicht mehr als ein Nicken zustande. Die Bürgermeisterin verlässt das Haus und zieht die Tür hinter sich zu, aber ihre Worte klingen in mir nach, legen sich bleischwer in meine Magengrube.
Mein Beileid. Als hätte nicht jeder auf dieser Insel das mehr verdient als ich.
Ich bin froh, dass du jetzt hier bist.
Besser, als wenn es leer steht.
Ich habe das selbst gesagt. Doch es aus einem fremden Mund zu hören, macht die Worte schmerzhafter. Ich bin hier nicht mehr willkommen, das weiß ich. Egal, wie freundlich Ms. Oberg lächelt, egal, wer meine Möbel rückt. Ich bin es seit zwölf Jahren nicht mehr und werde es nie wieder sein. Dafür habe ich nach dem Unfall selbst gesorgt.
Ich starre Ms. Oberg hinterher. Es ist nichts zu hören bis auf das Tosen des Sturms und das Prasseln des Regens.
Von zwei der Zimmer oben aus kann man den Ozean sehen. Früher habe ich die Fenster immer aufgemacht und mich rausgelehnt, weil ich glaubte, der Wind, der einem dort ins Gesicht schlägt, sei das schönste Gefühl auf der Welt. Jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, diese Treppe zu erklimmen und die drei Schlafzimmer noch mal zu betreten. Allein in diesem Wohnzimmer zu stehen, kostet mich all meine Kraft.
Ich gehe zum Sofa und ziehe das Laken ab. Die Couch ist dieselbe wie damals. Dunkelrot, in L-Form. An einem Nachmittag habe ich Brad beim Herumalbern versehentlich mit meinem Ellbogen gestoßen, als er gerade ein Glas Kirschsaft in der Hand hatte, und er hat alles vollgetropft. Onkel Jenson hat gescherzt, dass man es dank der Farbe ohnehin nicht sehen könne. Aber der Fleck ist getrocknet und wurde zu einem dunklen Braun, das sich bis heute von dem Stoff abhebt. Ein Beweis, dass ich mal hier war. Etwas, das nicht gemeinsam mit mir verschwunden ist.
Dieser Fleck ist treuer als ich. Und dieses Wissen zerreißt mir das Herz. Erinnerungen drängen in mir an die Oberfläche. Ich lasse mich auf das Polster fallen und schlinge die Arme eng um meinen Körper.
Ich will sie nicht. Ich will nicht hier sein.
Ich will dieses Haus nicht haben, das so voll mit allem ist, was ich zwölf Jahre lang vermieden habe.
Aber was will ich stattdessen? Jetzt, wo Dad mein Leben nicht mehr diktiert, fühle ich mich aufgeschmissen. Überfordert. Erst hat er mich ins Internat gezwungen, dann in einen Studiengang, den ich nicht wollte. Was er mir nie beigebracht hat, ist, selbst etwas zu entscheiden. Warum auch? Seine Entscheidungen waren ohnehin die einzig richtigen. Ich wünschte, er würde sich wenigstens melden, und gleichzeitig bin ich wütend auf ihn. Zwei Wochen Funkstille sind es schon, und ich komme mir erbärmlich vor, ihn um Geld gebeten zu haben. Ich will sein verdammtes Geld nicht, weil es schon immer an Bedingungen geknüpft war, die ich eigentlich gar nicht erfüllen wollte. Aber es ist so hart allein … Ich sacke auf der Couch zur Seite und schließe die Augen. Wenn ich es mir stark genug wünsche, ist das dann alles ein Traum?
Wohl kaum. Die Tränen sind echt. Das Schluchzen auch. Der Schmerz erst recht. Ich rolle mich so klein zusammen, wie es irgendwie geht, und lasse alles über mich hereinbrechen.
Kapitel 2
JONNE
Dieser Sturm ist der schlimmste, den wir im letzten halben Jahr hatten. Ich bin seit zehn Stunden nass, habe drei Sets Wechselklamotten durch und den Wunsch aufgegeben, trocken zu Hause anzukommen. Der Regen hat mittlerweile aufgehört, aber es lohnt sich nicht mehr, sich noch umzuziehen. Die Spätsommertemperaturen machen die Nässe erträglich, und ich bin ohnehin gleich daheim.
Ich betrete Brenda’s, und die Glocke über der Tür kündigt mich an. Wie so oft sitzt Brenda hinter der Kasse, die Nase in einem ihrer Kreuzworträtsel vergraben. Sie schaut auf und nickt, als sie mich erkennt. Ihr Blick wandert an mir hinab und bleibt dann vorwurfsvoll am Boden zu meinen Füßen hängen, den ich volltropfe. Sie schaut mir wieder ins Gesicht und hebt die Brauen. Ich zucke entschuldigend mit den Schultern.
Brenda rollt mit den Augen und weist in Richtung der Regale. Ein stummes geh. Sie hat wohl einen guten Tag. Wenn sie eine ihrer Launen hätte, würde ich es ihr zutrauen, dass sie mich mit dem Besen wieder aus dem Laden scheucht. Und manchmal lege ich es genau darauf an, weil ich weiß, dass es ihr insgeheim Freude bereitet und ihr zumindest ein zufriedenes Schmunzeln aufs Gesicht zaubert. Ich grinse Brenda an, schüttle mich wie ein Hund und verschwinde schnell aus ihrem Sichtfeld. Ihr Lachen folgt mir.
»Unverschämte Kundschaft mit sechs Buchstaben?«, ruft sie.
»Aalton!«, gebe ich zurück.
»Bravo, hast ja doch was im Köpfchen! Bevor ich’s vergesse, sag deiner Cousine, dass ihre Horrorbestellung da ist.«
»Oje, hoffentlich vergesse ich es nicht«, witzle ich über das Regal hinweg.
»Ich sag ja: unverschämt! Pass auf, Mr. Aalton, oder ich hole den Wischmopp!« Sie betont meinen Namen fast spöttisch.
»Willst du nicht lieber erst wischen, wenn ich wieder draußen bin?«
Brenda schnaubt so laut, dass ich es selbst hinten im Laden höre. Lachend trete ich um die nächste Ecke, aber es bleibt mir im Hals stecken, als ich sehe, wer dort vor dem Kühlregal steht. Was macht sie denn noch hier? Ich habe nicht damit gerechnet, sie wiederzusehen. Die meisten Tagestouristen reisen am Nachmittag wieder ab und stehen nicht nach Feierabend im Supermarkt.
Die Fremde hat mir den Rücken zugewandt. Ihre lilafarbenen Haare fallen ihr vom Wind zerzaust bis unter die Schulterblätter, und sie trägt einen dunkelblauen Regenmantel mit passenden Gummistiefeln. Ihre Beine sind nackt, ich sehe noch den Saum eines weißen Rocks. Sie wirkt in Gedanken, also räuspere ich mich. Fast schüchtern dreht sie sich zu mir um, und wie schon heute Mittag trifft mich ihr Blick mitten in den Magen. Es liegt eine Niedergeschlagenheit darin, die in mir das sofortige Bedürfnis weckt, sie in den Arm zu nehmen und zu trösten. Ich kann gar nicht erklären, was genau es ist. Sie wirkt aufgelöst, als müsste sie sich mit Mühe zusammenhalten, während die Fassade unaufhörlich bröckelt. Und scheinbar verliert sie den Kampf, denn im Vergleich zu jetzt war sie heute Mittag geradezu freudestrahlend. Ihre blauen Augen sind rot umrandet, als hätte sie geweint, und allein bei der Vorstellung zieht sich etwas in mir schmerzhaft zusammen. Verdammter Beschützerinstinkt. Verdammte Sommersprossen …
»Du bist ja immer noch hier«, platzt es aus mir heraus. Fuck, das klang echt unhöflich. Ich schiebe ein Schmunzeln hinterher, und ihre Miene hellt sich ein klein wenig auf.
»Und du bist immer noch nass«, kontert sie und lässt ihren Blick über meinen Körper wandern.
Ich muss lachen, und jetzt schleicht sich ein Lächeln auf ihre Lippen. Ich weiß wieder, warum ich heute Mittag so peinlich von vollen Mülleimern erzählt habe. Wenn sie lächelt, brennen in meinem Gehirn irgendwelche Synapsen durch – oder was auch immer da oben so vonstattengeht. Es macht sie unbeschreiblich schön. Und es wischt diesen schwermütigen Ausdruck von ihrem Gesicht, der dort einfach nicht hingehört. »Leider, ja«, bestätige ich. »So schnell trifft man sich wieder. Du hast es also zur Fähre geschafft?«
»Dank dir, ja.«
Ich runzle die Stirn und trete näher an sie heran. Erst in diesem Moment wird mir bewusst, wie spät es ist. Die letzte Fähre zurück ist eben gefahren. »Du bleibst länger?«
Die Fremde nickt.
»Und ich dachte, du wärst eine abenteuerlustige Tagestouristin, die auf Extremwetter steht.«
Sie zögert. »Über das abenteuerlustig lässt sich diskutieren. Aber ein Tag reicht sowieso nicht, ich muss mir immerhin dieses … Knollending anschauen, von dem du so geschwärmt hast. Und den berüchtigten Mülleimer.«
Dieser gottverdammte Mülleimer. Ich überspiele es mit einem Grinsen. »Du meinst die größte Maserknolle der Welt. Für die Bezeichnung Knollending würde man dich in Port McNeill wahrscheinlich mit Fackeln und Mistgabeln jagen.«
Röte stiehlt sich auf ihre hellen Wangen, aber sie hält meinem Blick stand und reckt kaum merklich das Kinn. »Ich brauche wohl wirklich einen Fremdenführer.«
Ich versuche meine Überraschung zu verbergen und scheitere kläglich. Sie geht darauf ein? Damit habe ich nicht gerechnet. Doch ich werde mich nicht beschweren. »Stets zu Diensten«, erwidere ich. »Aber wenn ich ehrlich bin … den Mülleimer würde ich weglassen.«
»Obwohl er so romantisch ist?«
Ich zwinkere ihr zu. »Es gibt noch ein paar romantischere Orte.«
Ihre Wangen werden dunkelrot. »Du bist der Experte. Ich lasse mich überraschen.« Scherzen wir oder meint sie es ernst? Ich weiß auf jeden Fall, wie ich es meine. Und das hier ist eine Steilvorlage für ein Date, oder?
»Morgen dann?«, schlage ich vor. »Das Wetter soll besser werden. Ich habe frei. Um eins geht die Fähre, und wenn wir zurück sind, zeige ich dir die Insel.«
Was tue ich hier eigentlich? Seit wann mache ich mich an Touristinnen ran? Doch sie hat etwas an sich, das mir schon den ganzen Tag nicht aus dem Kopf gegangen ist. Es ist ihr Gesicht. Zumindest ist es das, was ständig vor meinem inneren Auge aufgetaucht ist. Ihr trauriger Blick. In Kontrast dazu ihr Lächeln. Und die Tatsache, dass sie mir bekannt vorkommt. Dabei bin ich mir sicher, sie noch nie gesehen zu haben. Daran würde ich mich erinnern.
Ihre Überraschung ist offensichtlich. Vielleicht hat sie doch nur einen Witz gemacht. Ich rechne schon mit einer Absage, doch ihre Augen beginnen zu strahlen, und ein zaghaftes Lächeln umspielt ihre vollen Lippen. Fuck, sie ist süß. »Dann treffen wir uns an der Fähre?«, fragt sie.
»Zehn vor eins?«
»Klingt gut.«
Wieder kann ich mein Grinsen nicht verbergen. Ich stehe da wie ein verknallter Teenager und himmle sie an. Mein letzter freier Sonntag ist eine Ewigkeit her, und ich wollte den morgigen Tag eigentlich nutzen, um ein paar dringende Sachen von meiner To-do-Liste abzuhaken. Dennoch macht es mich seltsam glücklich, ihn stattdessen mit ihr verbringen zu können.
»Wirst du was Trockenes anziehen?« Sie errötet noch mehr und beißt sich auf die Unterlippe, als hätte sie das nicht sagen wollen. Mein Blick bleibt unweigerlich daran hängen.
»Du verlangst unmögliche Dinge von mir«, raune ich. Sie muss aufhören, so zu lächeln. Es löst einen Sturm in mir aus, der schlimmer ist als das Unwetter draußen.
»Wirst du bei deinem Job oft nass?«, fragt sie verstohlen und wendet sich dem Kühlregal zu. Sie öffnet die Tür und nimmt eine Packung Joghurt heraus. Bevor mein Verstand einschreiten kann, bin ich schon direkt hinter sie getreten und greife an ihr vorbei nach der Butter. Dabei komme ich ihr so nah, dass ich ihr Parfüm riechen kann. Sie duftet nach Vanille und … Kardamom? Süßlich, ein bisschen nach Herbst. Und sie ist groß für eine Frau, wenn auch ein Stück kleiner als ich. Es gefällt mir, dass wir fast auf Augenhöhe sind. Dass ihr Gesicht so nah an meinem ist.
»Normalerweise nur, wenn ich Ertrinkende aus dem Wasser retten muss«, antworte ich leise.
Sie sieht zu mir hoch, und ich frage mich, auf was für ein Niveau ich hier sinke. Gebe ich ernsthaft mit meiner Rettungsschwimmerausbildung an, um eine Frau zu beeindrucken? Die Leute, denen ich das Leben gerettet habe, kann ich an meinen Fingern abzählen.
»Gerade siehst du eher aus, als wärst du selbst fast ertrunken«, erwidert sie grinsend.
Ich muss lachen. »Touché.« Ihr Gesicht ist voller Sommersprossen. Sie scheinen mehr zu werden, je näher man ihr kommt. Ich erwische mich dabei, wie ich versuche sie zu zählen und dabei wieder nur dastehe und sie anstarre.
Sie schließt die Regaltür und hebt ihren vollen Korb hoch, ohne sich von mir zu entfernen. »Ich hab alles.«
»Kann ich dir tragen helfen?« Die Worte haben meinen Mund verlassen, bevor ich groß darüber nachdenken kann.
»Brauchst du nichts mehr?« Sie schaut hinunter auf die Butter in meiner Hand.
»Nope.«
»Du kommst nur für eine Packung Butter her?«
»Buttertoast«, sage ich gespielt ernst. Mehr wird es morgen früh dann auch nicht geben, da ich gerade den Rest meiner Einkaufsliste ignoriere. Erst rede ich über Mülleimer, dann über Buttertoast. Warum sie noch nicht vor mir geflüchtet ist, ist mir ein Rätsel. Aber sie wirkt eher belustigt als besorgt. »Darf ich?« Ich nehme ihr den Korb ab und bringe ihn für sie zur Kasse. Brenda zieht fragend die Augenbrauen hoch, als sie uns zusammen erblickt, sagt aber nichts. Ich lege die Butter aufs Kassenband und helfe dann, auch die anderen Sachen daraufzupacken.
»Das macht zwei Dollar, Jonne«, verkündet die ältere Dame mit einem vielsagenden Unterton.
Ich reiche Brenda das Geld, ignoriere ihren Blick und stecke die Butter in meine Jackentasche. Der Einkauf meiner Begleitung ist um einiges größer. Ich packe alles in zwei Tüten und warte, dass sie bezahlt. Dabei entgeht mir nicht, dass Brendas Hand unter ihren Kassentresen wandert. Zweifelsohne zu den Werbekondomen, die sie dort bunkert und mit denen sie sich ständig Scherze erlaubt.
Ich räuspere mich lautstark, und sie erstarrt. Beide Frauen schauen fragend zu mir. Brenda hat eine Unschuldsmiene aufgesetzt, doch ich fixiere sie stur mit meinem Blick und schüttle langsam den Kopf. Sie verdreht die Augen, zieht ihre Hand zurück und nimmt das Geld entgegen. Als wir kurz darauf den Laden verlassen, bin ich erleichtert. Ich liebe unsere Dorfgemeinschaft, doch sie kann auch anstrengend sein. Morgen spricht zweifelsohne die ganze Insel über uns. Kein Geheimnis ist vor Brendas wachsamen Augen und ihrem losen Mundwerk sicher.
Draußen regnet es wieder, aber der Wind hat nachgelassen. Meine Begleiterin zieht sich die Kapuze ihres Regenmantels über den Kopf und sieht mich entschuldigend an. »Ich bin hergelaufen. Du musst nicht …«
Ich schüttle den Kopf. »Bin schon nass, vergessen? So bin ich wenigstens nass und nützlich.«
»Ertrinkende retten ist dir nicht nützlich genug?«, zieht sie mich auf und setzt sich in Bewegung.
Ich folge ihr. »Das passiert so selten, das zählt nicht. Wo wohnst du denn? Weit kann es ja nicht sein.«
Sie antwortet nicht sofort. Ich werfe ihr einen Seitenblick zu und sehe, wie sie sich wieder auf die Unterlippe beißt. »In einem von den Häusern unten am Meer.«
»Kaleva Road?«, rate ich. Für alles andere hat sie die falsche Richtung eingeschlagen.
»Jep.«
Ich wusste gar nicht, dass dort jemand an Touristen vermietet. Aber woher auch? Ich meide die Straße. »Wo kommst du her?«
»Edmonton.«
Fuck, okay. Das ist weit. Aber nicht zu weit, oder? Wie lang dauert ein Flug von Vancouver aus? Zwei Stunden? Warum denke ich über so was nach? Mann, ich kenne diese Frau gar nicht. Ich möchte es nur unbedingt. Ich will wissen, wer sie ist. Warum mich dieses Gesicht nicht loslässt. Und dieses Bedürfnis hatte ich lang nicht mehr.
»Großstadtmädchen, was?«, ist das Einzige, was mir einfällt. Wir lassen den Ortskern hinter uns und folgen der Straße, die parallel zum Ozean in Richtung Osten verläuft.
»Ja. Aber … ich hab mich dort nie richtig wohlgefühlt, ehrlich gesagt.« Ihre Stimme klingt mit einem Mal wieder niedergeschlagen. Erneut muss ich an ihren Blick von vorhin denken. An ihre geröteten Augen. Nur zu gern würde ich herausfinden, was mit ihr los ist. Aber ich will nicht zu aufdringlich sein, also verkneife ich mir die Frage.
»Wohnst du nicht mehr dort?«, hake ich vorsichtig nach.
»Nein.« Sie kaut wieder auf ihrer Lippe. Ist sie nervös, oder ist das einfach eine Angewohnheit von ihr?
»Und wo wohnst du jetzt?«
Stille. »Hier«, sagt sie dann so leise, dass ich es über das Rauschen der Wellen hinweg fast nicht höre. »Erst mal.«
Okay. Jetzt habe ich einen ganzen Haufen an Fragen. Vorneweg die, warum sie ausgerechnet hierher gekommen ist. Sie wirkt nicht glücklich, oder? Wäre sie lieber woanders?
»Na dann, umso besser, dass du einen kompetenten Fremdenführer wie mich an deiner Seite hast«, versuche ich sie aufzumuntern. »Ich bin sicher, du wirst dich hier bald wie zu Hause fühlen. Die Leute sind furchtbar nett. Also wirklich furchtbar. Manchmal wäre ein bisschen Distanz ganz gut.« Ich zwinkere ihr zu.
Sie schnaubt, aber es klingt eher wie ein Schluchzen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die Kurve heute nicht mehr kriegen. Trotzdem lächle ich sie an. Lieber würde ich sie in den Arm nehmen, doch das steht mir nicht zu.
Sie versucht, es zu erwidern, scheitert allerdings kläglich. Was auch immer mit ihr los ist, lässt sich nicht einfach so beiseiteschieben.
»Wie heißt du eigentlich?«, frage ich, um sie vom Thema abzulenken.
Sie zögert wieder. »Lavender. Und du bist Jonne? Die Frau an der Kasse hat dich so genannt.«
Der Name lässt mich stocken. Aber das ist nur ein beschissener Zufall, oder? Bestimmt. Sie ist nicht die Lavender. Sie kann es nicht sein. Selbst wenn wir zu der Straße laufen, um die ich sonst einen Bogen mache.
»Jep«, antworte ich.
»Der Name ist ungewöhnlich.«
»Er ist finnisch.«
»Ah.« Sie nickt verstehend.
»Du kennst dich also mit der Inselgeschichte aus?« Ist sie es doch? Quatsch. Das kann man auch im Internet herausfinden. Achtzig Prozent der Touristen wissen das.
»Minimal. Ich weiß, dass es ursprünglich eine finnische Siedlung war.«
»Genau. Meine Urgroßeltern waren bei der Gründung dabei. Und in meiner Familie halten sich einige Traditionen hartnäckig. Zum Beispiel die, seinen Kindern Namen zu geben, die kein Kanadier richtig aussprechen kann. Wenn du wüsstest, wie oft ich Johnny genannt werde …«
»Mir gefällt Jonne«, sagt sie.
Lavender … Sie ist es nicht. Ich bin mir sicher. Allein der Gedanke ist doch absurd. »Danke.«
»Was bedeutet er?«
Oh, fuck. »Das musst du meine Mutter fragen«, rette ich mich. Ich bin nicht gut im Lügen. Also umgehe ich die Antwort besser.
Misstrauisch zieht Lavender die Augenbrauen zusammen. Sie hat mich durchschaut. »Ist es was Peinliches?«
Ich versuche, ein ernstes Gesicht zu bewahren. »Ich weiß nicht, was du meinst.«
»Ich werde googeln«, warnt sie mich. »Also … sobald ich Internet habe.«
»Du hast kein Internet?«
»Nein. Das Telefon geht auch nicht.«
»Hm. Soll ich es mir mal anschauen? Was sagen denn deine Vermieter dazu?«
Sie schüttelt den Kopf. »Das Haus gehört mir.«
»Wie, das Haus gehört …«
Ich halte inne.
Lavender ist auf eine der Grundstückseinfahrten abgebogen, und ein schmerzhafter Stich schießt durch meinen ganzen Körper.
Ich würde mir gern weiter einreden, dass das nicht wahr ist. Aber wie schon erwähnt: Ich bin nicht gut im Lügen. Der Name. Die Straße. Das Haus, das jetzt ihr gehört. Bis gestern hat es leer gestanden. Es hätte so bleiben sollen.
Ich weiche einen Schritt zurück. Lavender bleibt stehen und sieht mich an. Die Verunsicherung in ihrem Blick spricht Bände. Sie weiß es genauso gut wie ich, oder? Deswegen hat sie vorhin gezögert, hat nur die Straße genannt.
»Was ist los?«, fragt sie leise.
Ich schnaube und kämpfe gegen die Wut an, die in mir hochkocht. Als wüsste sie das nicht. Ich komme mir so verarscht vor.
Lavender Whitcomb. Die Nichte von Jenson Whitcomb.
Fuck! Natürlich kommt sie mir bekannt vor. Ich habe dieses Gesicht schon tausendmal gesehen – nur zwölf Jahre jünger und umrahmt von schulterlangen hellblonden Haaren. Das Bild von ihr steht wahrscheinlich heute noch auf Jensons Kommode. Ich habe es so oft angestarrt und mich geärgert. Über sie. Ihre Züge sind dieselben. Auch die Sommersprossen sind geblieben. Sie lassen sie weiterhin niedlich und unschuldig wirken, verbergen ihren hässlichen Charakter.
Es kostet mich alles an Selbstbeherrschung, Lavenders Einkäufe nicht gegen den nächstbesten Baum zu schleudern. Stattdessen stelle ich die Tüten geradezu schmerzhaft sanft auf dem matschigen Weg ab. Das Papier wird durchweichen und reißen. Es ist mir scheißegal.
»Jonne?«, fragt sie zaghaft, und der Sturm in meinem Inneren schnürt mir die Luft ab. Vorhin war er etwas Positives. Jetzt ist es purer Hass. Sie klingt so verletzlich. Aber es ist alles nur Fassade. Ich weiß ganz genau, wer sie ist. Was sie getan hat. Was sie hier macht.
Sie ist hier, um auch noch den letzten Rest, der von Jenson geblieben ist, zu zerstören. Und wenn ich nicht sofort von hier verschwinde, werde ich explodieren.
»Ich muss los«, würge ich hervor und wende mich ab. Ich erkenne meine eigene Stimme nicht wieder. Sie klingt eisig.
Die ersten Schritte, die ich mache, sind die schlimmsten. Weil ich mich umdrehen und ihr ins Gesicht schreien will. Weil ich ihr den Haustürschlüssel aus der Hand reißen sollte, den sie vorhin aus ihrer Tasche gezogen hat. Weil ich ihr entgegenbrüllen will, was ich von ihr halte.
Aber was würde das bringen, außer dass Jenson sich im Grab umdreht? Er hat genug gelitten. Und das ihretwegen.
Also laufe ich weiter, vergrabe die Hände in meinen Jackentaschen und umklammere die Butterpackung, als ginge es um mein Leben.
Lavender folgt mir nicht. Sie steht einfach nur da, ruft mir nicht noch einmal nach. Schweigt. Wahrscheinlich weil ihr absolut klar ist, dass sie nichts sagen kann, was helfen würde. Und dass sie nichts als Verachtung verdient hat.
Kapitel 3
LAVENDER
Er wird nicht kommen.
Das wusste ich schon, als Jonne sich gestern einfach umgedreht und meine Einkäufe in den Matsch gestellt hat, kaum dass er realisiert hat, wer ich bin. Das war es, was ihn zum Gehen bewegt hat. Erst war er nett zu mir. Aber mein Name in Verbindung mit diesem Haus hat aus mir jemanden gemacht, mit dem er keine weitere Sekunde verbringen wollte. Für den er nicht mal einen Abschiedsgruß übrig hatte. Er bereut wahrscheinlich jedes freundliche Wort, das er mit mir gewechselt hat. Und ich kann es ihm nicht mal verübeln.
Dennoch trifft mich die Erkenntnis in diesem Moment härter als erwartet. Ich hocke auf einem Pfosten der Hafenabsperrung und lasse zu, dass ein kleiner Teil von mir sich schmerzhaft über dieses abrupte Ende wundert. Das war es dann mit Jonne. So schnell, wie er in meinem Leben aufgetaucht ist, so schnell ist er auch wieder verschwunden.
Es sollte mich nicht stören. Es war vorhersehbar.
Aber an diesem düsteren Tag gestern war er das Einzige, das mich über Wasser gehalten hat. Und jetzt?
Jetzt gehe ich unter.
Reiß dich zusammen, Lavender.
Wenn ich ehrlich bin, ist der stechende Schmerz, den der Anblick der ablegenden Fähre in mir auslöst, sogar besser als der dumpfe, der mir schon in den Gliedern sitzt, seit ich Edmonton verlassen habe. Und dieser Vergleich ist noch fragwürdiger als die Tatsache, dass ich ernsthaft dachte, Jonne könnte mich mögen und heute trotz allem zu unserer Verabredung erscheinen. Wie konnte es passieren, dass ich ihn in diesen wenigen Minuten, die wir uns kannten, schon so nah an mich herangelassen habe, dass er mich verletzen konnte? Bin ich so verzweifelt, dass ich mich an jeden noch so dünnen Strohhalm klammern muss?
Ja. Verdammt …
Ich wende den Blick vom Hafen ab und vergrabe einen Moment lang das Gesicht in den Händen. Eigentlich wollte ich meine düsteren Gedanken so loswerden, aber die Augen zu schließen bewirkt eher das Gegenteil. Es bringt die Albträume von heute Nacht zurück. Ich sehe wieder Onkel Jenson vor mir, das so vertraute Schmunzeln auf seinen Lippen. Das freche Grinsen von Brad. Und dann Jonnes freundliches Lächeln, das erlischt, bevor ich es genießen kann. Genauso schnell, wie Brad und Jenson gestorben sind.
Der Gedanke lässt mich erschaudern. Ich schüttle den Kopf und konzentriere mich wieder auf die Wellen in sicherer Entfernung. Obwohl der Sturm abgeklungen ist, bleibt das Meer unruhig. Bedrohlich.
Eigentlich sollte ich froh sein, dass Jonne nicht aufgetaucht ist. Bei diesem Seegang will ich wirklich nicht auf die Fähre, die gerade wild schaukelnd auf Vancouver Island zusteuert. Bestimmt hätte ich mich blamiert und ihm entweder vor die Füße gekotzt oder mich so fest in seinen Arm gekrallt, dass er danach hätte genäht werden müssen. Auch ein guter Weg, um ein Date zu ruinieren.
Und was hätten wir überhaupt am anderen Ufer gemacht? Port McNeill angeschaut, das nur ein Haufen alter Häuser rund um eine übergroße Was-auch-immer-Knolle ist? Sind wir mal ehrlich, darauf hatte ohnehin keiner von uns beiden Lust.
Aber das ist auch gelogen. Ich würde gerade alles tun, um mich von meinem Leben abzulenken. Fuck, jetzt denke ich schon wieder darüber nach. Ich merke erst, dass ich auf meiner Unterlippe kaue, als ich Blut schmecke. Nicht mal diesen Tick habe ich unter Kontrolle. Mein Leben ist mir so endgültig entglitten, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, um es wieder in den Griff zu bekommen. Wie soll ich das anstellen? Womit beginnt man, wenn alles, wirklich alles, derart in Scherben liegt?
Ich seufze tief. Geld. Das wäre ein guter Anfang. Insbesondere, weil ich mir bald nicht mal mehr Essen leisten kann. An die Strom- und Wasserrechnungen will ich überhaupt nicht denken. Ich brauche einen Job, und zwar dringend.
Doch auch bei diesem Punkt bin ich ratlos, wo ich beginnen soll. Ich habe ja keinerlei Berufserfahrung, keine Ausbildung. Vielleicht sollte ich stattdessen direkt schauen, ob ich das Haus loswerde. Nur weil Ms. Oberg behauptet, es sei nichts wert, muss das ja nicht stimmen, oder? Nur wie finde ich das heraus, ohne einen Makler zu bezahlen, den ich mir absolut nicht leisten kann? Vielleicht wenn ich ein paar der Möbel verkaufe …
Okay, Lavender. Jetzt denk mal mit. Du lebst auf einer verdammten Insel. Niemand wird hierherkommen, um eine alte Couch mit Kirschflecken abzuholen. Mal abgesehen davon, dass das dein Bett ist, weil du dich nicht überwinden kannst, hoch zu den Schlafzimmern zu gehen aus Angst, dass dich die Erinnerungen dort erschlagen. Und wenn du das Haus jetzt verkaufst, hast du zwar ein bisschen Geld auf dem Konto, aber immer noch keinen Job und kein Dach mehr über dem Kopf.
O Gott … Wenn ich wenigstens Internet hätte. Ich bin nicht vorbereitet. Dieses ganze Unterfangen war völlig kopflos. Und das nur, weil ich bis zur letzten Minute gezögert habe. Weil ich einfach nicht wahrhaben wollte, dass ich hier ende. Zwei Wochen hätte ich Zeit gehabt. Mehr sogar. Schon als das Prüfungsergebnis in meinem Postfach landete, hätte ich darüber nachdenken können. Spätestens nach der Exmatrikulation hätte ich es tun müssen.
Aber ich war zu feige. Bin es immer noch. Ich möchte schreien. Oder heulen. Vielleicht auch beides gleichzeitig. Ich habe keine Ahnung.
Ziellos stehe ich auf, wende mich vom Meer ab und setze mich in Bewegung. Wohin überhaupt? Wahrscheinlich nach Hause, um mich dort wieder weinend auf dem Sofa zusammenzurollen. Klingt nach einem Plan.
Allerdings komme ich nicht weit. Gerade als ich den kleinen Platz überquere, tritt eine junge Frau in meinem Alter aus dem Supermarkt. Sie trägt ihre dunklen Haare als Longbob mit kerzengeradem Pony und hat sich ein dick in Klebeband eingewickeltes Päckchen unter den Arm geklemmt. Ihr Blick fällt auf mich, und ein Strahlen breitet sich auf ihrem hübschen Gesicht aus.
»Du bist die Neue!«, ruft sie aus und kommt auf mich zugeeilt. Ich erstarre und weiß einen Moment nicht, was ich jetzt tun soll. Die Neue? Ist das ein Kompliment? Eine Beleidigung? Warum lächelt sie so, wenn sie doch weiß, wer ich bin? Beinahe rechne ich damit, dass die Fremde mit der Stupsnase mir übermäßig euphorisch eine klatscht, aber stattdessen streckt sie mir ihre Hand entgegen, und ich ergreife sie rein aus Reflex.
»Hi!« Sie drückt kräftig zu. Nicht schmerzhaft, sondern herzlich. Ihre blauen Augen lächeln mit ihrem Gesicht um die Wette, und alles an ihr wirkt so echt, dass ich noch verwirrter bin. »Ich bin Auri!«
»Ähm … Lavender«, stammle ich und lasse zu, dass sie meinen Arm durchschüttelt. Sie ist ein ganzes Stück kleiner als ich, aber sie hat verdammt viel Kraft.
»Weiß ich doch! Du bist Jensons Nichte! Sally hat mir erzählt, dass du gestern angekommen bist. Sally Oberg, meine ich.«
»Oh … okay«, mache ich nur.
Auri lässt meine Hand los, und ich unterdrücke das Bedürfnis, die Arme schützend vor meiner Brust zu verschränken.
»Dich hat bestimmt noch keiner rumgeführt, oder?«, fragt sie. »Schaust du dich gerade um?«
»Nein, also … noch nicht. Aber du musst nicht …«
»Ich hab Zeit! Du brauchst unbedingt eine Führung, jetzt, wo du hier wohnst.«
Ich öffne den Mund, um zu protestieren. Um ihr zu sagen, dass ich hier ganz sicher nicht wohne, dass ich keine Führung brauche, um ihr irgendeine Ausrede aufzutischen, weshalb ich dringend wegmuss. Doch da hat Auri sich bereits bei mir untergehakt und zieht mich in Richtung Dorfkern. Panik steigt in mir auf. Ich kann nicht …
»Das Wichtigste ist direkt hier!«, verkündet sie. »Die Chocolate Dreams Bakery. Ich würde sterben für Tommys Schokobrötchen. Wirklich. Manchmal esse ich drei am Tag. Dafür verzichte ich gern auf eine richtige Mahlzeit. Oh, wie wär’s mit einer Wegzehrung? Ich spendier dir eins!«
Mein Gehirn ist völlig überfordert mit der Flut an Informationen, die Auri mir hier vor die Füße wirft. Dazu kommt das vage Gefühl eines Déjà-vus, weil ich so oft in dieser Bäckerei gestanden haben muss und mich so gut wie nicht daran erinnere. Auri steuert auf das kleine Gebäude zu, das direkt am Hafen liegt, und ich stemme automatisch die Beine in den Boden, unfähig, auch nur einen weiteren Schritt darauf zu zu machen. Alles in mir zieht sich zusammen. Allein bei dem Gedanken, den Leuten da drin gegenüberzustehen, bricht mir der Schweiß aus. Eine Reaktion wie die von Jonne gestern reicht mir. Für den Rest meines Lebens, wenn ich ehrlich bin.
»Nein danke. Ich hab gerade gegessen«, lüge ich und bekomme sofort ein schlechtes Gewissen.
»Auch kein halbes?«, bietet Auri an, die meine Stimmung nicht bemerkt zu haben scheint. Habe ich so ein gutes Pokerface? »Ich opfere mich und esse deine zweite Hälfte.« Sie zwinkert mir zu. Warum ist sie so freundlich? Kannte sie meinen Onkel nicht? Das hier ist doch ein winziges Fischerdorf. Hier kennt jeder jeden.
»Vielleicht ein andermal«, erwidere ich. »Und ich weiß auch nicht … wegen der Führung …«
»Oh. Okay, verstehe.« Jetzt hat sie es begriffen. Die Enttäuschung ist ihr anzusehen, aber sie lächelt und lässt meinen Arm los. »Sorry, ich habe dich ganz schön überrumpelt, oder? Ich habe mal wieder erst gemacht und dann nachgedacht. Wie immer.« Auri lacht verlegen und befördert das Päckchen von ihrem rechten Arm unter ihren linken, als müsste sie dort meinen ersetzen. Ein Geruch, der mich an alte Turnschuhe erinnert, wird dabei von der nächsten Windböe zu mir rübergetragen. Ich versuche, nicht die Nase zu rümpfen.
»Kein Problem«, versichere ich ihr. »Aber ich muss mich erst akklimatisieren, bevor ich mich ins Getümmel stürze.«
»Na klar. Kann ich dir vielleicht bei irgendwas helfen?« Auri schaut mich so hoffnungsvoll an, dass meine Gewissensbisse noch größer werden.
Einen Moment lang stehe ich unschlüssig herum. »Kannst du mir zeigen, wo Ms. Oberg wohnt?«, frage ich dann. »Oder vielleicht rufe ich sie lieber an. Ich will sie nicht stören.«
»Ach, Quatsch! Sally hat bestimmt Zeit! Ich bring dich hin, das ist nicht weit.«
»Okay. Danke.«
Auri setzt sich schlendernd in Bewegung, und ich trotte neben ihr her, darauf bedacht, möglichst wenig Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Die Straßen sind relativ leer, obwohl heute Sonntag ist. Vielleicht liegt es an den Windböen, die immer wieder über die Insel fegen und einem die Haare ins Gesicht peitschen. Hin und wieder begegnen wir Leuten. Auri grüßt jeden freundlich. Ich tue es ihr verhalten nach und lasse die kritischen bis neugierigen Blicke der Inselbewohner über mich ergehen.
»Bist du gestern gut angekommen?«, will Auri wissen. Das Paket wechselt wieder die Seite – zum Glück, denn so ist es weiter von mir entfernt, und weniger von dem Miefgeruch weht zu mir herüber.
»Es war okay«, murmle ich.
»Mit dem Haus alles in Ordnung? Ich hab gehört, es ist in keinem so guten Zustand?«
Warum behaupten das alle? Es sah doch ganz in Ordnung aus. Klar, es ist uralt, aber … Andererseits habe ich wirklich keine Ahnung von Häusern.
Ich zucke mit den Schultern. »Soweit ich es beurteilen kann, ist alles okay. Nur das Internet funktioniert nicht. Dabei habe ich heute Morgen schon vom Handy aus mit der Firma telefoniert, der Anschluss ist noch freigeschaltet.«
Auri stöhnt auf. »Technik! Aber das kann hier bestimmt jemand reparieren.«
»Kennst du einen günstigen Handwerker?«, frage ich hoffnungsvoll. »Ich bin ein bisschen knapp bei Kasse, aber …«
»Günstig?«, unterbricht Auri mich. »Quatsch, Lavender. Hier würde niemand Geld für so was nehmen, das machen deine neuen Nachbarn für umsonst! Mach dir deshalb keine Sorgen.«
»Umsonst?«, wiederhole ich erschrocken. »Ihr kennt mich doch gar nicht! Das kann ich nicht annehmen.«
»Klar kannst du! Hier auf der Insel hilft man sich gegenseitig. Aus Tradition und Überzeugung. Das ist unsere Lebensphilosophie. Brauchst du sonst noch irgendwas? Raus mit der Sprache.«
Eigentlich will ich Auri nicht zu viel von mir verraten. Ich habe zu große Angst, dass alles, was ich sage, hier irgendwann gegen mich verwendet wird. Doch sie ist so nett. Wenn ich sie nicht um Hilfe bitten kann, wen dann?
»Ich bräuchte einen Job«, gestehe ich widerwillig. »Irgendwas Kleines, um ein bisschen Geld zu verdienen. Nur temporär. Ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bin.«
»Du willst nicht bleiben?« Auri klingt, als hätte ich ihr soeben eröffnet, dass ich keine Schokobrötchen mag.
»Keine Ahnung.«
»Du musst bleiben! Wir brauchen mehr Girlpower auf Malcolm Island!« Sie lächelt mich breit an, und ich lächle automatisch zurück. Bei ihr kann man nicht anders. »Bei dem Job kann ich dir nicht helfen, aber lass uns das auch Sally fragen. Sie weiß sicher was. Sie bekommt alles mit, was hier passiert«, fügt sie zerknirscht hinzu. »Wirklich alles.«
»Soll ich fragen …?«
Schwach schüttelt sie den Kopf. »Sagen wir es so … wenn es nach mir gegangen wäre, hätte sie nicht meinen nackten Hintern gesehen.«
Ich hebe entsetzt die Brauen.
Auri zuckt mit den Schultern und grinst. »Nacktbaden.«
»Ist das nicht saukalt?«
»Jap. Außer man wärmt sich dabei anderweitig …«
»Okay. Ich glaube, ich habe genug gehört«, unterbreche ich sie. »Und Ms. Oberg hat sicher mehr als genug gesehen.«
Auri lacht. »Ich glaube, seitdem unternimmt sie nachts keinen kleinen Spaziergang mehr. Mein Po hat sie nachhaltig verstört. Wir sind gleich da. Es ist das Haus da vorn. Direkt neben dem Museum.«
Ich mustere die unscheinbaren Gebäude vor uns. »Hier gibt es ein Museum?« Daran erinnere ich mich wirklich nicht.
»Ja, wusstest du das nicht? Es ist großartig! Direkt hier ist auch unser Secondhandladen, der ist aber eher ein Witz. Könnte man höchstens als Requisitenlager für einen Horrorfilm zweckentfremden. Und die Bücherei. Unsere Bürgermeisterin Sally und ihre Tochter Laina kümmern sich um alles. Du musst dir das Museum unbedingt mal anschauen, da kann man die ganze Geschichte der Insel nachverfolgen!«
»Okay, werde ich machen.«
»Schon zwei Sachen auf deiner Liste. Das und Tommys Schokobrötchen.«
»Die scheinen es dir wirklich angetan zu haben.«
Auri tätschelt mir gespielt ernst die Schulter. »Irgendwann wirst du es verstehen.«
Wir erreichen das kleine Holzhaus, auf das Auri zugesteuert hat, und sie drückt die Klingel. Es muss schon recht alt sein, aber es ist deutlich, dass seine Besitzer sich gut darum kümmern. Alles scheint noch in bester Ordnung, die Fenster sind geputzt und die beiden Beete neben der Tür ordentlich gepflegt. Quietschgelbe Dahlien wachsen dort bis über die Fensterbretter empor und bieten so einen natürlichen Sichtschutz. Ein Windspiel hängt unter dem Vordach und klimpert munter vor sich hin.
Im Haus tut sich so lange nichts, dass ich schon gegangen wäre, wäre ich allein gewesen. Aber Auri bleibt seelenruhig stehen und wechselt nur das Päckchen wieder in ihren anderen Arm. Erneut weht der Geruch zu mir rüber, und ich muss sie einfach fragen. »Was ist da eigentlich drin?«
Frech grinst Auri mich an und hält mir den Karton entgegen. »Riech mal und rate.«
Diesmal kann ich nicht verhindern, dass ich das Gesicht verziehe. Ich denke gar nicht dran, meine Nase diesem Ding zu nähern. »Ich rieche es schon die ganze Zeit«, gestehe ich. »Und ich habe keinen Schimmer.«
»Käse.« Sie schnuppert selbst an dem Päckchen, als würde es nach Rosen duften, und klemmt es sich mit seliger Miene zurück unter den Arm. »Der beste Blauschimmelkäse an der ganzen Westküste.«
»Ah!«, mache ich. Also, doch keine Turnschuhe.
Sie wirft mir einen belustigten Blick zu. »Was dachtest du denn?«
Ich werde rot. »Keine Ahnung. Vielleicht, dass du biologische Kriegswaffen schmuggelst oder so.«
Auri lacht laut. »Wenn man den Leuten hier Glauben schenken darf, tue ich das auch. Brenda, das ist die Ladenbesitzerin, tut immer so, als wäre das Zeug giftig. Sie bestellt es für mich vom Festland, und wenn ich es nicht sofort abhole, wenn die Lieferung da ist, bekomme ich es so dick in Plastik eingewickelt, dass ich eine Säge brauche, um es wieder aufzubekommen.«
»Und es stinkt trotzdem noch«, stelle ich nüchtern fest.
Sie wackelt mit den Augenbrauen. »Jep.«
Endlich wird die Tür geöffnet. Ms. Oberg schaut uns entgegen. Sie trägt eine dunkelgraue Stoffhose und dazu eine knallrote Bluse. Ihre Locken stehen wild zu allen Seiten ab, und ein leicht gehetzter Ausdruck liegt auf ihrem Gesicht.
»Hallo, ihr beiden. Das ist ja eine Überraschung.« Fahrig wischt sie sich etwas von der Wange, das aussieht wie eine Staubfluse. »Bitte entschuldigt, ich war auf dem Dachboden. Kommt doch rein.«
Wir grüßen sie ebenfalls, und ich will gerade über die Schwelle treten, da fällt ihr Blick auf Auris Paket. Ms. Oberg kneift die Augen zusammen. »Das bleibt draußen.«
»Im Ernst?«, beschwert Auri sich, bückt sich jedoch und stellt es zu ihren Füßen ab. »Ihr übertreibt alle maßlos.«
»Brenda hat mir erzählt, dass es diesmal besonders schlimm ist. Ich gehe kein Risiko ein.«
»Laut Brenda ist es jedes Mal besonders schlimm …«
»Sie hat ein feines Näschen«, stimmt Ms. Oberg zu und führt uns durch den schmalen Flur in eine große Wohnküche mit einer Fensterfront mit Blick aufs Meer. »Immer wenn ich backe, steht sie ganz zufällig nach Feierabend vor meiner Tür. Es ist ein wenig gruselig.«
Ich schaue mich im Zimmer um. Ms. Obergs Inneneinrichtung ist überraschend geschmackvoll. Die Möbel sind alle aus hellem Holz, die Wände sind in Cremefarbe mit hellblauen Akzenten gestrichen. Überall hängen Makrameeampeln mit Pflanzen, Windspiele, Traumfänger und Muscheln. Es ist ein maritimes Feeling, das sofort beruhigend wirkt. Und mittendrin steht Ms. Oberg mit ihrer knallroten Bluse. »Kann ich euch einen Kaffee anbieten?«, fragt sie.
»Du meinst einen Caramel Latte mit extra Schaum?«, entgegnet Auri, lässt sich auf einen der Stühle fallen und klimpert zuckersüß mit den Wimpern.
Ms. Oberg verdreht die Augen. »Na schön. Für dich auch, Liebes?« Sie wendet sich an mich.