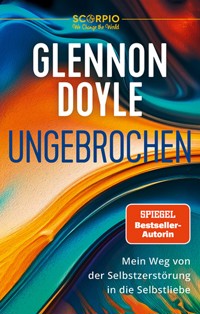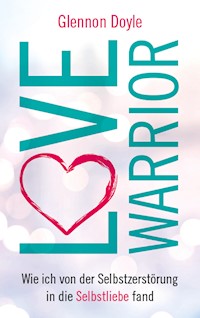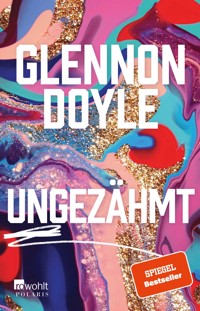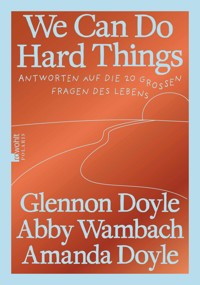
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wenn wir durch ein neues Land reisen, brauchen wir einen Reiseführer. Wenn wir durch Liebe, Herzschmerz, Freude, Elternschaft, Freundschaft, Alter, Trauer, Neuanfänge – kurz, das Leben – reisen, brauchen wir auch einen Reiseführer. We Can Do Hard Things ist unser Reiseführer für das Leben. Immer wieder stellen sich Bestsellerautorin Glennon Doyle die gleichen Fragen: Warum bin ich so, wie ich bin? Wie finde ich heraus, was ich will? Woher weiß ich, was ich tun soll? Warum kann ich nicht glücklich sein? In schwierigen Zeiten sind Glennons Kompasse ihre Schwester Amanda und ihre Frau Abby. Als kürzlich innerhalb eines einzigen Jahres bei Glennon Magersucht und bei Amanda Brustkrebs diagnostiziert wurde und Abbys geliebter Bruder starb, waren sie zum ersten Mal alle gleichzeitig völlig verzweifelt. Also wandten sie sich dem einzigen zu, was ihnen immer geholfen hat, ihren Weg zu finden: tiefgründige, ehrliche Gespräche mit anderen. Sie fragten einander, ihre engsten Freunde und viele andere kluge Menschen nach den Erfahrungen und Erkenntnissen, die sie selbst auf ihrer Lebensreise gesammelt haben. Als Glennon, Abby und Amanda die Antworten aufschrieben, erkannten sie: 1. Egal, welchen Weg wir gehen, jemand anderes hat dasselbe Terrain bereits bereist. 2. Die Weisheit unserer Mitreisenden wird uns den Weg erleuchten. We Can Do Hard Things versammelt all diese Weisheit – diesem Buch können wir uns zuwenden, wenn wir ratlos sind und uns allein fühlen, wenn wir Klarheit im Chaos brauchen oder auf unserem Lebensweg kluge Gesellschaft suchen. Denn wir müssen nicht allein reisen. We Can Do Hard Things ist unser Wegbegleiter. Mit Weisheiten von: Brené Brown • Hannah Gadsby • Jane Fonda • Elizabeth Gilbert • Kamala Harris • Tobin Heath • Katherine May • Celeste Ng • Michelle Obama • Natalie Portman • Esther Perel • Maggie Smith • Gloria Steinem • Ocean Vuong • Reese Witherspoon und vielen anderen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Glennon Doyle • Abby Wambach • Amanda Doyle
We Can Do Hard Things
Antworten auf die 20 großen Fragen des Lebens
Über dieses Buch
Unser Reiseführer fürs Leben – für Liebe, Herzschmerz, Elternschaft, Freundschaft, Älterwerden und Neuanfänge
Immer wieder stellen sich uns die gleichen Fragen: Warum bin ich so, wie ich bin? Wie finde ich heraus, was ich will? Warum kann ich nicht glücklich sein? Auch Glennon Doyle kennt dieses Gedankenkarussell. In schwierigen Zeiten sind ihre Schwester Amanda und ihre Frau Abby ihre Kompasse. Doch als innerhalb eines Jahres bei Glennon Magersucht und bei Amanda Brustkrebs diagnostiziert wird und Abbys geliebter Bruder stirbt, sind alle drei gleichzeitig völlig verzweifelt. Unterstützung finden sie in Gesprächen mit anderen – von Reese Witherspoon über Kamala Harris und Michelle Obama bis hin zu Maggie Smith. We Can Do Hard Things enthält die gesammelte Weisheit aus diesen Gesprächen – und die ermutigende Botschaft: Wir sind nicht allein.
Vita
Abby Wambach, Amanda Doyle und Glennon Doyle moderieren gemeinsam den preisgekrönten und von der Kritik gefeierten Podcast We Can Do Hard Things, der seit seinem Start im Jahr 2021 mehr als eine halbe Milliarde Abrufe zu verzeichnen hat. Die Inhalte dieses Buches basieren auf einer Auswahl von Gesprächen aus diesem Podcast. Weitere Folgen finden sich auf wecandohardthingsworld.com.
ABBY WAMBACH ist zweifache Olympiasiegerin, Weltmeisterin sowie sechsfache US-Fußballerin des Jahres und Weltfußballerin von 2012. Sie setzt sich für Gleichstellung und Inklusion ein und schrieb mehrere Bücher.
AMANDA DOYLE ist Gründerin, Vize-Präsidentin und Justiziarin von Together Rising. Die gemeinnützige Organisation hat bisher mehr als 55 Millionen US-Dollar für Frauen, Familien und Kinder in Krisensituationen gesammelt. Davor war Amanda in einer weltweit agierenden Anwaltskanzlei und bei der International Justice Mission in Ruanda tätig.
GLENNON DOYLE ist Bestsellerautorin, renommierte Aktivistin sowie Gründerin und Präsidentin von Together Rising. Von ihr erschienen die Bücher Ungezähmt sowie Ungezähmt – das Journal, Love Warrior (ausgewählt für Oprah Winfreys Book Club) und Carry On, Warrior.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel «We Can Do Hard Things» bei The Dial Press, einem Imprint von Random House. Random House gehört zu Penguin Random House LLC, New York
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«We Can Do Hard Things» Copyright © 2025 by Glennon Doyle, Abby Wambach und Amanda Doyle
Redaktion Ulrike Gallwitz
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich, nach dem Original von Penguin Random House LLC, US
Coverabbildung We Can Do Hard Things LLC
ISBN 978-3-644-02565-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für unsere Kinder,
Alicia Amma Bobby Chase Cosmo
Elliott Frieda Senna Theodore Tish:
Ich gehe staunend durch mein Leben. Seit meiner Kindheit stellen sich mir dieselben Fragen, und ich fühle mich oft wie ein wandelndes Fragezeichen. Mit so einer Veranlagung wird man am besten Schriftstellerin, und das bin ich auch geworden. Meinen ersten Essay schickte ich in die Welt wie ein Rauchzeichen:
Leben: Findet ihr das Leben auch so rätselhaft und kompliziert wie ich?
… Hallo?
Die Leute meldeten sich. Zwanzig Jahre und vier Bücher später liefert mir die Post jeden Monat Wagenladungen voller Briefe ins Haus. Ich habe ein halbes Dutzend überquellender Mail-Accounts, und meine Kinder wissen, wir können nie in den Supermarkt gehen, ohne dass eine Fremde auf mich zukommt und mir ihre Geschichte erzählt. Dabei ist mir eines klar geworden: Obwohl die Geschichten individuell sind, kreisen wir alle immer wieder um dieselben Fragen. Warum bin ich so, wie ich bin? Woher weiß ich, was ich tun soll? Was tut mir jetzt gut? Wozu das alles?
Auch ich war auf der verzweifelten Suche nach Antworten. Das Leben ist Chaos, aber ich wollte kein Chaos und lief jeder Menge Scharlatane hinterher, die durch die Vortäuschung falscher Sicherheit mein Bedürfnis nach Kontrolle bedienten. Meine späten Zwanziger verbrachte ich bei fundamentalistischen Christen, in den Dreißigern wurde ich zur glühenden Anhängerin von Wellnesskultur, Produktivität und Stress, und in meinen Vierzigern wandte ich mich mit religiösem Eifer Politik und Aktivismus zu. Das alles konnte mich nicht vor der Verwirrung und dem Schmerz bewahren, Mensch zu sein.
Vor einiger Zeit begann das Gedankenkarussell dann, sich noch hektischer zu drehen. Bei mir wurde Anorexie diagnostiziert, bei meiner Schwester Amanda stellte man Brustkrebs fest, und meine Frau Abby verlor ihren geliebten großen Bruder. Die Kinder wurden allmählich erwachsen und flügge. Unser Land und die Welt wirkten, als würden sie bald auseinanderfliegen. Ich hatte die Lebensphase erreicht, in der es einem vorkommt, als würde man nach und nach alles wieder verlieren, was man sich aufgebaut hat, und auch die Menschen, die einen geprägt haben. Ich wollte das nicht. Ich wollte meinen Frieden wiederhaben: Struktur, Stille, Weisheit. Ich dachte, das wäre
die Definition von Frieden. Inmitten dieser schmerzvollen Phase begannen Amanda, Abby und ich damit, tiefgehende, ausführliche Gespräche mit einigen der klügsten Menschen auf dem Planeten zu führen. Wir baten diese Weisen der Jetztzeit in Interviews, in Texten oder bei einer Tasse Kaffee, uns von ihrem inneren Ringen zu erzählen, von der einen, immer wiederkehrenden Frage, die sie umtreibt. Ihre Antworten waren uns vertraut – es handelte sich um dieselben Fragen wie in den unzähligen Briefen und in Gesprächen an der Fleischtheke, die Fragen, um die wir alle ein Leben lang kreisen: Wer bin ich wirklich? Warum bin ich so wütend? Wie soll es weitergehen? Wir nannten sie «Die Fragen» und überlegten, was wäre, wenn die lebenslange Auseinandersetzung mit den Fragen gar kein Problem darstellte, sondern es in Wirklichkeit genau darum ging? Was, wenn wir dazu bestimmt sind, für immer um Die Fragen zu kreisen wie die Planeten um die Sonne? Was, wenn die Schwerkraft der Fragen das ist, was uns in der Umlaufbahn hält?
Die in diesem Buch zusammengetragene Weisheit hat uns drei gerettet. Das ist nicht übertrieben. Während ich mit Unterstützung meiner Ärztinnen meinen Körper nährte, halfen mir die Gespräche dabei, eine Version des Lebens zu entwerfen, mit der ich weiterleben kann. Ich bin jetzt eine andere. Amanda erholte sich allmählich von ihrer Krebserkrankung. Sie ist jetzt eine andere. Abby lernte, ihren Verlust zu tragen. Sie ist jetzt eine andere. Wir haben die Suche nach Sicherheit aufgegeben und üben uns stattdessen in Hingabe, überlassen uns in einem wunderschönen, unergründlichen Universum Seite an Seite mit Millionen anderer kreiselnder Wirbel dem lebenslangen Tanz mit den Fragen. Was ist ein Tanz anderes, als sich gemeinsam im Kreis zu drehen?
Wir machen euch hiermit diese lebensrettenden Gespräche, diesen neuen, wilden Frieden zum Geschenk – aus ganzem, offenem, wirbelndem, tanzendem Herzen.
EinsWarum bin ich so, wie ich bin?
Ich bin mir selbst ein Rätsel. Ich möchte verstehen, weshalb ich die Dinge tue, die ich tue, weil diese Dinge sich auf die Menschen auswirken, die ich liebe. Ich will nicht funktionieren wie auf Autopilot. Ich möchte sorgfältig entscheiden, welche Muster ich weitergebe. Ich möchte Kreisläufe durchbrechen. Ich möchte in Freiheit leben, handlungsfähig und bewusst. Um das zu tun, muss ich in mich selbst hineinschauen, muss meine Schaltkreise erforschen, sie erkennen und vieles neu verdrahten.
Verantwortungsvolles Erwachsensein heißt, Schaltkasten und Elektrikerin zugleich zu sein.
Ich bin das Rätsel und die Kundschafterin.
Gar nicht so leicht.
GLENNON
Wir werden in Kultur- und Familiensysteme hineingeboren, die uns sagen: Du darfst deinem Appetit nicht trauen. Du darfst deinem Verlangen nicht trauen. Du darfst dir selbst nicht trauen. Und weil du dir nicht trauen darfst, bekommst du eine Liste mit Regeln, die du stattdessen befolgen musst.
Das hat dazu geführt, dass wir essenzielle Anteile unserer selbst verdrängt haben. Das war zwingend notwendig, um in einer Gesellschaft, in Institutionen und Familien zu bestehen, die uns den Zugang zu unserer Herkunft, unserer Macht und der uns innewohnenden Weisheit verwehrten.
Kein Wunder, dass wir nicht in der Lage sind, voll und ganz authentisch zu sein. Der Weg, den wir eingeschlagen haben, um im Leben zu bestehen, hat uns gleichzeitig innerlich zerrissen.
AMANDA
Heute bin ich mir der Schubladen deutlich bewusst, in die ich mich selbst verfrachtet habe – Schubladen, die mir von meiner Familie und der Gesellschaft, in der ich lebe, präsentiert wurden. Ich habe mich bewusst dort hineinbegeben und sie fest hinter mir zugezogen, um in Sicherheit zu sein, um gemocht zu werden, um dazuzugehören. Inzwischen sprenge ich immer wieder die Grenzen, die ich mir selbst auferlegt habe, weil ich lernen will zu akzeptieren, wer ich wirklich bin. Es ist, als wäre ich in einen Topf gepflanzt worden, würde wachsen und mich ausdehnen und schließlich den Topf sprengen. Ich kann meinen Schubladen aber nur entkommen, wenn ich verstanden habe, was genau diese Schubladen sind und welchem Zweck sie dienen.
ALEX HEDISON
Ich trage die Muster meiner Herkunftsfamilie in mir,darum bin ich, wie ich bin.
Wir sind von Geburt an fest auf unsere Bezugspersonen fixiert. Lange bevor wir lernen zu sprechen, wissen wir, was sie zum Lächeln bringt und dazu, sich uns zuzuwenden, und wann sie sich stirnrunzelnd abwenden. Wir registrieren das alles genau und passen uns an, um unser Überleben zu sichern. Wir betonen die Anteile von uns, die Liebe und Fürsorge zur Folge haben, und verstecken die anderen. Wir werden so, wie wir glauben, dass sie uns haben wollen.
Dann werden wir schließlich erwachsen, und eines Tages schauen wir in den Spiegel und fragen uns: Warum verstecke ich noch immer so viel von mir selbst? Bin ich meinem wahren Selbst überhaupt schon mal begegnet?
GLENNON
Ich wurde Sportlerin, um von meiner Mutter Liebe zu bekommen.
Alles, was ich wollte, waren die Liebe, Akzeptanz und Zuwendung meiner Mutter. Gleichzeitig war da schon immer dieses tiefe Wissen um meine Homosexualität in mir und die Ahnung, dass meine Mutter diesen Teil von mir niemals wirklich akzeptieren würde. Um meine Homosexualität zu kompensieren, entwickelte ich die starke Identifikation als Sportlerin. Es funktionierte. Ich wurde gefeiert. Doch diese Art von Bestätigung fühlte sich nie wirklich stimmig an. Nach einem erfolgreichen Spiel war meine Familie außer sich vor Freude über meine Tore. Trotzdem fragte ich mich ständig, was wohl wäre, wenn ich keine Tore mehr schießen würde? Würden sie das, was dann noch von mir übrig war, auch noch lieben?
ABBY
Ich lernte, mich besser auf die Gefühle anderer einzuschwingen als auf meine eigenen.
In meiner Familie bestimmten die emotionalen Schwankungen einer Person das Erleben der anderen. Im Kontext so einer Dynamik lernt ein Kind, hinsichtlich der Emotionen anderer extrem feinfühlig und wachsam zu werden, weil es den Frieden wahren will. Ich tue das schon mein Leben lang und habe erst vor Kurzem gelernt, dass es für dieses Verhalten tatsächlich einen Fachbegriff gibt. Es nennt sich emotionale Überwachung und bedeutet, dass man feinste Antennen für die Empfindungen aller Menschen um sich herum hat und ein Leben als Problemlöserin führt. Man ist so sehr damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass es den anderen gut geht, dass man das Gefühl für die Grenzen zwischen dem eigenen Erleben und dem der anderen verloren hat. Das Erleben der anderen ist mein Erleben.
AMANDA
Ich wurde extrem, um gesehen zu werden.
Ich habe mich immer in Extremen ausgedrückt. Eine Person war mir nicht einfach nur unsympathisch, ich hasste sie. Mir war nicht einfach ein bisschen langweilig, ich starb vor Langeweile. Es ist interessant, darauf zu schauen, welche Menschen das Bedürfnis haben, sich derart dramatisch auszudrücken. Vielleicht haben wir einfach sehr früh gelernt, dass unsere Bedürfnisse nur befriedigt werden, wenn wir sie auf extreme Weise artikulieren.
GLENNON
Ich habe gelernt, womit ich Liebe bekomme und womit nicht, darum bin ich, wie ich bin.
Ich wurde zum Spiegel der Werte meines Vaters.
Als ich aufwuchs, drehte mein Vater Filme wie Früchte des Zorns und Die zwölf Geschworenen und verkörperte darin starke, mutige Charaktere, die sich für die Benachteiligten einsetzten. Ich wusste, dass er diese Rollen liebte, weil sie die Werte repräsentierten, die ihm wichtig waren. Damals war mir das nicht bewusst, aber ich glaube, ihn in diesen Rollen zu erleben, wirkte wie Dünger für meine Seele. Als die Wahrheit über den Vietnamkrieg herauskam, fingen die gut gedüngten Sprossen meines Lebens als Aktivistin an zu wachsen.
JANE FONDA
Ich wurde Comedian, um meine Mutter zum Lachen zu bringen.
Es ist schwer zu sagen, welcher Teil unserer Persönlichkeit eine vor Jahren ausgebildete Bewältigungsstrategie ist und was tatsächlich zu uns gehört. Ich frage mich, wer ich wohl geworden wäre, wäre ich allein an einem Strand aufgewachsen. Ich bin mir nicht sicher, dass ich dann auch Comedy gemacht hätte. Ich bin im Grunde ziemlich introvertiert. Ich glaube, in Wirklichkeit versuchen wir alle nur, unsere Mütter zum Lachen zu bringen.
MAE MARTIN
Bindungsstile
MIT DR. ALEXANDRA SOLOMON
Die Art und Weise, wie wir uns in Beziehungen verhalten, spiegelt das Verhalten der Menschen wider, die sich um uns gekümmert haben, als wir klein waren. Deren Fähigkeit oder Unfähigkeit, unsere frühesten Bedürfnisse zu stillen – das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, Gesehenwerden und Bestätigung –, führt zur Entwicklung eines «Bindungsstils». Dieser wird in frühester Kindheit geprägt, noch ehe wir zwei Jahre alt sind, und begleitet uns bis ins Erwachsenenalter. Etwas über Bindungsmuster zu lernen, hilft uns zu verstehen, warum wir sind, wie wir sind. Obwohl erlernte Bindungsmuster wesentlichen Einfluss darauf haben, wie wir Beziehungen leben, ist unser Bindungsstil kein Schicksal – aus unsicherer Bindung kann sichere Bindung werden.
Wir alle streben nach dem Gefühl von Sicherheit, Selbstvertrauen und Vertrauen in unsere Beziehungen. Hinweise darauf, dass ich sicher gebunden bin, sind ein gesundes Selbstwertgefühl und die Fähigkeit, meine Bedürfnisse zu artikulieren. In meiner Partnerschaft fühle ich mich wohl damit, meinem Gegenüber emotional nahe zu sein. Ich agiere mit Zuversicht im Außen, weil ich darauf vertraue, dass es zu Hause jemanden gibt, der mich versteht und an mich glaubt. Wenn ich ein sicherer Bindungstyp bin, waren die Bezugspersonen meiner frühesten Kindheit auf meine emotionalen und körperlichen Bedürfnisse eingestellt und haben mit Fürsorge darauf reagiert. Sie ermutigten mich dazu, die Welt zu erforschen, und gaben mir Raum zur Entfaltung. Sie signalisierten mir mit Worten und Taten: Du bist wertvoll. Du bist in Sicherheit. Du bist wichtig. Aber auch wenn ich in meiner Kindheit keinen sicheren Bindungsstil entwickeln konnte, kann ich später im Leben sichere Bindung erleben, indem ich bewusst gesunde und vertrauensvolle Beziehungen entwickle.
In meiner Partnerschaft zu vertrauen, fällt mir schwer, selbst wenn mein Gegenüber sich als vertrauenswürdig erwiesen hat. Ich brauche permanent die Versicherung, nicht verlassen zu werden, und habe schreckliche Angst vor Zurückweisung oder davor, alleingelassen zu werden. Ich habe das Gefühl, mein Wert hinge von der Bestätigung meines Gegenübers ab. Meine unsicher-ängstliche Bindung wurde herausgebildet, weil die Bezugspersonen meiner frühesten Kindheit in der Befriedigung meiner körperlichen und emotionalen Bedürfnisse unzuverlässig waren, sodass ich diese Verbindung ständig infrage stellte. Möglicherweise diente die Zuwendung meiner Bezugspersonen dazu, ihren eigenen emotionalen Hunger zu befriedigen, anstatt mir die beständige Liebe und Unterstützung zu geben, die ich brauchte, um zu wachsen und zu reifen.
Mein Heilungsweg beinhaltet, zu lernen, mich selbst zu trösten, meinen Wert zu bejahen und mir die Bestätigung zu geben, nach der ich mich sehne, damit sich meine Beziehungen wechselseitiger anfühlen.
ABBY:
Glennon und ich sind völlig unterschiedliche Bindungstypen. Ich bin unsicher-ängstlich, sie ist vermeidend. Wenn wir uns streiten, reagiere ich automatisch mit folgendem Muster: Liebst du mich noch? Verlass mich nicht! Ich sehne mich verzweifelt nach Trost.
GLENNON:
Ich dagegen erstarre augenblicklich zu Eis. Sobald zwischen uns etwas Trennendes spürbar wird, geht bei mir die Mauer hoch. Dann steht Abby gefangen davor und ich dahinter. Und wir sind beide allein.
Wenn mir nachgesagt wird, autark und selbstständig zu sein, bin ich womöglich ein vermeidender Bindungstyp. Ich besitze zwar vielleicht ein hohes Selbstwertgefühl, habe jedoch Schwierigkeiten, mich emotional auf andere einzulassen. Ich neige dazu, Menschen wegzustoßen, sobald sie mir zu nahe kommen. Ein häufiger Gedanke lautet: Ich brauche dich nicht. Ich brauche niemanden. Ich habe einen vermeidenden Bindungsstil entwickelt, weil die Bezugspersonen meiner frühen Kindheit emotional distanziert waren. Wenn ich emotionale Nähe einforderte, wurde ich womöglich zurückgewiesen, beschämt oder bestraft. So lernte ich, mich auf niemand anderen zu verlassen als auf mich selbst.
Mein Heilungsweg beinhaltet, Nähe zu anderen Menschen bewusst zuzulassen und darauf zu vertrauen, dass meine Versuche nicht schon im Ansatz erstickt werden – in dem Wissen, dass der Wunsch eines Menschen, mir nahe zu sein, nicht bedeutet, dass er es darauf abgesehen hat oder er in der Lage ist, mich zu kontrollieren.
Wenn ich desorganisiert gebunden bin, fühle ich mich in einer liebenden Beziehung ständig im Zwiespalt. Ich sehne mich nach Nähe und habe gleichzeitig Angst davor, einen anderen Menschen an mich heranzulassen. Anstatt mich an mein Gegenüber zu klammern oder es wegzustoßen, tue ich beides. Ich suche aktiv nach emotionaler Nähe und schlage dann aus Angst, verletzt zu werden, um mich oder weise mein Gegenüber zurück. Ein desorganisierter Bindungsstil ist oft das Resultat von Missbrauchserfahrungen in der Kindheit. Als Kind sehnte ich mich nach der Liebe und Zuwendung meiner Bezugspersonen, aber gleichzeitig hatte ich große Angst vor ihnen.
Mein Heilungsweg beinhaltet die Erkenntnis, dass meine starken emotionalen Reaktionen, wie zum Beispiel Wut, mir zeigen, dass ich Angst habe oder verwirrt bin, um dann geeignete Schritte zur Selbstregulierung zu unternehmen. Meine Fähigkeit, Selbstwahrnehmung und Selbstmitgefühl zu üben, hilft mir dabei, mich innerlich stabiler zu fühlen und in meinen Beziehungen mehr Beständigkeit zu etablieren.
Anziehung im Erwachsenenalter ist nichts anderes als die Aktivierung unserer frühesten Bindungsmuster. Unser Körper signalisiert uns: Das kenne ich. Ich bin für diesen Menschen das passende Puzzleteil.
Stellen Sie sich ein Kleinkind vor, im Alter bis zu drei Jahren. Fragen Sie sich, was dieses Kind bis jetzt schon tun musste, um Aufmerksamkeit zu bekommen, wie oft es sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten musste. Wie viele Situationen mögen das gewesen sein? Eine Million? Jedenfalls genug, um dieses Verhalten tief einzufurchen. Kein Wunder, dass der Körper reagiert und sich hingezogen fühlt, wenn er merkt: Dieses Muster kenne ich.
DR. BECKY KENNEDY
In großen Familien wie meiner Herkunftsfamilie ist es für die einzelnen Kinder nicht einfach, von ihren Eltern die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie brauchen. Ich habe gelernt, dass ich um Liebe kämpfen muss. Als erwachsene Frau fühlte ich mich vor allem zu Menschen hingezogen, die etwas überheblich und oft sogar ein bisschen fies waren, weil sie mir das Gefühl gaben, um ihre Liebe kämpfen zu müssen.
Mein Gedanke war: Diese Beziehung fühlt sich nach Heimat an.
Mit Glennon war es völlig anders. Als wir uns kennenlernten, war sie von Anfang an ganz da, sie war absolut offen und sofort voller Liebe. Ich verstand das nicht gleich, weil es für mich etwas völlig Neues war. Ich glaube, in mir war tatsächlich so etwas wie Trauer. Ich hatte mein Leben lang versucht, mir die Zuneigung anderer Menschen zu erkämpfen, um mir selbst zu beweisen, dass ich wertvoll und gut genug bin. Es war anstrengend und beängstigend. Als Glennon mir signalisierte, dass sie mich so liebte und wollte, wie ich war, musste ich meine übliche Eroberungsstrategie aufgeben. Ich musste meine neuronalen Bahnen neu verkabeln und mir bewusst machen: Das ist wahre Liebe. Ihre Liebe für mich ist schon da. Meine Aufgabe ist es, dieser Liebe zu vertrauen, anstatt ihr nachzujagen oder sie zu erzwingen oder zu kontrollieren.
Das ist zwar auf seine Art auch beängstigend, aber es entspricht mir mehr.
ABBY
In einer perfekten Welt hätte meine Familie mein ganzes Selbst willkommen geheißen und genährt. Doch in allen Familien herrscht Druck. Um uns diesem Druck anzupassen, erstarren wir und werden eindimensional. Wir lernen, gewisse Rollen zu spielen, um den Status quo in der Familiendynamik aufrechtzuerhalten. Doch das hat einen hohen Preis: Unser volles, wahres Selbst darf sich nicht entfalten. Erst jetzt erkenne ich allmählich, dass die Rolle, die ich in meiner Familie einnahm, nichts mit meiner wahren Persönlichkeit zu tun hat. Ich habe lediglich ein Drehbuch befolgt. Die gute Nachricht lautet, dass jede Rolle ihre ganz eigene Heldinnenreise mit sich bringt. Wenn wir es wagen, uns auf diese Reise zu begeben, lernen wir, im wahrsten Sinne des Wortes aus der Rolle zu fallen und ganz Mensch zu werden. Nach und nach tragen wir so unser vollständiges Selbst in unsere Beziehungen hinein, in unsere Arbeit und in die Welt.
GLENNON
Ich habe in meinem Familiensystem eine Rolle übernommen, um den Frieden zu wahren, darum bin ich, wie ich bin.
Ich wurde zur Leistungsträgerin, um zu beweisen, dass es uns gut ging.
Indem ich mich in meiner Kindheit und Jugend mit guten Leistungen hervortat und oft die Beste war, versuchte ich, die Rolle der «Unkomplizierten» zu erfüllen. Das Signal lautete: Macht euch um mich keine Sorgen. Bei mir läuft’s prima. Mir geht’s gut. Unserer Familie geht’s gut. Ich arbeitete an dem Beweis, dass es uns als Familie gut ging, dass wir sogar stolz auf uns sein konnten. Auf diese Weise habe ich verinnerlicht, ich könne der Welt und mir selbst am besten beweisen, dass es mir gut geht, indem ich gute Leistungen erbringe und die Beste bin. Ich will aber nicht mehr die Beste sein, damit es mir gut geht. Ich will ein ganzer Mensch sein. Ich möchte mir Liebe und Anerkennung nicht mehr durch Leistung verdienen, und ich will auch nicht, dass die Menschen, die ich liebe, etwas leisten müssen, um sich meine Liebe und Anerkennung zu verdienen.
AMANDA
Ich wurde zur Heldin.
Meine Sportlichkeit erlaubte es mir in gewisser Weise, die Heldin unserer Familie zu werden – die Strahlende, die Kraftstrotzende, die Aufregende. In Wirklichkeit verachtete ich diesen Teil von mir, weil ich wusste, dass er nicht ganz echt war. Ich wurde zwar idealisiert, aber ich blieb unerkannt. Eine meiner tiefsten Wunden ist die Angst, nicht erkannt zu werden.
ABBY
Ich wurde die Kranke.
Die Geschichte, die ich mir seit Ewigkeiten über mich selbst erzähle, lautet: Ich bin die Kranke. Meine Rolle bestand darin, krank zu sein, kaputt zu sein. Meine Aufgabe bestand in der Verkörperung des Krankhaften in unserem Familiensystem. Wie sich diese Beschädigung manifestierte, spielte keine Rolle, ob als Angststörung, Depression, Bulimie oder Alkoholismus. Wichtig war nur, dass alle in der Familie ihre Rolle kannten, solange ich krank blieb, und sich damit das Familiensystem im Gleichgewicht befand. Auf diese Weise ließ sich das Kaputte in unserer Familie wunderbar unter dem Deckel halten und wegargumentieren. Ich habe mein Leben lang behauptet, ich wäre schon «kaputt zur Welt gekommen». Was soll das heißen? Niemand kommt kaputt zur Welt. Ich wurde nicht kaputt geboren, ich wurde krank, weil ich die Gifte des Familienverbands eingeatmet hatte. Inzwischen probiere ich es mit einem neuen Gedanken: Was, wenn ich überhaupt nicht kaputt bin? Wenn ich niemals kaputt war? Würde ich mit diesem Wissen anders leben?
GLENNON
Familienrollen
MIT DR. ALEXANDRA SOLOMON
Ich trage die Verantwortung. Als Kind schrieb ich gute Noten und glaubte, wenn ich nur gut genug wäre, würden die Probleme in meiner Familie verschwinden. Ich erbringe starke Leistungen und bin sehr kompetent. Ich habe an mich und andere hohe Erwartungen und kann Unzulänglichkeiten nur schwer akzeptieren. Ich bin selbstkritisch und nie zufrieden mit meinen Anstrengungen. Mein Heilungsweg besteht darin, bewusst Kontrolle loszulassen und geduldiger zu werden, vor allem in stressigen Situationen.
Als Kind sprach ich oft aus, was niemand sonst zu sagen wagte. Ich stieß andere vor den Kopf, um das Familiensystem am Laufen zu halten, was zu Distanz zwischen mir und den Menschen führte, die ich liebe. Heute besitze ich großartige Führungsqualitäten – ich bin hartnäckig und furchtlos. Manchmal fühle ich mich jedoch missverstanden. Ich bin extrem wachsam, weil ich es gewohnt bin, außerhalb des Familiensystems zu stehen. Mein Heilungsweg besteht darin, bewusst Trost aus Verbundenheit und Zugehörigkeit zu schöpfen.
Ich war dafür verantwortlich, mich in die Erwachsenen in meiner Familie hineinzuversetzen und ihnen Trost zu spenden. Ich habe mich oft wie eine «kleine Erwachsene» verhalten, der andere sich anvertrauen konnten, und hatte mich um ihre emotionalen Erfahrungen zu kümmern. Ich besitze großes Mitgefühl und bin sehr kollaborativ. Aber ich gehe oft Beziehungen zu Menschen ein, die «gerettet» werden müssen, und versuche, ihre Probleme für sie zu lösen. Mein Heilungsweg besteht darin, klare Grenzen zu setzen und mich in meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse einzufühlen.
Ich habe gelernt, Familienkonflikte mit Humor, Gelassenheit und Diplomatie zu entschärfen. Als Vermittlerin lenkte ich die Aufmerksamkeit fort vom Konflikt. Ich blieb unter Druck ruhig und lenkte die anderen mit Humor ab. Heute agiere ich in intensiven Situationen als Entertainerin oder Mediatorin. Der Zugang zu meinen eigenen Gefühlen fällt mir jedoch schwer. Mein Heilungsweg besteht darin, meine unterdrückten Emotionen zu erforschen.
Ich war unkompliziert, um den Druck auf die Erwachsenen zu reduzieren, oft zog ich mich zurück, um keine Belastung zu sein. Dabei wollte ich dringend gesehen und geliebt werden. Meine Gaben sind Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Unabhängigkeit. Doch es fällt mir schwer, mich wirklich zu zeigen oder um Unterstützung zu bitten. Mein Heilungsweg besteht darin, meine Bedürfnisse zu artikulieren und bewusst Raum einzunehmen.
Ich war der «Grund» für Probleme in meiner Familie, der versehrte Mittelpunkt, um den meine Familie sich herumorganisierte. Anderen die Aufgabe zu übertragen, sich auf meine Herausforderungen zu konzentrieren, diente als Ablenkung von tiefer liegenden Themen und nahm die anderen aus ihrer Selbstverantwortung. Heute kann ich gut für mich einstehen, besitze Selbstbewusstsein und Resilienz. Mein Heilungsweg besteht darin, den Gedanken zuzulassen, dass ich niemals kaputt war.
Es ist möglich, uns von den Rollen, die wir übernommen haben, zu lösen, doch der erste Schritt besteht darin, sie zu betrauern. Es ist traurig, als schwarzes Schaf gegolten zu haben, aus der Familie verstoßen und geächtet worden zu sein. Es ist traurig, nie wirklich die Erlaubnis gehabt zu haben, Kind zu sein, weil man damit beschäftigt war, ständig zwischen den anderen zu vermitteln. Es ist traurig, als Kind unsichtbar gewesen zu sein und bis heute zu glauben, es nicht wert zu sein, gesehen zu werden. Es ist traurig, diejenige gewesen zu sein, die sich um die Familie kümmern und alle zum Lachen bringen musste, obwohl sie selbst jemanden gebraucht hätte, der sich um sie kümmerte. Es ist traurig, wenn einem immer eingeredet wurde, man wäre nicht gesund, obwohl in Wirklichkeit die Familie krank war.
Gleichzeitig ist es befreiend zu wissen, dass diese Zuschreibungen in der Familie Rollen sind und nicht die Wirklichkeit, denn das bedeutet, dass wir das Drehbuch aus der Hand legen können.
Ich will keine Heldin mehr sein. Eine Heldin kann niemand lieben, denn Heldinnen sind nicht real. Sich von einer Rolle zu lösen, braucht Zeit. Wir müssen unzählige, unerträglich unbequeme Entscheidungen treffen, ehe es sich irgendwann nach Freiheit anfühlt. Es bedeutet, Dinge auszusprechen, wie zum Beispiel: «Ich bekomme das nicht perfekt hin.» – «Ich schaffe das nicht alles.» – «Es lastet zu viel auf meinen Schultern.» Oder: «Ich höre auf, so zu tun, als wäre ich krank.» – «Ich höre auf, mich zu verhalten, als wäre ich hilflos.» Oder auch: «Ich widerstehe dem Drang, die Anspannung mit einem Witz zu lösen, denn dein Verhalten ist nicht witzig.» Wir dürfen Schritt für Schritt lernen, das Drehbuch beiseitezulegen und so in unser ganzes kompliziertes und komplexes Selbst hineinzuwachsen.
AMANDA
AMANDA:
In jeder Zelle unseres Körpers befindet sich DNA. Diese DNA ist von Molekülen umgeben, die jeder einzelnen Zelle signalisieren, wie sie sich ausbilden soll. Das führt dazu, dass sich manche Zellen zu einer Sehzelle entwickeln, andere zu einer Zelle im Ohr und wieder andere zu einer Leberzelle. Erleiden wir ein Trauma, verändert dieses Trauma uns auf molekularer Ebene. Es beeinflusst die Marker, was wiederum zu einer veränderten genetischen Ausprägung führt. Trauma verändert also sprichwörtlich die Funktionsweise unserer DNA. Das Fachgebiet, das sich mit der Frage auseinandersetzt, inwiefern unsere Umgebung die Struktur unserer DNA beeinflusst, ist die Wissenschaft der Epigenetik. Die Epigenetik zeigt uns, dass unsere Traumata auf genetischer Ebene von Generation zu Generation weitergegeben werden. In den Niederlanden kam eine Studie zu dem Ergebnis, dass sich das Trauma von Hunger in der DNA der Nachkommen von Überlebenden einer Hungersnot widerspiegelte, obwohl sie das Trauma selbst nie erlebt hatten. Sie haben das Trauma von ihren Vorfahren geerbt. Es lebt durch die Ausprägung ihrer DNA in ihnen weiter. Ihr Körper erinnert sich an etwas, das sie selbst nie erlebt haben.
DR. GALIT ATLAS:
Richtig. Traumata verändern nicht die Gene an sich, sondern sie verändern die Ausprägung der Gene. Gene besitzen sozusagen ein Gedächtnis. In unserer klinischen Arbeit konnten wir feststellen, dass wir nicht nur die Angstreaktion oder die biologische Reaktion auf ein Trauma erben; unser Unterbewusstsein weiß auch etwas über den konkreten Inhalt des Traumas. Wir erben Informationen über bestimmte Ereignisse im Leben unserer Vorfahren, die uns unglaublich erscheinen, wie Daten oder konkrete Erinnerungen, auch wenn wir die spezifische Geschichte rund um das Trauma nicht kennen. Ein Beispiel: Als meine Mutter zehn Jahre alt war, ertrank ihr Bruder. Er war vierzehn Jahre alt. Und noch ehe sie von dieser Familiengeschichte erfuhren, hatten die Kinder der nächsten Generation Angst vor Wasser.
Ich trage die Traumata und Triumphe meiner Vorfahren in mir, darum bin ich, wie ich bin.
Wenn ich eine Drei nach Hause brachte, wurde ich verprügelt, und ich weiß, dass es vielen anderen Kindern ähnlich ging. Unsere Eltern haben viel durchgemacht, und als sie dann endlich hier waren, lautete die Haltung: Hier überlebst du nur, indem du gute Noten schreibst, Geld verdienst und Ärztin wirst. Nur dann wird die Welt für dich zum sicheren Ort. Angst und Trauma waren die Triebfedern für den körperlichen Missbrauch. In San José existiert die größte vietnamesische Gemeinde außerhalb Vietnams, und in meiner Gemeinschaft gibt es viele vietnamesische Geflüchtete. Es gibt viele Überlebende des Koreakrieges. Es gibt viele chinesische Überlebende der Kulturrevolution. Außerdem gibt es eine große kambodschanische Bevölkerungsgruppe, Überlebende des Genozids durch die Roten Khmer. Im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass sie alle Angst hatten. Mir wurde klar, dass ich Teil einer traumatisierten Gemeinschaft bin. Mir das wirklich bewusst zu machen, hat mir dabei geholfen, mich zumindest teilweise von meinem Selbsthass zu befreien, von dieser kritischen Stimme in mir, die mir ständig einredet: Ich bin ein Freak. Ich bin Abschaum. Mir wurde klar, dass ich das Produkt von Krieg und Kapitalismus und globalen sozioökonomischen Faktoren bin, die ungleich größer sind als ich.
STEPHANIE FOO
In jedem Menschen existieren Elemente von generationalem Trauma. Der damit verbundene Schmerz äußert sich in einer Form von Zorn. Es ist dies ein gerechter Zorn, der geehrt werden muss.
DR. MARIEL BUQUÉ
Zu verstehen, weshalb wir so sind, wie wir sind, heißt nicht nur zu erfahren, was mit uns geschehen ist und wie wir es überlebt haben, sondern es heißt auch zu erfahren, was vor uns geschehen ist und wie unsere Vorfahren es überlebt haben.
GLENNON
Meine Ahninnen, jene Freiheitskämpferinnen meiner Vergangenheit, inspirieren mich sehr. Sie fanden Wege, wo es oft ausweglos war. Sie hatten etwas Gaunerhaftes an sich. Sie lebten in zwei verschiedenen Welten. Es gelang ihnen, inmitten einer unfassbar toxischen und gewalttätigen Kultur Gemeinschaften zu bilden. Meine Großmutter hatte zwei Jobs, zog acht Kinder groß und überwand posttraumatischen Stress. Sie war, nachdem sie während der terroristischen Jim-Crow-Ära Zeugin eines Lynchmords geworden war, aus Mississippi weggezogen. Ich sage immer, meine Ahninnen schwebten in einem aus Ungewissheit und Hoffnung gebauten Raumschiff davon. Sie schwebten Richtung Norden, fort vom Süden, in der Hoffnung auf eine neue Welt. Sie erschufen sich innerhalb einer Welt, die ihnen die Freiheit verwehrte und sie nicht als Menschen ansah, trotzdem neue Welten. Das ist die Widerstandskraft, zu der ich mich hingezogen fühle. Mir kann keiner erzählen, etwas sei unmöglich. Ich glaube es nicht.
TRICIA HERSEY
GLENNON:
Auf meinem Heilungsweg komme ich häufig an Punkte, wo ich denke, vielen Dank auch, liebe Vorfahren. Warum muss ich jetzt die Arbeit tun? Was zum Teufel habt ihr euch dabei gedacht? Meine Schwester und ich haben etwas Ahnenforschung betrieben und dabei erfahren, dass unser Ururgroßvater als Kind von seinen Eltern getrennt worden war. Er wurde aus der Familie herausgerissen, musste sein Zuhause und sein Land verlassen und wurde auf ein Schiff verfrachtet, das den Ozean überquerte, um der großen Hungersnot in Irland zu entkommen. Manchmal meine ich, die Stimmen meiner Vorfahren zu hören. Weißt du, Glennon, sagen sie, betrachte die Aufgabe, das transgenerationale Trauma aufzulösen, als deinen persönlichen Ozean. Du bist in unserer Ahnenlinie diejenige, die dazu bestimmt ist, das Trauma zu transformieren, damit es mit dir enden kann. Wir waren nicht dazu in der Lage, denn wir hatten weder die Zeit noch die Ressourcen dazu. Wir mussten andere Meere überqueren. Jetzt überquerst du für uns diesen Ozean, du Glückliche.
ABBY:
Fluch und Segen zugleich.
PRENTIS HEMPHILL:
So sehe ich das auch. Zu ehren, wo wir herkommen, ist etwas Wunderbares. Es ist ein Erinnern. Unsere Vorfahren sind in uns. Wie du schon sagtest, dies ist jetzt deine Aufgabe. Du bildest die Grenze deiner Ahnenlinie, und es gibt etwas, worum du dich kümmern musst. Es gilt, etwas zu transformieren.
Es existiert so etwas wie ein intergenerationales Unbewusstes, das heißt, eine Generation lebt in der anderen, die Generationen teilen etwas Unbewusstes miteinander und kommunizieren darüber, und zwar in beide Richtungen.
DR. GALIT ATLAS
Ich glaube, die Sehnsucht, zu verstehen, woher der Schmerz unserer liebsten Menschen rührt, ist die Grundlage meiner Arbeit. Woher kommt Schmerz? Wenn man dieser Frage nachgeht und allmählich erste Antworten darauf findet, wird klar, dass die Komplexität der vielfältigen Formen von Gewalt, die wir mit unseren Müttern oder anderweitig erleben, von eigenen Verletzungen der Gewaltausübenden herrühren, sie wurden ihrerseits durch Systeme verletzt, die weit vor ihrer Geburt entstanden sind. Sie alle hatten mit Herausforderungen zu kämpfen. Das macht unser Leid zwar nicht ungeschehen, doch es setzt dieses Leid in einen größeren Zusammenhang und weitet unseren Blick auf sie als Menschen, die ihr Bestes versucht haben. Eigentlich ist es schön zu erkennen, dass jede Mutter ihre Grenzen hat, denn erst das macht sie wirklich menschlich.
Ich kann nicht für andere sprechen, aber ich konnte erkennen, dass die Gewalt, die meine Mutter in sich trug, Ausdruck ihrer Machtlosigkeit war. Sie hatte keinerlei Wirkungsmacht, nicht als Mensch, nicht als Frau, nicht in ihren Beziehungen zu Männern, in ihrer Beziehung zur Welt, zur Gesellschaft, nicht in ihrem Job. Die Gewaltausbrüche waren eine Reaktion auf diesen Frust. Ihr Frust gründete immer auf dem Wunsch, mich zu beschützen und dass ich es einmal besser haben sollte. Das klingt paradox, aber so ist Trauma nun einmal. Trauma macht keinen Sinn. Trauma sollte niemals Sinn machen.
Wenn wir von PTBS sprechen, sprechen wir über Menschen mit verschobener Erinnerung. Sie verhalten sich, als wären sie in Gefahr, obwohl im Augenblick keine Gefahr besteht. Das trifft auf die Opfer häuslicher Gewalt zu, es trifft auf Geflüchtete und Kriegsheimkehrer zu. Die übertriebene Wachsamkeit und Paranoia von Kriegsveteranen liegt darin begründet, dass sie handeln, als wären sie im Kriegsgebiet.
Im Augenblick versuchen viele Holocaustforschende, unserem Verständnis von epigenetischem Trauma eine neue Perspektive zu geben und es auch als epigenetische Stärke zu betrachten. Nicht nur Traumata, Ballast oder Leiden wurden weitergegeben, sondern auch Stärke, Wachsamkeit, oder sogar Paranoia, und das Bedürfnis nach Kontrolle. Wenn meine Mutter zur Kfz-Zulassungsstelle musste, bereitete sie sich schon Tage im Voraus akribisch darauf vor. Sie legte die Unterlagen zurecht, die Formulare, das Geld, Bargeld zum Schmieren. Sie bereitete sich auf den Gang zur Zulassungsstelle vor, als stünde Krieg ins Haus. Das ist einerseits traurig, aber andererseits ist es auch eine wunderbare Fähigkeit, denn es birgt Innovation, es birgt die Fähigkeit zu überleben in sich.
Überleben ist kein Zufall. Überleben ist ein kreativer Akt.
OCEAN VUONG
Ich wurde von meinen Erfahrungen geprägt, darum bin ich, wie ich bin.
Trauma ist nichts Bewusstes. Es ist die Stimme unseres Körpers, der sagt: Das, was da passiert ist, war zu viel, zu schnell, zu bald, zu lang und konnte nicht reguliert werden. Wenn ein Trauma aktiviert wird, verschiebt sich das Gefühl für unser Selbst in der Welt und erstarrt. Es kann passieren, dass ein Trauma, das allgegenwärtig ist und sich über lange Zeiträume erstreckt – ob im Außen oder im Innen – allmählich als Persönlichkeitsmerkmal erlebt wird. Ein Trauma im Familiensystem mag aussehen wie eine Familieneigenschaft. Traumata in Menschen mögen aussehen wie kulturelle Eigenschaften. Traumata in Kulturen mögen als natürlich erlebt werden. Jemand, der ein Trauma erlitten hat, mag verrückt erscheinen. Doch so jemand ist nicht verrückt. Dieser Mensch hält sich am Leben. Unbewältigte Traumareaktionen sind kein Makel, sie dienen dem Selbstschutz.
RESMAA MENAKEM
Als Kind war ich Opfer von regelmäßigem sexuellen Missbrauch. Dies passierte in einem Alter, in dem Kinder eigentlich lernen, sich frei zu fühlen und die Handlungsmacht ihres Körpers kennenlernen – zum Beispiel, dass sie von hier nach dort springen können. Ich aber lernte, meinen Körper zu verlassen, um zu überleben. Ich bin keine Expertin, aber es ist allgemein bekannt, dass es sich hierbei um eine weitverbreitete und notwendige Traumareaktion handelt. Dissoziation hat einen schlechten Ruf, doch in einer unmittelbar traumatischen Situation ist diese Reaktion Gnade. Leider kann sich dieses Erleben von Entkörperung auch in unser späteres Leben ausweiten, wenn längst keine Gefahr mehr besteht und es nicht mehr nötig ist, unser Überleben zu sichern.
COLE ARTHUR RILEY
Stell dir vor, du hast auf dem Weg zum Donut-Laden einen Unfall. In dem Moment der traumatischen Erfahrung kodiert dein Gehirn sämtliche Details. Vielleicht trägt der Unfallverursacher einen blauen Pullover und das Ganze ereignet sich unmittelbar vor dem Donut-Laden. All diese Details werden als potenzielle Gefahren abgespeichert. In Zukunft wird dein Gehirn in dem Versuch, dir das Leben zu retten, entsprechend sensibel reagieren. Das kann dazu führen, dass du beim Anblick eines Donuts in Panik gerätst. Das klingt natürlich vollkommen unvernünftig, aber so funktioniert unser Gehirn eben. Es ist Ausdruck der Anpassungsfähigkeit, die unser genialer Körper im Laufe der Evolution entwickelt hat, um uns das Überleben zu sichern.
STEPHANIE FOO
Als Schwarzes Kind in einer weißen rechtsextremistischen, gewalttätigen Pflegefamilie aufzuwachsen, ist abwegig. Natürlich kommt es zu körperlichem Missbrauch, und rein äußerlich heilen diese Verletzungen irgendwann wieder ab. Heimtückischer jedoch ist der psychologische Missbrauch, denn was hier geschieht, ist die Kolonialisierung des Geistes. Ich glaube, wir sind alle ständig damit beschäftigt, unseren Geist zu dekolonisieren, weil wir in diesen toxischen Hierarchien aufgewachsen sind.
ALLISON RUSSELL
Da gab es diesen Missbrauchsvorfall in meiner Kindheit. Ein befreundetes Kind, das bei uns übernachtete, tat mir etwas an. Mir war klar, dass etwas passierte, aber mir war nicht klar, was. Ich hatte das Gefühl, es gebe einen Unterschied zwischen der Realität und den Rollen, die wir spielten. Mir wurde eindeutig zu verstehen gegeben, dass solche Gefühle falsch waren oder ignoriert werden mussten. So habe ich schon sehr früh gelernt, mir selbst nicht zu vertrauen.
KERRY WASHINGTON
GLENNON:
Sag mal, Sam, hattest du eine glückliche Kindheit, oder bist du einfach witzig?
SAMANTHA IRBY:
Ich bin ein witziger Mensch. Nein, Quatsch. Ich bin sehr witzig. Wenn du einer Person begegnest, die du witzig findest, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du dich fragst: Wo ist deine Wunde? Wie bist du so geworden?
Ich wurde von meinen Erfahrungen geprägt, darum bin ich, wie ich bin.
GLENNON:
Du sagst über dich: «Ungefähr zu der Zeit, als sich mein innerer Scham-Alarm herausbildete, fing ich an, ein Doppelleben zu führen. Anstatt zu weinen, machte ich Witze. Ich verdrängte meinen Schmerz und versiegelte das Verlies mit einem Witz. Ich wurde von Minute zu Minute witziger.» Und weiter: «Mit elf Jahren wurde mein Selbsthass empfindungsfähig.»
Als ich das las, machte ich mir ein paar Notizen: «Im Alter von elf: Glennon wird bulimisch, Abby wird Fußballstar, Cameron wird witzig.» Es ist bekannt, dass wir im Alter zwischen acht und zwölf damit beginnen, uns abzuspalten – wir verbergen unser wahres Selbst und entwickeln eine Doppelgängerin, die wir der Welt präsentieren.
CAMERON ESPOSITO:
Ja, mir ist das auch erst vor einigen Jahren klar geworden, aber ich glaube, ich wurde als Kind ziemlich krass gemobbt. Ich dachte einfach, das wäre normal. Ich trug eine Brille, hatte eine Zahnspange und einen Topfschnitt, mit meiner Geschlechteridentifikation gingen wilde Dinge vor sich, ich war lesbisch und schielte. Deshalb versuchte ich, den anderen zuvorzukommen, frei nach dem Motto: Ich weiß schon, was du mir sagen willst, aber hör mal, so ist es noch viel witziger. Ich tat das auch für mein Selbstwertgefühl. Ich konnte das Spiel, ein Mädchen zu sein, das seinen Wert aus den Dingen zieht, für die Frauen normalerweise geschätzt werden, nicht mitspielen. Also wurde ich megawitzig.
In mir sind viele verschiedene Ichs zu Hause, darum bin ich, wie ich bin.
Ist das Selbst eine unveränderliche, begreifbare Einheit? Vermutlich nicht. Ich komme mir eher wie eine Kommune vor als wie ein einzelnes Selbst. Ich habe das Gefühl, aus vielen, miteinander konkurrierenden, sich torpedierenden Anteilen zu bestehen, die sich in Reaktion auf das Trauma und das Wunder, ein Mensch zu sein, entwickelt haben. Wie Walt Whitman sagte, wir alle enthalten Vielheit.
GLENNON
Die Kernidee des Modells der inneren Familiensysteme besagt, dass wir aus vielen autonomen Anteilen bestehen. In uns gibt es viele kleine Köpfe, die wir gemeinhin als «Denken» bezeichnen. Sie streiten oder diskutieren und versuchen ständig, uns Ratschläge zu erteilen. Wie Kinder in einer Familie sind diese Teile anfangs unschuldig und rein und weit offen – wissbegierige innere Kinder. Doch Traumata zwingen sie aus ihren ursprünglichen Rollen hinaus in extreme Positionen. Weil es sich hierbei um unsere empfindsamsten Anteile handelt, werden sie von Trauma, Zurückweisung und Verrat am tiefsten verletzt. Sie nehmen die Last von emotionalem Schmerz, tiefer Angst und Wertlosigkeit auf sich. Um welches Trauma es auch immer geht, diese Anteile werden am schwersten getroffen und bleiben in dem Alter, in dem sich das Trauma ereignet hat, stecken – erstarrt und voller Angst. Weil wir diesen Schmerz nicht ständig spüren wollen, sperren wir diese Anteile weg. Wir verbannen sie in den inneren Keller. Dies tun wir, ohne zu ahnen, dass wir uns damit gleichzeitig von unseren wertvollsten Qualitäten abschneiden. Durch die systemische Therapie mit der inneren Familie können wir wieder Zugang zu diesen verbannten Anteilen bekommen und sie heilen.
RICHARD SCHWARTZ
Unsere inneren Anteile entwickeln sich, um uns zu beschützen. Sie wollen uns davor bewahren, zu viel zu fühlen – möchten uns ein wenig in Dissoziation von unserem Körper halten. Wenn unsere Anteile Verletzungen oder ein Trauma erleben, nehmen sie, wie Richard Schwartz es nennt, «Lasten» auf sich. Ihre Aufgabe besteht darin, unsere Außenwelt zu kontrollieren, damit diese Lasten nicht getriggert werden. Dies nahm seinen Anfang, als wir noch Kinder waren, und diese inneren Anteile glauben, wir wären immer noch Kinder. Deshalb versuchen sie, uns mit denselben Strategien zu beschützen wie früher. Allerdings können sich die Verhaltensweisen, die uns, als wir klein waren, beschützten, später in etwas verwandeln, das uns schadet, beispielsweise Essstörungen oder Süchte. Die Gesellschaft redet uns ein, diese Anteile wären schlecht, weil sie uns und anderen Schaden zufügen, und verlangt von uns, diese Anteile loszuwerden und uns lieber auf unsere positiven Seiten zu konzentrieren. Doch alles, was wir mit Gewalt versuchen loszuwerden, verstärkt sich, um sich zu verteidigen. Die inneren Anteile schlagen wild um sich und melden sich immer lauter zu Wort, bis sie endlich unsere Aufmerksamkeit bekommen. Jeder unserer Anteile ist für uns gleichermaßen wertvoll und förderlich. Sie haben, als wir traumatisiert wurden, ihrem Zweck gedient. Deshalb ist es wichtig, runter in den Keller zu gehen und mit ihnen in Dialog zu treten: Ich weiß, dass du hier bist, um mir zu helfen. Was versuchst du zu beschützen? Was willst du mir sagen?
AMANDA
Es gibt Stimmen in meinem Kopf, die erst wieder still werden, wenn sie das Gefühl haben, vollständig gehört, wertgeschätzt und verstanden worden zu sein. Meine erste Reaktion lautet meistens: Was hat dieser Anteil eigentlich für ein Problem? Warum sagt er mir, ich darf nichts essen? Warum? Mach das leise. Stell das bitte endlich ab. Nein. Das Gegenteil ist richtig: Mach das unbedingt lauter. Dieser Teil muss gehört werden. Er sagt: Glennon, früher war es gefährlich, deinem Appetit freien Lauf zu lassen. Ich habe dich beschützt, indem ich dafür gesorgt habe, dass wir klein und schmal bleiben und in Sicherheit. Das tue ich heute noch. Ich versuche, dafür zu sorgen, dass du klein und schmal bleibst, damit wir überleben. Ich versuche nur, dich zu beschützen. Wir alle haben Anteile in uns, die über sehr lange Zeit sehr viel geleistet und uns damit das Überleben gesichert haben. Sie arbeiten auf der Basis veralteter Informationen. Sie wissen nicht, dass wir längst in Sicherheit sind und andere Regeln gelten. Sie brauchen lediglich ein Update.
GLENNON
Ich habe mir für das Videospiel namens Leben einen kleinen Avatar ausgedacht, eine kleine Kämpferin mit Motorradjacke. Sie hält ein Mikro in der Hand und geht vor mir hinaus in die Welt. Sie dient als dissoziativer Schutz meines wahren Ichs, meines kleinen Selbst, und sie ist ziemlich niedlich. Die Vorstellung, mich auf diese Weise um mich zu kümmern, vor allem, als ich jünger war, aber auch heute noch, gefällt mir. Ich stelle mir vor, da wäre eine, die zu mir sagt: «Ich hab dich. Ich bin hier. Bleib du ruhig dahinten. Ich mach das hier.» Und dann tritt die Stand-up-Comedian mit der wilden Frisur und der Lederjacke raus auf die Bühne und kümmert sich um mein empfindsames Selbst.
CAMERON ESPOSITO
Ich hatte eine Klientin mit Bulimie, die sich außerdem geritzt hat. Das hat mich neugierig gemacht, und ich fragte: «Warum tust du ihr das an?» Daraufhin erzählte mir der angesprochene Anteil bereitwillig, dass die Klientin als Kind missbraucht worden sei und es wichtig war einzuschreiten, um sie davon abzulenken. Es war, wie sich herausstellte, eine Heldengeschichte. Mir gelang es mitzugehen, und ich sprach dem Anteil meine Bewunderung dafür aus, dass er ihr das Leben gerettet hatte. Der Anteil brach in Tränen aus, weil er bis zu diesem Zeitpunkt immer nur verteufelt worden war und alle versucht hatten, ihn wegzutherapieren. Endlich gab es jemanden, der Verständnis hatte und ihn würdigte. Unsere Anteile glauben, sie würden uns das Überleben sichern.
RICHARD SCHWARTZ
Wie alt warst du, als du zum ersten Mal gedacht hast, das muss ich unter Kontrolle kriegen? Wann war das? Während der Grundschule? Du hast als kleines Kind Verantwortung übernommen, vermutlich für deine Familie und für den Rest der Welt, weil du wolltest, dass es allen gut geht, und hast dafür dein eigenes Glück geopfert. Ich sage es noch einmal, du warst noch ein Kind. Wie geht es dir, wenn du heute an dieses kleine Kind denkst, das versucht hat, seinen Eltern dabei zu helfen, glücklich zu sein, das versucht hat, die Welt im Gleichgewicht zu halten? Welche Gefühle empfindest du gegenüber diesem Menschen?
MARTHA BECK
Meine Kultur hat mich geprägt, darum bin ich, wie ich bin.
Meiner Auffassung nach gibt es zwei Sorten von Leid.
Da ist zum einen das unvermeidliche Leid, das integraler Bestandteil der menschlichen Existenz ist, wie zum Beispiel die Erfahrung eines gebrochenen Herzens. Wir alle erleben früher oder später Verlust und Trauer. Wir alle werden irgendwann in unserem Leben gezwungen, unsere Komfortzone zu verlassen.
Ich glaube – und diese Idee basiert auf einem klugen Satz, den ich zuerst von John Powell gehört habe –, dass es noch eine andere Form von Leid gibt, und die ist vermeidbar. Dieses Leid hat mit den Systemen zu tun, in denen wir leben, und damit, was uns diese Systeme über uns selbst erzählen und darüber, wie viel oder wenig Macht wir besitzen.
AI-JEN POO
Etiketten sind keine starren Schubladen. Etiketten sind ein Projekt. Ein Wissensfeld. Wenn ich mich als Asian American bezeichne, spreche ich von einer Reise. Ich spreche nicht von einem Kästchen zum Ankreuzen. Menschen versuchen ständig, mich in eine Schublade zu zwängen, aber wie sollen wir jemals irgendetwas endgültig bestimmen – Männlichkeit, Weiblichkeit, egal was? Ich weiß doch selbst nicht, was das ist. Woher auch? Woher sollte irgendjemand von uns das wissen?
OCEAN VUONG
Ich wurde von den Schubladen geprägt, in die meine Kultur mich gesteckt hat, darum bin ich, wie ich bin.
Wenn wir essen gehen, denke ich beim Blick in die Speisekarte automatisch, okay, diese Optionen gibt es, und bestelle. Dann wendet die Kellnerin sich an Abby, und es geht los. «Ich hätte gerne das hier, aber mit dem da statt diesem hier, und lassen Sie das bitte ganz weg.» Irgendwann wird das Essen serviert, und ihres ist immer viel besser als meines. Insgeheim bin ich jedes Mal ein bisschen neidisch, weil ich das Gefühl habe, sie hätte gegen die Regeln verstoßen und wäre auch noch dafür belohnt worden. Ich dachte immer, die Höflichkeit würde von uns verlangen, uns genau an die Speisekarte zu halten.
Die Gesellschaft hat uns Auswahllisten für alle möglichen Bereiche in die Hand gedrückt, für Sexualität, Gender, Arbeit, Mutterschaft. Unsere Optionen sind deshalb so beschränkt, weil die Speisekarte nicht derjenigen dient, die daraus bestellt, sondern der Ordnung der Dinge. Irgendjemand hat diese Speisekarte geschrieben, und das waren garantiert nicht wir.
GLENNON
Ist es nicht absolut schräg, dass es nur zwei Kategorien gibt, in die wir uns einordnen dürfen?
ABBY
Wir betrachten Gender als etwas Inhärentes, uns Angeborenes – etwas, das ist, wie es ist. In Wirklichkeit erschaffen wir Gender, indem wir ihm Bedeutung verleihen. Wir kreieren Gender, indem wir einem Kind tausendmal am Tag sagen, wer es ist, und das bereits vor seiner Geburt. Wir tun dies nicht nur verbal, sondern auch in Form von offenen und stillschweigenden Erwartungen, Reaktionen, Ängsten und der Ziele, die wir für unsere Kinder haben. Was ist für sie angemessen? Was ist tabu? Wofür werden sie geschmäht? Wofür werden sie gelobt?
Kinder machen unterschiedliche Erfahrungen, die auf den geschlechtsspezifischen Erwartungen ihres Umfelds beruhen. Diese Unterscheidung wird tief in ihre Identität, in ihr Selbstwertgefühl eingebettet und erschafft unterschiedliche Menschen. Ist das getan, heißt es: «Sie unterscheiden sich sehr, das muss am Geschlecht liegen!», anstatt zu erkennen, dass diese Unterschiede ihren Ursprung in der fortwährenden Konstruktion, Überwachung und Verstärkung des Geschlechts selbst haben.
Es heißt allgemein, Biologie wäre Schicksal, doch in Wirklichkeit ist Kultur Schicksal, weil unser Selbstverständnis durch kulturelle Diktate bestimmt wird. Wir verweisen auf das, was wir geworden sind, als Beleg für unsere biologische Prägung. Auf diese Weise setzt sich die sich selbst erfüllende Prophezeiung immer weiter fort.
Doch die gute Nachricht lautet, dass Kultur und Gesellschaft sich ständig wandeln – und damit auch unser Schicksal.
AMANDA
Die Genderregeln meiner Kultur haben mich geprägt, darum bin ich, wie ich bin.
Ich finde es eigenartig, dass trans- und nichtbinären Menschen der Vorwurf gemacht wird, sie würden anderen die Genderdiskussion zumuten, obwohl die wahre Zumutung darin besteht, Milliarden komplexer, göttlicher, differenzierter Seelen in lediglich zwei Kategorien einzuteilen: Männer und Frauen. Uns wird weisgemacht, es gäbe nur zwei Geschlechter, und diejenigen, die das behaupten, kommen damit durch, weil sie all diejenigen töten, verschwinden lassen, ausradieren und entrechten, die seit Ewigkeiten Seite an Seite mit euch leben.
ALOK
Wenn ich Männern beim Mannschaftssport zusehe oder sie auf der Tribüne beobachte, bin ich jedes Mal erstaunt, wie leidenschaftlich sie sich umarmen und küssen, sich gemeinsam freuen, weinend auf dem Rasen liegen, wie hemmungslos sie Trauer, Verletzbarkeit, Enthusiasmus, Leidenschaft, Tränen zeigen. Ich frage mich dann immer, ob Männer Sport deshalb so lieben, weil sie dort die Männerregeln missachten dürfen: einander nicht berühren, sich nie verletzlich zeigen, sich nicht zu sehr einlassen, keine Freude und Verbundenheit zeigen. Ist Sport der Ort, wo sie sich von alldem befreien und endlich ganz Mensch sein dürfen? Auch die Frauen und Mädchen, die ich beim Sport beobachte, wirken unglaublich frei. Sie nehmen sich die Freiheit, die Frauenregeln links liegen zu lassen und wild zu sein, animalisch, mächtig, wetteifernd. Es ist faszinierend zu beobachten, wie Menschen sich ausgerechnet in einem so geschlechtsspezifischen Bereich wie der Welt des Sports von Geschlechterrollen frei machen.
GLENNON
Als Lehrerin habe ich die Konditionierung von Mädchen und Jungen hautnah mitbekommen. Hatten zwei Jungen miteinander Streit, wurde ihnen gesagt, sie sollten sich in ihrem Konflikt ehrlich und direkt verhalten. Gerieten jedoch zwei Mädchen aneinander, hieß es: «Ihr müsst lieb zueinander sein. Vertragt euch.» Die Mädchen sollten um jeden Preis den Frieden wahren, auch wenn dieser Frieden unehrlich war, weil sie dafür ihre Gefühle herunterschlucken mussten, ohne dass die zugrunde liegende Meinungsverschiedenheit auch nur angesprochen wurde. Die Mädchen hatten kein Recht auf Zerwürfnisse. Mädchen werden darauf konditioniert, dem eigenen, inneren Konflikt den Vorzug zu geben, um im Außen jeden Konflikt zu vermeiden.
Es ist also nicht überraschend, dass Frauen oft Schwierigkeiten damit haben, Konflikte untereinander offen und direkt anzugehen. Wir haben gelernt, Konflikte herunterzuschlucken, Verletzungen seitens anderer zu ignorieren und so zu tun, als ob wir jemanden mögen, auch wenn es eindeutig nicht stimmt. Doch die Wahrheit kommt immer irgendwann ans Licht. Wenn wir sie nicht direkt aussprechen können, dann eben auf ungesunden Schleichwegen – dafür gibt es den unschönen Begriff «Stutenbissigkeit». Ich glaube, wir Frauen würden einander seltener in den Rücken fallen, wenn es uns als Kindern erlaubt gewesen wäre, einander frontal anzugehen und dann zur Tagesordnung zurückzukehren.
GLENNON
Als körperbehinderter Mann habe ich sehr mit meiner Männlichkeit zu kämpfen. Ich verspüre noch immer den Drang, einer traditionellen Männerrolle zu genügen, und empfinde mich noch immer nicht wirklich als Mann, weil ich die allgemein gültigen, willkürlichen Werte von Männlichkeit übernommen habe. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich im ersten Jahr nach meinem Unfall auf dem Beifahrersitz im Bus meiner Mutter saß. Sie brauchte etwas vom Metzger, und weil ich nicht wollte, dass sie meinen Rollstuhl für mich aus dem Auto holte, sagte ich ihr, ich würde sitzen bleiben. Es war schon Abend, sie überquerte den Parkplatz, und plötzlich bekam ich Angst. Was, wenn ihr etwas passiert?, dachte ich. Es ist stockdunkel. Mir wurde bewusst, dass ich ihr nicht würde helfen können, falls tatsächlich etwas geschah.
Ich fragte mich: Was bedeutet Mannsein für mich, wenn ich nicht in der Lage bin, die Menschen, die mir am nächsten sind, zu unterstützen oder zu beschützen?
Bei der herkömmlichen Definition von Männlichkeit geht es viel um Fähigkeiten, vor allem auf körperlicher Ebene. Ich persönlich kann körperlich nicht viel leisten. Ich habe mich immer für mein Bedürfnis geschämt, dieser Vorstellung von «Männlichkeit» zu genügen, doch dann sagte ich mir: Carson, es ist nicht deine Schuld. Du hast die Erwartungen anderer Leute verinnerlicht. Inzwischen kann ich wählen, wer ich bin. Ich habe selbst die Wahl, wie ich Mannsein und Männlichkeit für mich definieren möchte.
CARSON TUELLER
Auf den Fidschi-Inseln wurde kurz nach Einführung des Fernsehens eine Studie durchgeführt. Fast fünfzig Prozent der Mädchen hatten nach einer gewissen Zeit eine Essstörung entwickelt. Faszinierend dabei ist Folgendes: Man hat die Mädchen gefragt, weshalb sie Diät hielten und Abführmittel benutzten. Die Antwort lautete, verallgemeinert: «Weil die dünnen Frauen im Fernsehen mehr Macht haben.» Es ging nicht um Schönheit, es ging um Macht.
Die Heilung meiner Anorexie verlangt von mir, einen genauen Blick auf die Körperhierarchie zu lenken – mir anzusehen, inwiefern es Vorteile für mich hat und mir Macht verleiht, mich zu kontrollieren, dünn zu bleiben, mich den gültigen Schönheitsstandards anzupassen. Dünn zu sein, verleiht Macht. Die Stirn faltenfrei zu halten, keinen grauen Haaransatz zu haben, verleiht Macht. Bei Schönheit dreht sich alles nur um Macht.
GLENNON
Ich wurde von den Vorstellungen meiner Kultur darüber geprägt, welche Körper wertvoll sind, darum bin ich, wie ich bin.
GLENNON:
Sonya, du sagst, wir befinden uns alle auf der Stufenleiter der Körperhierarchie. Wir sind alle zugleich Opfer und Komplizin.
SONYA RENEE TAYLOR:
Das Ziel der Körperhierarchie besteht darin, möglichst weit nach oben zu kommen und dabei zu erkennen, dass die meisten von uns in einem Körper zu Hause sind, der die oberste Stufe nie erreichen wird. Doch solange unter uns noch irgendjemand steht, wissen wir wenigstens, dass wir besser dran sind als andere – das ist nicht zwingend ein bewusster Prozess.
Meiner Meinung nach ist diese Leiter allerdings nur deshalb real, weil wir das Spiel mitspielen. Wir verlieren nichts, wenn wir von der Leiter steigen. Im Gegenteil, das, was wir dann gewinnen, nämlich radikale Selbstliebe, befindet sich jenseits unserer Vorstellungskraft. Es ist wie die Beschreibung eines atemberaubenden Sonnenuntergangs. Man weiß erst wirklich, wie es ist, wenn man es selbst erlebt, wenn man dasteht und zusieht, wie der gigantische Ball aus Feuer und Hitze und Gasen am Horizont versinkt.
Auf diesem frauenfeindlichen, tödlichen Planeten im Körper einer Frau zu leben und Essstörungen oder andere Copingstrategien zu entwickeln, ist keine Anomalie. Es geht nicht um die Frage, ob in diesem oder jenem Kleidungsstück die Oberschenkel zu dick wirken. Es geht nicht um Eitelkeit. Es geht um Sicherheit und Wirkungsmacht und den Mangel von beidem. Es geht darum, sich zu entsexualisieren, um zu überleben. Es geht um den Versuch, eine Möglichkeit zu finden, sich sicher zu fühlen. Wer in einem Haus lebt, in das wahrscheinlich eingebrochen wird, tut gut daran, dieses Haus für Einbrecher weniger attraktiv zu machen. Ich verstehe alle unter uns, die aufgrund eines Lebens inmitten von Raubtieren ungesunde Copingstrategien entwickelt haben. Wir sind Opfer gezielter Verunsicherung. Nicht wir sind verrückt, sondern die anderen.
GLENNON
Mädchen werden mit Regeln und Vorschriften bombardiert. Ich habe erlebt, dass kleine, vollständig bekleidete Mädchen zu hören bekamen: «Los, zieh dir etwas an» – weil ein Mann in der Nähe war. Ich werde niemals vergessen, wie ich als Kind einmal meinen Großvater begleitete, der meinen Onkel im Gefängnis besuchte. Ich war damals neun oder zehn. Als wir ankamen, musste mein Großvater mit mir wieder kehrtmachen. Ich durfte nicht mit hinein, weil ich ein Top mit Spaghettiträgern trug. Ich war ein Kind, aber es hieß, meine Aufmachung wäre eine Provokation für die Gefängnisinsassen. Mädchen bekommen suggeriert, dass sie die Schuld tragen, wenn jemand sie attraktiv findet, weil sie nicht genug getan haben, um sich zu beschützen.
TARANA BURKE
Ich finde die kollektive Übereinkunft seltsam, die besagt, dass die Hälfte aller Gesichter weltweit über jede Kritik erhaben ist. Warum um alles in der Welt sind Männergesichter der Öffentlichkeit jederzeit zumutbar, während die Gesichter von Frauen so minderwertig oder verheert sind, dass wir uns jeden Morgen mit Make-up und Concealer und Konturenstift und Farben zukleistern müssen? Ein Typ, der mit hängender Visage irgendwo abhängt, ist völlig okay, aber wenn ich ohne Concealer aus dem Haus gehe, heißt es, ich sähe müde aus. Ich habe jedes Mal das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, wenn ich ungeschminkt das Haus verlasse. Als wäre ich der Welt makellose Haut und unnatürlich dichte Wimpern schuldig. Das ist doch seltsam, oder?
GLENNON
Dicken Menschen wird automatisch ein gestörtes Verhältnis zum Essen und zum eigenen Körper unterstellt. Die Psychologin Deb Burgard sagt: «Wir verordnen übergewichtigen Menschen haargenau das, was wir bei untergewichtigen Menschen als Störungsbild diagnostizieren.» Das heißt, wir verlangen von dicken Menschen ein gestörtes Essverhalten, indem wir von ihnen erwarten, dass sie möglichst wenig Kalorien zu sich nehmen. Wir erwarten, dass sie sich Gewalt antun, um dünn zu werden, weil alles andere inakzeptabel ist. Meinen Körper zu lieben, ändert also nichts am Verhalten der anderen. Es existiert trotzdem eine äußere Welt, die ich nicht einfach zum Verschwinden bringen kann.
AUBREY GORDON
Etwas, das mich als stark sehbehinderte Frau seit jeher begleitet, ist die Tatsache, dass andere Menschen viele Vorstellungen und Ideen dazu haben, wer ich bin oder wer ich sein könnte oder wie mein Leben sein könnte oder zu welchen Dingen ich Zugang habe oder nicht. Durch den Blick anderer – egal ob Fremde oder Menschen, die einen lieben – entmenschlicht oder auf eine bestimmte Facette reduziert zu werden, gehört zu den schmerzhaftesten Erfahrungen überhaupt. Es vermittelt einem das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Vielleicht entstammt unser tiefster Schmerz diesem Erleben von Getrenntheit.
CHLOÉ COOPER JONES
GLENNON:
Wir neigen dazu, rassistische Gewalt mit weißen Männern zu assoziieren und ignorieren dabei die Rolle weißer Frauen, doch jedes Weißsein