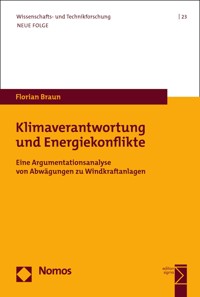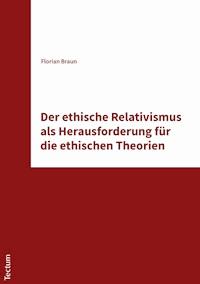39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Multimedia, Internet, neue Technologien, Note: 1,0, Fachhochschule Kaiserslautern Standort Zweibrücken, Sprache: Deutsch, Abstract: Wohl kaum ein anderes soziales Phänomen im Internet hat sich in den vergangen Jahren so dynamisch entwickelt wie die sozialen Netzwerke im Web 2.0. In Deutschland sorgte der Erfolg von studiVZ für einen Boom dieser Internet-Angebote. Die Euphorie erreichte ihren Höhepunkt, als die Verlagsgruppe Holtzbrinck im Januar 2007 das Studentennetzwerk für 85 Millionen Euro kaufte. Noch nie dagewesene Dimensionen von Klickzahlen zeigen, dass die User viel Zeit damit verbringen,ihr Profil sowie ihre Kontakte zu pflegen, Fotos hochzuladen und sich gegenseitig zu „gruscheln“. Gerade aufgrund dieser positiven Resonanz stellt sich die Frage, ob sich die hohe Nutzeraktivität auch auf der wirtschaftlichen Seite von studiVZ bemerkbar macht. Inwieweit konnte studiVZ die hochgesteckten Erwartungen seitens des Investors Holtzbrinck erfüllen? Eineinhalb Jahre nach der Übernahme wird anhand dieser Arbeit eine Analyse des Geschäftsmodells und der Entwicklungen von studiVZ vorgenommen. Das Ziel der Untersuchung ist die Betrachtung des Web 2.0 in Verbindung mit der Analyse vergangener und zukünftiger Erfolgskriterien, Chancen, Gefahren sowie Zukunftsaussichten für das Geschäftsmodell von studiVZ. Für den Verlauf der Arbeit ergeben sich die folgenden zentralen Fragestellungen: - Welche Motive führten zur Übernahme von studiVZ durch Holtzbrinck und wie sieht das aktuelle Geschäftskonzept des Social Network aus? - Welche Faktoren sind für den Erfolg von studiVZ auf dem deutschen Markt verantwortlich? - Wie stellt sich die wirtschaftliche Situation für studiVZ dar? Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der Geschäftstätigkeit, dem aktuellen Unternehmensumfeld und den Marktentwicklungen? - Ist das derzeitige Ertragsmodell von studiVZ geeignet, um dem Unter-nehmen einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg zu verschaffen oder besteht zukünftig Handlungsbedarf? - Wie sehen die Perspektiven von studiVZ aus? Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte. Zunächst erfolgt in Kapitel 2 eine Einführung in das Themengebiet Web 2.0. Anschließend wird in Kapitel 3 das Web 2.0-Geschäftsmodell „Social Networking“ am Beispiel von studiVZ aufgezeigt. In Kapitel 4 werden die zentralen Erfolgsfaktoren analysiert, welche zum Erfolg von studiVZ geführt haben. Der Schwerpunkt der Arbeit bildet Kapitel 5, das eine Situationsanalyse des Social Network-Anbieters beinhaltet. Daraus werden die Perspektiven von studiVZ ermittelt. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Ausblick.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
Page 5
Page 6
Page 1
Einleitung
1 Einleitung
Die Einleitung beginnt mit einer kurzen Problembeschreibung. Anschließend werden die Zielsetzung und Vorgehensweise dieser Arbeit erläutert.
1.1 Problemstellung
Wohl kaum ein anderes soziales Phänomen im Internet hat sich in den vergangen Jahren so dynamisch entwickelt wie die sozialen Netzwerke im Web 2.0. In Deutschland sorgte der Erfolg von studiVZ für einen Boom dieser Internet-Angebote. Die Euphorie erreichte ihren Höhepunkt, als die Verlagsgruppe Holtzbrinck im Januar 2007 das Studentennetzwerk für 85 Millionen Euro kaufte. Viele Marktbeobachter sprachen damals in Anlehnung an die Spekulationsblase der New Economy von einer „Bubble 2.0“. Aus Nutzersicht sind die Social Networks von studiVZ mittlerweile zu einer der beliebtesten Anwendungen im Web geworden. Noch nie dagewesene Dimensionen von Klickzahlen zeigen, dass die User viel Zeit damit verbringen, ihr Profil sowie ihre Kontakte zu pflegen, Fotos hochzuladen und sich gegenseitig zu „gruscheln“. Gerade aufgrund dieser positiven Resonanz stellt sich die Frage, ob sich die hohe Nutzeraktivität auch auf der wirtschaftlichen Seite von studiVZ bemerkbar macht. Oder sind etwa Tendenzen für einen neuen „Hype“ zu erkennen? Inwieweit konnte studiVZ die hochgesteckten Erwartungen seitens des Investors Holtzbrinck erfüllen? Eineinhalb Jahre nach der Übernahme wird anhand dieser Arbeit eine Analyse des Geschäftsmodells und der Entwicklungen von studiVZ vorgenommen.
1.2 Zielsetzung
Das Ziel der Untersuchung ist die Betrachtung des Web 2.0 in Verbindung mit der Analyse vergangener und zukünftiger Erfolgskriterien, Chancen, Gefahren sowie Zukunftsaussichten für das Geschäftsmodell von studiVZ. Der Schwerpunkt wird auf die Sichtweise seitens des Unternehmens beziehungsweise Eigentümers Holtzbrinck gelegt. Hierbei erfolgt die Be-
Page 2
Einleitung
trachtung der Thematik hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Kriterien. Auf-grund der hohen Interdisziplinarität der sozialen Netzwerke werden aber auch sozial- und kommunikationswissenschaftliche Bereiche angerissen. Die Bearbeitung des Themas wird anhand aktueller Literatur, Studien, Untersuchungen sowie Internetquellen vorgenommen. Den Praxisbezug erhält die Arbeit durch ein absolviertes Praktikum des Autors bei studiVZ im Jahr 2007 und die tägliche Nutzung von Social Networks. Weiterhin wurde aufgrund der sehr dynamischen und schnelllebigen Marktentwicklungen großen Wert auf eine möglichst aktuelle und zeitnahe Darstellung der Materie gelegt. Für den Verlauf der Arbeit ergeben sich die folgenden zentralen Fragestellungen:
•Was versteht man unter dem Begriff Web 2.0 und welche Merkmale liegen dem „neuen Internet“ zugrunde? Was bedeutet das Web 2.0 für die Internetökonomie?
•Welche Motive führten zur Übernahme von studiVZ durch Holtzbrinck und wie sieht das aktuelle Geschäftskonzept des Social Network aus?
•Welche Faktoren sind für den Erfolg von studiVZ auf dem deutschen Markt verantwortlich?
•Wie stellt sich die wirtschaftliche Situation für studiVZ dar? Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der Geschäftstätigkeit, dem aktuellen Unternehmensumfeld und den Marktentwicklungen?
•Ist das derzeitige Ertragsmodell von studiVZ geeignet, um dem Unternehmen einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg zu verschaffen oder besteht zukünftig Handlungsbedarf?
•Wie sehen die Perspektiven von studiVZ aus?
1.3 Gang der Arbeit
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte. Zunächst erfolgt in Kapitel 2 eine Einführung in das Themengebiet Web 2.0. Anschließend wird in Kapitel 3 das Web 2.0-Geschäftsmodell „Social Networking“ am Beispiel von studiVZ aufgezeigt. In Kapitel 4 werden die zentralen Erfolgs-
Page 3
Einleitung
faktoren analysiert, welche zum Erfolg von studiVZ auf dem deutschen Markt geführt haben. Der Schwerpunkt der Arbeit bildet Kapitel 5, das eine ausführliche Situationsanalyse des Social Network-Anbieters beinhaltet. Daraus werden der zukünftige Handlungsbedarf und die Perspektiven von studiVZ ermittelt. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Ausblick.
Page 4
Grundlagen des Web 2.0
2 Grundlagen des Web 2.0
In Kapitel 2 wird eine Einführung in das Thema Web 2.0 vorgenommen. Zunächst sollen Herkunft und Bedeutung des Begriffes Web 2.0 geklärt werden. Danach erfolgt eine Beschreibung der wesentlichen Kriterien, die das Web 2.0 derzeit prägen. Anschließend werden die Auswirkungen auf die Internetökonomie aufgeführt. Das Kapitel schließt mit einer kritischen Betrachtung der Entwicklungen im Web 2.0.
2.1 Herkunft und Bedeutung des Begriffes Web 2.0
Der Begriff Web 2.0 entstand im Oktober 2004 während einer Brainstorming-Sitzung mit Dale Dougherty von O’Reilly Media und Craig Line von MediaLive für eine neue Internet-Konferenz in den USA.1Das Ziel der „Web 2.0 Conference“ bestand darin, zentrale Charakteristika herauszuarbeiten, die die damals erfolgreichsten Internet-Unternehmen kennzeichneten. Weiterhin identifizierten die Veranstalter eine Reihe von ökonomischen, sozialen und technologischen Trends, die das Internet seit dem Platzen der Internetblase im Jahre 2000 signifikant verändert haben und somit einen Wendepunkt markierten.2Entscheidend beeinflusst wurde diese Entwicklung durch die Entstehung neuer Anwendungen, Techniken und Geschäftsmodelle. Die wesentlichen Merkmale des Web 2.0 wurden nach der Konferenz in einer Mind Map3zusammenfasst und von O’Reilly 2005 in seinem viel beachteten Artikel „What is Web 2.0?“ näher erläutert. Jedoch blieb O’Reilly bei der Beschreibung des Web 2.0 unpräzise, vielmehr sieht er das neue Internet als eine Ansammlung von Prinzipien und Praktiken.4In einem weiteren Schritt stellte er typische Web 2.0-Dienste klassischen Internetanwendungen gegenüber, um so die Unterschiede zwischen dem neuen und alten Internet aufzuzeigen.5
1Vgl. O’Reilly (2005)
2Vgl. Reitler (2007), S. 15
3Siehe Anhang 1a: Web 2.0 Mind Map
4Siehe Kapitel 2.2.1: Grundprinzipien nach O’Reilly
5Siehe Anhang 1b: Web 1.0 vs. Web 2.0-Anwendungen
Page 5
Grundlagen des Web 2.0
Die Dehnbarkeit des Begriffes hat in Wissenschaft und Praxis zu regen Diskussionen darüber geführt, um was es sich beim Web 2.0 wirklich handelt.6Während Web 2.0 für O’Reilly ein neues Netzverständnis darstellt, ist es für die anderen lediglich ein „Buzz-Word“7oder Marketing-Begriff, der alten Wein in neuen Schläuchen verkauft. Aus Sicht des Begründers des World Wide Web Berners-Lee ist der Begriff ein Jargon, bei dem nie-mand weiß, was damit genau gemeint ist.8Andere wiederum erinnern die kaum greifbaren Konzepte an die New Economy und bezeichnen das Web 2.0 als den Beginn eines neuen Internet-Hypes. Auch die Versionsbezeichnung „2.0“ wird oft als Kritikpunkt angeführt, denn sie suggeriert, dass es sich beim Web 2.0 um eine komplett neue Version handelt. Jedoch bildet das Web 2.0 nach Meinung vieler Beobachter das Ergebnis eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses ab, der bereits vor über einer Dekade eingeläutet wurde.9.
Die Aussagen verdeutlichen, dass die Auffassungen zur Bedeutung des Begriffes Web 2.0 divergieren. Im folgenden Kapitel werden die wesentlichen Kriterien des Web 2.0 ausführlich dargelegt.
2.2 Wesentliche Merkmale des Web 2.0
In diesem Abschnitt wird eine Charakterisierung des Web 2.0 vorgenommen. Zunächst werden die Grundprinzipien erläutert, die nach O’Reilly das Web 2.0 ausmachen. Danach werden die veränderten Rahmenbedingungen bezüglich der Internetnutzung dargelegt und das neue Nutzerverständnis aufgezeigt. Abschließend folgt ein Überblick über die neuen Anwendungen im Web 2.0, die unter dem Namen „Social Software“ zusammengefasst werden.
6Vgl. Alby (2007), S. 16
7Zu Deutsch „Schlagwort“
8Vgl. Roth (2006)
9Vgl. Maaß/Pietsch (2007a), S. 5
Page 6
Grundlagen des Web 2.0
2.2.1 Grundprinzipien nach O’Reilly
Die von O’Reilly beschriebenen Charakteristika haben die Entwicklung des Web 2.0 entscheidend geprägt.10Sie fanden sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis hohe Beachtung. In Anlehnung an das Begriffsverständnis von O’Reilly lassen sich dabei die nachfolgenden Grundprinzipien mit dem Web 2.0 in Verbindung bringen11:
Globale Vernetzung
Das Internet stellt zunehmend eine Plattform von wiederverwendbaren Diensten und Daten dar, wodurch es Nutzern und Unternehmen durch Verwendung offener Standards ermöglicht wird, bei der Lösung eigener Aufgaben auf die Leistungen anderer zurückzugreifen. Erfolgreiche Unternehmen sind darauf ausgerichtet, Daten auf globaler Ebene zu sammeln, anzubieten und auszutauschen.
Kollektive Intelligenz
Die Entstehung offener Systeme ermöglicht eine kooperative Erstellung von Inhalten. Dadurch ist eine Webkultur entstanden, die sich durch die aktive Partizipation der Nutzer auszeichnet. Anstelle der Inhaltspflege tritt aus Sicht der Plattformbetreiber das Vertrauen in die Nutzergemeinschaft, deren kollektive Intelligenz die benötigte Informationsqualität sicherstellt. Dabei steigt die Qualität des Angebotes mit der Anzahl der Nutzer. Die Nutzung kollektiver Intelligenz führt dazu, dass die Gesellschaft über größeres Wissen verfügt, wenn die Informationen so weit wie möglich verbreitet werden, statt nur für wenige Personen zugänglich zu bleiben.
Datengetriebene Plattformen
Im Mittelpunkt der elektronischen Wertschöpfungsprozesse im Web 2.0 stehen Datenbanken, deren Daten wichtiger als die Anwendungen sind. Hierbei geht es für die Unternehmen um den Aufbau einzigartiger Datenbanken mit geographischen, persönlichen und produktspezifischen Infor-
10Vgl.O’Reilly (2005)
11Vgl. Kollmann/Häsel (2007), S. 6-8
Page 7
Grundlagen des Web 2.0
mationen, welche den Nutzern als Kern- oder Nebenleistung zur Verfügung gestellt werden.
Perpetual Beta
Plattformen des Web 2.0 werden nicht mehr über einen langfristigen Zeitraum entwickelt und als fertiges Produkt an den Markt gebracht, sondern aufgrund von Kundenfeedback sowie der Auswertung des Nutzungsverhaltens ständig weiterentwickelt. Dadurch befinden sich die Produkte in einem ständigen Beta-Stadium. Weiterhin werden die Nutzer beim Test neuer Funktionen aktiv in die Entwicklung mit einbezogen.12
Leichtgewichtige Architekturen
Da die Zusammenführung von Informationen eine immer größere Rolle einnimmt, gilt es zukünftig, Inhalte aus verschiedenen Quellen einfach auswählen, verbinden und kombinieren zu können. Dies erfordert aus Sicht der Unternehmen vor allem offene Programmierschnittstellen, die eine einfache Nutzung fremder Dienste ermöglichen und dadurch einen Mehrwert für den Nutzer generieren.
Geräteunabhängigkeit
Web 2.0 Plattformen beschränken sich nicht mehr ausschließlich auf den stationären PC, sondern werden mit zunehmender Konvergenz von Internet, Mobilfunk und Digitalfernsehen auch auf anderen Endgeräten wie zum Beispiel Mobiltelefonen angeboten.
Reichhaltige Benutzeroberflächen
Die Webapplikationen im Web 2.0 bestehen nicht mehr nur aus statischen Hypertextdokumenten, vielmehr enthalten sie interaktive Elemente, die zuvor nur PC-Anwendungen vorbehalten waren. Möglich werden die „Rich Internet Applications“ durch zunehmend wichtiger werdende Technologien wie Flash und AJAX13.
12Vgl. Lux (2007), S. 3
13AJAX bezeichnet ein Konzept der asynchronen Datenübertragung, das es ermöglicht, innerhalb einer HTML-Seite eine Server-Anfrage durchzuführen, ohne die Seite komplett neu laden zu müssen (Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Ajax_(Programmierung)).
Page 8
Grundlagen des Web 2.0
Die sieben Grundprinzipien zeigen, dass es sich beim Web 2.0 nach der Ansicht von O’Reilly keineswegs um eine Menge neuer Techniken, sondern vielmehr um eine Reihe beobachtbarer Trends handelt, welche sich auf die informationsverarbeitenden Prozesse auswirken (vgl. Abb. 1).
Abbildung 1: Grundprinzipien des Web 2.014
Die genannten Kriterien reichen jedoch nicht aus, um das Web 2.0 ganzheitlich zu charakterisieren. Aus diesem Grund ist es notwendig, weitere wahrnehmbare Veränderungen in die Betrachtung mit einzubeziehen.
2.2.2 Veränderte Rahmenbedingungen
Kein anderes Medium hat sich bisher weltweit so dynamisch entwickelt wie das Internet. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich. So haben sich die technischen Vorraussetzungen für die Nutzung des Internets maßgeblich verändert. Einer der Gründe warum das Web 2.0 nicht schon früher aufkommen konnte, findet sich in der Entwicklung der Bandbreiten. Durch die Diffusion von Breitbandanschlüssen (vgl. Abb. 2) sind die Da-
14Vgl.Kollmann/Häsel (2007), S. 9
Page 9
Grundlagen des Web 2.0
tenübertragungsraten in den letzten Jahren weltweit um ein Vielfaches gestiegen.
15Abbildung 2: Entwicklung der Zugangsmöglichkeiten in das Internet
Waren im Jahre 1998 noch 64 Prozent der Nutzer per Modem im Internet unterwegs und mussten sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 56 Kilobit pro Sekunde begnügen, so nutzten im vergangenen Jahr fast 60 Prozent aller Internetnutzer in Deutschland schnelle Breitbandzugänge, bei denen derzeit Übertragungsraten von bis zu 30.000 Kilobit pro Sekunde möglich sind. Mit der Verbreitung der schnellen Zugänge stieg auch die Nutzung multimedialer und interaktiver Anwendungen, die im Web 2.0 eine über-geordnete Rolle spielen. Durch die Liberalisierung des deutschen Telekommunikationsmarktes im Jahr 1998 führten der zunehmende Wettbewerb und die Einführung von Flatrates zu stark sinkenden Kosten der Internetnutzung. Diese Entwicklungen trugen im Wesentlichen dazu bei, dass derzeit fast 43 Millionen Deutsche einen Internetzugang besitzen, was gegenüber 2002 eine Steigerung von 50 Prozent ausmacht. Die Penetrationsrate beträgt aktuell 65,8 Prozent (vgl. Abb. 3).
15Vgl. Gscheidle/Fisch (2007), S. 394
Page 10
Grundlagen des Web 2.0
16Abbildung 3: Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland
Weltweit sind 2008 circa 1,3 Milliarden Menschen im World Wide Web vertreten. Gemessen an der Weltbevölkerung ist damit bereits jeder Fünfte online.17Durch die wachsende Verbreitung des Internets hat sich die Mediennutzung in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Im Zeitraum zwischen 1999 und 2005 ist die durchschnittliche Internetnutzungszeit in Deutschland von täglich 17 auf 59 Minuten angestiegen.18Die geschilderten Veränderungen konnten in fast allen Industrieländern der Welt beobachtet werden. Sie stellen die Grundlage für die Herausbildung des Web 2.0 dar. Dabei muss angemerkt werden, dass die verschieden Einflussfaktoren in Abhängigkeit zueinander stehen und sich dementsprechend auf das Nutzerverhalten der Internetuser auswirken.
2.2.3 Neues Nutzerverständnis
Die veränderten Rahmenbedingungen haben dazu beigetragen, dass im Web 2.0 das Entstehen einer neuen Generation von Internetusern zu beobachten ist.19Dieser Trend ist besonders stark bei den jüngeren Nutzern ausgeprägt. Der Internetnutzer ist nicht mehr lediglich Konsument von In-16Vgl.Van Eimeren/Frees (2007), S. 363; ARD/ZDF (2008)
17siehe Anhang 2: Internetnutzung weltweit
18siehe Anhang 3: Entwicklung der Mediennutzungsdauer
19Vgl. Hass/Walsh/Kilian (2008), S.10
Page 11
Grundlagen des Web 2.0
formationen, sondern beteiligt sich auch als Produzent von Inhalten, indem er beispielsweise in Blogs publiziert, auf Meinungsplattformen Produkte bewertet und selbst erstellte Musik, Fotos oder Videos zur Verfügung stellt. In diesem Zusammenhang wird immer wieder von der Entwicklung des Konsumenten hin zum Prosumenten gesprochen.20Laut einer Studie konnten 2007 neun Prozent der über 14-jährigen User in Deutsch-land als Prosumenten klassifiziert werden. Bei den 14- bis 29-Jährigen lag dieser Anteil bei 33 Prozent.21
Durch das zunehmend aktive Verhalten der User im Web 2.0 verwandelt sich das Internet zunehmend in eine Plattform, auf der Content jeder Art erstellt, gemeinsam benutzt, bearbeitet und anderen Internetnutzern zugänglich gemacht wird. Da die Inhalte folglich nicht vom Anbieter eines Webangebots, sondern von den Nutzern stammen, entsteht so genannter „User Generated Content“. Neue Anwendungen, die zusammenfassend als Social Software22bezeichnet werden, sind neben dem technologischen Fortschritt des Internets Treiber dieser Entwicklung. Unter den zehn weltweit am häufigsten genutzten Webseiten befinden sich mit YouTube, MySpace, Wikipedia und Facebook mittlerweile vier Anwendungen, die auf nutzergenerierten Inhalten basieren.23Es muss jedoch kritisch angemerkt werden, dass bei einigen Angeboten wie zum Beispiel Wikipedia der größte Teil der User selbst keine eigenen Inhalte erstellt. Dies besagt die „90-9-1 Regel“24von Jakob Nielsen, wonach lediglich ein Prozent der Nutzer eines Dienstes eigene Inhalte veröffentlichen, neun Prozent gelegentlich aktiv werden und die restlichen 90 Prozent nur passiv teilnehmen. Weiterhin hat sich das Kommunikationsverhalten, insbesondere bei jüngeren Nutzern, deutlich gewandelt. Während die User früher überwiegend per E-Mail kommunizierten und anonym in Foren agierten, engagiert sich im Web 2.0 eine wachsende Anzahl der Nutzer in „Social Networks“25wie beispielsweise studiVZ oder Facebook. Dabei ist der Trend hin zu echten
20Der Begriff Prosument wurde erstmalig 1980 von Toffler geprägt und beschreibt das Verschwimmen der Grenzen zwischen Produzent und Konsument.
21Vgl. TNS Infratest (2007)
22Siehe Kapitel 2.2.4: Neue Anwendungen durch Social Software
23Vgl. Alexa (http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?ts_mode=global&lang=none)
24Vgl. Nielsen (2006)
25Siehe Kapitel 3.1: Social Networks im Web 2.0
Page 12
Grundlagen des Web 2.0
Internetidentitäten festzustellen, welche über diese Plattformen miteinander in Verbindung treten und persönliche Informationen über sich preisgeben. Dabei ist vermehrt ein hohes Maß an Selbstoffenbarung seitens vieler Konsumenten im Web 2.0 zu beobachten.
Um das neue Nutzerverständnis zu beschreiben, lassen sich verschiedene Gruppen identifizieren. Das Markt- und Medienforschungsinstitut Result hat in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk im Rahmen einer Studie eine Nutzertypologie entwickelt, die in Abbildung 4 dargestellt ist.
26Abbildung 4: Nutzertypologie im Web 2.0
Sie beschreibt die verschiedenen Nutzer in Abhängigkeit der zwei Dimensionen „Gestaltungsgrad“ und „Kommunikationsgrad“. Innerhalb dieser Dimensionen sind die verschiedenen Typen von Web 2.0-Nutzern platziert. Die Größe der Felder zeigt nicht die Größe der Gruppen, sondern die mögliche Bandbreite der kommunikativen und gestaltenden Involviertheit an.27Bei der Verteilung der einzelnen Typen wird deutlich, dass die Suche nach Informationen und Unterhaltung nach wie vor primäre Tätigkeiten im Internet darstellen.28Aber auch die so genannten „Kommu-nikatoren“(34%), „Spezifisch Interessierte“ (17%) und „Netzwerker“ (12%) stellen einen nicht unwesentlichen Anteil an der Gesamtnutzung dar.
26Vgl. Trump/Klingler/Gerhards (2007), S. 37-45
27Vgl. Trump/Klingler/Gerhards (2007), S. 37
28Siehe Anhang 4: Verteilung der Nutzertypen im Web 2.0
Page 13
Grundlagen des Web 2.0
2.2.4 Neue Anwendungen durch Social Software
Das veränderte Nutzerverständnis im Web 2.0 wurde primär durch das Aufkommen neuer Anwendungen hervorgerufen, die sehr häufig unter dem Schlagwort „Social Software“ subsumiert werden. Auch wenn derzeit noch keine allgemeingültig akzeptierte Definition vorliegt, hat sich der Begriff mittlerweile in Wissenschaft und Praxis etabliert. Unter Social Software versteht man im weitesten Sinne „Softwaresysteme, welche menschliche Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit unterstützen“.29Schmidt hingegen definiert Social Software als online basierte Anwendungen, die das Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement unterstützen.30Ein entscheidender Punkt, der alle diese Anwendungen verbindet, ist die Tatsache, dass der Einzelne eine im Verhältnis zum Gesamtwerk relativ kleine Leistung erbringt und durch seinen Teil dazu beiträgt, dass alle Nutzer insgesamt von einem vorteilhaften Endprodukt profitieren, dessen Nutzen subjektiv über den eigenen Einsatz hinausgeht.31Es existiert derzeit keine einheitliche Kategorisierung von Formen sozialer Software. Deswegen soll im Folgenden eine Klassifizierung neuer Anwendungen vorgenommen werden, die den Nutzen für den User als Unterscheidungskriterium in den Mittelpunkt stellt (vgl. Abb. 5):
32Abbildung 5: Ausprägungen von Social Software
29Sixtus (2005)
30Vgl. Richter/Koch (2007), S. 7
31Vgl. Häusler (2007), S. 2032Eigene Darstellung und Klassifikation
Page 14
Grundlagen des Web 2.0
Social Networking(Soziales Vernetzen)
Hierunter versteht man Plattformen wie zum Beispiel studiVZ oder MySpace, die in erster Linie zur Darstellung der eigenen Person sowie zur Herstellung von sozialen Kontakten genutzt werden.33
Social Collaborating(Soziales Kollaborieren)
Das gemeinschaftliche Arbeiten an Wissensressourcen wird mit so genannten Wikis gefördert. Ein Wiki ist eine Software zur Sammlung von Webseiten, die von den Nutzern nicht nur gelesen, sondern meist auch direkt online geändert werden können.34Ziel eines Wiki ist es, die Erfahrung sowie den Wissensschatz der Autoren kollaborativ in Texten auszudrücken, die allen Nutzern zugänglich sind. Große Bekanntheit erlangten die Wikis durch das Online-Lexikon Wikipedia, das ausschließlich aus Beiträgen von Nutzern besteht. Die Artikel können von den Usern weiterentwickelt, editiert und korrigiert werden.35Wikipedia ist weltweit in über 250 Sprachen verfügbar und allein in deutscher Sprache sind derzeit über 750.000 Artikel abrufbar.36
Social Publishing & Sharing(Soziales Veröffentlichen und Teilen)Zentraler Bestandteil dieser Art von Social Software ist das Veröffentlichen und Abrufen von Informationen und medialen Inhalten, die, nach thematischen Interessen geordnet, den Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Damit die Informationen beziehungsweise Inhalte durch andere Nutzer besser auffindbar sind, werden sie mit so genannten „Tags“ versehen. Tags sind Schlagwörter, mit denen Inhalte verknüpft werden. Im Gegensatz zur starren Kategorisierung können Inhalte mit mehreren Tags versehen werden, so dass sie nicht nur einer Kategorie zugeordnet sind. Dadurch wird die Suche erheblich vereinfacht. Die am meisten verwendeten Tags werden in einer „Tag Cloud“ dargestellt.37Folgende Applikationen lassen sich dabei unterscheiden:
33Siehe Kapitel 3.1: Social Networks im Web 2.0
34Vgl. Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wiki)
35Vgl. Hass/Walsh/Kilian (2008), S.13
36Vgl. Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia)
37Zu deutsch „Wortwolke“
Page 15
Grundlagen des Web 2.0
•Blogs / Podcasts
Der Begriff Blog38bezeichnet eine Webseite, die von einem Autor regelmäßig mit Beiträgen gespeist wird, wobei der aktuellste Beitrag an erster Stelle steht.39Es ist eine Art öffentlich einsehbares Tagebuch oder Journal, mit dem der Autor („Blogger“) je nach Interessenlage in-formieren, externe Informationen sammeln, verlinken und kritisch hinterfragen kann.40Der Leser kann wiederum die Beiträge kommentieren und mittels „RSS-Feeds“ abonnieren.
Ähnlich dem Blogging werden Podcasts41zur Veröffentlichung von Audio- und Video-Inhalten genutzt.
•Social Bookmarking
Diese Online-Dienste dienen dem Ablegen von Lesezeichen (Bookmarks), die anderen Nutzern öffentlich zugänglich sind. Zu den größten Anbietern zählen del.icio.us und Digg.
•Media Sharing
Dies sind Anwendungen, die das Publizieren und Austauschen digitaler Medien im Internet ermöglichen. Darunter fallen Foto-Plattformen wie zum Beispiel Flickr und Video-Portale wie YouTube oder MyVideo. Die eingestellten Dateien können von den Nutzern kommentiert und bewertet werden.
Die beschrieben Social Software Anwendungen sind sehr stark auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet. Mit dem Fokus auf Einfachheit, Partizipation und Massenkompatibilität haben diese Dienste in den letzten Jahren hohe Popularität erlangt und zum Erfolg des Web 2.0 beigetragen. Dies wird ersichtlich, wenn man sich die Nutzung der Angebote näher betrachtet (vgl. Abb. 6).
38Abkürzung für die Wortschöpfung aus Web (Netz) und Log (Tagebuch)
39Vgl. Mikloweit (2007), S. 57
40Vgl. Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Blog)
41Podcast setzt sich aus den beiden Wörtern iPod und Broadcasting zusammen.
Page 16
Grundlagen des Web 2.0
42Abbildung 6: Nutzung von Web 2.0-Anwendungen
Zu den am meisten genutzten Anwendungen in Deutschland gehören demnach Wikis (Wikipedia), Social Networks sowie Video- und Fotoplatt-formen. Bei den jüngeren Nutzern liegt deren Nutzungsanteil signifikant höher.43Trotz dieser Unterschiede kann unterstellt werden, dass einige Web 2.0-Dienste in breiten Teilen der Gesellschaft angekommen sind. Deswegen wird in diesem Zusammenhang immer wieder vom Entstehen des „Social Web“ gesprochen, da die Entwicklung von Social Software eine Art Humanisierung des Netzes in Gang gesetzt hat, die durch die Aufgabe der Anonymität im Web echte Gemeinschaft fördert, soziale Kontakte entstehen lässt und somit zu einer Neuentdeckung des Zusammengehörigkeitsgefühls innerhalb der virtuellen Welt führt.44
2.3 Implikationen für die Net Economy
Die beschriebenen Veränderungen hin zum Web 2.0 haben sich in vielfältiger Weise auf die Internetökonomie ausgewirkt. Demnach haben sich unter anderem neue Geschäftsmodelle herausgebildet und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen ist deutlich gestiegen. Nachfolgend sollen beide Aspekte näher beleuchtet werden.
42Fittkau & Maaß (2008a), S. 61
43Vgl. Gscheidle/Fisch (2007), S. 400
44Vgl. Mikloweit (2007), S. 68
Page 17
Grundlagen des Web 2.0
2.3.1 Herausbildung neuer Geschäftsmodelle
Die veränderte Nutzung des Internets durch den User sowie das Entstehen von Social Software haben seit 2004 zu einem neuen Boom von Geschäftsmodellen im Web geführt. Ein wesentliches Element ist hierbei die Verlagerung von Teilen der Wertschöpfung auf den Nutzer (vgl. Abb. 7).
45Abbildung 7: Wertschöpfungskette im Web 2.0
Während bei traditionellen Internet-Geschäftsmodellen die Inhalte durch den Betreiber beziehungsweise Content-Provider erstellt und angesammelt wurden, werden diese Prozesse nun durch den Nutzer übernommen. Die Unternehmen sind weiterhin für das Vermarkten und die Distribution der Inhalte verantwortlich. Typische Beispiele im Web 2.0 sind Social Net-works und Media Sharing-Plattformen, deren Erlösmodell derzeit zum größten Teil aus Werbeeinahmen besteht.
Weiterhin erlangt der so genannte „Long Tail“46im Web 2.0 eine immer größer werdende Bedeutung (vgl. Abb. 8). Das Long-Tail-Prinzip wurde erstmalig im Jahr 2004 von Anderson formuliert und beschreibt die Durchbrechung der Pareto-Verteilung, wonach 80 Prozent des Umsatzes mit 20 Prozent der Produkte gemacht werden.47Im Online-Handel machen diese Produkte jedoch oftmals nur einen geringen Anteil am Gesamtumsatz aus. Dies hängt damit zusammen, dass die Online Händler aufgrund niedriger
45Eigene Abbildung, in Anlehnung an Kolo/Eicher (2006), S. 10
46Zu Deutsch „Langer Schwanz“
47Vgl. Anderson (2004)
Page 18
Grundlagen des Web 2.0
Lagerkosten ein stark diversifiziertes Sortiment anbieten können, das einer speziellen Produktnachfrage gegenübersteht. Im stationären Handel sind die Kosten, um Nischen anzubieten und Käufer zu erreichen, häufig zu hoch, da die Nachfrage nach Nischenprodukten in einem geographisch begrenzten Gebiet zu gering ist.
48Abbildung 8: Long-Tail-Prinzip
Im Onlinehandel dagegen wird der überwiegende Teil des Umsatzes mit einer Vielzahl von Produkten erzielt, die einzeln betrachtet einen geringen Umsatz aufweisen, zusammen jedoch einen enormen Beitrag zum Gesamtumsatz leisten.
Die geschilderten Überlegungen lassen sich nun auch auf das Web 2.0 übertragen. Demnach entstehen neue Geschäftsmodelle, die sich auf bestimmte Zielgruppen und Nischen fokussieren. Nicht nur bei den sozialen Netzwerken ist dieser Trend zu beobachten, sondern auch im „Social Commerce“. Unter Social Commerce wird eine konkrete Ausprägung des elektronischen Handels (E-Commerce) verstanden, bei der die aktive Beteiligung der Kunden und die persönliche Beziehung der Kunden unterein-ander im Vordergrund stehen.
48Eigene Darstellung