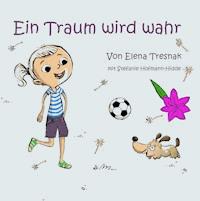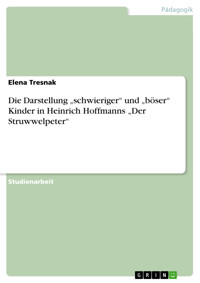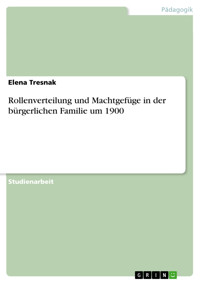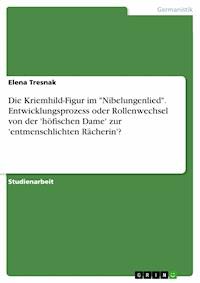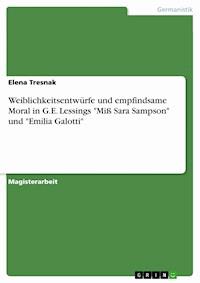
Weiblichkeitsentwürfe und empfindsame Moral in G.E. Lessings "Miß Sara Sampson" und "Emilia Galotti" E-Book
Elena Tresnak
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,0, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Titel meiner Magisterarbeit lautet „Weiblichkeitsentwürfe und empfindsame Moral in G. E. Lessings ‚Miß Sara Sampson’ und ‚Emilia Galotti’“. Das von mir intendierte Ziel besteht darin, mittels einer Analyse der Trauerspiele bestimmte literarische Weiblichkeitskonzepte abzuleiten und mit Hilfe historischer und soziologischer Ergebnisse auf die Problemstellung einzugehen, inwiefern diese Weiblichkeitskonzepte mit der historischen Realität kongruent sind oder nicht. Etwas profan ausgedrückt könnte man formulieren: Stehen die von Lessing dargestellten Frauenbilder im Einklang mit dem allgemeinen Geschlechterverständnis des 18. Jahrhunderts oder antizipiert Lessing eine modernere Auffassung bezüglich der Rolle der Frau? Diese Frage stellt sich meines Erachtens zu Recht, denn als Dramatiker der Aufklärung vertrat Lessing jene vernunftorientierten Maximen, die den ‚Menschen’ in den Vordergrund stellten und nicht dessen Geschlecht. Führt man diesen Gedankengang konsequent weiter, gelangt man zu den neueren feministischen Theorien und den von ihren Vertretern geforderten Egalitätsbestrebungen, deren wichtigste Prämisse analog zu Lessings humaner Einstellung darin bestand, dass „all of us, men as well as women should be regarded as human beings.” Dass Lessing in seinen Dramen nicht die Theorien der modernen ‚Women’s Studies’ oder ‚Gender Studies’ antizipierte beziehungsweise antizipieren konnte, versteht sich von selbst. Wenn ich im Folgenden den Begriff ‚Emanzipation’ verwende, ist dieser nicht im Sinne gegenwärtig geführter Debatten zu verstehen, sondern muss als eine Anerkennung und Aufwertung der weiblichen Sphäre beziehungsweise einer partiellen Loslösung von dem traditionell vorherrschenden Frauenbild des 18. Jahrhunderts begriffen werden. Für die Beantwortung der oben angeführten Frage besitzt zum einen der Diskurs über Tugend und Moral und die sich im Zuge der Empfindsamkeit konstituierende Korrelation zwischen Tugendhaftigkeit und weiblicher Unschuld Relevanz. Zum anderen ist die Frage nach der vorherrschenden Familienstruktur des 18. Jahrhunderts und der Funktion, die der Frau innerhalb dieses Systems zufiel, bedeutsam, da sie sich als aussagekräftiger Indikator für das Verhältnis zwischen Vätern und Töchtern beziehungsweise Ehegatten und Ehefrau erweist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
I. Prolog
1. Thematik und Zielsetzung
2. Methode und Aufbau
II. Hauptteil
1. ‚Tugend’ und ‚Moral’ im 18. Jahrhundert
1.1. Der Tugendbegriff in Frühaufklärung und Empfindsamkeit
1.2. Die Korrelation von ‚Geschlecht’ und ‚Moral’
1.3. Die ‚tugendhaften’ Töchter
1.3.1. „So ist die Tugend ein Gespenst“ (S.S.: I, 7; S. 15): Saras Tugendrigorismus
1.3.2. „Ich stehe für nichts“(E.G.: V 7; S. 85): Emilias Bekenntnis zur Verführbarkeit
1.4. Die ‚lasterhaften’ Geliebten
1.4.1. „Ich bin eine nichtwürdige Verstoßene, […].“(S.S.: IV, 6; S. 66): Marwoods Intrige
1.4.2. „Wie kann ein Mann ein Ding lieben, das ihm zum Trotze, auch denken will?“(E.G.: IV, 3; S. 61): Orsinas Stigmatisierung als ‚Verrückte’
2. Die Familie im 18. Jahrhundert
2.1. Die Struktur der Familie in Frühaufklärung und Empfindsamkeit
2.2. Die Relevanz der Frau im patriarchalischen Familiengefüge
2.3. ‚Vater’ und ‚Familie’ in Lessings theoretischen Schriften
2.4. Die Väter- Töchter- Beziehungen
2.4.1. „Er ist noch der zärtliche Vater?“(S.S.: III, 3; S. 42): Sara und William Sampson
2.4.2. „Solcher Väter gibt es keinen mehr“ (E.G.: V, 8; S. 86): Emilia und Odoardo Galotti
2.5. Die Gruppe der Mütter
2.5.1. „-Gott! ich ward eine Muttermörderin […]!“(S.S.: IV, 1; S. 57): Die Absenz der Mutter
2.5.2. „Soll ich umsonst Mutter sein?“ (S.S.: II, 4; S. 28): Marwoods Mutterschaft
2.5.3. „- Ich unglückselige Mutter!“ (E.G.: III, 8; S. 53): Claudia als Mediatorin zwischen höfischer und familialer Lebenswelt
III.Epilog
1. Resümee der literarischen Weiblichkeitskonzepte
2. Historische Weiblichkeitskonzepte in Frühaufklärung und Empfindsamkeit
3. Abschließender Vergleich
Literaturverzeichnis
I. Prolog
1. Thematik und Zielsetzung
Der Titel meiner Magisterarbeit lautet „Weiblichkeitsentwürfe und empfindsame Moral in G. E. Lessings ‚Miß Sara Sampson’ und ‚Emilia Galotti’ “. Das von mir intendierte Ziel besteht darin, mittels einer Analyse der Trauerspiele bestimmte literarische Weiblichkeitskonzepte abzuleiten und mit Hilfe historischer und soziologischer Ergebnisse auf die Problemstellung einzugehen, inwiefern diese Weiblichkeits-konzepte mit der historischen Realität kongruent sind oder nicht. Etwas profan ausgedrückt könnte man formulieren: Stehen die von Lessing dargestellten Frauenbilder im Einklang mit dem allgemeinen Geschlechterverständnis des 18. Jahrhunderts oder antizipiert Lessing eine modernere Auffassung bezüglich der Rolle der Frau? Diese Frage stellt sich meines Erachtens zu Recht, denn als Dramatiker der Aufklärung vertrat Lessing jene vernunftorientierten Maximen, die den ‚Menschen’ in den Vordergrund stellten und nicht dessen Geschlecht. Führt man diesen Gedankengang konsequent weiter, gelangt man zu den neueren feministischen Theorien und den von ihren Vertretern geforderten Egalitätsbestre-bungen, deren wichtigste Prämisse analog zu Lessings humaner Einstellung darin bestand, dass „all of us, men as well as women should be regarded as human beings.”[1] Dass Lessing in seinen Dramen nicht die Theorien der modernen ‚Women’s Studies’ oder ‚Gender Studies’ [2] antizipierte, bzw. antizipieren konnte, versteht sich von selbst. Wenn ich im Folgenden den Begriff ‚Emanzipation’ verwende, ist dieser nicht im Sinne gegenwärtig geführter Debatten zu verstehen, sondern muss als eine Anerkennung und Aufwertung der weiblichen Sphäre, bzw. einer partiellen Loslösung von dem traditionell vorherrschenden Frauenbild des 18. Jahrhunderts begriffen werden.
Für die Beantwortung der oben angeführten Frage besitzt zum einen der Diskurs über Tugend und Moral und die sich im Zuge der Empfindsamkeit konstituierende Korrelation zwischen Tugendhaftigkeit und weiblicher Unschuld Relevanz. Zum anderen ist die Frage nach der vorherrschenden Familienstruktur des 18. Jahrhunderts und der Funktion, die der Frau innerhalb dieses Systems zufiel, bedeutsam, da sie sich als aussagekräftiger Indikator für das Verhältnis zwischen Vätern und Töchtern, bzw. Ehegatten und Ehefrau erweist.
2. Methode und Aufbau
Meine Magisterarbeit geht von der Prämisse aus, dass der Zusammenhang zwischen der sozialen Struktur einer Zeit und den in der Literatur abgebildeten Sozialstrukturen nicht als eindeutiges Kausalverhältnis aufgefasst werden kann und darf. Es ist vielmehr anzunehmen, dass ein weniger direktes Verhältnis zwischen literarischer Darstellung und historisch- sozialen Fakten eines Denk, bzw. Literatursystems besteht. Eine vollständige und idealtypische Kongruenz zwischen historischem Basiswissen und literarischem Überbau muss negiert werden. Die den Trauerspielen immanenten sozialen Strukturen und moralischen Kategorien müssen interpretiert werden, ohne zwangsläufig ein schlüssiges Deduktionsverhältnis zur historisch realen Sozialgeschichte herzustellen. Es sei hier darauf verwiesen, dass die zu untersuchenden Stücke und die in ihnen vertretenen Figuren keine vollständige mimetische Abbildung der historischen Realität darstellen. Die Weiblichkeitsentwürfe in Lessings Stücken müssen vielmehr als Konglomerat unterschiedlichster Einflüsse verstanden werden, als ein differenziertes System gegenseitiger Beeinflussung und Veränderung, in dem beispielsweise auch Lessings dramentheoretische Überlegungen für die Konzeptualisierungen seiner Figuren Relevanz besitzen. Für meine Untersuchungen ist es daher notwendig, auf der einen Seite Lessings theoretische und konzeptuelle Überlegungen einzubinden und andererseits die historisch-reale Situation zu thematisieren, um anschließend aufzuzeigen, inwiefern die literarische Darstellung in Lessings Trauerspielen von der historischen Realität divergiert, bzw. welche Teilbereiche er übernommen hat.
Meine Magisterarbeit gliedert sich dafür in Prolog, Hauptteil und Epilog. Im Prolog stelle ich Thematik und intendierte Zielsetzung vor und verdeutliche die textanalytische Arbeitsmethode und den Aufbau dieser Arbeit. Anschließend folgt mein Hauptteil, welcher sich in zwei Themenkomplexe teilt, anhand derer sich die von Lessing illustrierten literarischen Weiblichkeitskonzepte am sinnvollsten ableiten lassen: In den Komplex ‚Tugend und Moral im 18. Jahrhundert’ und in den Komplex ‚Familie im 18. Jahrhundert’. Die werkimmanenten Interpretationen, die dem ersten Teil folgen, beziehen sich auf die Gruppe der ‚tugendhaften’ Töchter und die Gruppe der ‚lasterhaften’ Geliebten. Die vorangehenden historischen Darlegungen über den Tugendbegriff in Frühaufklärung und Empfindsamkeit sowie der Korrelation von ‚Geschlecht’ und ‚Moral’ veranschaulichen die Fakten der sozialen und gesellschaftlichen Realität.
Der zweite Teil ist ähnlich strukturiert: Auf die soziologische Darstellung der Familie in Frühaufklärung und Empfindsamkeit folgt die Betrachtung der Relevanz der Frau innerhalb des patriarchalischen Familiengefüges. Des Weiteren erläutere ich anhand von Lessings theoretischen Schriften und Briefen dessen Auffassung zu Familie, um die beiden Stücke anschließend unter dem Aspekt patriarchalischer Familienordnung zu interpretieren.
Im Epilog fasse ich die von mir eruierten literarischen Frauenbilder zusammen und lege die in der Frühaufklärung und Empfindsamkeit konstitutiven historischen Weiblichkeitskonzepte dar. Ich beende meine Magisterarbeit mit einem abschließenden Vergleich, der v.a. auf die Frage rekurriert, ob Lessings Weiblichkeitsentwürfe im Einklang mit dem allgemeinen Geschlechterverständnis des 18. Jahrhunderts stehen oder ob er eine Konzeptualisierung modernerer Weiblichkeitsimagines antizipierte.
II. Hauptteil
1. ‚Tugend’ und ‚Moral’ im 18. Jahrhundert
1.1. Der Tugendbegriff in Frühaufklärung und Empfindsamkeit[3]
Die Betrachtung des Tugendbegriffs in der frühen Aufklärung expliziert, dass sich das Subjekt (ergo Mann und Frau) in dieser Phase allein über seine Rationalität definierte, welche mit deistischer Religiosität und ‚Tugendhaftigkeit’, d.h. der Einhaltung tradierter Normen äquivalent gesetzt wurde. Normverstöße wie falscher Glaube oder die Verletzung des moralischen Sittenkodex erschienen als schlicht ‚unvernünftig’, wobei zwei Klassen von Normverletzungen zu differenzieren waren: reversible, auf Irrtum beruhende, Fehler und irreversible, die faktische Verletzung zentraler Normen betreffende Fehler (z.B. voreheliche Liebesbeziehungen). Michael Titzmann argumentiert
in diesem Zusammenhang, dass aus diesen Prämissen heraus eine Dichotomisierung der Weltstruktur resultiere, in der es nur zwei mögliche Zustände gäbe. In Bezug auf den Moralbegriff bedeute dies entweder ‚Tugend’ (=Normerfüllung) oder Nicht- ‚Tugend’ (= ‚Fehler’ oder ‚Laster’).[4]
Tugend musste im weitesten Sinne als Ausdruck eines internalisierten Wertesystems verstanden werden, während der damit zusammenhängende Begriff der Moral die eigentliche Wertekategorie darstellte, nach der einzelne Handlungen bewertet wurden.[5] Sie wurde als eine Eigenschaft verstanden, die v.a. durch Vernunft definiert war und ohne ein Mindestmaß an Bildung nicht auskommen konnte. Der vorherrschende Rationalismus der Aufklärung begründete Tugend auf Vernunft und setzte die Begriffe nahezu gleich, so dass die tugendhaften Charaktere als Vertreter des gesunden Menschenverstandes und die ‚Lasterhaften’ als unvernünftig verstanden wurden.
Tugend und Moral waren in der frühen Aufklärung ergo keine spezifisch weiblichen Eigenschaften, sondern Eigenschaften, durch die sich der vernunftbegabte, aufgeklärte Mensch definierte.[6] Christian Franz Paullini erörterte in seinem Werk „Das Hoch- und Wohlgelehrte Teutsche Frauen-Zimmer“ (1705) die „ohne Fug in Zweifel gezogene Frage: Ob nemlich das Weibliche Geschlecht am Verstand dem Männlichen von Natur gleich / auch/ zu Verrichtung Tugendsamer Wercke und Thaten/ ebenmäßig fähig und geschickt sey.“ [7] und kam zu dem Ergebnis, dass die Natur nicht zwischen den Geschlechtern divergiere, folglich beide Geschlechter zu Tugend und Weisheit gleichermaßen fähig seien. Die daraus resultierende neue Stellung der Frau als weibliche Gelehrte sollte sich in ihrer Tugend, für die das Wissen moralphilosophisch als Grundbedingung erachtet wurde, ausdrücken. Diese neue Korrelation von Verstand und Tugend stellte den Versuch dar, den neuen Typus vor Spott und geistlicher Kritik zu bewahren. Letztlich diente sie jedoch einzig der Förderung weiblicher Dienstbarkeit zu Gunsten des Mannes. [8]
Im Zuge der empfindsamen Strömung[9] wurden partielle Änderungen in Bezug auf den Tugend- und Moralbegriff evident. Das moralische Wertesystem errichtete im Zuge der Empfindsamkeit immer strenger werdende Sexualordnungen nicht nur im Familienkreis, sondern auch in der Gesellschaft, die Sittenverstöße mit zahlreichen Tabus und scharfer Gesetzgebung ahndete.
War die Moral in der Frühaufklärung noch eine für Männer und Frauen gleichermaßen geforderte gesellschaftliche Eigenschaft, lässt sich im Zuge der sich entwickelnden empfindsamen Bewegung der Wandel des Tugendbegriffs zu einer moralischen Kategorie konstatieren, welche eng mit weiblicher Unschuld korreliert wurde. Diese Änderung war u.a. das Resultat eines Paradigmenwechsels von der gelehrten und gesellschaftlich aktiven hin zur passiven, empfindsamen Frau mitsamt ihrer Zurückdrängung in den privaten Raum der Familie.
1.2. Die Korrelation von ‚Geschlecht’ und ‚Moral’
Wie bereits evident geworden sein dürfte, sind die Begriffe ‚Geschlecht’ und ‚Moral’ unmittelbar miteinander korreliert. Sie lassen sich nicht ohne einander denken: Auf der einen Seite finden sich die dem Geschlechterbegriff zugeschriebenen Rollenbilder, die aus den psychischen und physiologischen Erwartungshaltungen sowie aus den konventionellen- teils klischeehaften- Vorstellungen der entsprechenden Zeit resultieren. Auf der anderen Seite findet sich die ‚Moral’, die sich insbesondere im 18. Jahrhundert in paradigmatischer Weise als ein Konstrukt von Tugend und Laster definieren lässt. Wenn ich mich im Folgenden mit der Korrelation von ‚Geschlecht’ und ‚Moral’ beschäftige, gehe ich dabei vorwiegend auf den Zusammenhang von ‚Weiblichkeit’ und ‚Tugend’ ein. Gründe dafür liegen v.a. in einer Neudefinition des Tugendbegriffs. Wie bereits angedeutet war jener in der Frühaufklärung noch eine gesellschaftlich gefasste Eigenschaft, die für Männer und Frauen gleichermaßen gefordert wurde. Im weiteren Verlauf der Aufklärung und in der Phase der Empfindsamkeit verengte er sich jedoch zu einer moralischen Kategorie, so dass der Begriff ‚Tugend’ schließlich immer stärker mit sexueller Moral, respektive weiblicher Unschuld korreliert wurde. Karin Wurst argumentiert in diesem Zusammenhang, dass das Beiprodukt eines restriktiven Tugend- und Moralverständnisses die „Verteufelung der Sinne“ sei und zumeist an der Unterdrückung der Sexualität oder am Beispiel der Frau vorgeführt würde. [10]Aus diesem Grund halte ich es für sinnvoll, zunächst auf die sexuelle Moral vor dem Einfluss der Empfindsamkeit einzugehen und anschließend die sexuelle Moral während der empfindsamen Bewegung zu fokussieren. Es sei dabei zwischen der sexuellen Moral in der Ehe und der vorehelichen Sexualmoral differenziert.[11] Die rationalistisch- bürgerliche Moral der Aufklärung verstand Sexualität im Allgemeinen als beunruhigend und bedrohlich. Michel Foucault beschreibt dies in seinem Werk „Sexualität und Wahrheit“ (1977) wie folgt:
„Die Sexualität wird sorgfältig eingeschlossen. Sie richtet sich neu ein, wird von der Kleinfamilie konfisziert und geht ganz im Ernst der Fortpflanzung auf. Um den Sex breitet sich das Schweigen.“[12]
Aus diesem Grund wurde jeglicher geschlechtliche Umgang verurteilt, der nicht durch die Ehe legitimiert war, und es wurde sowohl von den unverheirateten Männern als auch von den Frauen Keuschheit und geschlechtliche Unberührtheit gefordert. Hier wurde jedoch eine doppelte Moral zwischen Mann und Frau evident: Die Forderung nach vorehelicher geschlechtlicher Enthaltsamkeit bezog sich vornehmlich auf die weiblichen Gesellschaftsmitglieder, bei ihnen stand die Forderung nach der Frau als ‚virgo intacta’ im Vordergrund. Die Absolutheit, mit der voreheliche Keuschheit gefordert wurde und die Rigorosität, mit der ein Verstoß gegen dieses Gebot geahndet wurde, zeugt davon, dass weiblicher Unschuld im System der bürgerlich-rationalistischen Moral signifikante Bedeutung zukam. Die vorherrschende Auffassung, in der weiblichen Unschuld repräsentiere sich ihr sittlicher Wert, hatte zur Folge, dass der Verlust ihrer Tugend gleichbedeutend mit dem Verlust jeglichen sittlichen Wertes war. Der vorehelicher Verlust weiblicher Unschuld bedeutete wiederum, dass die ‚gefallene’ Frau in der Gesellschaft nicht mehr heiratsfähig war, ausgenommen ihr Verführer erklärte sich zu einer Heirat bereit. Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die Prinzipien, die auf eine Reglementierung der vorehelichen Sexualmoral fokussierten, auf den Grundgedanken der bürgerlichen Moral rekurrierten: Auf die Unterwerfung der als ordnungswidrig und bedrohlich empfundenen sexuellen Kräfte unter das Gebot einer von der Gesellschaft festgelegten Ordnung.
Eine Untersuchung der vorehelichen Sexualmoral während der empfindsamen Strömung indiziert partiell eine gewisse ‚Aufweichung’ der vormals rigorosen bürgerlichen Moralauffassung. Das Vergehen selbst erfuhr eine differenzierte Bewertung, was u.a. auf die veränderte moralische Einstellung des patriarchalischen Hausvaters zurückzuführen war.[13] Ein Fehltritt wie beispielsweise die voreheliche Verführung erhielt insgesamt weniger Gewicht, da er aus Sicht des positiv zu bewertenden Gefühls gemessen wurde und weniger am Maßstab einer objektiven von Familie und Gesellschaft repräsentierten Ordnung. In der empfindsamen Sexualethik deutete sich durch die nachsichtigere Beurteilung sexueller Verfehlungen die Tendenz zur Aufhebung jener doppelten Moral an, wie sie in der rationalistisch- bürgerlichen Sittlichkeitsauffassung zu finden war. Es blieb allerdings trotz der neuen sensitiven Gefühlskultur lediglich bei der Tendenz, denn auch die empfindsame Moral beurteilte Verfehlungen von Frauen durchweg ernster als von Männern. Besonders evident wurde dies an der Literatur, die nahezu nur Normverstöße von weiblichen Figuren darstellte, während entsprechende Fehltritte des Mannes kaum behandelt wurden. Besonders signifikant wird dies anhand der bürgerlichen Trauerspiele Lessings und Schillers, in denen der Diskurs über weibliche Unschuld zum bestimmenden Merkmal dieser Gattung wurde. Die Thematik kreist dabei fast immer um die durch Verführung oder vermeintliche Verführung bedrohte Unschuld der Frau und die Konfrontation von ‚Tugend’ und ‚Laster’, was ich im Folgenden anhand der von mir zu untersuchten Stücke exemplifizieren werde.
1.3. Die ‚tugendhaften’ Töchter
1.3.1. „So ist die Tugend ein Gespenst“ (S.S.: I, 7; S. 15): Saras Tugendrigorismus
Neben der Tatsache, dass die Titel beider Werke die Namen der weiblichen Protagonisten tragen, lassen sich Lessings bürgerliche Trauerspiele „Miß Sara Sampson“(1755) und „Emilia Galotti“(1772) unter verschiedenen Gesichtspunkten vergleichen. Ich beschränke mich bei meiner Analyse auf die Aspekte ‚Tugend’ und ‚Familie’. In beiden Stücken wird an zentraler Stelle die „Halsstarrigkeit der Tugend“[14] thematisiert. Während in der „Miß Sara Sampson“ diese Art der Halsstarrigkeit, im Sinne eines kompromisslosen und restriktiven Tugendrigorismus von Vater und Tochter zumindest partiell als Fehler erkannt wird, übernimmt Emilia im gleichnamigen Stück die unnachgiebige Position des Vaters, derzufolge sie ihren Suizid einer (möglichen) Verführung vorzieht.
Die Betrachtung der „Miß Sara Sampson“ verdeutlicht die Signifikanz der Termini ‚Tugend’ und ‚Laster’, denn jene Begriffe sind zentraler Gesprächsgegenstand aller Protagonisten des Trauerspiels. Die Gespräche der weiblichen und männlichen Figuren weisen auf die bereits thematisierte Verengung des Tugendbegriffs zu einer moralischen Kategorie hin, die mit weiblicher Unschuld korreliert wird. Der dramatische Konflikt beider Stücke konstituiert sich v.a. daraus, dass sich die Bewahrung weiblicher Tugend für die Frauen als schwierig erweist, denn sie ist durch die Verbindung von „menschlicher Schwachheit“[15] und den Verführungsversuchen seitens der männlichen Protagonisten (Vgl. E.G.: II, 6; S. 27ff.) gefährdet. Deren Begehren ist größtenteils darauf gerichtet, die Frau um das zu bringen, worauf gerade ihr größter Reiz basiert: Ihre sexuelle Reinheit. Der weibliche Körper fungiert als fetischisierte Tugend, wobei eine Gefährdung jener Tugend zugleich als Bedrohung der patriarchalischen Ordnung innerhalb der emotionalisierten Familie angesehen wird. Betrachtet man die weibliche Hauptperson Sara Sampson in Lessings gleichnamigem Trauerspiel findet man diese Thesen bestätigt. Der Leser erfährt von Saras Verführung zunächst durch ihren Vater und dessen Diener Norton, welche berichten, dass sie mit ihrem Geliebten Mellefont von zu hause geflohen sei und mit ihm in einem „elenden Wirtshause“ (S.S.: I, 1; S. 5) residiere. Die Schilderungen des ihr nachgereisten Vaters William Sampson und dessen Dieners Waitwell demonstrieren, dass Sara ein tugendhaftes Mädchen war, bevor sie Mellefont kennen lernte:
Waitwell: „Das beste, schönste, unschuldigste Kind, das unter der Sonne gelebt hat, das muß so verführt werden. […] Aus jeder kindischen Miene strahlte die Morgenröte eines Verstandes, einer Leutseligkeit, einer - -.“ (S.S.: I, 1; S. 5)
Obwohl Sir William Sampson seine Tochter nach tugendhaften und moralisch integren Wertmaßstäben erzogen hat, kann er ihre Verführung durch Mellefont nicht verhindern. Sein Ausspruch: „Es war der Fehler eines zärtlichen Mädchens, und ihre Flucht war die Wirkung ihrer Reue. Solche Vergehungen sind besser als erzwungene Tugenden- […].“ (S.S.: I, 1; S. 6) verdeutlicht, dass Saras Vater nicht die Tugend als Norm in Frage stellt, sondern zwischen dem zärtlichen Gefühl und dem daraus resultierenden Fehler auf der einen Seite und einem gezwungenermaßen tugendkonformen Verhalten auf der anderen Seite abwägt. Er stellt letztlich das Gefühl über das sittliche Gesetz und schwächt damit die Verbindlichkeit objektiver Tugendnormen ab. Die Textstelle indiziert eine Anspielung Lessings auf das der Aufklärung zugrunde liegende stoische Tugendideal, das für ihn den direkten Kontrast zu dem in der Empfindsamkeit entstehenden sittlichen Ideal des ‚zärtlichen’ Herzens darstellte. Sir Williams Aussage wäre unter dieser Prämisse derartig zu interpretieren, als es besser ist, aus Gefühl lasterhaft zu werden, als aus Gefühllosigkeit tugendhaft zu bleiben, er charakterisiert sich damit als Vertreter einer neuen sensitiven Gefühlskultur.[16]
Die Untersuchung des weiteren Textverlaufes ergibt, dass Saras Flucht als erste- vom Text explizit dargestellte -Normverletzung gedeutet werden muss, da die eigentliche Verführung von Lessing in die Vorgeschichte verlegt worden ist. Sara hat mit der Abkehr von ihrem Elternhaus die von der bürgerlichen Gesellschaft postulierten Moralvorstellungen und mit ihr den Sittenkodex ihrer Zeit verletzt. Eine weitere Normüberschreitung wird evident, wenn man das szenische Arrangement betrachtet, das Lessing konstituiert hat: Sir Williams Tochter lebt bereits seit neun Wochen mit ihrem Geliebten in einem verrufenen Gasthof, ohne ihn zu heiraten, da Mellefont eine Heirat unter fadenscheinigen Gründen immer wieder verschiebt. Für sie ist dieser Zustand unerträglich, da sie mit ihm in einer Gemeinschaft lebt, die ihre Tugend gefährdet- die Tugend, in die sich Mellefont ursprünglich verliebt hat. Sara ergibt sich jedoch nicht leidend in ihr Schicksal, sondern drängt auf den Vollzug der Ehe, denn Ihrer Meinung nach macht das ehelose Zusammenleben mit Mellefont die „aufrichtigste Liebe“ zu einer „unheiligen Leidenschaft“ (S.S.: IV, 8; S. 75):