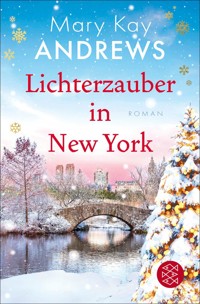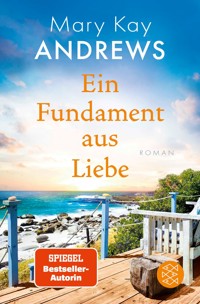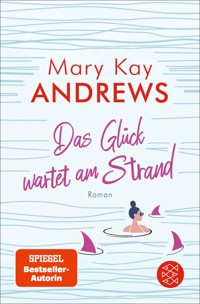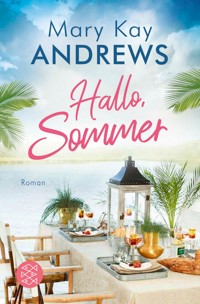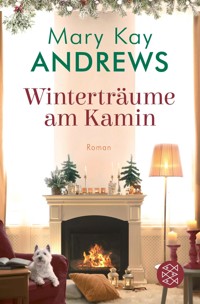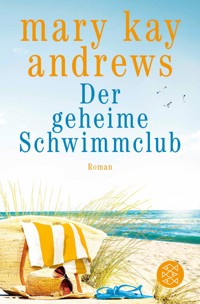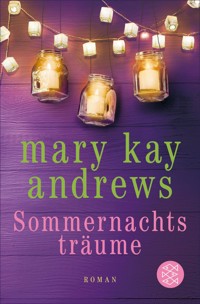12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER digiBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Winterbuchreihe
- Sprache: Deutsch
Weihnachtslichter, Wintermagie und große Gefühle. Genießen Sie zwei wundervolle Weihnachtsromane von der SPIEGEL-Bestsellerautorin und stimmen Sie sich auf die schönste Zeit des Jahres ein. Weihnachtsglitzern: Eloise Foley liebt Weihnachten. Sie freut sich auf gemütliche Abende im Kreise der Familie und mit ihrem Freund Daniel, der aber ziemlich in seinem Restaurant eingespannt ist, und auf den Wettbewerb für die schönste Laden-Weihnachtsdekoration. In einer alten Kiste findet sie eine blaue Brosche in Form eines Weihnachtsbaums. Davon inspiriert verwandelt sie ihr kleines Antiquitätengeschäft in die Weihnachtswunderwelt »Blue Christmas«. Doch an einem chaotischen Verkaufstag verschwindet die Brosche – und eine geheimnisvolle Fremde hinterlässt Eloise Geschenke an den seltsamsten Orten. Purer Zufall oder wahre Weihnachtsmagie? Winterfunkeln: Dieses Jahr ist die Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes für Eloise Foley. Ihr Traummann Daniel will sie am 24. Dezember heiraten. Die Antiquitätenhändlerin ist überglücklich. Doch als der große Tag immer näher rückt, ist an Besinnlichkeit nicht zu mehr denken. Denn erst passt das Brautkleid nicht und dann wird der Zukünftige auch noch mit einer anderen Frau gesehen. Kann dieses Weihnachten doch noch das langersehnte Fest der Liebe werden? Weitere Winterromane der Autorin: Winterträume am Kamin Lichterzauber in New York Sommer, Sonne und Herzklopfen – In der Sommerbuch-Reihe der Autorin sind u. a. erschienen: Die Sommerfrauen Sommerprickeln Kein Sommer ohne Liebe Hallo, Sommer Das Glück wartet am Strand Ein Fundament aus Liebe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mary Kay Andrews
Weihnachtsglitzern / Winterfunkeln
Zwei Winterromane in einem Band
Über dieses Buch
Weihnachtsglitzern: Eloise Foley liebt die Weihnachtszeit. Ganz besonders freut sie sich auf den alljährlichen Wettbewerb um die schönste Weihnachtsdekoration in den Läden von Savannah. In ihrem kleinen Antiquitätengeschäft erschafft sie die Weihnachtswunderwelt »Blue Christmas«. Doch nicht alle fiebern Weihnachten mit der gleichen freudigen Erwartung entgegen – besonders ihr Freund Daniel verhält sich in dieser Jahreszeit immer distanziert. Muss Eloise den Traum von einem magischen Fest der Liebe aufgeben?
Winterfunkeln: Die schönste Zeit des Jahres ist für Eloise Foley einfach Weihnachten. Dieses Jahr soll das Weihnachtsfest besonders schön werden, denn ihr Traummann Daniel will sie ausgerechnet am 24. Dezember vor den Altar führen. Die Antiquitätenhändlerin ist überglücklich. Aber je näher der große Tag rückt, desto mehr ist es mit den besinnlichen Feiertagen vorbei. Und dann wird Daniel auch noch mit einer anderen Frau gesehen. Kann dieses Weihnachten doch noch das langersehnte Fest der Liebe werden?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Mary Kay Andrews wuchs in Florida, USA, auf und lebt mit ihrer Familie in Atlanta. Im Sommer zieht es sie zu ihrem liebevoll restaurierten Ferienhaus auf Tybee Island, einer wunderschönen Insel vor der Küste Georgias. Seit ihrem Bestseller »Die Sommerfrauen«gilt sie als Garantin für die perfekte Urlaubslektüre.
Maria Poets übersetzt seit vielen Jahren Belletristik, darunter viele Spannungstitel, und zeichnet sich u.a. durch Dialogstärke und ihr Gespür für Ton und Tempo aus. Sie lebt als freie Übersetzerin und Lektorin in Norddeutschland.
Impressum
Erschienen bei FISCHER digiBooks
Die Originalausgaben erschienen unter den Titeln »Blue Christmas« 2006 im Verlag HarperCollins Publishers, New York.
»Christmas Bliss « 2013 im Verlag St. Martin’s Press, New York.
Copyright © 2006 und 2013 by Whodunnit, Inc.
Für die deutschsprachige Ausgaben:
Weihnachtsglitzern: © 2013 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Published by arrangement with Avon, an imprint of HarperCollins Publishers, LLC.
Winterfunkeln: © 2014 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: www.buerosued.de unter Verwendung von Motiven von Friedrich Strauss / Agentur Friedrich Strauss und Fi online / Ojo Images
ISBN 978-3-10-492438-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Buch 1 – Weihnachtsglitzern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nachwort
Buch 2 – Winterfunkeln
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Epilog
Mary Kay Andrews
Weihnachtsglitzern
Roman
1
Ich befestigte gerade die letzten aufgefädelten Popcorns und Cranberrys mit der Heißklebepistole am zweiten der eineinhalb Meter hohen, kunstvoll beschnittenen Weihnachtsbäume, als meine beste Freundin ins Maisie’s Daisy gestürmt kam.
BeBe Loudermilk blieb wie angewurzelt stehen, sah sich in meinem Antiquitätenladen um und rümpfte angewidert die Nase.
Sie deutete auf die halbleeren Kisten mit Äpfeln, Orangen und Kumquats, die verstreut auf meinem Arbeitstisch herumstanden, auf die halbierten Ananas und die Granatäpfel, die aus den Einkaufstüten quollen, und den frisch gefallenen Popcorn-Schnee, der den Fußboden bedeckte.
»Was zum Teufel ist hier denn los?«, fragte sie theatralisch. In BeBes Bemerkungen schwingt meistens eine gehörige Portion Drama mit.
»Willst du jetzt nebenbei auch noch in den Obsthandel einsteigen?« Traurig schüttelte sie den Kopf. »Und ich dachte, mit den Antiquitäten liefe es richtig gut.«
»Weihnachtsdekoration«, erklärte ich, drückte die Popcornfäden auf den Weihnachtsbaum, den ich bereits mit einer halben Obstplantage aus winzigen, grünen Holzäpfeln und Kumquats behängt hatte. »Für den Altstadt-Dekowettbewerb.«
»Ah jaa«, sagte sie gedehnt.
Zaghaft tippte sie gegen den Baum, den ich gerade fertig geschmückt hatte, und prompt fiel eine Kumquat herunter, rollte über den Boden und gesellte sich zu dem weiteren halben Dutzend heruntergefallener Früchte.
»Putzig«, sagte sie wegwerfend.
»Putzig? Mehr fällt dir dazu nicht ein? Putzig? Drei volle Tage sitze ich jetzt schon an diesem Projekt. Ich habe gut dreihundert Dollar für frisches Obst und Nüsse ausgegeben und gefühlte zehn Meilen Popcorn und Cranberrys aufgefädelt. Sieh dir nur meine Hände an!«
Ich hielt BeBe die Hände zur Begutachtung hin. Die Fingerspitzen waren von Nadeln zerstochen, die Handflächen vom Heißkleber verbrannt, und unzählige Pflaster bedeckten die Stellen, wo ich mich selbst aufgespießt hatte.
»Unglaublich«, sagte BeBe. »Aber wozu das Ganze?«
»Weil«, sagte ich, »ich dieses Jahr den Wettbewerb der Einzelhändler um die beste Weihnachtsdekoration gewinnen werde. Selbst wenn ich dafür die gesamte Fassade dieses Gebäudes mit jedem Stück Obst, das in Savannah zu finden ist, behängen muss.«
»Noch einmal … warum machst du dir solche Mühe? Ich meine, was springt für dich dabei heraus?«
»Stolz«, sagte ich. »Letztes Jahr dachte ich schon, ich hätte so gut wie gewonnen. Weißt du noch, wie ich alles mit vergoldeten Palmwedeln und Girlanden aus Magnolienblättern geschmückt hatte? Und mit getrockneten Okraschoten und Pinienzapfen? Und dann bin ich noch nicht einmal lobend erwähnt worden! Diese dämliche Boutique in der Whitaker Street hat den ersten Preis bekommen. Ist es zu fassen, dass die mit ihren schwachsinnigen Kopoubohnen, diesen kitschigen Vogelnestern und ausgestopften Kardinal-Vögeln gewonnen haben? Ich meine, mit ausgestopften Vögeln! Da denkt man doch sofort an Hitchcock!«
»Das war bestimmt nur ein tragisches Versehen«, sagte BeBe und sah sich im Laden um. »Kannst du mir noch mal verraten, warum ich heute unbedingt kommen sollte?«
»Du hast versprochen, auf den Laden aufzupassen«, erwiderte ich. »Bei Trader Bob drüben in Hardeeville findet eine Auktion statt, sie fängt mittags an. So kurz vor Weihnachten kann ich es mir nicht leisten, den Laden zuzumachen, wenn ich auf Einkaufstour gehe. Ich hatte gehofft, du könntest mir helfen, die Deko anzubringen, ehe ich in einer Stunde los muss.«
Sie seufzte. »Also gut. Was soll ich machen?«
Ich zeigte auf die Weihnachtsbäume. »Hilf mir mal, die beiden rauszuschleppen. Die kommen in die großen schmiedeeisernen Vasen neben der Eingangstür. Dann müssen wir das Schild über der Tür mit den Ananas, Zitronen und Limonen bekleben und die Weinlaubgirlanden um die Schaufenster hängen. Ich habe zwei verschieden Sorten Weintrauben besorgt – grüne und rote, und die befestigen wir mit Heißkleber, sobald das Grünzeug richtig hängt. Dann fehlt nur noch das Schaufenster selbst. Aber das mache ich fertig, sobald ich aus Hardeeville zurück bin.«
Schnaufend und keuchend wie Schwerstarbeiter und mit einigen sehr unweihnachtlichen Flüchen, als BeBe sich einen künstlichen Fingernagel abbrach, schafften wir es schließlich, alle Dekorationen dort anzubringen, wo ich sie haben wollte.
»So«, sagte ich, als ich draußen auf dem Gehweg stand und unser Kunstwerk betrachtete. »Da hast du’s, Babalu!«
»Babalu?«
»Das Babalu da drüben«, sagte ich und deutete auf die andere Seite des Troup Square. »Das Geschäft meiner nächsten und schwulsten Konkurrenten.«
»Das ist aber gar nicht nett«, sagte sie. »Ich dachte, du magst schwule Männer.«
»Du kennst Manny und Cookie nicht«, erklärte ich.
Manny Alvarez und Cookie Parker hatten ihren Laden in der Harris Street im letzten Frühjahr eröffnet. Manny war ein pensionierter Landschaftsgestalter aus Delray Beach, Florida, und Cookie? Nun ja, Cookie behauptete, er hätte bei der Tournee von Les Misérables am Broadway im Chor mitgesungen, aber er musste inzwischen mindestens fünfzig sein, wurde allmählich kahl und wog fast hundertfünfzig Kilo.
»Ich habe versucht, nett zu sein und sie freundlich zu empfangen. Zum Eröffnungstag bin ich mit Blumen zu ihnen gegangen und habe sie zum Abendessen eingeladen, aber seit sie ihren Laden aufgemacht haben, versuchen sie, mich zu verdrängen«, erklärte ich BeBe. »Sie haben versucht, mir meine besten Zulieferer abspenstig zu machen. Sie haben bei der Stadtverwaltung angerufen und sich darüber beschwert, dass meine Kunden in der Lieferantenzone parken. Sie sind sogar zum Geschenkemarkt gefahren und mit genau derselben Auswahl an Aromakerzen und Badesalzen zurückgekommen, die ich auch anbiete, und verkaufen sie jetzt zwei Dollar billiger.«
»So eine Frechheit!«, sagte BeBe. Sie reckte den Hals, um über den Platz zum anderen Laden zu schauen. »Sieht aus, als würden sie ebenfalls an ihrer Weihnachtsdekoration arbeiten. Ein halbes Dutzend Männer müssen da drüben rumschwirren. Wow, sieh dir das an. Sie haben so einen Truck, wie ihn auch Telefongesellschaften haben, mit einer hydraulischen Arbeitsbühne. Jemand behängt die gesamte Fassade mit Lichterketten.«
»Egal, was sie machen, es kann nur absolut kitschig werden«, sagte ich und stolzierte mit BeBe im Schlepptau zurück in den Laden. »Weißt du noch, was sie zu Halloween gemacht haben? Die gesamte Fassade hat einen roten Teufel dargestellt, mit den gelb beleuchteten Schaufenstern als Augen.«
»Hm«, machte BeBe unverbindlich.
»Die haben die ganze Nacht geblinkt. Ich hätte fast einen Anfall bekommen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Es hat mich fast wahnsinnig gemacht«, sagte ich. »Das war doch völlig daneben.«
»Es passte nicht zu Savannah«, stimmte BeBe zu. »Aber es fiel auf. Das musst du zugeben.«
»Pah! Auffallen kann doch jeder«, sagte ich, »wenn Geld keine Rolle spielt. Und die beiden schwimmen offensichtlich darin. Ich habe gehört, dass Manny persönlich zwanzigtausend Dollar für die neue Weihnachtsbeleuchtung des Einkaufsviertels gespendet hat. Aber das ist natürlich nichts anderes als der kaum verschleierte Versuch, den Dekowettbewerb für sich zu entscheiden.«
»Trotzdem ist das eine Menge Kohle«, stellte BeBe fest. »Wie sind die zu ihrem Geld gekommen?«
»Geerbt«, erklärte ich. »Ich habe gehört, dass Manny in Florida einen sehr viel älteren Liebhaber hatte, der vor zwei Jahren starb. Der hatte eine Telekommunikationsfirma gegründet, und als er starb, bekam Manny alles.«
»Außer guten Geschmack.« Ich warf ihr einen dankbaren Blick zu. Sie ist wirklich die beste Freundin der Welt.
»Also dann«, sagte ich und wischte mir die Hände hinten an meiner Jeans ab. »Ich muss jetzt los nach Hardeeville. Gegen vier müsste ich wieder zurück sein. In der Kasse ist reichlich Wechselgeld. Die Preise stehen überall dran. Alles, was braun oder orange ist, kannst du als Thanksgiving-Artikel anbieten und für die Hälfte weggeben. Und wenn du Manny oder Cookie dabei ertappst, wie sie draußen herumschleichen, um meine Dekoideen zu klauen, hetz ihnen einfach Jethro auf den Hals.«
»Jethro?« Sie seufzte schwer.
Als er seinen Namen hörte, steckte Jethro, der Ladenhund, seine Schnauze aus seinem Versteck unter dem Arbeitstisch hervor. Anscheinend hatte er die Hoffnung, dass ich vielleicht zwischen all diesen ekligen Früchten auch einen Hundekeks für ihn fallen lasse, immer noch nicht aufgegeben.
»Er bewundert dich«, erklärte ich BeBe. »Und er ist ein großartiger Gesellschafter.«
»Er haart«, sagte BeBe. »Er sabbert. Er furzt.«
»Wenigstens widerspricht er nicht«, sagte ich und ging durch die Hintertür zu meinem Pick-up.
2
Es war einer dieser Wintermorgen, die einem wieder ins Gedächtnis riefen, warum man im Süden lebte. Sonnig, mit einem Hauch von Kühle in der Luft. Trotz der Tatsache, dass es nicht einmal mehr zwei Wochen bis Weihnachten waren, war das dichte Gras auf dem Troup Square immer noch smaragdgrün, und das Spanische Moos hing wie alter Spitzenbesatz von den Eichen herab, die die eiserne Armillarsphäre in der Mitte des Platzes umstanden. An diesem wunderschönen Wintermorgen war ich genauso dankbar für das, was es gab, wie für das, was fehlte: keine Mücken, keine sengende Hitze, keine erstickende Schwüle.
Eigentlich müsste ich in die entgegengesetzte Richtung fahren, doch zunächst lenkte ich meinen alten, klapprigen, türkisfarbenen Truck um den Platz herum. Nur mal kurz beim Babalu vorbeischauen, nahm ich mir vor. Nur, um mich zu vergewissern, wie überlegen meine eigene Dekoration war. Doch als ich das Tempo drosselte, sank mir das Herz.
Die zweistöckige, lachsrosa Fassade des Babalu war nicht wiederzuerkennen. Sich windende Weinranken bedeckten auf märchenhafte Weise die gesamte Front. Zwei hoch aufragende Palmen in Bodenvasen im Rokokostil flankierten die Eingangstür des Geschäfts, die von einer phantastischen Girlande aus Moos, Buchsbaum, Stechwinde und Zedernzweigen umkränzt war. Alles, einschließlich der Palmen, war zuerst mit weißer Farbe und anschließend mit Glitzer besprüht worden. An dem weißen Wein hingen Hunderte von Prismen aus geschliffenem Glas, in denen sich wie bei einem Kronleuchter das Licht kristallklar brach und bis auf den Gehweg strahlte. Es war das reinste Winterwunderland.
Direkt auf dem Bürgersteig, den Mann im Korb der Hebebühne herumkommandierend, stand die Schneekönigin höchstpersönlich, Manny Alvarez.
»Nein, Süßer«, rief er und formte seine Hände zu einem Sprachrohr. »Sie sollen die Lichter alle in einem Bündel dort oben rechts festmachen.«
Der Truck mit der Hebebühne blockierte die Straße vor dem Laden, und mir blieb nichts anderes übrig, als dahinter anzuhalten. Meine Bremsen gaben ein knirschendes Geräusch von sich, und Manny drehte sich schnell herum, um zu sehen, woher der Krach kam. Ein Lächeln erhellte sein Gesicht, als er mich entdeckte.
»Eloise«, sagte er und zog eine Braue hoch. »Mal kurz kontrollieren, was die Konkurrenz so macht?«
Ich biss die Zähne zusammen. »Hallo, Manny. Sieht aus, als würde auf Ihrer Seite des Platzes ein für Savannah eher unübliches Wetter herrschen.«
»Sie kennen mich doch«, sagte er leichthin. »Phantasie ist mein Leben. Und ganz ehrlich, die ganzen Nüsse und Früchte und Beeren, an die sich sämtliche Einheimischen hier unten zu klammern scheinen, sind doch völlig von gestern. Finden Sie nicht?«
»Die Vorgaben der historischen Kommission sehen ausdrücklich vor, dass man natürliche regionale Gestaltungselemente verwendet«, bemerkte ich. »Vermutlich tendieren die ›Einheimischen‹, wie Sie sie nennen, deswegen dazu, sich an die Richtlinien zu halten.«
»Ach, Richtlinien«, sagte er kopfschüttelnd. »Wie langweilig! Cookie und ich glauben, dass man seiner Muse folgen sollte, um in seiner Arbeit die volle Bandbreite seiner Kreativität zum Ausdruck zu bringen.«
»Wie schön für Sie«, sagte ich. »Ich bin gespannt, was die Jury im Umfeld einer historischen Altstadt aus dem achtzehnten Jahrhundert wohl von stilisierten weißen Palmen hält.«
»Das wollen Sie gar nicht wissen«, sagte er.
3
Trader Bob’s Fundgrube – Auktionshaus ist ein bombastischer Name für einen umgebauten Hühnerstall in einer Sackgasse am Rand der winzigen Stadt Hardeeville, South Carolina, die nur durch die Talmadge Memorial Bridge von Savannah getrennt war.
Weil Trader Bob, alias Bob Gross, es für Zeit- und Geldverschwendung hielt, einen Katalog zu drucken oder Werbezettel zu verteilen, war eine Auktion bei ihm stets ein Abenteuer. An guten Tagen konnte er eine Containerladung mit feinsten englischen oder holländischen Antiquitäten aufgetan haben, vermischt mit Restposten von Baumwollstrümpfen und Raubkopien von Videos, die er notleidenden Vertretern abgekauft hatte. Mehr als einmal war ich zu Trader Bob gefahren und hatte zugesehen, wie er kistenweise halbaufgetaute Tiefkühlpizza und leicht eingedellte Dosen mit eingemachten Ananas unter den Hammer brachte.
An diesem Dezembermorgen stand auf dem Parkplatz, einem abgeernteten Kornfeld, nur rund die Hälfte der üblichen bunten Mischung aus Vans und Trucks der anderen Händler, aber das was mir ganz recht. Weniger Händler bedeuteten weniger Gebote und bessere Geschäfte.
An der Tür begrüßte mich Bobs Schwester und Geschäftspartnerin, Leuveda Garner, mit einem freundlichen Nicken und bot mir eine Bietertafel aus Pappe an.
»Hey, Eloise«, sagte sie. »Lange nicht gesehen.«
»Frohe Weihnachten, Leuveda«, sagte ich. »Irgendwas Gutes dabei heute?«
»Hast du Bedarf an tiefgekühlten Milchtüten? Bob hat einen Supermarkt drüben in Easley aufgekauft. Wir haben haufenweise altes Inventar und Ladenregale. Und ein paar gute Registrierkassen, falls du dich dafür interessierst.«
»Ich dachte eher an Antiquitäten. Habt ihr gerade nur Zeug aus dem Laden?«
»Nicht nur«, antwortete sie schnell. »Wir haben auch den gesamten Hausstand des Eigentümers. Ein paar Möbel, Geschirr, Wäsche, das ganze Zeug vom Dachboden und aus dem Keller und dazu allerlei Gerümpel aus ein paar Schuppen auf dem Grundstück.« Sie rümpfte die Nase. »Alter Kram, wie du ihn magst, Eloise. Such dir besser einen Platz. Bob fängt heute früh an, weil er noch nach Hendersonville fahren will, um eine Ladung Möbel abzuholen, und das Wetter in den Bergen soll ziemlich schlecht sein.«
Und tatsächlich, als meine Augen sich an das Dämmerlicht im Hühnerstall gewöhnt hatten, sah ich Bob bereits auf seinem Podest stehen, das Mikrophon an der Vorderseite seines Hemds befestigt, wie er gerade einen alten, lebensgroßen Pappaufsteller von Meister Proper hochhielt.
»Also, Leute«, rief Bob, »ich brauche ein echt sauberes Gebot für den Anfang. Das hier ist altehrwürdige Werbekunst. Was bietet ihr? Was wollt ihr geben? Gib mir hundert. Und los, hohoho. Kapiert?«
Das Publikum stöhnte, aber es hatte kapiert.
Da ich keine Zeit gehabt hatte, mir die Ware vorher anzusehen, setzte ich mich mit einem metallenen Klappstuhl ganz nach vorne und versuchte, die Angebote von dort aus in Augenschein zu nehmen. Manchen Auktionatoren machte es nichts aus, wenn man sich umsah, während sie redeten, aber Bob Gross führte ein strenges Regiment, und sobald er einmal mit der Arbeit angefangen hatte, duldete er keine Ablenkung mehr.
Wie Leuveda angekündigt hatte, war heute die komplette Ladeneinrichtung eines kleinen Lebensmittelladens einschließlich der Auslagen an den beiden Längswänden des Hühnerstalls aufgebaut. Mein Blick blieb an einer ramponierten Brotvitrine aus rot lackiertem Metall mit drei Fächern hängen, auf dem oben das alte Logo von Sunbeam-Brot prunkte. Die hochgesteckten goldenen Löckchen des Sunbeam-Mädchens leuchteten immer noch so frisch wie am ersten Tag, als sie in das weiße Brot biss. Das wäre genau das Richtige als Auslage im Maisie’s Daisy. Ich sah es bereits vor mir, mit Stapeln alter Decken, Tischtücher und Bettwäsche.
Rechts neben dem Sunbeam-Mädchen lehnte eine alte, türkis gestrichene, hölzerne Fliegengittertür mit einem hellgelben Metallwerbeschild für Orangensaft.
»Meins«, flüsterte ich leise. Diese Fliegengittertür wollte ich unbedingt für mich selbst haben. Sie würde eine wunderbare Küchentür in meinem Reihenhaus in der Charlton Street abgeben.
Nervös musterte ich die anderen Auktionsbesucher, um die Konkurrenz einzuschätzen, und stellte erfreut fest, dass die meisten von ihnen sich tatsächlich nur für das modernere Inventar zu interessieren schienen, das Bob Stück für Stück versteigerte.
Als eine halbe Stunde später das Sunbeam-Regal an der Reihe war, verlangte Bob als Einstiegsgebot zweihundert Dollar. Ich ließ meine Bietertafel unten. Viel zu teuer, fand ich. Heute, bei diesem spärlichen Publikum, konnte er froh sein, wenn er fünfzig dafür bekam – so viel hatte ich bereits dafür eingeplant.
»Zweihundert?«, flehte Bob und suchte den Raum nach Geboten ab. »Und was ist mit einsfünfundsiebzig?« Ungläubig breitete er die Arme aus. »Leute, das sind echte Americana. Die haben einfach ihren Preis.«
»Einhundertachtzig.« Die Stimme kam hinten aus dem Raum, und ich hatte sie erst vor kurzem gehört. Gerade heute Morgen, um genau zu sein. Ich wirbelte auf meinem Stuhl herum und sah Manny Alvarez, der hektisch mit seiner Bietertafel wedelte.
»Das hört sich doch schon besser an«, sagte Bob anerkennend. »Ein Mann, der den Wert der Dinge kennt.«
Manny Alvarez! Was mischte der sich hier in Hardeeville unters gemeine Volk? Ich kaufte seit Jahren bei Trader Bob, und ich hatte noch nie erlebt, dass ein anderer Antiquitätenhändler aus Savannah meine geheime Quelle aufgesucht hätte. War Manny meinem Truck über die Brücke gefolgt?
»Wir haben einhundertachtzig«, rief Bob gut gelaunt und sah sich im Stall um. »Bietet jemand mehr?«
Meine Finger wurden weiß, als ich die Bietertafel umklammerte. Hundertachtzig war ein fairer Preis für das Brotregal, es war sogar immer noch günstig. Aber ich hatte nicht eingeplant, so viel Geld für etwas auszugeben, das ich überhaupt nicht verkaufen wollte.
»Einhundertachtzig zum Ersten«, dröhnte Bob und starrte mich direkt an. »Eloise Foley, ich fass es nicht, dass du bei diesem Stück nicht mitbietest. Als ich das kleine Sunbeam-Mädchen sah, musste ich sofort an dich denken.«
»Einhundertfünfundachtzig«, sagte ich durch zusammengebissene Zähne.
»Einsneunzig«, legte Manny nach.
Mein Herz schlug schneller. »Einszweiundneunzig?«
Bob verdrehte die Augen, nickte aber und akzeptierte mein geschmacklos niedriges Gebot.
»Ach zum Teufel«, sagte Manny. »Zweihundert.«
Bob sah in meine Richtung. Meine Bietertafel blieb, wo sie war. Weihnachten stand vor der Tür. Ich musste Geschenke kaufen. Rechnungen bezahlen. Die Toilette im Geschäft machte merkwürdige, gurgelnde Geräusche, die ein teures Klempnerproblem zu werden versprachen.
Bob sah zu Manny. Ich sah zu Manny. Er hatte bereits sein Scheckheft gezückt und ein arrogantes, dummdreistes Grinsen aufgesetzt. Ich hasse arrogante Blödmänner. Aber völlig pleite zu sein, hasse ich noch mehr.
»Ich bin draußen«, sagte ich kopfschüttelnd.
»Sicher?«, fragte Bob. Sein Hammer schwebte in der Luft.
Ich nickte.
»Verkauft für zweihundert Dollar«, sagte Bob. »Sie haben ein großartiges Geschäft gemacht, Mister.«
»Ich weiß«, erwiderte Manny. Er zwinkerte mir breit grinsend zu und ging zu Leuveda, um zu zahlen.
Ich drehte mich wieder um und versuchte, mich auf den Rest der Auktion zu konzentrieren und mich damit zu trösten, dass ich bei der Fliegengittertür mit der Orangensaftwerbung vermutlich keine Konkurrenz haben würde.
Die Fliegengittertür wurde ein Zwölf-Dollar-Schnäppchen, für das ich mir selbst auf die Schulter klopfte, doch dann blieb meine Bietertafel unten, während Bob die restlichen irdischen Besitztümer der Supermarktbetreiber versteigerte, wozu eine erstaunliche Anzahl von Tupperdosen, uralten Videobändern und kistenweise leere Einweckgläser gehörten.
Schließlich machte Bob eine Pause und nahm einen Schluck Kaffee aus seinem Styroporbecher. Er schaute auf seine Uhr und auf die merklich geschrumpfte Gruppe der Bieter.
»Leute, es wird spät, und ich muss noch in die Berge. Ich sag euch was. Ich habe hier drei Kartons mit gemischtem Inhalt. Wir haben keine Zeit mehr, um das Zeug einzeln rauszuholen. Leuveda«, rief er nach hinten. »Schatz, erzähl den Leuten, was in den Kartons ist.«
Leuveda stand auf und fuhr sich mit der Hand durch die sandfarbenen Locken. »Da sind richtig gute Sachen drin. Hübscher, alter Weihnachtsschmuck aus Glas, etwas Vintage-Wäsche. Ich meine, da ist mindestens eine Weihnachtstischdecke dabei, dazu ein paar alte Schürzen und so etwas. Verschiedene Porzellanstücke, ein Schmuckkästchen voll Krimskrams. Die richtig guten Sachen hat die Familie natürlich raussortiert, aber wahrscheinlich ist noch etwas hübscher, alter Modeschmuck übrig geblieben.«
Bob nickte anerkennend, und Leuveda setzte sich wieder und kassierte wieder von den Händlern ab, die bereits aufbrechen wollten.
»Gebt mir zwanzig – ein Preis für alle drei Kartons«, drängte Bob.
Zwei Männer in der ersten Reihe standen auf, streckten sich und gingen in Richtung Tür.
»Zwanzig«, wiederholte Bob. »Leuveda, sagtest du nicht, der Weihnachtsschmuck sei von Shiny Brite? Noch originalverpackt?«
»Vier, vielleicht fünf Shiny-Brite-Schachteln«, bestätigte Leuveda, ohne von ihrer Rechenmaschine aufzublicken. »Und eine Lichterkette aus Mini-Lavalampen.«
Mein Puls schoss in die Höhe. Ich sammelte seit Jahren alten Glaszierrat, und Shiny Brite – besonders in der Originalverpackung – stand auf meiner Wunschliste ganz oben.
Doch ehe ich irgendetwas sagen konnte, neigte eine magere, rothaarige Frau vor mir den Kopf. »Ich gebe dir fünf Dollar, Bob.«
»Fünf!«, heulte er. »Dafür bekommst du nicht einmal eine einzelne Weihnachtskugel von Shiny Brite.«
»Fünf«, wiederholte sie und stand auf.
»Eloise?«, sagte er, als er merkte, dass ich herumzappelte.
Er hatte mich, und er wusste es. »Sieben«, sagte ich und kreuzte insgeheim die Finger, während ich versuchte, ein Pokergesicht zu machen.
»Estelle?«, wandte er sich wieder an den Rotschopf. »Du wirst sie doch wohl nicht damit durchkommen lassen!«
Entschlossen schüttelte sie den Kopf.
Bob seufzte. »Ihr bringt mich noch ins Grab. Sieben zum Ersten, zum Zweiten, verkauft für sieben Dollar.«
Lächelnd winkte ich ihm mit meiner Bietertafel zu. Mit lauter Stimme rief er die Nummer Leuveda zu, die den Kaufpreis bereits zu meiner Rechnung hinzugefügt hatte.
»Da kann ich den Laden ja gleich dichtmachen«, sagte Bob und schüttelte entrüstet den Kopf.
Als ich den Truck schließlich beladen hatte, war es fast vier. Ich wusste, dass BeBe voller Ungeduld darauf brennen würde, endlich aus dem Laden rauszukommen. Trotzdem konnte ich nicht widerstehen und spähte in den schwersten Karton, sobald ich ihn neben der Fliegengittertür auf die Ladefläche des Pick-ups gehievt hatte.
Der herbe Verlust des Sunbeam-Brotregals an Manny Alvarez war rasch vergessen, als ich die vier vergilbten Originalpappschachteln mit Shiny-Brite-Glasschmuck herausnahm.
»Wow!«, rief ich und lugte durch den brüchigen Zellophandeckel auf die glitzernden, bunten Glaskugeln. Die Schachteln enthielten nicht nur schlichte, schmucklose Kugeln, sondern auch die selteneren und noch begehrteren Glasfiguren in Form von Engeln, Schneemännern und Weihnachtsmännern. Manche hatten flockige Wirbel oder Streifen, und ein paar waren kugel- oder tränenförmig. Jeder Karton enthielt ein Dutzend Teile, alle in den Modefarben der Fünfziger wie Türkis, Rosa, Hellblau und Pfefferminzgrün.
Ich mache mir nie die Mühe, die Richtpreise für die Dinge herauszufinden, die ich sammle. Zurzeit kaufe ich ohnehin nur, wenn der Preis günstig ist, und ich habe auch nicht vor, sie weiterzuverkaufen. Doch auch so wusste ich, dass meine Sieben-Dollar-Kartons ein Volltreffer waren.
Unter den Schachteln mit dem Glasschmuck entdeckte ich ein ordentlich zusammengelegtes, wenn auch leicht fleckiges, weihnachtliches Bridgetuch aus den Fünfzigern mit einem Ziersaum aus roten und grünen Stechpalmenblättern und aufgestickten Spielkartenmotiven. Dann waren da noch acht Küchenschürzen, alle mit Weihnachtsthemen, von praktischen rot-weißen Baumwollschürzen mit Zackenlitzen bis zu einem sexy roten, gerüschten Chiffonteil und einem gestärkten, weißen Organzading mit gehäkeltem Spitzenbesatz und einer applizierten Schneeflocke auf der Tasche.
»Bezaubernd«, sagte ich und strich glücklich über den Stapel Schürzen. Darunter fand ich noch eine Schachtel, gefüllt mit Dutzenden wunderschönen, klassischen Damentaschentüchern, sowie das Schmuckkästchen, das Leuveda versprochen hatte.
Das Kästchen selbst war nichts Besonderes. Auf Privatflohmärkten und in Gebrauchtwarenläden hatte ich im Laufe der Jahre unzählige solcher Kästchen mit geprägtem Leder gesehen. Im Inneren fand ich das erwartete Durcheinander aus alten Glasperlen, ausgeblichenen Ketten aus wertlosen Perlen, verwaisten Ohrclips und billigen Armbändern und Broschen.
Mit dem Zeigefinger wühlte ich in dem Haufen herum, bis ich auf den Boden des Kästchens stieß, wie ein Maler, der seine Farbe umrührt, als mich etwas Scharfes stach und ich zu bluten anfing.
»Autsch«, rief ich und saugte am Finger. Mit der linken Hand hob ich das Stück auf, an dem ich mich gestochen hatte.
Es war eine Brosche. Eine große, knallige Brosche mit blauen Edelsteinen, vielleicht fünf Zentimeter hoch, in der Form eines Weihnachtsbaumes. Ein blauer Weihnachtsbaum.
Mein Handy klingelte. Ich schaute auf das Display und zuckte zusammen. BeBe. Die Zeit war um, und sie hatte keine Lust mehr auf Kaufmannsladen spielen. Aber ich musste ohnehin zurück und den Laden fertig dekorieren, ehe ich mich für die große Weihnachtsparty heute Abend schick machte.
»Hi«, sagte ich und klemmte das Telefon zwischen Ohr und Schulter, während ich die Brosche an meine Bluse steckte. »Wie läuft’s?«
»Großartig«, sagte BeBe ohne Begeisterung. »Dein Hund sabbert mir auf den Schuh. Dein Klo hört sich an, als würde es jeden Moment explodieren. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ich habe diesen hässlichen, klebrig aussehenden Tisch neben der Tür für zweihundertfünfzig Dollar verkauft.«
»Du hast was?«, rief ich.
»Ganz richtig, ich konnte es auch nicht fassen«, lachte sie. »Und ich hab’s bar auf die Hand gekriegt, du brauchst dir also keine Sorgen wegen Scheckbetrug zu machen.«
»Zweihundertfünfzig«, wiederholte ich tonlos.
»Klasse, was?«
»Geht so«, erwiderte ich. »Das war ein Tisch aus Hickoryholz aus den 1920ern, signiert und von Hand getischlert von Jimmy Beeson. Er stammte aus einer dieser alten Hütten oben am Rabunsee in North Georgia. Ich habe fast tausend Dollar dafür bezahlt.«
»Oh«, sagte BeBe. »Dass du ihn mit zweihundertfünfzig Dollar ausgezeichnet hast, war also so eine Art Lockangebot?«
»Nein«, sagte ich betrübt. »Auf dem Preisschild stand eine Fünfundzwanzig mit zwei Nullen. Zweitausendfünfhundert.«
»Au Backe«, sagte BeBe. »Pass auf, ich mache es wieder gut, wenn wir uns sehen. Aber jetzt muss ich abschließen und mich für die Party deines Onkels heute Abend schick machen. Ist es okay, wenn Jethro so lange allein ist, bis du wieder hier bist?«
»Geh schon«, sagte ich. »Er hat immer am Bein von genau diesem Tisch genagt. Aber das ist ja jetzt kein Problem mehr.«
4
Als ich wieder beim Maisie’s Daisy war, stellte ich den Truck ab und ging über die Straße, um einen besseren Blick auf die Ladendekoration zu bekommen. Die Früchtegirlanden und Kränze waren geschmackvoll und absolut vorschriftsmäßig. Und ja, dachte ich kleinlaut, Manny hatte recht. LANG-WEI-LIG.
Aber Regeln waren nun einmal Regeln. Wenn ich den Altstadt-Dekowettbewerb gewinnen wollte, musste ich mich nun einmal brav an die Vorschriften halten.
Als ich meine Auktionsbeute vom Truck in den Laden schleppte, hatte ich eine Idee. Draußen mochte das Geschäft vielleicht bieder und spießig aussehen, aber drinnen konnte ich schließlich tun und lassen, was ich wollte. Die Schachteln mit dem alten Weihnachtsschmuck hatten mich in eine ziemlich aufgekratzte Stimmung versetzt.
Ich schaltete das Licht an, und Jethro rannte auf mich zu und setzte mir seine großen, schwarz-weißen Pfoten auf die Brust. »Nicht jetzt, Dicker«, sagte ich und kraulte ihn kurz hinter den Ohren. Ich öffnete den Kiefernholzschrank, in dem sich die Musikanlage des Ladens verbarg, ging meine Sammlung Weihnachts-CDs durch und landete schließlich bei Harry Connick, Nat King Cole und Johnny Mathis.
»Die hier«, sagte ich laut und schob die CD in den Player. »Genau danach ist mir jetzt.«
Es war mein absoluter Lieblingsweihnachtssampler. A Christmas Gift for You from Phil Spector mit sämtlichen legendären (und spleenigen) Nummern aus den Sechzigern: die Crystals, die Ronettes, Darlene Love, sogar der unnachahmliche Bob B. Soxx and the Blue Jeans.
Kurz darauf swingte Darlene Loves kräftige Stimme von einer White Christmas, arrangiert im typischen Phil-Spector-Klangmauer-Stil. Es klang überhaupt nicht wie bei Bing Crosby, aber auf seine eigene Weise genau richtig.
Ich nahm die Shiny-Brite-Schachteln und ging damit zum Schaufenster. In den letzten paar Jahren hatte ich jeden Weihnachtsbaum aus Aluminium gekauft, den ich auf kleinen und großen Flohmärkten finden konnte, aber mittlerweile fuhr auch der Rest der Welt völlig auf die Fünfziger ab, und die Bäume waren rar und teuer geworden. Dieses Jahr hatte ich nur drei Stück davon ergattert, und ich musste jede Menge Kunden enttäuschen, die sie direkt aus dem Schaufenster kaufen wollten. Jetzt flitzte ich von Baum zu Baum und hängte die Shiny-Brite-Kugeln auf der Fensterseite in die Bäume, so dass die Passanten sie sehen konnten. Ich vermischte den alten Baumschmuck mit neueren Reproduktionen, die ich im September beim Geschenkemarkt in Atlanta bestellt hatte. Mit den winzigen, hell flackernden Lichtern funkelten sie ganz wunderbar.
Doch das Schaufenster wirkte immer noch zu steif, zu förmlich. Ich hatte ein Wohnzimmer nachgebildet, mit zwei Sesseln mit Schonbezügen im Schottenmuster, einem schlichten Kaminsims, eingefasst von abblätternder grüner Farbe, und einem rot-grünen, handgewebten Teppich. Auf einem Beistelltisch lag ein Stapel alter, ledergebundener Bücher, ganz oben ein aufgeschlagenes Exemplar von Clement Clarke Moores ’Twas the Night Before Christmas mit Illustrationen von N. C. Wyeth.
Nur wenige Stunden zuvor war das Fenster für mich noch perfekt gewesen, aber jetzt kam es mir viel zu brav und vorhersehbar vor.
Ich verschränkte die Arme vor der Brust und dachte nach. Plötzlich setzten die Ronettes mit Frosty the Snowman ein, und meine Phantasie bekam Flügel.
Ich entfernte den Beistelltisch und ersetzte ihn durch einen frisch erworbenen antiken Bibliothekstisch. Eine Verbesserung, entschied ich. Widerstrebend kramte ich meinen Vorrat an Weihnachtsgeschenkschachteln aus dem Ramschladen hervor. Ich würde mit meinen Kunden darum streiten müssen, sie behalten zu dürfen, aber sie waren wirklich viel zu schön, um nicht gezeigt zu werden. Ich arrangierte sie unter dem Baum und warf erneut einen kritischen Blick auf das Bild. Da fehlte noch etwas. Da fehlte noch eine Menge.
Ich warf einen raschen Blick auf die Uhr und stellte fest, dass ich jedes Zeitgefühl verloren hatte. Die Party begann um sieben, und in fünfzehn Minuten wollte Daniel mich abholen!
Später, versprach ich mir. Genies darf man nicht drängen. Ich pfiff nach Jethro, nahm das Kästchen mit dem Modeschmuck von der Auktion und hetzte nach Hause.
Wie immer, wenn ich durch meine Haustür eintrat, sprach ich ein stummes Dankgebet. Mein Haus war nicht das prächtigste oder älteste im historischen Viertel von Savannah, nicht einmal in der Charlton Street. Es war 1858 erbaut worden und wirkte streng und nüchtern. Aber es war aus den heißbegehrten grauen Savannah-Ziegeln errichtet, hatte hübsche, filigrane, schmiedeeiserne Zierleisten, einen wunderschönen Vorgarten und eine phantastische Gourmetküche nach meinen eigenen Entwürfen. Und es gehörte mir. Ganz allein mir. Ich entdeckte das Haus, als Tal und ich gerade frisch verheiratet waren. Der Kaufpreis betrug 200000 Dollar, das war mehr, als wir uns leisten konnten, doch ich unterschrieb den Kaufvertrag ohne Zögern und stürzte mich sofort auf die Renovierung, wobei ich einen Großteil der Arbeit selbst erledigte.
Dieses Haus war mein Anker. Mein Traum. Es hatte die Ehe mit Tal überdauert. In unserer Scheidungsvereinbarung wurde ihm das Reihenhaus zugesprochen, ich bekam nur die Remise. Doch durch eine merkwürdige Wendung der Ereignisse ließ das Glück Tal im Stich, und er musste das Haus verkaufen. Ich war selig, ihn ausbezahlen zu können. Und als mein Antiquitätengeschäft anfing, richtig gut zu laufen, konnte ich sogar noch das baugleiche Nachbarhaus kaufen. Ich zog mit Maisie’s Daisy aus der Remise ins Erdgeschoss des anderen Hauses und vermietete die beiden oberen Stockwerke an ein junges Paar, das an der Kunstschule unterrichtete.
Nachdem ich Jethro mit einem Hundekeks bestochen hatte, stürzte ich die Treppe hoch, um mich für die Party umzuziehen. Ich hatte bereits die schlichte, schwarze Caprihose und das schwarze Spitzentop herausgelegt, die ich anziehen wollte. Aber die Brosche mit dem blauen Weihnachtsbaum ließ mich die Sache noch einmal überdenken.
Zu meiner Stimmung heute Abend passte nur Vintage-Look. Sobald ich geduscht hatte, kramte ich in meinem Kleiderschrank und suchte nach der richtigen Kombination.
Da! Aber ob ich da noch reinpasste?
Das schwarze Cocktailkleid aus den Fünfzigern hatte ich in dem tollen Vintage-Laden in Atlanta gefunden. Normalerweise bringt es mich um, in einem Laden viel Geld für alte Sachen zu bezahlen, aber als ich dieses Kleid eines Samstags beim Bummeln in der McLendon Avenue im Schaufenster sah, wusste ich, dass ich es haben musste. Und wenn es vierzig Dollar kostete.
Das Oberteil bestand aus perlenbesetztem, schwarzen Brokat, hatte einen tiefen Ausschnitt und Flügelärmel. Der weite, knöchellange, bauschige Rock bestand aus schwarzem Chiffon über zwei Schichten schwarzem Tüll. Ich betupfte meinen Hals und mein Dekolleté mit meinem Lieblingsparfüm und quälte mich in ein schwarzes Mieder von Merry Widow. Ich schlüpfte in das Kleid, hielt die Luft an und mühte mich mit dem Reißverschluss ab. Als das Kleid noch auf halbmast war, hörte ich die Türglocke, und Jethro bellte.
Mist. Okay, es war zehn nach sieben, aber Daniel war in letzter Zeit niemals pünktlich. Sein Restaurant, das Guale, war zu Feiertagen immer proppenvoll, und seit er BeBe ihre Anteile ausgezahlt hatte, schien er immer länger zu arbeiten. Ich hatte mich noch nicht geschminkt oder meine Haare gerichtet, aber es würde nichts bringen, Daniel warten zu lassen.
Nicht um diese Jahreszeit. Weihnachten schien ihn immer grantig zu machen. Ich wusste, dass er einfach überarbeitet war, aber es machte mich dennoch traurig, dass er diese Tage nicht genießen konnte, die doch eigentlich ein frohes Fest sein sollten.
Besonders dieses Jahr. Mein Geschäft lief prima, und nachdem er jahrelang als Koch in den Küchen anderer Leute gearbeitet hatte, hatte Daniel endlich begriffen, dass sein Traum ein eigenes Restaurant war. Drei Jahre waren wir jetzt zusammen, und ich war insgeheim halbwegs überzeugt, dass dieses Weihnachten dasjenige welche werden könnte …
Ich rannte die Treppe hinunter, um die Tür zu öffnen. Er stand, die Schlüssel in der Hand, vor mir und zog ein komisches Gesicht.
»Was ist los?« Ich gab ihm einen raschen Kuss.
»Nichts«, sagte er und schaute sich auf der Straße um. »Ich wollte schon selbst aufschließen, aber dann hatte ich plötzlich das unheimliche Gefühl, jemand würde mich beobachten.«
Ich steckte den Kopf zur Tür hinaus und schaute die Straße hinunter. Über den Platz sah ich etwas Rotes verschwinden.
»Vielleicht wurdest du tatsächlich beobachtet«, sagte ich und zog ihn ins Haus. »Ich wette, es waren diese Widerlinge Manny und Cookie.«
»Wer?«, fragte Daniel und küsste meinen Nacken. »Mmm. Du riechst gut.« Er hielt mich auf Armlänge von sich entfernt und lächelte. »Und siehst gut aus. Aber das Kleid ist doch nicht neu, oder?«
»1958 war es neu«, sagte ich und drehte mich, damit er die volle Wirkung sah.
»Kannst du mir bitte beim Reißverschluss helfen?«, bat ich und hob mein Haar im Nacken an. »Manny und Cookie sind die Besitzer vom Babalu, diesem neuen Laden auf der anderen Platzseite, in der Harris Street. Ich hab dir doch schon von ihnen erzählt. Sie versuchen, mich zu verdrängen. Ich glaube, sie waren hier, um zu spionieren und nachzusehen, wie ich meinen Laden für den Wettbewerb dekoriert habe.«
Er zog den Reißverschluss zu, ohne irgendwelche Dummheiten zu machen. Daran merkte ich, dass er mit den Gedanken ganz woanders war.
»Wie kommst du nur auf die fixe Idee, sie könnten dich verdrängen wollen?«, wollte er wissen.
»Wegen allem. Aber ich will gar nicht erst damit anfangen. Ich muss kurz noch mal hoch und mir etwas Farbe ins Gesicht tun, dann können wir aufbrechen.«
»Ich finde dich schön, so wie du bist«, sagte Daniel. »Außerdem müssen wir echt los, Eloise. In zwei Stunden muss ich noch einmal ins Restaurant. Wir haben heute zwei Weihnachtsfeiern von Rechtsanwaltskanzleien, und alle Partner erwarten, dass der Koch sich persönlich blicken lässt.«
»Daniel!«, protestierte ich. »Das ist James’ und Jonathans erste Party. Da kannst du unmöglich früher gehen. Und ich will es nicht.«
»Du kannst doch bleiben«, sagte er. »Aber ich muss auf jeden Fall früher weg.« Stirnrunzelnd schaute er auf die Uhr, als sei jede Minute, die er nicht im Restaurant verbrachte, eine Zumutung. »Was ist, können wir los?«
»Eine Minute«, entgegnete ich schnippisch.
Oben trug ich etwas Eyeliner, Maskara und Lippenstift auf und schlüpfte in schwarze Wildlederpumps mit hohen Absätzen. Ich schnappte mir meinen schwarzen Samtschal, legte ihn mir um die Schultern und befestigte die blaue Weihnachtsbaumbrosche daran.
»Fertig«, sagte ich am Fuß der Treppe, immer noch leicht verärgert, weil Daniel die Party früher verlassen wollte.
Er griff nach meinem Schlüsselbund und reichte ihn mir. Als er mich anschaute, runzelte er erneut die Stirn.
»Was ist?«, fragte ich und zupfte am Halsausschnitt des Kleides. »Ist mein Dekolleté zu tief?«
»Nein«, sagte er langsam. Er hob die Hand und berührte meinen Schal.
»Diese Brosche. Woher hast du sie?«
»Von einer Auktion bei Trader Bob heute Nachmittag«, erklärte ich überrascht. Obwohl er als Koch mehr Sinn für Kunst hatte als andere, war Daniel nun einmal ein Mann. Dinge wie Schmuck oder Schuhe fielen ihm kaum auf. »Warum? Gefällt sie dir nicht?«
»Doch. Sie ist nett«, sagte er und starrte immer noch auf die Brosche.
»Was ist los? Du starrst ja immer noch.«
»Meine Mutter hatte genau so eine.« Er wandte den Blick ab. »Meine Brüder und ich haben unser Geld vom Rasenmähen zusammengeworfen und sie ihr in dem Jahr gekauft, in dem mein Dad uns verlassen hat. Sie hat sie immer getragen, jedes Jahr zu Weihnachten. Sie sagte, es wäre genau das Richtige. Du weißt schon, weil mein Dad abgehauen ist, hatten wir in dem Jahr alle zu Weihnachten den Blues, so dass es wortwörtlich blaue Weihnachten waren. Wie in diesem Elvis-Song.«
»Oh«, sagte ich leise. Daniel sprach sonst nie über seine Mutter. Über seinen Vater übrigens auch nicht. Ich wusste, dass sein Dad seine Mom mit drei Söhnen sitzengelassen hatte, als Daniel noch ein Kind war. Ich wusste auch, dass Paula, seine Mom, in einen Skandal um ihren verheirateten Chef in der Zuckerraffinerie hier in Savannah verwickelt war. Als die Sache ans Licht kam, kam er in ein Bundesgefängnis in Florida, doch vorher ließ er sich von seiner Frau scheiden und heiratete Paula. Nicht lange danach folgte Paula Stipanek Gambrell ihrem neuen Mann nach Florida. Daniel und seine beiden älteren Brüder wurden von ihrer Tante Lucy großgezogen. Es war keine glückliche Geschichte, und mein Unmut über seine schlechte Stimmung verflog.
Ich hakte mich bei ihm unter. »Wenn ihr Jungs eine Brosche wie diese gekauft habt, beweist das nur euren guten Geschmack. Solche Broschen waren in den Vierzigern und den Sechzigern der letzte Schrei. Ich kenne Hunderte Varianten von Weihnachtsbaumbroschen. Jede Modeschmuckfabrik hat sie hergestellt. In Schmuckgeschäften und Kaufhäusern wurden die teureren Broschen verkauft, exklusive Stücke von Weiss, Eisenberg oder Miriam Haskell. Mittlerweile werden sie für Hunderte von Dollar gehandelt.«
Daniel stieß ein kurzes, humorloses Lachen aus. »Eines kann ich dir garantieren, die Brosche meiner Mom ist heute keine hundert Dollar wert. Wir haben sie in dem Ramschladen in der Broughton Street gekauft. Wir haben vielleicht fünf Dollar zusammengekratzt, um sie bezahlen zu können.«
Während wir zu Daniels Truck gingen, hörte ich Jethro traurig im Haus heulen.
»Armer Kerl. Er hasst es, allein zu Hause zu bleiben.«
Daniel zupfte an seiner Krawatte, ein seltenes Zugeständnis von ihm. »Ich hätte nichts dagegen, heute Abend den Platz mit ihm zu tauschen.«
»Vielen Dank!«, erwiderte ich bissig.
»Tut mir leid«, sagte er und küsste mich versöhnlich auf die Wange. »Aber ich kann Weihnachtspartys einfach nichts abgewinnen. Konnte ich noch nie. Aber was ich hätte sagen sollen, ist, ich wünschte, du und ich könnten heute Abend zu Hause bleiben. Nur wir beide. Ich würde dir nur zu gern wieder aus diesem heißen Kleid helfen.«
»Hmpf«, machte ich, wenig überzeugt.
5
Kurz nach seinem fünfundzwanzigjährigen Dienstjubiläum als Priester hatte mein Onkel James sein Kollar an den Nagel gehängt und war nach Savannah zurückgekehrt, um als Rechtsanwalt zu arbeiten und ein ruhiges Leben in dem bescheidenen Haus zu leben, das er von seiner Mutter geerbt hatte. Nicht lange danach outete er sich zögerlich als homosexuell, und nicht lange danach lernte er seinen derzeitigen Partner, Jonathan McDowell, kennen.
Drei lange Jahre hatte mein konservativer Onkel gewartet, ehe er endlich Jonathans Bitte nachgab, offen zusammenzuleben. Im September waren Jonathan, ein charmanter, fünfundvierzigjähriger Assistent des Distriktanwalts, und seine bezaubernde Mutter, Miss Sudie, in James’ Haus in der Washington Avenue gezogen.
Heute Abend gaben sie ihre erste Party. Seit Wochen war James total nervös. »Und wenn niemand kommt?«, hatte er sich gesorgt, als wir den Speisezettel für die Feier durchgingen.
»Die Leute werden kommen«, hatte ich ihm versprochen. »Du und Jonathan habt eine Menge Freunde. Und jeder wird Miss Sudie lieben. Und außerdem«, sagte ich, »wollen die Leute unbedingt wissen, was Jonathan aus deinem Haus gemacht hat.«
James schüttelte den Kopf und strich sich über das schütter werdende Haar. »Er hat das Wohnzimmer braun gestrichen. Braun! Meine Mutter würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie es wüsste. Sie hat die unteren Räume immer in Rosa gehalten.«
Ich erschauderte. »Hustensaft-Rosa. Die Farbe alter Damen. Aber egal, es ist doch gar nicht richtig braun. Das ist ein dunkler, wunderschöner Mokkaton. Jonathan hat einen exzellenten Geschmack. Ich bin so froh, dass er dich überredet hat, Grandmas schrecklichen alten Plunder rauszuwerfen.«
»Ich dachte, du magst Antiquitäten«, sagte James.
»Nicht alle Antiquitäten sind gleich«, informierte ich ihn. »Dieses furchtbare rosa Samtsofa war potthässlich, und das weißt du auch. Und diese pastellblauen, puscheligen Sessel – igitt.«
»Das neue Sofa ist wirklich bequem«, gab James zu. »Und Jonathans Ledersessel eignen sich prima zum Lesen. Außerdem durfte ich die Sachen in meinem Schlafzimmer behalten.«
Heute Abend war also die Coming-out-Party meines Onkels – in mehr als einer Hinsicht. Als wir uns seinem Haus näherten, stellte ich erfreut fest, dass überall am alten Haus Lichterketten strahlten. Um die Eingangstür hing eine große Girlande aus immergrünen Zweigen, und ein halbes Dutzend Leute standen plaudernd auf der Veranda und nippten an ihrem Wein. Auf beiden Straßenseiten reihte sich ein Auto an das andere.
»James hatte Angst, dass niemand kommen würde«, erzählte ich Daniel und wies ihn an, in der Auffahrt direkt hinter dem dunkelgrauen Buick meiner Eltern zu parken, die auch in dieser Straße wohnten. »Mama und Daddy gehen nach acht nicht mehr weg«, erinnerte ich ihn.
Daniel warf mir einen raschen Blick zu. »Und deine Mutter hat keine Probleme damit, dass sie zusammenleben? Sie war nicht schockiert?«
»Ich würde nicht gerade behaupten, dass sie es gutheißt«, sagte ich. »Aber du weißt doch, was für ein Snob Mama ist. Die McDowells gehören zum alten Geldadel von Savannah. Sie ist begeistert, dass James mit jemandem aus den besseren Kreisen zusammen ist. Und sie bewundert Miss Sudie.«
James empfing uns an der Haustür, prächtig anzuschauen in einem eleganten, jagdgrünen Sportsakko mit Karomuster und rostrotem Rollkragenpullover.
»Wow!«, sagte ich und küsste ihn. »Du siehst aus, als kämst du direkt aus einer Werbeanzeige von Ralph Lauren.«
Er runzelte die Stirn. »Ist das gut?«
»Sehr gut«, lachte ich. »Und du musstest nicht einmal eine Krawatte umbinden.«
»Nicht einmal für Jonathan«, sagte James. »Nicht einmal zu Weihnachten.«
Jonathan kam dazu und legte Daniel und mir die Arme um die Schultern. »Beschwert er sich schon wieder über die verdammte braune Farbe?«
»Nein«, erwiderte ich. »Er beglückwünscht sich selbst, weil er keine Krawatte tragen muss.«
»Na, dann kommt rein und holt euch etwas zu essen und zu trinken«, sagte Jonathan. »Daniel hat beim Essen wahre Wunder vollbracht. Für diese Lammkoteletts könnte ich sterben.«
»Danke«, sagte Daniel.
»Aber erwähnt James gegenüber bloß nicht, was das gekostet hat«, fuhr Jonathan fort. »Er glaubt immer noch, Cocktailwürstchen mit Käsedip seien für eine Party völlig in Ordnung.«
»Das ist der Familienfluch der Foleys«, klärte ich Jonathan auf. »Wir sind so geizig, dass es quietscht.«
Während Daniel in der Küche verschwand, um nach dem Essen zu sehen, schlenderte ich herum und plauderte mit Freunden und Verwandten.
Im Wohnzimmer entdeckte ich Mama und Daddy. Daddy schien sich in seinem guten Anzug unbehaglich zu fühlen, und Mama trug ihr traditionelles Weihnachtsparty-Outfit: einen grünen Wollrock und einen dieser grässlichen Pullover mit Weihnachtsmotiven, die sie so bezaubernd fand. Auf der Vorderseite prunkten zwei riesige, gestrickte Weihnachtsbäume, geschmückt mit winzigen Kugeln und Lichtern, die tatsächlich leuchteten und blinkten. Unglücklicherweise blinkten zwei rote Lichter genau mitten auf ihrer Brust, so dass es von der anderen Seite des Raumes aussah, als würden ihre Nippel einem zuzwinkern.
»Eloise«, rief Mama und streckte die Hand aus, um mich neben sich auf das Sofa zu ziehen. »Was siehst du schön aus heute Abend!«
Ich schaute an meinem Kleid herunter und zupfte am Ausschnitt herum. Alte Gewohnheiten sterben nur schwer. »Wirklich? Dieses Kleid gefällt dir?« Normalerweise hasst Mama meine Vintage-Sachen. Sie kann nicht verstehen, wie ich die »ausrangierte Kleidung von Toten« tragen kann.
»Die Brosche«, sagte Mama und berührte den Weihnachtsbaum, der an meinem Schal befestigt war. »Als du klein warst, hatte ich auch so eine. Weißt du noch?«
Ich sah zur Brosche hinunter. »Genau so eine?«
Sie runzelte die Stirn. »Nicht ganz. Meine war eher golden, mit Zweigen und Perlen in allen möglichen Farben.«
»Solche Broschen waren vor Jahren sehr beliebt«, erklärte ich ihr. »Daniel sagt, seine Mutter hätte genau so eine Brosche gehabt. Auch in Blau und so.«
»Ach so«, sagte Mama. Sie hatte ein unglaubliches Gedächtnis für Skandale und erinnerte sich an jede Einzelheit aus dem Prozess gegen Hoyt Gambrell. »Hört er manchmal noch von seiner Mutter?«
»Nein«, erwiderte ich knapp und bedauerte bereits, das Thema angeschnitten zu haben.
»Wo steckt Daniel eigentlich?«, fragte Daddy. »Bei der Arbeit im Restaurant?«
»Er ist hier«, sagte ich. »Du weißt doch, das Guale hat heute Abend das Catering übernommen.«
»Nett«, sagte Mama unbestimmt. »Wie nennt man dieses pappige Reiszeug, das es zu den Lammkoteletts gibt?«
»Risotto?«
»Interessant«, sagte Mama. Dann erhellte sich ihre Miene, und sie fügte hinzu: »Ich habe James ein paar meiner berühmten Obstkuchen zum Dessert mitgebracht. Vergiss nicht, ein Stückchen davon zu probieren.«
»Bestimmt nicht«, versprach ich und schwor mir im Stillen, den Kuchen zu meiden wie die Pest. Den größten Teil meines Lebens war meine Mutter eine heimliche Alkoholikerin gewesen, aber nach ihrer Entziehungskur hatte sie ihre frisch gewonnene Energie aufs Kochen verwendet. Leider hatte die Nüchternheit ihre Kochkünste nicht verbessert.
»Dieses Jahr habe ich meinem Obstkuchen etwas Neues hinzugefügt«, vertraute sie mir an. Sie senkte die Stimme und schirmte den Mund mit der Hand ab, falls jemand versuchen sollte, ihr das Geheimrezept abzulauschen, und flüsterte: »Ahornsirup!«
»Tatsächlich?«
Daddy nickte traurig. »Sie hat den ganzen Supermarkt leergekauft.«
»Zwei Dutzend Kuchen«, berichtete Mama. »Das ist ein neuer Rekord. Ich habe deinen im Auto, du musst nur mitkommen, wenn wir aufbrechen.«
»Mach ich«, versprach ich und stand auf. »Jetzt sehe ich besser mal nach Daniel. Er muss früher gehen und zurück ins Restaurant. Sie haben ein paar große Privatfeiern heute Abend, und er muss sich dort noch einmal blicken lassen.«
»Aber vergiss den Kuchen nicht«, zwitscherte Mama. »Ich habe nur noch ein Dutzend übrig. Er ist sehr beliebt dieses Jahr.«
Was, fragte ich mich, während ich durch die Räume schlenderte, die von Licht und Gelächter belebt waren, sollten die Leute mit Obstkuchen mit Ahornsirupgeschmack anfangen? Sie könnten sie als Türstopper benutzen. Als Bootsanker. Oder als Buchstützen.
Ich fand Daniel im Esszimmer, wo er gehackte Petersilie über den Shrimp-Gumbo, den traditionellen Eintopf der Cajun-Küche, streute, der in einer Schüssel auf der Warmhalteplatte stand.
»Sieht gut aus«, sagte ich und gab ihm einen raschen Kuss.
»Du auch«, sagte er geistesabwesend.
»Stimmt irgendetwas nicht?«, fragte ich, obwohl ich bereits wusste, dass etwas nicht in Ordnung war.
»Auf der Anrichte dort drüben müsste eine Schüssel mit Trifle stehen«, sagte er und zeigte auf die massive Mahagonianrichte meiner Großmutter. »Als ich herkam, stand sie noch in der Küche, aber jetzt ist sie verschwunden.«
»Jeder liebt dein Trifle«, sagte ich. »Vielleicht haben die Leute schon alles verputzt.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein. In der Küche standen zwei volle Schüsseln. Wir haben genug für hundert Leute gemacht, das hätte dicke reichen müssen. Außerdem sind die Schüsseln ebenfalls verschwunden.«
»Wie bitte?« Ich ging zur Anrichte, um mir die Sache genauer anzusehen. Neben einer Kristallschüssel mit Bowle entdeckte ich ein Silbertablett, auf dem sich scheibenweise nach Ahornsirup duftender Obstkuchen stapelte.
»Der Fall ist gelöst«, erklärte ich Daniel. »Marian Foley hat wieder zugeschlagen.«
»Deine Mutter hat eine ganze Schüssel voll Trifle verspeist?«
»Das bezweifle ich. Dein Dessert schwimmt in Sherry. Mama hat panische Angst davor, wieder zur Flasche zu greifen. Sie würde nicht einmal mehr Hustensaft schlucken. Nein, ich fürchte, Mama hat dein Trifle beseitigt, um die Konkurrenz für ihren Obstkuchen auszuschalten.«
»Nein!«, rief Daniel. »Da kommt also der Kuchen her? Ich dachte, es sei ein Geschenk von einem von James’ Klienten.«
»Leider nein. Sie hat mir selbst gesagt, dass sie ihn für die Party mitgebracht hat. Dieser Obstkuchen ist ihr ganzer Stolz.«
Daniel ging zu dem bereits erwähnten Tablett, beugte sich darüber, schnupperte und zog eine Grimasse.
»Was zum Teufel ist da drin?«
»Familiengeheimnis«, sagte ich und legte die Hand aufs Herz. »Ich musste schwören, Stillschweigen zu bewahren.«
»Duellierende Desserts.« Daniel schüttelte den Kopf. »Das gibt es auch nur bei den Foleys.«
»Tut mir leid«, sagte ich. »Soll ich versuchen herauszufinden, was sie mit dem Trifle angestellt hat?«
»Nein. Darum kann James sich kümmern. Hör zu, Schatz, ich sage es ungern, aber ich muss zurück ins Guale.«
»Schon?« Stirnrunzelnd schaute ich auf die Uhr. »Es ist doch erst kurz nach acht.«
»Du kannst doch noch bleiben«, schlug er vor. »Deine Eltern können dich nach Hause bringen.«
»Lass gut sein«, sagte ich, ohne meinen leichten Unmut verbergen zu können. »Komm, wir suchen James und Jon und verabschieden uns.«
Er steuerte auf das Wohnzimmer zu, doch ich hielt ihn zurück. »Nicht da rein. Ich muss mich rausschleichen, ohne dass Mama mich sieht. In Daddys Auto wartet ein Obstkuchen auf mich.«
»Autsch«, sagte er. »Ich hoffe, sie haben die Fenster aufgelassen.«
Auf der Fahrt nach Hause schwiegen wir eine ganze Weile.
»Alles in Ordnung?«, fragte ich schließlich. Ich gab mir einen Ruck, rutschte hinüber und massierte ihm den Nacken.
»Bin nur müde.«
»Mehr nicht?«
»Es ist eine anstrengende Zeit im Jahr«, erklärte Daniel. »Wenn man ein Restaurant hat, hängt da wesentlich mehr dran, als wenn man nur fürs Kochen zuständig ist.«
»Ich weiß. Aber da ist doch noch etwas anderes, oder nicht?« Meine Stimme klang schärfer als beabsichtigt.
Er schüttelte meine Hand ab. »Ich hasse Weihnachten.«
»Daniel!«
»Das ist doch nicht schlimm. In zwei Wochen ist alles vorbei. Das Leben kann endlich wieder normal werden.«
»Dies sollte die glücklichste Zeit des Jahres sein. Ich habe auch viel zu tun, aber ich liebe Weihnachten. Ich liebe alles, was damit zusammenhängt …«
»Du schon«, unterbrach er mich schroff. »Aber ich nicht.«
Ich holte tief Luft und schluckte meinen Ärger herunter. »Kann ich dir irgendwie helfen? Möchtest du darüber reden?«
Er warf mir nur einen ungläubigen Blick zu, als hätte ich ihm ein unanständiges Angebot gemacht.
Als wir bei mir ankamen, fuhr er rechts ran und ließ den Motor laufen. Eine Weile blieben wir schweigend sitzen. »Kannst du nicht einmal für eine Minute mit hineinkommen?«, bat ich leise.
Er schüttelte den Kopf, brachte mich aber noch bis zur Haustür. Er zog seine Schlüssel hervor und schloss mir auf. »Ich rufe dich später an«, sagte er und stieß die Tür weit auf.
Ehe ich etwas sagen konnte, raste Jethro an uns vorbei und war verschwunden wie ein Blitz.
»Jethro!«, schrie ich. »Jethro, komm zurück!«
»Verdammter Köter«, murmelte Daniel. Er trat auf den Gehweg. »Hierher, Dicker«, rief er. »Jethro, hierher!«
Seine Stimme hallte in der verwaisten Straße wider. Eine magere gelbe Katze schlich über den Platz, und im Geäst eines Baumes in der Nähe hörte ich eine Eule heulen. Doch nirgendwo war ein Hund zu sehen.
Ich stand mitten auf der Charlton Street und brüllte seinen Namen.
»Jethro!«
»Und jetzt?«, fragte Daniel verärgert.
»Fahr doch einfach«, blaffte ich ihn an. »Ich finde den verdammten Köter schon alleine.«
»Steig in den Truck«, sagte Daniel. »Wir suchen ihn gemeinsam.«
»Nein.« Ich blieb dickköpfig. »Es ist mein Hund. Ich nehme meinen eigenen Wagen und suche ihn. Fahr zum Guale. Du bist doch sowieso schon spät dran.«
»Also gut«, sagte Daniel und spielte verlegen mit dem Schlüssel herum. Wir stritten uns nur selten, und keinem von uns behagte es, in dieser Stimmung auseinanderzugehen. Er gab mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Ich ruf dich an, okay? Und mach dir keine Sorgen. Er kann noch nicht weit gekommen sein.«
Ich schloss die Haustür ab und stieg in meinen Truck, wobei ich die Tür lauter zuknallte als nötig. Ich warf die Schuhe auf den Boden und den Schal, mit dem ich schlecht fahren konnte, auf den Beifahrersitz. Über eine Stunde suchte ich die Straßen des Viertels ab, blieb an jedem Block stehen und rief Jethros Namen.
Jede Person, die ich sah, hielt ich an, und fragte sie, ob ihr ein schwarz-weißer Hund über den Weg gelaufen sei, aber niemand hatte Jethro gesehen. Ich fuhr wieder nach Hause und schaute im Garten nach, in der Hoffnung, er sei von allein zurückgekommen. Doch das Tor war zugesperrt, und weit und breit war kein Hund zu sehen.
Ich stieg erneut in den Truck und fuhr dieselbe Strecke noch einmal ab. Ich rief nach meinem verschwundenen Jethro und versuchte mich zugleich zu beruhigen, dass ihm nichts geschehen war. Er ist ein Stadthund, sagte ich mir. Ich hatte ihn als herrenlosen Welpen buchstäblich aus einem Haufen Müll vor einem baufälligen Haus im viktorianischen Viertel gezogen. Er konnte für sich selbst sorgen. Und er trug sein Halsband und die Hundemarke. Irgendjemand würde ihn finden und mich anrufen.
Kurz vor Mitternacht gab ich die Suche auf und fuhr nach Hause. Entmutigt holte ich mir Decke und Kissen von oben und beschloss, auf dem Sofa zu schlafen – nur für den Fall, dass Jethro zurückkäme und an der Tür kratzte.
Mein Anrufbeantworter blinkte. Ich drückte auf den Knopf und betete. Vielleicht hatte schon jemand Jethro gefunden.
Doch der Anruf kam von Daniel.
»Hey«, sagte er. Er klang müde. »Sei mir nicht böse. Wir finden Jethro schon. Alles wird wieder gut. Ruf mich an, sobald du zu Hause bist.«
Vergiss es, dachte ich, und plötzlich war mein ganzer Ärger über unseren Streit und Daniels Weihnachtsunlust wieder da. Tränen stiegen mir in die Augen. Ich boxte in das Kissen, zog mir die Decke über den Kopf und fiel in einen unruhigen Schlaf.
6
Dreimal stand ich während der Nacht auf, öffnete die Haustür und blickte die Straße auf und ab. Durch reine Willenskraft versuchte ich, Jethro dazu zu bewegen, sich vor meinen Augen zu materialisieren, die Ohren aufgestellt, mit wedelndem Schwanz, die Zunge seitlich aus der Schnauze hängend, und mit großen, braunen Augen um ein Leckerli zu betteln. Jedes Mal schleppte ich mich allein zurück zum Sofa und versuchte zu schlafen.
Um sieben gab ich auf. Ich schlurfte in die Küche und schenkte mir eine Cola ein, gefolgt von einem Fingerhut Ibuprofen auf ex. Ich hatte keinen Appetit, also knabberte ich nur lustlos an einem Müsliriegel, ehe ich ihn im Mülleimer entsorgte.
Flugblätter, beschloss ich, wären eine gute Idee. Ich könnte sie auf meinem Drucker ausdrucken und sie überall in der Nachbarschaft aufhängen. Und um neun, wenn das Tierheim öffnete, würde ich dort anrufen und fragen, ob jemand Jethro gefunden hatte.
Ich war im Wohnzimmer und legte gerade die Decke zusammen, als ich draußen ein schwaches Winseln hörte. Ich rannte zur Haustür, öffnete sie und spähte hinaus.
Die Morgenzeitung lag auf der Treppe. Ich blickte erneut die Straße hoch und runter, sah aber nichts. Woher war das Winseln gekommen?
Nur mit Flanell-Pyjamahose und Unterhemd bekleidet, ging ich auf den Gehweg. Mein Truck!
Die vertraute schwarz-weiße Gestalt hüpfte auf dem Vordersitz auf und ab, winselte und kratzte mit den Pfoten am Fenster.
»Jethro!«, schrie ich und rannte zum Wagen. Ich öffnete die Tür, und er sprang mir in die Arme, leckte mir das Gesicht ab und wedelte mit Lichtgeschwindigkeit. Ich lachte, bis ich zu weinen anfing. Zwei tätowierte und gepiercte Studenten, die zufällig vorbeikamen, blieben stehen, um das Spektakel der Wiedervereinigung mit meinem Hund zu bestaunen.
»Obercool«, sagte das androgyne Wesen mit der violetten Stachelfrisur.
»Hammermäßig«, stimmte sein oder ihr Begleiter mit einem Skateboard unterm Arm zu.
»Wie um alles auf der Welt«, fragte ich, als ich wieder sprechen konnte, »bist du in diesen Truck gekommen?«
Zur Antwort leckte Jethro mir das Gesicht ab. Erst jetzt fiel mir das ausgefranste Stück Nylonschnur an seinem Halsband auf. Ich klemmte mir den zappelnden Hund unter den Arm und sah in den Truck. Ein großer, feuchter Knochen lag auf dem Fahrersitz, neben meinem schwarzen Samtschal, der Jethro, den unzähligen Hundehaaren nach zu urteilen, als Bett gedient hatte.
Ich schnappte mir den Schal und trug ihn mitsamt Hund ins Haus.
Sobald wir drinnen waren, sprang er von meinen Armen und rannte in die Küche. Ich folgte ihm und beobachtete erleichtert, wie er einen ganzen Napf voll Hundefutter verschlang. Als er fertig war, setzte ich mich auf den Boden und untersuchte ihn gründlich. Doch er war unverletzt. Keine Kratzer, keine Wunden, kein gekrümmtes Haar.
Er drehte sich auf den Rücken und erlaubte mir, ihn zur Begrüßung am Bauch zu kraulen.
»Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht«, tadelte ich ihn. »Wie bist du in den Truck gekommen? Wer hat dich gefunden und nach Hause gebracht?«
Statt mir die Sache zu erklären, ging er zur Hintertür und kratzte daran, um mich wissen zu lassen, dass es Zeit für seine Runde war. Doch ehe ich ihn rausließ, ging ich zuerst in den Garten, um mich zu vergewissern, dass das Tor sicher versperrt war.
Beruhigt, weil ich Jethro in Sicherheit wusste, rannte ich nach oben und zog mir Jeans und ein Flanellhemd an. Ich wollte unbedingt herausfinden, wo Jethro die Nacht verbracht hatte, doch ich würde meine Nachforschungen ein wenig aufschieben müssen. Ich hatte einen langen Tag vor mir, denn ich musste das Schaufenster vom Maisie’s Daisy fertig gestalten und mich für den Empfang heute Abend vorbereiten.
Ich hängte das Cocktailkleid auf, das ich in einem Haufen auf dem Schlafzimmerfußboden liegengelassen hatte, als mir einfiel, dass ich den Samtschal in die Reinigung bringen musste. Ich liebe meinen Hund, aber nicht seinen Geruch. Ich hob es auf, um nachzusehen, ob er irgendwelche sichtbaren Flecken bekommen hatte, und um die Brosche mit dem blauen Weihnachtsbaum abzumachen.
Keine Flecken, aber auch keine Brosche.