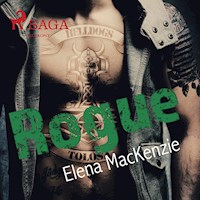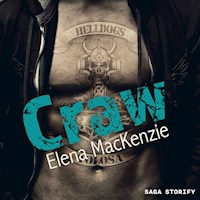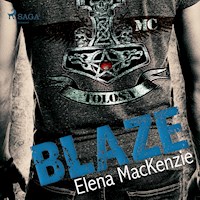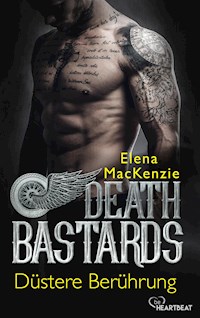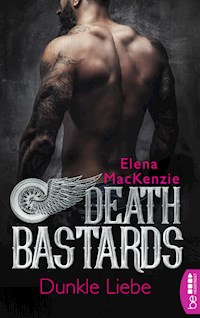3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Romance Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was passiert, wenn man die Grundgeschichte von »Die blaue Lagune« nimmt und sie statt auf einer romantischen Insel auf der einsamen Farm eines Serienmörders spielen lässt? Als Liam Emma sieht, weiß er, dass es falsch ist, sie zu entführen. Aber gemeinsam mit seinem Vater hat er schon viele Frauen entführt. Kommt es da auf dieses Mädchen mehr wirklich an? Liam will endlich jemanden für sich allein haben, um die Einsamkeit, in der er lebt, besser ertragen zu können. Das Grauen, mit dem er täglich konfrontiert wird, besser verarbeiten zu können. Um Emma behalten zu dürfen, würde er alles tun. Sogar morden? Als Emma Liam kennenlernt, macht er sie so neugierig, dass sie all ihre Scheu ablegt und mit ihm redet. Sie lässt sich von ihm dazu überreden, in seinen Transporter zu steigen. Der größte Fehler ihres Lebens oder der Beginn der schmerzhaftesten Liebesgeschichte, von der ihr jemals gehört habt? Einsamkeit, Grauen, Morde und ein Leben weit ab jeder Zivilisation. Und doch kann Emma nicht anders, als ihn zu lieben. Warnung! Dieser Thriller entführt seine Leser auf eine Farm mitten im Nirgendwo, wo zwei junge Menschen in eine Welt hineinwachsen, in der sie jeden Tag mit dem Tod und mit den düsteren Abgründen der menschlichen Seele konfrontiert werden. Ein Psychothriller, der aufgrund seines Themas nicht für jeden Leser geeignet ist. Dieses Buch ist düster und schaut tief in die Psyche der Opfer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
… WEIL MEIN SCHATZ EIN SERIENMÖRDER IST
SCARY ROMANCE
ELENA MACKENZIE
INHALT
Über dieses Buch
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Epilog
Auch erhältlich
Informiert bleiben
ÜBER DIESES BUCH
Was passiert, wenn man die Grundgeschichte von »Die blaue Lagune« nimmt und sie statt auf einer romantischen Insel auf der einsamen Farm eines Serienmörders spielen lässt?
Als Liam Emma sieht, weiß er, dass es falsch ist, sie zu entführen. Aber gemeinsam mit seinem Vater hat er schon viele Frauen entführt. Kommt es da auf dieses Mädchen mehr wirklich an?
Liam will endlich jemanden für sich allein haben, um die Einsamkeit, in der er lebt, besser ertragen zu können. Das Grauen, mit dem er täglich konfrontiert wird, besser verarbeiten zu können. Um Emma behalten zu dürfen, würde er alles tun. Sogar morden?
Als Emma Liam kennenlernt, macht er sie so neugierig, dass sie all ihre Scheu ablegt und mit ihm redet. Sie lässt sich von ihm dazu überreden, in seinen Transporter zu steigen. Der größte Fehler ihres Lebens oder der Beginn der schmerzhaftesten Liebesgeschichte, von der ihr jemals gehört habt? Einsamkeit, Grauen, Morde und ein Leben weit ab jeder Zivilisation. Und doch kann Emma nicht anders, als ihn zu lieben.
Warnung! Dieser Thriller entführt seine Leser auf eine Farm mitten im Nirgendwo, wo zwei junge Menschen in eine Welt hineinwachsen, in der sie jeden Tag mit dem Tod und mit den düsteren Abgründen der menschlichen Seele konfrontiert werden. Ein Psychothriller, der aufgrund seines Themas nicht für jeden Leser geeignet ist. Dieses Buch ist düster und schaut tief in die Psyche der Opfer.
PROLOG
In den USA verschwinden jährlich unzählige Menschen spurlos.
Emma
Tock, tock, tock macht mein Kopf, wenn er gegen die Wand stößt. Den Schmerz fühle ich schon lange nicht mehr, nur noch die klebrige Feuchtigkeit die mein Blut hinterlässt, das aus der Wunde an meinem Hinterkopf sickert und mein hellrotes Haar dunkelrot färbt. Tock, tock, tock ist das einzige Geräusch, dass die Stille zerreißt, die mich in diesem kargen Raum umgibt. Seit Tagen starre ich an die weißen Wände und alles, was ich tun kann, ist essen, schlafen und mir den Schädel einschlagen. Und warten. Auf ihn.
Ich werde immer auf ihn warten, selbst dann noch, wenn sie mich unter Drogen setzen und meinen Verstand unter einem Netz aus Spinnweben begraben. Wenn sie mich an dieses Bett schnallen, um zu verhindern, dass ich mich weiter verletze. Selbst dann noch, wenn sie ihn einsperren sollten, genau wie mich. Ich werde morgen, übermorgen und in zehn Jahren noch auf ihn warten. So wie ich gestern, vorgestern und letzten Monat auf ihn gewartet habe. Und er wird kommen. Er wird kommen und mich holen. Das weiß ich, denn er hat es geschworen. Und er tut immer alles, was er versprochen hat. Er wird mich hier rausholen.
Ich schließe die Augen, stoße weiter meinen Kopf gegen die Wand, lausche dem Tock, Tock, Tock, das mein Kopf beim Schlag gegen die Wand in meiner Zelle verursacht, und warte darauf, dass er mich aus der geschlossenen Abteilung dieser hochgesicherten Psychiatrie holt. Ich weiß, er kommt.
Ich konzentriere mich ganz fest auf sein Gesicht, seine dunkelbraunen, fast schwarzen Augen, die mich so sehr fasziniert haben, als ich noch ein Kind war, dass ich ihm nicht widerstehen konnte. Ich konzentriere mich auf die gezackte Narbe, die seine rechte Augenbraue in zwei Hälften teilt. Seine etwas zu schmale Nase. Und dieses gefährliche Lächeln, hart und erschreckend, das sein Gesicht erst in den letzten Jahren erobert hat. Ich sehe das Blut, das von seinen Händen tropft, das seine nackten Füße bedeckt und den Boden in dem fensterlosen Raum unter dem Farmhaus. Und dann verschwindet dieses wunderschöne Gesicht und Nebel verschlingt ihn wabernd. Er wird mir einfach entrissen und zurück bleibt nur diese unendlich drückende Stille.
Diese Stille, diese Ruhe und die Sehnsucht nach ihm, das alles treibt mich in den Wahnsinn. Mehr noch als die Tabletten, die sie mir hier mit Gewalt einflößen. Manchmal schreit einer der anderen Patienten auf, kreischt und protestiert gegen was auch immer, dann fühle ich mich fast wieder so als wäre ich Zuhause. Bei ihm. Schmerzensschreie. Ich vermisse sie. Aber wie kann ich nur? Wieso tue ich das? Wie kann ich mich nach dem Ort sehnen, an dem ich so vieles sehen musste, das falsch war?
Ich fahre mir durch die Haare, betaste meinen Hinterkopf, das verfilzte lange Haar, in dem getrocknetes Blut sich mit frischem vermischt und betrachte meine blutigen Finger.
Dieses Rot entlockt mir ein Lächeln. Die Art, wie meine Hände mit dem Blut daran aussehen erinnert mich an ihn. Und an mich. Wie oft standen wir uns blutverschmiert gegenüber? So oft, dass wir den Geruch gar nicht mehr wahrgenommen haben. Dass die toten Augen der Opfer uns nicht einmal mehr in unseren Träumen verfolgt haben. So oft, dass die Todesschreie der Opfer sich für mich nach Zuhause angefühlt haben.
Rot. Blut. Rot. Ein Lied kommt mir in den Sinn, wir haben es als Kinder oft gesungen. Und später dann, als wir älter wurden, habe ich es für ihn abgeändert.
Rot, rot, rot sind alle meine Kleider,
rot, rot, rot ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was rot ist,
weil mein Schatz ein Serienmörder ist.
Ich weiß, er kommt und holt mich.
1
Zwölf Jahre zuvor
Liam
»Du bleibst hier«, befiehlt mein Vater mir. Er geht weg, ohne mich noch einmal anzusehen, aber ich weiß, dass sein Gesicht die Vorfreude zeigt, die ich schon mein Leben lang kenne. Ich weiß, warum wir mit dem weißen Transporter in die Stadt gefahren sind, er die Nummernschilder entfernt hat und er nicht will, dass ich mitkomme, sondern hier am Auto warte. Wir haben dieses Spiel schon ein paar Mal gespielt. Ich weiß genau, was passieren wird, weil ich Dad schon oft dabei beobachtet habe.
Jedes Mal fahren wir in eine andere Stadt, aber es ist immer das gleiche Spiel: Dad geht in ein kleines Geschäft, eine Bar oder eine verlassene Straße und spricht eine Frau an. Er sagt ihr nette Dinge, wie sehr ihm ihre Augen gefallen würden, wie hübsch sie wäre, wie schön ihr Lächeln wäre. Dann erzählt er von seinem Sohn, der am Auto wartet, mit dem irgendetwas nicht stimmen würde, da seine Mutter aber kürzlich gestorben wäre, wüsste er nicht, was er tun solle. Meine Aufgabe ist es, verheult und todunglücklich auszusehen. Dafür sorgt er, indem er mein Gesicht mit Dreck beschmiert und mir dann Wasser ins Gesicht spritzt. Dann soll ich anfangen zu heulen, sobald er mit der Frau zum Transporter kommt. Und ich soll vor dem offenen Transporter stehen, so dass er sie in den Laderaum stoßen kann, sobald sie zwischen den geöffneten Türen steht und niemand sie mehr sehen kann.
»Warum weinst du?«, möchte jemand wissen. Ich löse den Blick von der noch schaukelnden Schwingtür, durch die mein Vater gerade verschwunden ist und entdecke ein kleines rothaariges Mädchen, das mich aus großen grasgrünen Augen verwundert und irgendwie auch ein wenig besorgt ansieht. Sie sitzt auf einem mechanischen Pony, das sich nicht bewegt. Ich bin 8 Jahre alt, andere Kinder in meinem Alter besuchen längst die Schule, ich nicht. Meine Mutter unterrichtet mich zu Hause. Das Mädchen ist viel jünger als ich. Höchstens 6 Jahre alt. Sie sitzt auf diesem Pony in einem weißen Spitzenkleid mit bunten Blumen und tut so, als würde sie das Pony reiten, dabei schwingen ihre geflochtenen Zöpfe lustig auf und ab. Als sie bemerkt, dass ich sie mustere, bleibt sie plötzlich still sitzen, legt den Kopf auf eine mädchenhaft niedliche Art schief und sieht mich lächelnd an.
»Warum weinst du?«, will sie wieder wissen.
Ich verziehe das Gesicht zu einem boshaften Grinsen. Sie soll nicht glauben, ich würde weinen, weil mir das peinlich ist. »Ich weine nicht«, sage ich hart und schiebe die Hände in die Taschen. Sie soll auch nicht meine verdreckten Nägel sehen. Sie ist so hübsch und fein und niedlich, dass ich mir neben ihr irgendwie schäbig vorkomme mit meinem verdreckten Gesicht, den schmutzigen Nägeln und den zerschlissenen Lumpen, die ich am Leib trage. Sie wirkt viel mehr wie eine Puppe als wie ein Mädchen. Ein Spielzeug. Sie gefällt mir.
»Du siehst aber so aus«, widerspricht sie.
Ich trete nahe an sie heran, werfe einen Blick auf den offen stehenden Transporter, der darauf wartet, gleich eine Frau zu verschlucken, und als ich mir sicher bin, dass ich nicht zu weit weg bin, um die Türen schnell zuwerfen zu können, bleibe ich neben ihr stehen und beuge mich näher zu ihrem Gesicht. »Sehe ich aus, als würde ich weinen? Ich weine nicht«, setze ich sie drohend in Kenntnis und denke keine Sekunde daran, dass die Kleine gleich sehen könnte, wie Dad und ich eine Frau stehlen. Dad hasst Zeugen.
Sie atmet erleichtert aus, dann lächelt sie wieder und zeigt mir ihre winzigen weißen Zähne. Sie hat noch nicht mal eine Zahnlücke. Ich habe welche, zwei oben und eine unten. Sie ist eben noch viel jünger als ich, deswegen fühle ich mich gleich viel stärker. Ich beuge mich noch näher zu ihr und atme tief ein. Dad macht das bei den Frauen auch immer. Den Geruch der Frauen mag ich nicht, die meisten stinken regelrecht nach irgendetwas süßem, blumigen. Aber das Mädchen, sie riecht nach Sonne und Spielplatz. Und nach Schokoladeneis. Wahrscheinlich dem Eis, das einen dicken Fleck auf ihrem weißen Kleid hinterlassen hat. Mitten auf ihrer Brust. Er sieht aus wie ein ein wenig unregelmäßiges Herz. Oder wie die Flecken, die das Blut der Frauen auf dem dunklen Kellerboden hinterlassen, wenn Vater mit ihnen fertig ist.
»Wie heißt du?«, will sie jetzt wissen.
Ich zucke lässig mit den Schultern. Ich weiß nicht warum, aber ich will cool wirken, also lege ich den Kopf etwas schief und runzle die Stirn so tief ich kann. »Liam, und du?«
Sie weicht meinem Blick aus und zupft an dem Halfter des unechten Ponys, bevor sie mich wieder ansieht. »Eigentlich darf ich mit niemanden reden, aber du bist ein Kind, also darf ich wohl doch.«
»Ja, und wie heißt du nun?«, möchte ich ungeduldig wissen, auch ich darf eigentlich mit niemanden reden und zudem ist das hier mein erstes Gespräch überhaupt mit einem anderen Kind. Ich hatte noch nie die Möglichkeit, mit jemanden in meinem Alter zu reden. Eigentlich habe ich kaum die Chance mit jemand anderem als meinen Eltern zu reden. Manchmal rede ich mit den Frauen, wenn ich ihnen zu essen bringe, was selten vorkommt, da Mutter das meistens tun soll. Aber dann kann man das kaum als Unterhaltung bezeichnen, sie wollen alle das gleiche von mir, dass ich sie rette oder die Polizei rufe. Aber das geht nicht.
Ich konzentriere mich wieder auf das Mädchen und mustere sie nachdenklich. Wahrscheinlich hat sie irgendeinen Prinzessinnennamen. So was wie Ariel oder Kira. Irgendeinen Namen, wie ich ihn aus den Trickfilmen kenne, die ich mir zu Hause immer ansehe, weil es nichts anderes für mich zu tun gibt, als über die Weiden zu laufen, mich irgendwo in der Scheune zu verstecken oder Mom bei der Arbeit zu helfen.
»Emma, meine Mama sagt Em, wenn sie mich liebhat. Wenn sie mich nicht liebhat, weil ich was gemacht habe, das ich nicht darf, dann sagt sie Emma.«
Ja, ich habe auch so einen Namen, den ich dann zu hören bekomme, wenn mein Vater mich gerade nicht mag. Aber eigentlich mag er mich nie besonders. Ich sehe zur Ladentür hin, aus der gerade eine Frau tritt, sie sieht sich nicht um, sondern geht direkt weiter, eine Tasche in der Hand, eilt sie die Straße runter. Glück gehabt, denke ich, während ich ihr mit den Augen folge, dann konzentriere ich mich wieder auf das Mädchen neben mir.
»Aha«, sage ich gelangweilt, muss ihr aber in diese großen leuchtenden Augen starren, aus denen sie mich fasziniert ansieht. Sie mustert mein Gesicht mit einer Aufmerksamkeit, die dafür sorgt, dass mir ganz heiß wird. Ich weiß nicht einmal warum, aber da ist dieses merkwürdige Gefühl, wenn ich sie ansehe, und dieses Gefühl gefällt mir sehr. Vielleicht liegt es daran, dass sie das erste Kind ist, mit dem ich mich überhaupt unterhalte. Ich hatte noch nie die Gelegenheit. Sie macht mich neugierig. Und obwohl ich so tue, als wäre ich ein harter, cooler Kerl, kann ich mich kaum dagegen wehren, dass ich unbedingt jede Sekunde mit ihr auskosten will. Dad sagt immer, es ist wichtig, dass ein Mann rüberkommt, als wäre er ein echter Kerl mit Muskeln, Härte und der Macht, alles hinzubekommen, was er sich vornimmt. Jeder, egal ob Mann oder Frau, muss ihm auf den ersten Blick ansehen, dass man sich am besten nicht mit ihm anlegen sollte. Wenn man es richtig anstellt, traut sich niemand, zu genau hinzusehen.
»Spielen wir was?«, will sie jetzt wissen und sieht mich abwartend an. Sie rutscht auf dem Pony umher und blinzelt gegen die untergehende Sonne an, die so tief steht, dass sie Probleme haben dürfte, mich richtig zu sehen. Wenn die Sonne auf unserer Farm untergeht, dann taucht sie die Berge im Westen in ein gleißendes Feuer. Wenn Schnee auf den Gipfeln liegt, sieht es noch schöner aus. Jetzt am Ende des Sommers liegt nur wenig Schnee auf den Gipfeln.
»Ich hab ein echtes Pony zu Hause«, sage ich, ohne dass ich mir was dabei denke. Es kommt mir einfach in den Sinn und aus irgendeinem Grund will ich, dass sie es weiß. Ein erstaunter und zugleich freudiger Ausdruck tritt auf ihr Gesicht. Ihre Augen werden noch größer, ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre.
»Wirklich ein Echtes? Wie heißt es? Wie sieht es aus?«, plappert sie mit ihrer hellen Stimme los und rutscht noch ungeduldiger herum.
Ich werfe der Tür wieder einen Blick zu, als sie aufschwingt. Eine Frau und ein Mädchen kommen heraus. Das Mädchen ist älter als Emma, mindestens so alt wie ich. Sie sieht mich kurz an, dann lässt sie sich von ihrer Mutter weiterziehen. Dad nimmt nie Frauen mit, die Kinder dabeihaben. Kinder sind eine Plage, sagt er immer. Aber wenn ich Emma so ansehe, kann ich das nicht verstehen. Sie ist toll, und so hübsch. Ich möchte ihre Haut gern berühren und herausfinden, ob sie so weich ist, wie sie aussieht. Ich hebe meine Hand und tippe mit einem Finger gegen ihre Wange. Sie fühlt sich wirklich ganz weich und glatt an. Und warm. Ich möchte sie weiter streicheln, weil ich fast nicht glauben kann, dass sie echt ist. Ich habe mir immer einen Bruder oder eine Schwester gewünscht. Jemanden zum Spielen, aber wahrscheinlich bekommen Familien wie wir nicht noch mehr Kinder. Sollten sie wohl nicht. Meine Mom sagt, so wie bei uns ist es nicht überall. Sie warnt mich immer davor, zu glauben, wir wären normal. Sie sagt, was bei uns passiert, ist das Böse.
Emma zuckt zurück und runzelt die Stirn. »Was machst du?«
»Ich wollte nur mal nachsehen.«
»Was nachsehen?«
»Wie du dich anfühlst.«
Sie schnaubt, dann kichert sie nervös und zuckt weiter zurück, dabei weicht das Lächeln auf ihrem Gesicht nicht für eine Sekunde. »Wie alt bist du?«, will sie jetzt wissen und zieht an den Zügeln des Pferds, als könnte sie es damit wirklich antreiben. »Ich bin sechs.«
»Acht«, sage ich knapp und runzle die Stirn, weil Dad diesmal wirklich lange braucht. Eigentlich geht es immer recht schnell, aber heute ist er schon ziemlich lange weg.
»Ich würde jetzt wirklich gern was spielen«, sagt sie wieder und sieht ungeduldig aus.
»Ich hab keine Zeit zum Spielen«, sage ich wahrheitsgemäß, ohne sie verletzen zu wollen.
»Warum nicht?« Sie klingt unglücklich, ein wenig quengelig und in ihren Augen schwimmen Tränen, was mich irgendwie erstaunt, weil sie offensichtlich wegen mir heult und ich mich wundere, weil ich so etwas bei ihr auslösen kann. Will sie so dringend mit mir spielen? Wie spielt man überhaupt richtig mit jemand anderen zusammen, mit einem Kind? Ich spiele manchmal mit meiner Mom. Ist es mit einem Mädchen wie Emma auch so?
»Was willst du denn spielen?«, hake ich nach, greife nach dem Halfter des Ponys und zupfe auch an dem Leder herum.
»Wir könnten uns beide auf das Pony setzen«, schlägt sie vor.
Ich schüttle den Kopf. »Keine Lust, das ist doch nicht echt.«
Sie verzieht das Gesicht und schnieft, ich kann die Enttäuschung deutlich in ihren Augen sehen.
»Verstecken«, schlägt sie jetzt vor.
Ich sehe mich um und ziehe eine Augenbraue hoch. »Wo willst du dich hier verstecken?«, frage ich. Zuhause verstecke ich mich oft, meistens weit genug weg, damit ich die Frauen nicht schreien hören muss. Aber hier gibt es nichts, wo man sich verstecken kann, außerdem wäre Dad wirklich sauer, wenn ich nicht meine Aufgabe erledige. Ich habe also gar keine Zeit mich zu verstecken.
»Du könntest mir dein Pony zeigen«, meint sie jetzt und sieht mich mit großen Augen erwartungsvoll an. Sie scheint von diesem Vorschlag begeistert zu sein. Ich denke kurz darüber nach und stelle fest, dass ich ihr mein Pony gern zeigen würde.
»Er heißt Bobby«, erzähle ich ihr. »Und er ist so groß.« Ich halte meine Hand etwas über meinen Kopf. »Sein Fell ist dunkelbraun und schwarz und ganz dick. Fast wie meine Haare«, füge ich an, weil Mom das immer sagt. Und mir gefällt der Gedanke, ihr Bobby zu zeigen immer mehr. Aber Dad würde es nie erlauben. »Das geht nicht«, sage ich ernst und wende mich von ihr ab. Ich gehe rüber zur Tür und versuche, durch die Scheiben hindurch etwas zu sehen. Aber eigentlich versuche ich nur, von dem Gedanken wegzukommen, der gerade begonnen hat, in meinem Kopf heranzuwachsen. Deswegen sehe ich sie auch nicht mehr an. Lieber starre ich weiter auf die Tür und hoffe, dass mein Vater sich beeilt, damit ich von ihr wegkomme.
Aber sie folgt mir, steht plötzlich neben mir, nimmt meine Hand und stellt sich genauso hin, wie ich stehe und starrt mit mir zusammen auf die Tür. Dann beginnt sie leise die Menschen zu zählen, die herauskommen, während wir so dastehen. Und jedes Mal, wenn sie bei 11 angekommen ist, beginnt sie von vorn, wahrscheinlich kann sie nicht weiter zählen, also helfe ich ihr. Ich schaffe es bis 20, weil Mom es mir beigebracht hat. Niemand, der das Geschäft verlässt, beachtet uns. Ich bin es gewohnt, dass alle durch mich hindurchsehen. Ich dachte immer, das läge an mir, weil ich viel schmutziger bin als alle anderen, die ich sehe, wenn ich mit Dad unterwegs bin. Aber sie beachten Emma genauso wenig. Vielleicht ist das einfach so. Vielleicht sind alle Kinder für Erwachsene lästig, so wie ich für Dad. Außer er braucht mich an so Tagen wie heute.
»Wo wohnst du«, will sie jetzt wissen. Sie stellt viele Fragen, habe ich den Eindruck, aber das stört mich nicht. Ich muss ihr ja nicht antworten, wenn ich nicht mag.
»Auf einer Farm«, sage ich und sehe zu ihr runter. Sie reicht mir nur bis zur Brust, so winzig ist sie. Trotzdem fühlt es sich toll an, dass sie meine Hand hält, als würde sie mir vertrauen. Als wären wir Freunde. Ich hatte noch nie eine Freundin oder einen Freund. Dass man einen haben kann, weiß ich auch nur aus dem Fernsehen. Lilo und Stitch sind Freunde. Ich mag die beiden, sie sind lustig und sie erleben viel zusammen. Ich stelle mir vor, dass ich mit Emma zusammen auch viele Abenteuer erleben könnte.
»Ich wollte schon immer mal eine Farm sehen.« Sie kichert, als sie mich jetzt ansieht. »Da gibt es viele Tiere, hat meine Mama mir erzählt. Habt ihr viele Tiere?«
»Ein paar. Ich kann dir unsere Farm zeigen«, schlage ich vor und zucke nervös zusammen, als ich Dad entdecke, der sich mit einer Frau langsam auf die Tür zubewegt. Er zeigt auf mich. Ich kann deutlich sehen, dass er verärgert ist, wahrscheinlich sehe ich nicht verheult genug aus. Oder er ist wütend, weil ich hier mit einem Mädchen stehe. Mir kommt der Gedanke, dass er mir Emma jeden Moment entreißen könnte. Das versetzt mich in Panik. Mein Herz ist noch niemals so schnell gerast. Ich höre es in meinem Kopf trommeln. Nervös packe ich Emmas Hand fester, als mein Vater im Geschäft noch einmal stehenbleibt, sich mit der Frau unterhält und mir mit der Hand hinter seinem Rücken ein Zeichen gibt. Ich soll Emma verjagen.
»Ich will gern deine Farm sehen.«
Ich nicke, werfe dem Transporter hinter mir einen flüchtigen Blick zu. Ich soll Emma gehen lassen, das will er von mir. Aber so sehr ich es auch versuche, ich kann ihre kleine Hand nicht loslassen. Ich schaffe es nicht. Ich will sie nicht verlieren. Sie soll bei mir bleiben, weil sie sich so gut anfühlt, wenn sie neben mir steht. Weil ihre Stimme so freundlich ist und hell. Und weil sie so köstlich duftet. Wenn ich sie loslasse, werde ich das alles vielleicht nie wieder erleben. Der Gedanke macht mich wütend vor Verzweiflung.
»Willst du noch immer verstecken spielen?«, frage ich sie mit zitternder Stimme und in meinem Magen dreht sich alles vor Nervosität um.
»Ja, okay«, sagt sie zaghaft.
»Verstecken wir uns im Transporter von meinem Dad«, schlage ich vor.
Sie kichert und schlägt sich die freie Hand vor den Mund. »Aber dann weißt du doch, wo du mich findest.« Dieses Kichern, so müssen kleine Feen klingen, wenn sie lachen. Oder Engel, Mom erzählt mir manchmal von den Engeln, die über sie und mich wachen, damit uns nichts passiert. Damit uns nicht passiert, was all den Frauen im Keller passiert.
»Wir verstecken uns ja auch vor meinem Dad.« Ich zeige auf den Rücken meines Vaters, der noch immer auf die Frau einredet. Manchmal lassen die Frauen, die er auswählt, sich nicht so leicht überzeugen. Diese hier scheint auch schwierig zu sein. Gut möglich, dass er von ihr ablässt und sich eine andere sucht.
Ich bin nervös, aufgeregt und mir ist ein wenig schlecht, weil ich weiß, dass ich das hier nicht dürfte. Dad wird wütend sein. Aber dieses eine Mal möchte ich auch jemanden für mich haben. Ich möchte auch mit jemanden spielen können. Ich möchte Emma haben. Was ist schon dabei, wenn ich einfach das tue, was mein Vater auch tut?
»Das klingt lustig«, meint Emma und zieht mich schon auf den Transporter zu. Ich helfe ihr dabei, hineinzuklettern. Im Inneren ist es stockfinster, zumindest hinten, wo kein Sonnenlicht mehr hinkommt. Dad hat die Wände dick verkleidet, damit niemand etwas hören kann, wenn die Frauen schreien und sich wehren. Wird Emma auch schreien, wenn sie erst versteht, was passiert? Wird sie weinen? Der Gedanke, sie könnte weinen, gefällt mir nicht. Er macht mich sogar wütend. Ich will nicht, dass sie weint. Aber sie für mich zu behalten, ist mir wichtiger. Sie wird bestimmt auch wieder aufhören zu weinen. Vielleicht weint sie gar nicht, weil Dad sie wieder freilässt, sobald er mitbekommt, dass sie da ist. Was ist schon dabei, ich zeige ihr die Farm und Bobby und dann spielen wir etwas, danach bringt Dad sie wieder weg?
»Kommst du nicht mit rein?«, will sie aus dem Inneren wissen.
»Versteck dich ganz hinten«, sage ich ihr. »Ich seh nur nochmal kurz nach.« Das Zittern meiner Stimme hat jetzt meinen ganzen Körper gepackt, weswegen ich meine Hände an den Seiten ganz fest zusammenballe. In meinem Magen scheint etwas völlig verrückt zu spielen. Warum bin ich nur so nervös? Dad und ich machen so etwas doch öfter. Ich sollte es gewohnt sein. Es macht mir auch nie viel aus, wenn es Frauen sind, die hinten auf der Ladefläche landen. Sie alle sind für mich gesichtslos und austauschbar geworden im Laufe der Zeit. Sie kommen und sterben. So ist das bei uns. Aber jetzt ist es Emma, die dort im Dunkeln wartet. Und es wird Dad sein, der mich bestrafen wird. Vielleicht bekomme ich wieder tagelang nichts zu essen und muss im Keller sitzen, bis er glaubt, es wäre genug.
Ich sehe zum Geschäft und jetzt kommt Dad mit der Frau heraus. Sie sieht mich besorgt an. Und eigentlich sollte ich jetzt anfangen, zu weinen, aber ich bin zu aufgeregt, um mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Trotzdem wende ich mich ihr zu und versuche, unglücklich auszusehen. So als bräuchte ich Hilfe, weil es mir nicht gut geht. Aber da ich schon direkt hinter dem Transporter stehe, die Türen noch immer offen sind, geht trotzdem alles ganz schnell. Noch ehe ich Luft holen kann, um zu wimmern, stößt mein Dad die Frau in den Lieferwagen und wirft die Türen zu, dann zerrt er mich um das Auto herum, drängt mich in den Fahrerraum und steigt hinterher. Ganz automatisch rutsche ich rüber auf meinen Platz, schnalle mich an und starre aus der großen Scheibe. Meine Finger sind zu Fäusten geballt, als mein Vater losfährt und ich von hinten die ersten leisen Schreie höre. Die Dämmung des Autos ist so gut, dass ich kaum unterscheiden kann, ob Emma schreit oder die Frau.
Mein Dad fährt immer in kleinere Städte, wo es wenig Verkehr und kaum Zeugen gibt. Außerdem, so sagt er immer, gibt es in kleinen Städten viel seltener Überwachungskameras als in großen. Es dauert also nicht lange, bis wir aus der Stadt raus sind und auf der Landstraße fahren. Trotzdem werden wir bis in die Nacht unterwegs sein, denn Dad holt seine Frauen niemals in der Nähe der Farm. Unsere Farm liegt so weit außerhalb von jeder Stadt, dass ich manchmal glaube, dass niemand weiß, dass es sie überhaupt gibt. Wo genau unsere Farm ist, weiß ich auch nicht, weil Dad mir lange bevor wir ankommen, immer die Augen verbindet, damit ich den Weg nicht kenne. Es gibt nicht einmal eine richtige Straße, die zur Farm führt. Da ist nur ein Pfad, der in den Wald führt, der gerade breit genug für unser Auto ist. Ich glaube, wer nicht weiß, dass dieser Pfad da ist, wird ihn nicht sehen. Er führt mehrere Minuten mit dem Auto durch den Wald, bis er dann zwischen unseren Viehweiden hindurchführt.
Wir haben ein paar Kühe, Hühner, Schafe und Ziegen, ein Maisfeld und hinter dem Haus baut Mom Kartoffeln und Gemüse an. Wir haben auch ein paar Apfelbäume und Kirschbäume. Dad sagt, wir haben genug, um nur wenig einkaufen zu müssen und gut über die Runden zu kommen, weswegen es wichtig ist, dass ich viel mitarbeite. Genauso wie Mom. Vielleicht kann Emma mir bei der Arbeit helfen?
Ich sehe nervös zu meinem Vater auf. Noch scheint er nichts bemerkt zu haben. Wie immer schweigt er auf dem Heimweg, sein Gesicht ist angespannt und er schaut immer wieder in die Seitenspiegel, als befürchte er, dass uns jemand folgt. Hinten im Laderaum ist es mittlerweile ruhig geworden. Es ist nichts mehr zu hören. Ich schließe die Augen und lausche auf den Motor, spüre den schaukelnden Bewegungen des Autos nach und lasse mich von ihnen einlullen. In meinem Traum sehe ich Emmas grüne Augen vor mir, die mich anklagend ansehen. Ich träume auch davon, dass Dad mich über die Holzbank in der Küche bindet und mich dann mit seinem Ledergürtel bestraft, weil ich Emma mitgenommen habe. Und obwohl der Schmerz mich selbst im Traum dazu bringt, aufzuschreien und ihn anzuflehen, damit aufzuhören, kann ich noch immer nicht bereuen, dass ich sie mitgenommen habe. Ganz tief in mir verspüre ich eine wahnsinnige Freude bei der Vorstellung, dass ich nicht mehr allein sein werde.
»Wir sind da«, brüllt Dad mich ungeduldig an und ich schrecke aus dem Schlaf auf, blinzle gegen das Licht in der Garage an und versuche, mich zu orientieren, was ihm zu lange dauert. Ich muss so fest geschlafen haben, dass Dad mir nicht einmal die Augen verbinden musste. Er zerrt an meinem Arm, so dass ich zu ihm rüber rutschen muss, um auf seiner Seite auszusteigen. Ich folge ihm um das Auto herum, und als wir fast hinten sind, fällt mir wieder ein, warum ich eben schon mit einem so komischen Gefühl im Magen aufgewacht bin. Mein Körper hat sich schneller an die drohende Gefahr erinnert, als mein Verstand. Emma!
Vorsichtig bleibe ich ein paar Schritte hinter meinem Dad stehen und mache mich bereit, so schnell wie möglich in Deckung zu gehen, sobald er Emma entdeckt. Aber die Vorstellung, sie allein mit meinem Dad zu lassen, sie meine Strafe tragen zu lassen, sorgt dafür, dass mein Magen sich vor lauter Angst in meinem Körper herumdreht, also rücke ich ein Stück näher an Dad heran, bereit, mich schützend vor Emma zu stellen.
Mein Dad öffnet vorsichtig den Laderaum, in einer Faust hält er die Spritze mit dem Medikament, das eigentlich für Rinder und Pferde ist, das er aber dazu benutzt, um die Frauen, die sich zu stark wehren, zu betäuben, damit er sie ohne viel Ärger in den Raum unter dem Haus tragen kann. Ich hoffe sehr, dass nicht Emma zuerst aus dem Inneren springt, damit nicht sie diese Spritze bekommt. Die beiden Türen öffnen sich und sobald das Licht der Garagenlampe ins Innere fällt, springt die Frau aus dem Auto und wirft meinen Vater zu Boden. Sie schlägt auf ihn ein, kreischt immer wieder und brüllt.
»Emma, Emmaaa! Lauf!«, schreit sie, während sie weiter auf meinen Dad einschlägt.
Eigentlich müsste ich ihm jetzt helfen, aber ich bin wie gelähmt und kann nur auf den Laderaum starren, aus dem sich langsam aus dem Dunkel heraus das Sommerkleid von Emma schält.
»Emma, nun mach schon«, kreischt die Frau wieder, man hört ihrer Stimme an, dass ihre Kräfte schwinden, vielleicht hat Dad ihr auch die Spritze schon gegeben und sie schläft jede Sekunde ein. Selbst wenn Emma wollte, sie könnte nirgendwohin laufen, denn die Garage ist verschlossen, nur mein Dad kann sie öffnen.
Emma steht mittlerweile am Rand und starrt mit weit aufgerissenen Augen zuerst zu mir, dann zu der am Boden liegenden Frau. Sie weint leise still in sich hinein, schreit nicht so wie die Frau, aber ihr Köper zittert und ich kann ihr den Schock ansehen, unter dem sie steht. Sie tut mir leid, aber eigentlich bin ich viel zu egoistisch, um es wirklich bereuen zu können, dass sie hier ist. Ich hoffe nur, dass Dad ihr nicht wehtun wird. Nicht so wie den Frauen im Keller. Was soll ich nur tun, wenn er sie tötet? Das könnte ich nicht aushalten.
»Mami?«, fragt sie wimmernd und ich zucke innerlich zusammen.
Ich sehe die Frau an, die jetzt neben meinem Vater liegt, der schwer atmet und mich hasserfüllt ansieht. Sie ist Emmas Mutter? Ich muss würgen, so übel wird mir, als ich begreife, was ich getan habe.
»Bastard!«, brüllt mein Vater mich an und rappelt sich stöhnend auf. In seinem Gesicht ist ein tiefer Kratzer zu sehen, der von seiner Schläfe bis hinunter zu seinem Kinn reicht. Blutstropfen perlen aus der offenen Haut. Dieser Kratzer lässt sein Gesicht nicht freundlicher wirken. Ängstlich weiche ich einen Schritt vor ihm zurück. Emma steht noch immer wie erfroren am Rand des Lieferwagens und starrt auf die schlafende Frau am Boden, der mein Vater jetzt wütend einen Tritt in die Rippen verpasst.
Er packt mich an den Oberarmen und schüttelt mich so sehr, dass mein Kopf hin und her geschleudert wird, bevor er mir eine Faust in den Magen donnert und sich mein ganzer Körper so sehr verkrampft, dass ich vor Schmerzen nicht mehr atmen kann. Ich höre Emma aufschreien und bekomme nur durch die Nebelwand, die mich umgibt, mit, dass sie zu ihrer Mutter gerannt ist und jetzt neben ihr kniet.
Keuchend gehe ich zu Boden und halte mir den Bauch, wimmere, so unerträglich sind die Schmerzen.
»Was hast du dir dabei gedacht, Bastard?« Ein Fußtritt trifft meine Seite hart und ich stöhne auf. »Ein Kind? Sie suchen wie die Irren, wenn es Kinder betrifft.«
»Ich wollte sie«, stoße ich hervor.
»Du wolltest sie? Die Presse wird sie auch wollen, die bauschen so was mehr auf, als wenn eine Frau verschwindet. Verdammter Mist, wir werden sie töten müssen. Du wirst sie töten müssen.« Dads Gesicht ist wutverzerrt, das bedeutet nie etwas Gutes, und doch schaffe ich es, zu betteln, weil ich Angst vor dem habe, was er von mir verlangt. Ich soll Emma töten? Ich?
Dad hat Regeln, was die Frauen betrifft, die er entführt. Er entführt grundsätzlich nur Touristinnen oder Teenager. Nach Touristinnen wird oft erst spät gesucht, erst dann, wenn man sie in der Heimat vermisst. Bei Mom war es auch so. Und Teenager laufen gern mal weg, wenn sie zu Hause Ärger hatten. Die Polizei geht oft davon aus, dass sie einfach nur untergetaucht sind. Und er wechselt oft die Bundesstaaten, weil die Behörden sich nicht untereinander austauschen. Es dauert oft ewig, bis sie mitbekommen, dass im Nachbarstaat ähnliche Fälle passiert sind, hat er mir mal erklärt. Am liebsten sucht er seine Opfer vor Bars oder Souvenirläden, so wie Emmas Mom.
»Nein«, stoße ich keuchend aus. »Nein, bitte nicht. Ich bin schuld. Bitte nicht.« Wird er wirklich wollen, dass ich Emma töte? Langsam komme ich wieder zu Atem und blinzle die Tränen aus meinen Augen, um mehr sehen zu können. Zuerst sehe ich meinen Vater, der Emma mit vor Wut verzerrtem Gesicht ansieht und sich dann zu ihr nach unten beugt. Er wird sie töten, geht mir durch den Kopf und ich weiß nicht, woher ich den Mut und die Kraft nehme, aber ich rapple mich auf und ignoriere den Schmerz, der meinen ganzen Körper erfasst hat, so wie schon hunderte Male zuvor auch. Ich werfe mich auf meinen Vater und klammere mich an ihm fest, beiße ihm in die Schulter und schmecke den bitteren Geschmack des Bluts, das aus der Wunde quillt.
»Lass mich los, Bastard!«, brüllt er auf und schleudert mich von sich, so dass ich hart auf dem Garagenboden aufschlage. Aber ich schieße sofort wieder hoch.
»Du fasst sie nicht an. Sie gehört mir«, schreie ich so laut ich kann und stürze mich wieder auf ihn. »Wenn du sie anfasst, werde ich dich töten.« Dann schluchze ich, sehe Emma an, die uns mit offenem Mund weinend beobachtet. Sie weint, und ich hasse es, dass sie weint, also trete ich meinem Vater gegen das Schienbein, so kräftig ich kann. »Sie gehört mir. Sie gehört mir. Sie gehört mir. Sie wollte mit mir spielen«, wiederhole ich immer wieder, bis mein Vater mich mit einem Schlag wegwischt, als wäre ich nur eine Fliege. Mein Kopf schlägt gegen die Seite des Transporters und der Schmerz nimmt mir für einen Moment die Orientierung. Mein Atem stockt und ich taumle, aber ich lasse mich nicht aufhalten. Flehend stelle ich mich vor Emma.
Er brummt irgendetwas, das ich durch mein Geschrei nicht verstehen kann, dann geht er wieder auf Emma zu, packt ihr Gesicht und sieht sie sich an, stößt sie von sich und bückt sich nach der Frau am Boden. Er hebt sie hoch, tritt im Vorbeigehen noch einmal nach mir und geht dann zur Tür, die die Garage mit dem Wohnhaus verbindet.
Er steckt den Schlüssel in das Vorhängeschloss, dass den breiten Stahlriegel sichert, öffnet das Schloss, schiebt den Riegel zu Seite und schließt dann die Stahltür auf, die verhindert, dass wir Dad jemals entkommen können.
»Steh auf, Bastard. Bring das Mädchen mit. Deine Mutter wird sich freuen, wenn sie noch so was wie dich hat, das ihr Arbeit macht.« Er öffnet die Stahltür und wartet darauf, dass ich ihm ins Haus folge, wo er die Tür sofort von innen mit einem ähnlichen Riegel und Vorhängeschloss wieder verriegelt. Die Schlüssel, mit denen er sämtliche Türen und Schlösser kontrolliert, trägt er immer bei sich, genauso wie ein Messer.
Ich weiß, er wird ungeduldig werden, wenn ich nicht sofort reagiere, also packe ich Emmas Hand und ignoriere, dass sie sich wehrt und aufschreit. Ich zerre sie hinter mir her und murmle, sie solle sich beruhigen. Wenn ich Dad davon überzeugen will, dass er Emma am Leben lässt, muss ich Emma davon überzeugen, nicht mehr zu weinen. Dann hat sie vielleicht eine Chance. Hoffe ich. Sobald alles verriegelt ist, gibt es kein Entkommen mehr aus diesem Haus, alle anderen Türen und auch die Fenster sind zugemauert. Aber ich würde auch niemals versuchen, zu entkommen, solange meine Mutter in diesem Haus eingesperrt ist.
2
Emma
Es ist stockdunkel, als wir das Haus betreten und sich hinter uns die Tür schließt, sofort verschlucke ich meine Schluchzer, halte die Luft an und umklammere die Hand fester, die mich auf ein schwaches Licht zuführt, das sich am Ende dieses Ganges befindet und im Moment das einzige ist, das ich überhaupt sehen kann.
Ich hole zitternd Luft, als der Mann, der meine Mom auf seiner Schulter trägt, in dieses Licht tritt und dann um eine Ecke herum verschwindet. Verzweifelt ziehe ich jetzt an Liams Arm, denn ich will zu meiner Mutter, egal, was es mich kostet. Ich will zu meiner Mutter. Erst jetzt bemerke ich, dass wir in einer Küche stehen, in deren Mitte ein alter Tisch steht, auf dem sich ein großer Topf befindet.
»Mom«, rufe ich verzweifelt und zerre wieder an der Hand, die mich festhält. Ich schreie und werfe den Kopf hin und her, treibe meine Nägel in Liams Handgelenk und kann einfach nicht verstehen, was hier gerade passiert? Was passiert nur mit uns? Mit meiner Mom? Mit mir? »Ich will nach Hause«, schreie ich Liam an, so laut ich kann. Aber er lässt mich nicht los, stattdessen sieht er mich mit weit aufgerissenen Augen verängstigt an.
»Du musst leise sein, sonst tut er dir weh«, fleht er und versucht mich in seine Arme zu ziehen, aber ich wehre mich, so gut ich kann. Bis jemand mich von hinten packt und ich erstarre.
Ich werde gegen eine Brust gezogen, dann wiegt mich jemand hin und her und summt leise eine Melodie, die ich nicht kenne. Ich versuche mich loszumachen, um etwas sehen zu können, und nach mehreren Versuchen bin ich endlich frei, drehe mich um und stehe einer Frau gegenüber, die nichts weiter anhat, als ein graues, schmutziges Hemd, das ihr bis zu den Oberschenkeln reicht. Um ihren Fußknöchel herum ist ein rostiger Ring angebracht und an dem hängt eine dicke rostige Kette, die sich in einer gewundenen Schlange einige Schritte über den gefliesten Küchenboden zieht und dann in einer Verankerung im Boden endet.
Die Frau ist sehr dünn, ihre Haare verfilzt und schmutzig-blond, aber sie lächelt mich freundlich an und streckt ihre vernarbten Arme nach mir aus, was mich verwirrt erstarren lässt, denn ich kenne diese Frau nicht, also mag ich sie auch nicht umarmen. Ich fühle mich so hilflos, dass mir nichts anderes einfällt, als Liam hilfesuchend anzusehen, der neben mir steht und mich besorgt mustert. Er sieht schon fast ängstlich aus, und wahrscheinlich sollte er das auch, denn ich glaube, er ist an allem schuld, was hier gerade passiert. Er wollte, dass ich in das Auto einsteige. Mom war so wütend, als sie mich in dem Auto entdeckt hat. Und die ganze Zeit hat sie geweint und mich festgehalten und dann hat sie versucht mit ihren Füßen die Tür aufzustoßen, aber die war so fest verschlossen, dass sie es bald aufgegeben hat. Stattdessen hat sie mich wieder an sich gezogen und mir immer wieder gesagt: »Sobald die Tür sich öffnet, rennst du so schnell du kannst. Ich werde den Mann aufhalten. Sieh dich nicht nach mir um. Lauf einfach und schrei. Schrei so laut du kannst.«
Ich hab nicht geschrien und ich bin auch nicht weggelaufen, weil meine Beine sich nicht bewegen wollten, als ich gesehen habe, wie meine Mom mit dem Mann gekämpft hat. Aber jetzt will ich schreien, also öffne ich den Mund und stoße den lautesten Schrei aus, den ich jemals ausgestoßen habe. Es fühlt sich fast an, als lasse dieser Schrei mich für einen Moment wieder besser atmen.
»Du darfst nicht schreien, er kommt sonst«, stößt Liam neben mir aus und er starrt verängstigt auf die Ecke, um die der Mann vorhin mit Mom verschwunden ist.
»Wo ist meine Mom?«, will ich wimmernd wissen und versuche, an der Frau vorbeizukommen, ich will dorthin, wo sie verschwunden ist. Aber sie hält mich auf.
»Deine Mom kommt nicht wieder«, sagt sie. »Ich bin Liams Mama«, fügt sie ganz ruhig an und geht vor mir auf die Knie. »Und wer bist du?«
»Ich will zu meiner Mama«, stoße ich quiekend aus, packe mir eine Strähne der Haare der Frau und zerre wütend daran. »Mama!«
»Du musst leise sein, er wird sonst wütend auf dich und dann wird er dich bestrafen. Das willst du doch nicht, oder?«, versucht sie mich zu beruhigen. Sie zieht mich an sich und diesmal wehre ich mich nicht mehr. Ich sinke schluchzend in ihre Arme und bemerke, dass sie nach Seife riecht, nicht so wie meine Mom, irgendwie anders, aber sie riecht gut. Dabei hatte ich erwartet, dass sie schmutzig stinkt, weil ihr Hemd so abgetragen aussieht. Ich sehe mich über ihre Schulter hinweg in der Küche um und bemerke, dass die Möbel alt sind, aber in einer fröhlichen sonnengelben Farbe mit bunten Blumen darauf. Eine Weile weine ich in ihren Armen, dann steht sie mit mir auf und setzt mich auf einen der Stühle am Tisch.