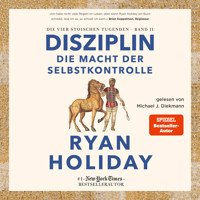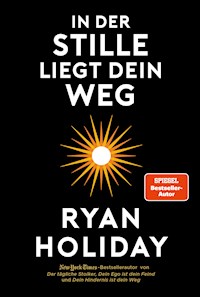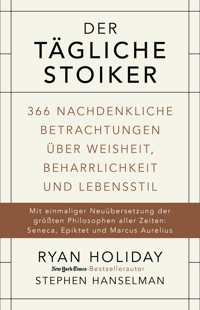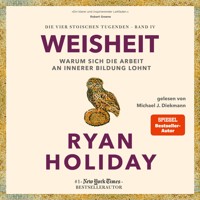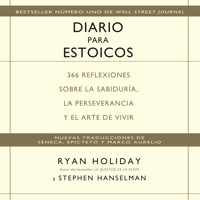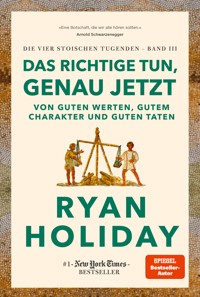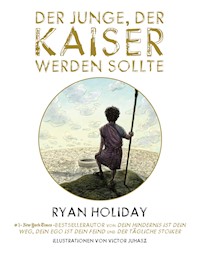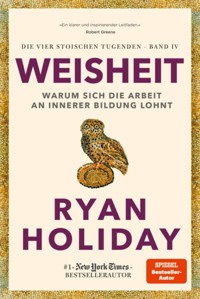
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Weisheit beruht auf Neugierde. Sie erfordert Demut und die Bereitschaft, aus der Vergangenheit zu lernen, um die Hindernisse der Gegenwart zu überwinden. Wir brauchen sie heutzutage mehr denn je. Im vierten und letzten Teil der Bestseller-Reihe »Die vier stoischen Tugenden« beschreibt Ryan Holiday eine Methode der Selbsterziehung, die wir unser ganzes Leben lang verfeinern können. Anhand von Geschichten der Stoiker, des Buddha und großer Persönlichkeiten von Abraham Lincoln bis Joan Didion verdeutlicht er, wie man Weisheit durch Lesen, Kontemplation und ein gesundes Urteilsvermögen kultivieren kann. Und am Beispiel von Elon Musk und Donald Trump zeigt sich, wie gefährlich Macht und Intelligenz ohne den mäßigenden Einfluss von Weisheit sein können. Der Autor fordert dazu auf, kritisch zu denken, aufmerksam zuzuhören und damit den Fallen des Gruppendenkens, der Selbstgerechtigkeit und der Selbstgefälligkeit zu entgehen. Wie schon die Stoiker wussten, hängen alle anderen Tugenden von der Weisheit ab. Sie erfordert Arbeit. Aber sie ist es wert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
DIE VIER STOISCHEN TUGENDEN – BAND IV
WEISHEIT
WARUM SICH DIE ARBEIT AN INNERER BILDUNG LOHNT
RYAN HOLIDAY
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und [email protected]
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2026
© 2026 by Finanzbuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Portfolio, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC
Die englische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel Wisdom Takes Work. © 2025 by Ryan Holiday. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Thomas Stauder, Ursula Pesch
Redaktion: Christiane Otto
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer, in Anlehnung an das Cover der Originalausgabe
Umschlagdesign: Jason Heuer
Umschlagabbildung: Mosaikeule: De Agostini / Getty Images; Rand: Repina Valeriya / Adobe Stock
Satz: Daniel Förster, Belgern
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-832-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-611-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Niemand soll in seiner Jugend zu träge sein, um nach Weisheit zu trachten, noch in seinem Alter zu müde. Denn es ist in keinem Alter zu früh oder zu spät für die Gesundung der Seele. Und zu sagen, die Zeit für das Studium der Philosophie sei noch nicht gekommen oder sie sei vorbei und vergangen, ist wie zu sagen, die Zeit für das Glück sei noch nicht gekommen oder schon vorüber.
Inhalt
Die vier Tugenden
Lange vor unserer heutigen Zeit kam Herkules an einen Scheideweg.
An einer friedlichen Wegkreuzung inmitten der griechischen Hügellandschaft, im Schatten astreicher Pinien, begegnete der große Held der griechischen Geschichte und des Mythos erstmals seinem Schicksal.
Wo genau dies passierte oder wann, weiß niemand. Wir erfahren von diesem besonderen Augenblick durch die Erzählung des Sokrates. Vor Augen haben wir diese Szene in der prächtigen Kunst der Renaissance. Seine jugendliche Kraft und seine strammen Muskeln, aber auch seine seelische Qual kommen in der klassisch gewordenen Kantate zum Ausdruck, die Johann Sebastian Bach ihm gewidmet hat. Wäre es 1776 nach dem amerikanischen Gründervater John Adams gegangen, dann wäre Herkules am Scheideweg auf dem offiziellen Siegel der gerade erst entstandenen Vereinigten Staaten verewigt worden.
Denn dort, bevor er unsterblichen Ruhm erwarb, bevor er die ihm gestellten zwölf Aufgaben erfüllte und bevor er die Welt veränderte, befand sich Herkules in einer persönlichen Krise, wie sie jeder von uns schon erlebt hat, mit einer wichtigen Weichenstellung für seine gesamte Existenz.
Wohin war er unterwegs? Welches Ziel wollte er erreichen? Darum geht es in dieser Geschichte. Auf sich allein gestellt, unbekannt und unsicher, wusste Herkules, wie so viele Menschen, hierauf noch keine Antwort.
Wo der Pfad sich gabelte, lag eine schöne Göttin, die ihm jede erdenkliche Verlockung darbot. Prächtig gekleidet, versprach sie ihm ein Leben in Saus und Braus. Sie schwor ihm, dass er nie Mangel, Unglück, Angst oder Schmerz würde erleiden müssen. Wenn er ihr folge, sagte sie zu ihm, würden alle seine Wünsche in Erfüllung gehen.
Daneben, auf dem Weg, der in eine andere Richtung führte, stand eine strenger wirkende Göttin in einem strahlend weißen Gewand. Sie brachte ihren Aufruf an ihn in ruhigerem Ton vor. Sie versprach ihm keine Belohnungen, sondern nur die Früchte seiner eigenen harten Arbeit. Es würde eine lange Reise werden, sagte sie. Er würde Opfer erbringen müssen und es würde für ihn angsteinflößende Situationen geben. Aber es war ein Lebensweg, der eines Gottes würdig war, der Weg seiner Vorfahren. Er würde ihn zu dem Mann machen, der er werden sollte.
War das die Realität? Ist es wirklich passiert?
Wenn es aber nur eine Legende ist, ist es dann überhaupt von Bedeutung?
Ja, denn es ist eine Geschichte über uns.
Über unser eigenes Dilemma. Über unseren persönlichen Scheideweg.
Herkules hatte die Wahl zwischen Laster und Tugend, dem leichten und dem schweren Weg, dem ausgetretenen Pfad und der weniger beschrittenen Route. Das Gleiche gilt für uns.
Herkules zögerte nur eine Sekunde und entschied sich dann für den Weg, der den entscheidenden Unterschied ausmachte.
Er wählte die Tugend.
»Tugend« kann altmodisch erscheinen. Tatsächlich aber bedeutet Tugend – griechisch arete – etwas sehr Einfaches und Zeitloses: ein hohes Niveau in moralischer, körperlicher und geistiger Hinsicht.
In der Antike setzte sich die Tugend aus vier Hauptbestandteilen zusammen.
Mut
Mäßigung
Gerechtigkeit
Weisheit
Der römische Kaiser und Philosoph Mark Aurel nannte sie »Prüfsteine des Guten«. Millionen von Menschen sind sie als »Kardinaltugenden« bekannt, vier nahezu universelle Ideale, die vom Christentum und dem größten Teil der abendländischen Philosophie übernommen wurden, aber auch geschätzt werden im Buddhismus, Hinduismus und fast jeder anderen Religion oder Weltanschauung. Wie C. S. Lewis zu Recht feststellte, sind diese Tugenden nicht nach einem kirchlichen Würdenträger benannt – dem Kardinal –, sondern ihre Bezeichnung basiert auf dem lateinischen Wort cardo (ursprünglich Türangel, in übertragener Bedeutung Angelpunkt).
Und Dreh- und Angelpunkte sind diese Tugenden in der Tat, sie öffnen die Tür zu einem guten Leben.
Sie sind auch der Gegenstand dieses Buches und dieser Reihe.
Vier Bücher.1 Vier Tugenden.
Ein gemeinsames Ziel: Ihnen die richtige Wahl zu ermöglichen …
Mut, Tapferkeit, Ausdauer, Stärke, Ehre, Aufopferung …
Mäßigung, Selbstbeherrschung, Zurückhaltung, Gelassenheit, Ausgeglichenheit …
Gerechtigkeit, Fairness, Hilfsbereitschaft, Kameradschaft, Güte, Freundlichkeit …
Weisheit, Wissen, Bildung, Wahrheit, Selbsterkenntnis, Frieden …
Sie sind der Schlüssel zu einem guten Leben, einem Leben voll Ehre und Ruhm, einer in jeder Hinsicht vorzüglichen Existenz. Es sind Charaktereigenschaften, die der Schriftsteller John Steinbeck perfekt beschrieben hat als »angenehm und erstrebenswert für [ihren] Besitzer, die ihn Taten vollbringen lassen, auf die er stolz sein kann und über die er sich freuen kann«. Doch mit »er« sind hier nicht nur die Männer gemeint, sondern es bezieht sich auf die gesamte Menschheit. In Rom existierte keine weibliche Version des Wortes virtus. Dies war ein generisches Maskulinum, denn die Tugend war weder männlich noch weiblich, es gab sie einfach.
Und es gibt sie noch heute. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Genauso wenig kommt es darauf an, ob Sie von kräftiger Statur sind oder extrem schüchtern, ob Sie einen genialen Verstand besitzen oder nur eine durchschnittliche Intelligenz, denn Tugend ist ein universeller Wert. Der gleiche Imperativ gilt für alle.
Jede dieser Tugenden ist untrennbar mit den anderen verbunden, aber dennoch unterscheiden sie sich voneinander. Das Richtige zu tun, erfordert fast immer Mut, genauso wie Mäßigung unmöglich ist ohne die Weisheit, den Wert einer Entscheidung zu erkennen. Was nützt der Mut, wenn er nicht für die Gerechtigkeit eingesetzt wird? Was nützt die Weisheit, wenn sie uns nicht bescheidener macht?
Norden, Süden, Osten, Westen – die vier Tugenden sind eine Art von Kompass. Nicht umsonst werden die vier Himmelsrichtungen auf einem Kompass »Kardinalpunkte« genannt: Sie weisen uns den Weg, indem sie uns zeigen, wo wir sind und was wahr ist.
Aristoteles beschrieb die Tugend als eine Art von Handwerk, etwas, das man sich aneignen kann, so wie man sich die Beherrschung eines Berufs oder einer Kunstfertigkeit aneignet. »Wir werden Baumeister, indem wir bauen, und wir werden Harfenspieler, indem wir Harfe spielen«, schreibt er. »Ebenso werden wir gerecht, indem wir gerecht handeln, gemäßigt, indem wir gemäßigt handeln, und tapfer, indem wir tapfer handeln.«
Tugend ist etwas, das wir tun.
Es ist etwas, das wir entscheiden.
Nicht nur einmal, sondern immer wieder, denn Herkules stand nicht nur einmal am Scheideweg. Es ist eine tägliche Herausforderung, mit der wir nicht nur einmal konfrontiert werden, sondern ständig. Werden wir egoistisch sein oder selbstlos? Tapfer oder ängstlich? Stark oder schwach? Weise oder dumm? Werden wir gute oder schlechte Gewohnheiten annehmen? Mut oder Feigheit? Werden wir uns mit der Unwissenheit zufriedengeben oder die Herausforderung neuer Ideen akzeptieren?
Werden wir stets dieselben bleiben … oder uns weiterentwickeln?
Wählen wir den bequemen Weg oder den richtigen Weg?
Einleitung
Das Ziel des Seins ist das Wissen; und wenn Sie sagen, das Ziel des Wissens ist das Handeln – ja, das stimmt, aber das Ziel dieses Handelns ist wiederum das Wissen.
Ralph Waldo Emerson
Von allen Tugenden ist Weisheit die am schwersten fassbarste. Sie ist etwas, das man anstrebt, etwas, das wir immer erlangen möchten.
Dennoch ist uns klar, dass uns dies mit ziemlicher Sicherheit nie gelingen wird, zumindest nicht vollständig, dass wahre Weisheit bestenfalls etwas ist, dem wir uns annähern können. Trotz lebenslanger Bemühungen entzieht sie sich jedes Mal unserem Zugriff und rückt mit jedem Schritt weiter in die Ferne, wie der Horizont, den man niemals erreichen kann.
Das Gleiche gilt für den Versuch, Weisheit zu definieren. Sie ist offensichtlich mehr als Klugheit, mehr als der Besitz von Wissen und Fakten, sogar mehr als Einsicht. Sie ist Intelligenz, Intuition, Erfahrung und Bildung, Philosophie und praktisches Verständnis, Bewusstsein und Gewitztheit, Weitsicht, Scharfsinn und, ganz richtig, die »Umsicht«, die man in der Antike manchmal als Weisheit bezeichnete.
Sie ist all dies und doch irgendwie auch viel mehr.
Sie möchten mir also mitteilen, dass Sie mir nicht sagen können, was Weisheit ist oder wie man sie erlangt?
Ja. Willkommen im Leben. Es ist kompliziert. Nur ein Dummkopf glaubt an einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Weisheit erfordert Arbeit. Wie Liebe und Glück und alles Wertvolle kann Weisheit nicht durch Tricks oder Abkürzungen erlangt werden. Wer behauptet, einen einfachen Weg zu ihr zu kennen, der lügt, und wer behauptet, sie zu besitzen, hat sie wahrscheinlich nicht.
Eines können wir über die Weisheit mit Sicherheit sagen: Sie ist nicht angeboren.
Und doch entspringen ihr zweifellos die anderen Tugenden – die Weisheit wird aus genau diesem Grund als Mutter aller Tugenden bezeichnet. Kann jemand, der Risiken nicht einzuschätzen vermag, wirklich mutig sein? Wie kann er ohne Weisheit überhaupt wissen, wofür er seinen Mut einsetzen soll? Ist es nicht eine Verschwendung von Selbstdisziplin, sie der falschen Sache zu widmen, sie fehlerhaft oder ineffizient zu nutzen? Man kann ein gutes Herz haben, aber ohne Kompetenz, ohne Verstand und Weitblick werden die Versuche, Gerechtigkeit zu üben, sicherlich scheitern.
Man könnte also sagen, dass Weisheit bedeutet, zu wissen,
… was zu tun ist,
… wann es zu tun ist
… und wie es zu tun ist.
Weisheit besteht darin, das Wesen aller Dinge zu verstehen.
Es ist die Fähigkeit, das, was vor einem liegt, klar zu erkennen. Es ist das weitmöglichste Verständnis dessen, wie Dinge funktionieren, warum sie geschehen, was ihr aktueller Zustand ist und was als Nächstes passieren könnte. Es handelt sich nicht um enzyklopädisches Wissen über Fakten und Zahlen, sondern um etwas sowohl Tiefgründiges als auch Praktisches – denn es war nicht Gandhis scharfer juristischer Verstand, der ihn zum Mahatma machte.
Während Weisheit schwer zu definieren ist, gilt das für ihr Gegenteil nicht. So wie Mut kompliziert ist, Feigheit aber einfach, so verhält es sich auch mit der Weisheit, einer Tugend, deren schwer fassbare Natur in komplettem Kontrast zur Dummheit steht. Wir erkennen einen Dummkopf, wenn wir einen sehen. Wir wissen, dass wir nicht so sein wollen.
So wie niemand weise geboren wird, wird auch niemand dumm geboren – zweifellos unwissend, aber wenn er das bleibt, hat er das selbst so gewollt. Wie werden wir uns entscheiden?
Weisheit ist wie Dummheit eine Art von Asymptote. Einige von uns sind weiter von der Achse entfernt als andere – manche sind klüger oder gebildeter –, aber da die Funktion unendlich ist, sind auch die Möglichkeiten endlos. Es gibt immer mehr zu lernen, mehr zu wissen, mehr zu verstehen über die Welt und über sich selbst. Das Gegenteil ist ebenfalls wahr: Wie dumm auch jemand scheinen mag, kann er die anderen immer noch überraschen, denn die menschliche Dummheit kennt ebenfalls keine Grenzen.
Wir streben nach Weisheit aus einem wesentlichen Grund: Wir benötigen sie, später und sofort. Das Leben ist ein Spiel für denkende Menschen. An einem Tag stehen wir vor einer Entscheidung über unsere Zukunft, am nächsten vor einem moralischen Dilemma. Komplexe Probleme. Komplizierte Personen. Verwirrende Situationen. Verborgene Chancen.
In diesen großen und kleinen Momenten ist die benötigte Weisheit entweder vorhanden oder nicht. Die Erfahrung, das Wissen und das Verständnis wurden entweder angesammelt oder nicht. Entweder haben wir den notwendigen Lernprozess absolviert oder nicht. In diesem Moment entdecken wir den Grund, wieso »gelernt« und »verdient« zusammenhängen.
Weisheit ist also ein verzögerter Indikator für in der Vergangenheit geleistete Arbeit, die Frucht, die aus vor langem in die Erde gestecktem Samen herangereift ist. Man kann nur ernten, was man gesät hat.
Dies ist der Weg
Seneca erzählt die Geschichte eines prätentiösen, aber faulen Römers. Er wollte seine gebildeten Freunde beeindrucken, also kaufte er sich, anstatt Hunderte von Stunden zu lesen, eine Reihe belesener Sklaven. Einer kannte Homer auswendig. Ein anderer kannte Hesiod. Er hatte einen Sklaven für Sappho, einen für Pindar und einen für Simonides, einen für jeden der antiken griechischen Dichter, die ein Römer der Oberschicht in- und auswendig kennen musste.
Er glaubte, er würde damit durchkommen, dass diese Männer ihm bei Abendgesellschaften kluge Zitate zuflüstern würden und ihm jederzeit zur Verfügung stünden, wenn er etwas würde nachschlagen müssen, bis ein Freund ihm vorschlug, Unterricht im Ringen zu nehmen. »Aber ich bin schwach und gebrechlich«, erwiderte der Mann. »Sag doch das nicht«, neckte ihn sein Freund. »Bedenke, wie viele vollkommen gesunde Sklaven du hast!«
Wir alle wünschen uns, dass es einen Weg gäbe, etwas umsonst zu bekommen, dass wir zu der Position vorspulen könnten, an der wir es »haben«. Wir suchen nach Tricks und Schummeleien, als ob Weisheit ohne unglaubliche Anstrengungen und ohne lebenslanges Lernen überhaupt möglich wäre. Seneca erinnert uns daran, dass diese Kompetenz nicht an jemand anderen delegiert werden kann.
Es gibt keine technischen Geräte, die dies für Sie erledigen können. Es gibt keine App zum Herunterladen. Es gibt keinen Lehrer, der Ihnen einfach alles in Ihr Gehirn stopfen kann. Es gibt keinen Guru, der Sie zur Erleuchtung führen kann, und keinen Schamanen, der Ihnen diese auf einen Schlag verabreichen kann. Es kommt nicht darauf an, womit Sie geboren wurden. Es geht darum, was Sie daraus machen.
Der Weg zur Weisheit ist nicht nur steinig, er wird auch von Brückentrollen bewacht und ist mit Hindernissen übersät. Es gibt Sackgassen. Es gibt Abgründe der Verzweiflung. Es gibt schwindelerregende Gipfel und furchterregende Wunder. Es sind weite Strecken zurückzulegen. Auf Ihrem Weg werden Sie unfreundlichen Menschen und unangenehmen Ideen begegnen. Sind Sie stark genug, um damit umzugehen? Sind Sie bereit für eine lange Reise? Oder möchten Sie, dass alles nett, ordentlich und einfach ist?
Selbst wenn Sie von Natur aus begabt sind, selbst wenn Sie bereits die besten Schulen besucht haben, haben Sie die Weisheit nicht sicher. Denn, wie Seneca schreibt: »Es bleibt noch viel zu tun; um dies zu schaffen, musst du all deine wachen Stunden und all deine Anstrengungen aufwenden, wenn du zum Ziel gelangen willst.«
In diesem Buch geht als also weniger um die Weisheit an sich als vielmehr um den Weg zu ihr. Es soll die Methoden einiger der weisesten Menschen, die je gelebt haben, erklären sowie die Fallstricke aufzeigen, in denen die Dummköpfe hängen geblieben sind. Dabei handelt es sich nicht immer um Methoden, die unsere Protagonisten selbst formuliert haben. Weise Menschen sprechen nicht oft über ihre Weisheit, Dummköpfe wissen nicht, dass sie dumm sind, aber beide haben uns etwas Besseres hinterlassen: ihr Beispiel.
Nach Weisheit haben seit Jahrtausenden viele große Männer und Frauen gestrebt, lange bevor Sokrates angeblich die Philosophie auf die Erde brachte. Wir werden uns mit den Ideen von Montaigne und Emerson – unseren Leitfiguren in diesem Buch – befassen und sie der Hybris und Dummheit von Menschen gegenüberstellen, die es besser hätten wissen müssen. Wir werden die geduldige, praktische Weisheit Lincolns betrachten und sie der impulsiven Unreife sogenannter Genies gegenüberstellen, die trotz ihrer Intelligenz so vieles nicht verstehen.
Vor allem werden wir uns mit der Arbeit all dieser Personen beschäftigen – denn niemand hat seine Weisheit umsonst erhalten.
Wie alle anderen Tugenden ist auch Weisheit ein Nebenprodukt davon, das Richtige zur richtigen Zeit auf die richtige Weise zu tun, und zwar nicht nur einmal, sondern konsequent im Laufe eines ganzen Lebens. Sie ist das Ergebnis einer Methode, und doch kann man sie nie wirklich besitzen.
Denn sieist die Methode selbst.
Keine bahnbrechende Methode, sondern dieselben Praktiken, dieselben Fragen, die Menschen sich seit Anbeginn der Menschheit gestellt haben, und dieselben Handlungen, die sie seitdem unternommen haben. Sie beruht auf Mentoren und Lehrzeiten. Auf dem Studium der Geschichte. Auf der Lektüre, umfassender Lektüre. Auf der Suche nach Erfahrungen. Auf dem Erforschen, Entdecken, Zerlegen, Diskutieren, Debattieren und Einfordern von Antworten. Sie beruht auf Konzentration und Beobachtung. Auf dem Vermeiden von Fehlern und auf dem Lernen aus den bereits gemachten Fehlern. Auf der Selbstanalyse. Auf dem Hinterfragen der eigenen Annahmen. Auf der Bereitschaft, ein Schüler zu bleiben, unabhängig davon, wie alt oder erfolgreich man ist.
Die Methoden mögen einfach sein, aber ist es auch einfach, sich ein Leben lang daran zu halten? Die von Tag zu Tag erzielbaren Erträge mögen bescheiden sein, aber im Laufe eines Lebens …
Wir können weiser werden, aber niemals weise.
Klüger, aber niemals klug.
Näher herankommen, aber niemals angekommen sein.
Die Weisheit steht jedem offen, der bereit ist, sie sich zu verdienen.
Die Weisheit ist nicht bequem.
Die Weisheit ist ein Kampf, den es zu gewinnen gilt.
Die Weisheit erfordert Arbeit.
Die Weisheit ist es wert.
Teil I Die Agoge (Ihr Trainingsplatz)
Kein Mensch wurde jemals zufällig weise.Seneca
Niemand kann uns Bildung vermitteln. Wir müssen sie uns selbst aneignen. Die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch in seinem Leben trifft, ist die, Schüler zu werden und dies nicht nur in der Schule oder im Beruf zu bleiben, sondern ein Leben lang. Es gibt einen Grund, warum weise Menschen so wenig über Weisheit sprechen. Sie sind noch zu sehr damit beschäftigt, sie zu suchen, und sehen sich selbst noch als Schüler. Eine gute Erziehung vermittelt uns gute Moralprinzipien, gute Ideen, gute Gewohnheiten – die Gesamtheit an Fähigkeiten, die es uns ermöglichen, alles zu lernen, was die Welt uns lehren kann. Was wir in unser Gehirn aufnehmen, insbesondere in jungen Jahren, aber auch später jeden Tag, bildet eine Art Bankguthaben, auf das wir in Zukunft zurückgreifen können. Die Verhaltensweisen, die wir uns angewöhnen, werden uns unterstützen … oder uns im Stich lassen. Wir müssen uns mit der Geschichte und der Menschheit auseinandersetzen. Wir müssen die Fähigkeit entwickeln zuzuhören, zu beobachten und zu lernen. Wir müssen einen ausgeprägten Sinn für Neugierde herausbilden, einen unstillbaren Wissensdurst. Die Gestaltung unseres eigenen Bildungswegs erfordert immense Disziplin und beträchtlichen Mut. Lassen Sie uns beginnen.
Eine höchst ungewöhnliche Erziehung …
Als Spross einer Adelsfamilie hätte Michel de Montaigne seine Kindheit eigentlich inmitten von Bediensteten und in luxuriösem Komfort verbringen sollen. Stattdessen ließen seine Eltern ihren Sohn nach seiner Geburt zunächst bei einer Bauernfamilie in der Nähe aufwachsen – nicht weil sie ihn vernachlässigen wollten, sondern um ihm etwas Unbezahlbares mit auf den Weg zu geben. Die meisten Kinder wohlhabender Familien wurden im 16. Jahrhundert Ammen und Kindermädchen anvertraut, aber Montaigne, der zwar in Sichtweite des riesigen Anwesens, das seinen Namen trug, untergebracht war, aber in großer innerlicher Distanz dazu, wurde nach seinen eigenen Worten »vom Schicksal nach den Gesetzen des einfachen Volkes und der Natur geformt«.
Es war ein ungewöhnlicher Beginn einer ungewöhnlichen Erziehung, die bis zu Montaignes Tod im Alter von 59 Jahren andauerte.
Nach diesen ersten Jahren im Schoß seiner Ersatzfamilie wurde Montaigne nach Hause geholt, wo sein Vater verfügte, niemand dürfe in seiner Gegenwart eine andere Sprache als Latein sprechen. Anstelle umgeben zu sein vom lokalen französischen Dialekt lebte Montaigne nun in der Welt von Seneca und Cato und eignete sich deren Sprache auf natürliche Weise an, so wie es die Menschen in der Antike getan hatten.
Sogar manche Dorfbewohner machten bei dem Plan mit, und Jahre später war Montaigne überrascht, als er einen von ihnen beiläufig ein Werkzeug mit seinem lateinischen Namen bezeichnen hörte – so sehr hatte sich diese um seinetwillen angenommene Gewohnheit eingeprägt. Da in seiner Umgebung keine anderen Sprachen gesprochen wurden – sein Lateinlehrer war Deutscher und konnte nicht einmal Französisch –, erlernte der Junge die Sprache der Philosophie schnell und mühelos. Die Römer waren um 60 vor Christus nach Bordeaux gekommen, und Rom hatte in den folgenden Jahrhunderten seine Macht verloren, aber für Montaigne war die Urbs Aeterna weiterhin maßgebend.
Bald sprach Montaigne fließender Latein als seine Eltern und besser als sein Privatlehrer. »Was mich betrifft«, erinnerte sich Montaigne später, »so verstand ich bis zum Alter von sechs Jahren Französisch genauso wenig wie Arabisch.«
Man könnte vermuten, dass eine so strenge und zielgerichtete Erziehung – seltsam war sie natürlich auch – freudlos gewesen sein muss. Montaigne hatte Glück, denn er wurde ebenso sehr von Liebe und Zärtlichkeit geprägt wie von diesen Experimenten. Später lernte er Griechisch, etwas traditioneller, aber sein Vater betrachtete dies als ein Spiel. Montaigne erinnerte sich an den Spaß, den er hatte, mit seinen Lehrern »Konjugationen hin- und herzuwerfen«, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass er dabei etwas lernte. Montaigne berichtete, dass Bildungsexperten seinem Vater auf dessen Auslandsreisen geraten hatten, das Gemüt seines Sohnes »ganz und gar durch Sanftmut und Freiheit« zu formen, seine Entscheidungen zu respektieren und ihm die Freude am Lernen zu vermitteln. Ist es verwunderlich, dass Montaigne auf seinem Sterbebett davon überzeugt war, den besten Vater der Welt gehabt zu haben?
Nur zweimal in seinem Leben wurde Montaigne körperlich gezüchtigt – recht sanft, wie er selbst feststellte –, etwas, das viele Kinder heute nicht behaupten könnten und im 16. Jahrhundert auf nur wenige Kinder zutraf. An den meisten Morgen wurde er nicht von einem nörgelnden Elternteil oder einem strengen Lehrer geweckt, sondern von den harmonischen Klängen der Musiker, die sein Vater engagiert hatte. Dies war ein Weg, seinem Sohn die Musik nahezubringen, zeugt aber auch von bemerkenswerter Fürsorge: Sein Vater hielt es für zu grausam, »die zarten Gehirne der Kinder« durch Schütteln oder Rufen aufzuwecken.
Mit sieben Jahren las Montaigne bereits zum Vergnügen Ovid, da er von seichten Kindergeschichten gelangweilt war. Er war jedoch nicht nur ein Bücherwurm. Im Haushalt der Montaignes bot alles eine Gelegenheit zum Lernen – selbst Streiche oder Fehler waren Anlass für Diskussionen oder Lektionen. Alles sollte »als ausgezeichnetes Buch dienen«, jede Situation bot eine Lehre, selbst »ein kleiner Betrug eines Dieners, eine Dummheit eines Lakaien, eine Bemerkung am Tisch« waren Anlass für Diskussionen, Debatten und Analysen. Alles musste hinterfragt werden. Jede Idee musste bis zu ihrer ursprünglichen Quelle zurückverfolgt werden. Große Denker wurden herangezogen, um Rat und Antworten zu geben, aber auch sie blieben von Kritik nicht verschont. »Man muss alles durch ein Sieb geben«, sagte Montaigne später zur Frage, wie ein Kind zu erziehen sei, »und nichts aufgrund bloßer Autorität oder Vertrauen in seinem Kopf verankern.«
Ihm wurde beigebracht, Fehler nicht zu dramatisieren, und er wurde sogar dazu ermutigt, sie zuzugeben. Das Wichtigste, was man Kindern beibringen solle, sagte er über die wahre Lektion, die er in seiner Jugend gelernt habe, sei, »dass das Eingestehen eines Fehlers, den man in seiner eigenen Argumentation entdeckt, selbst wenn man der Einzige ist, der ihn bemerkt hat, ein Akt der Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit ist, welche die wichtigsten zu besitzenden Eigenschaften sind«. In Montaignes Familie galt Starrsinn als Laster, und der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit oder Überlegenheit war der einzige Fehler, für den man sich schämen musste.
Es muss für Montaigne seltsam gewesen sein, als er zum ersten Mal das Klassenzimmer des Collège de Guyenne betrat, das sein Vater mit begründet hatte. Plötzlich war er von anderen Schülern umgeben, die alle diese Sache namens »Schule« machten. Wie Montaigne gewusst haben dürfte, stammt dieses Wort von der griechischen Bezeichnung für »Muße« ab. Damals wie heute ist die Etymologie weit von der Realität entfernt.
Montaigne gefiel es nicht, wie oft er und seine Mitschüler »der schlechten Laune eines wütenden Schulmeisters ausgeliefert« waren. Es gab so viele Unterrichtsstunden, dass die Tage endlos erschienen; er und seine Mitschüler empfanden es als eine Qual, »14 oder 15 Stunden pro Tag wie Lastenträger zu schuften«. Sie wurden dazu gezwungen, Passagen auswendig zu lernen, aufzusagen und zu übersetzen, als ob diese Geräusche, Laute und Symbole ein Ersatz für das Verstehen des Textes wären. Es sei tragisch, fand Montaigne, aber nicht überraschend, wie viele Kinder die Schule hassten und, noch trauriger, wie viele Lehrer ihre Schüler hassten.
So wie Vögel Nahrung in ihren Schnäbeln tragen, »ohne sie zu kosten, um sie ihren Jungen in den Schnabel zu stopfen«, sagte Montaigne, »suchen unsere Schulmeister in ihren Büchern nach Wissen und legen es nur auf ihre Lippen, um es dann auszuspucken und in den Wind zu verstreuen«. Seine Mitschüler, die das wiedergeben konnten, was sie von ihren Lehrern gelernt hatten, schienen ihm wie Papageien. »Etwas auswendig zu wissen, ist kein wirkliches Wissen«, sagte Montaigne später, »es bedeutet, das, was man dir gegeben hat, zu behalten und in deinem Gedächtnis zu speichern.«
Die Schule vermittelte ihm die Grundlagen von Mathematik, Logik und Dichtung. Aber er träumte davon, die Kontrolle über seinen eigenen Lehrplan zu erlangen, und später war er neidisch, als er erfuhr, dass Sokrates seinen Schülern den größten Redeanteil überließ.
Im Unterschied zu seinem Schulunterricht bestand der Rest seiner frühen Erziehung aus körperlichen Aktivitäten. Er lernte zu tanzen, zu reiten, den Speer zu werfen und ein Instrument zu spielen. Montaigne und seine Brüder praktizierten alle das französische Tennisspiel, was ungewöhnlich war, da Sport nicht als wichtig angesehen wurde. Montaigne scherzte, dass es vielen seiner Mitschüler besser gegangen wäre, wenn sie ausschließlichTennisunterricht erhalten hätten, denn dann hätten sie die Schule nicht besuchen müssen und wären zumindest körperlich fit geworden. Außerdem wären sie dann nicht so übertrieben stolz auf ihre Bildung gewesen. Auf jeden Fall wurde er nicht zu einem verweichlichten Intellektuellen erzogen, sondern zu einem aktiven und kräftigen jungen Mann.
Das Beste an jeder Bildungseinrichtung sind ihre Lehrkräfte. Trotz aller Mängel und Frustrationen seiner traditionellen Schulbildung hatte Montaigne das Glück, mehrere hervorragende Lehrer zu haben. Einer davon, George Buchanan, war vor religiöser Verfolgung aus Schottland nach Bordeaux geflohen. Der zukünftige Tutor von Königen war weit weg von seiner Heimat und konnte dem jungen Montaigne eine weltoffene Perspektive vermitteln. Buchanan liebte das Theater und inszenierte in der Schule viele Stücke, wobei er diesen ungewöhnlichen Jungen dazu brachte, in ihnen mitzuspielen.
Vielleicht war Buchanan mit dem Lehrer gemeint, dem Montaigne später dafür dankte, seine Liebe zum Lesen gefördert zu haben. In einer Zeit, in der Bücher teuer und Zensur an der Tagesordnung waren, erkannte dieser Lehrer, dass Montaignes Neugierde durch den Lehrplan der Schule nicht gestillt werden konnte. Sie einigten sich darauf, dass es Montaigne, solange er den schulischen Lehrplan bewältigen konnte, frei stand, zusätzlich noch seinen eigenen Interessen nachzugehen. Man kann sich vorstellen, wie Buchanan Montaigne immer wieder motivierte und ihm sogar Bücher aus seiner eigenen Bibliothek lieh. »Er tat so, als würde er nichts sehen«, sagte Montaigne dankbar, »weckte meinen Appetit, und ließ mich heimlich in die Welt dieser Bücher eintauchen.«
Es war auch ein brillanter Schachzug, denn Montaigne beobachtete, dass viele seiner Mitschüler die Schule mit einer Abneigung gegen das Lesen verließen.
Eines der Bücher, das er entdeckte, war eine wunderschöne Folio-Ausgabe der Werke von Terenz, herausgegeben vom Humanisten Erasmus, die Montaigne 1549 im Alter von 16 Jahren für sich erwarb. Er las dieses Buch noch bis ins hohe Alter immer wieder und fand es jedes Mal, wenn er Terenz zur Hand nahm, unmöglich, »nicht neue Schönheit und Anmut in ihm zu entdecken«.
Er schloss die Schule mehrere Jahre früher ab als üblich, mit guten Resultaten. Er hatte bessere Erfahrungen gemacht als die meisten anderen Schüler. »Aber trotz allem«, sagte er, als er seine Erfahrungen, die er im Collège gesammelt hatte, zusammenfasste, »war es immer noch Schule.« Was konnte er aus all diesen Jahren mitnehmen? Nichts im Vergleich zu dem, was er zu Hause gelernt hatte, wo er schon früh die Freude am Lernen entdeckt hatte.
Das wahre Ziel der Bildung war schon immer, Neugier zu wecken, den Wunsch, die Welt und den eigenen Platz darin zu verstehen. Oft wird genau das später wieder ausgelöscht.
Unter all dem, was der Junge erben würde – darunter riesige Ländereien, ein Weingut und ein Schloss –, war dies sein größter Segen. »Er wuchs unter einigen der bizarrsten Einschränkungen auf, die jemals einem Kind auferlegt wurden«, bemerkte Montaignes Biografin Sarah Bakewell, »und genoss gleichzeitig fast uneingeschränkte Freiheit. Er war eine Welt für sich.«
Doch schließlich musste Montaigne, wie alle Schulabgänger, in die reale Welt eintreten. Sein Vater war immer der Auffassung gewesen, dass die Erziehung seines Sohnes nicht nur um ihrer selbst willen erfolgte, sondern um den Jungen darauf vorzubereiten, die Familiengeschäfte zu leiten, ein Amt zu bekleiden, eine Führungsrolle zu übernehmen und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, indem er Werte hochhielt, die vor nicht allzu langer Zeit im »dunklen Mittelalter« verloren gegangen waren. Vielleicht hätte sich Montaigne gerne weiter der Gelehrsamkeit gewidmet, aber das Leben – und sein Vater – hatten andere Pläne.
»Der Schule schuldet ein Mann nur die ersten 15 oder 16 Jahre seines Lebens«, schrieb Montaigne später, »den Rest schuldet er dem Handeln.« Wir alle machen diesen Übergang durch, von der Schule zur praktischen Erfahrung, vom Klassenzimmer zur Schule des Lebens. All das, worüber Montaigne gelesen hatte – die griechische Demokratie, das Römische Reich, die Rechtsfälle von Cicero, die Macht der mittelalterlichen Kirche –, würde er nun hautnah erleben, nicht im Glanz des Goldenen Zeitalters, sondern in seiner chaotischen, schmutzigen Gegenwart.
Nach seinem Jurastudium arbeitete Montaigne als Richter am Parlament von Bordeaux, wo er komplexe Rechtsfälle beurteilen und mit verschiedenen Gerichten zusammenarbeiten musste. Damals wurden Richter nach zwei sehr unterschiedlichen Kriterien beurteilt und geprüft. Eine Methode, die bis heute üblich ist, bestand darin, die akademischen Leistungen und Fähigkeiten eines Bewerbers durch Wissenstests zu kontrollieren. Ein einfacherer Ansatz bestand darin, einem angehenden Richter einen Fall zur Beurteilung vorzulegen und zu beobachten, wie er dabei vorging, um so seine Denkweise einschätzen zu können.
Letzteres sei das bessere Verfahren, bemerkte Montaigne, »auch wenn beide notwendig und zusammen erforderlich sind, ist dennoch das Talent zum Wissenserwerb weniger wert als das Urteilsvermögen. Das Urteilsvermögen kann ohne Wissen auskommen, aber das Wissen nicht ohne Urteilsvermögen.«
Montaigne erhielt seine Stelle mit ziemlicher Sicherheit durch die Beziehungen seines Vaters, aber in den 15 Jahren, in denen er sie innehatte, erkannte er, dass es etwas ganz anderes ist, das Gesetz zu kennen und es zu verstehen. Er lernte, was alle großen Juristen gelernt haben, dass nämlich die Theorie an die Realität angepasst werden muss und nicht umgekehrt, und dass nur echte, schmerzhafte Erfahrungen einem Menschen beibringen können, seinen Beruf zu beherrschen.
Montaigne erkannte schnell, dass in den Büchern vieles ausgelassen worden war, als er mit der Komplexität des menschlichen Herzens konfrontiert war oder über die zweideutigen Ausgänge von Gerichtsprozessen nachdachte. Man konnte nicht sagen, dass seine Kollegen ihren Beruf mit viel Nachdenklichkeit ausübten. Montaigne erinnerte sich mit Entsetzen daran, wie er einen Richter, von dem er wusste, dass er seine Frau betrog, einen Angeklagten wegen genau desselben Vergehens verurteilen sah, kurz bevor er seiner Mätresse eine Liebesbotschaft schrieb.
Im Laufe seiner beruflichen Laufbahn entwickelte Montaigne ein Gespür dafür, wie Menschen denken, wie man einen Lügner erkennt und wie man an die Wahrheit gelangt. Aus diesem Grund wurde er an den Hof von König Karl IX. berufen und am Ende seiner juristischen Karriere mit dem Orden des Heiligen Michael ausgezeichnet, was praktisch einem französischen Ritterorden gleichkam.
Der Eintritt in die reale Welt ist für alle jungen Menschen ein Schock. Der Übergang von der Welt der Ideen in die Welt der Könige und Strafgerichte war zwangsläufig chaotisch und enttäuschend, aber das Frankreich, in dem Montaigne lebte und herumkam, muss ihm wie ein Land im Umbruch erschienen sein.
Eine Generation zuvor hatte Michelangelo die Sixtinische Kapelle bemalt. Magellan hatte die Welt umsegelt. Kopernikus hatte die Erde aus dem Zentrum des Universums verdrängt. Die Renaissance hatte ihre Blütezeit erreicht und wunderschöne Kunstwerke und weltbewegende Erkenntnisse mit sich gebracht. Jenseits des Atlantiks wurde eine neue Welt entdeckt. Als allmählich Berichte über andere Kulturen nach Europa gelangten, musste die Vorstellung der Menschen von der Größe und Form der Erde überdacht werden.
Neben all den Entdeckungen und Erfindungen kam es jedoch auch zu einer Destabilisierung. Die Stellung der Kirche, die lange Zeit eine einende Kraft gewesen war, wurde durch diese neuen Denkweisen und durch die neuen Technologien, die zu ihrer Verbreitung beitrugen, untergraben. Es herrschte, wie Montaigne es ausdrückte, die verbreitete Überzeugung, dass »die Welt auf dem Kopf steht«. Zum ersten Mal begannen die Menschen, die unterdrückende Rolle der Priester in der Gesellschaft zu kritisieren, und noch allgemeiner fragten sie sich: Warum ist alles so, wie es ist? Und soll es so bleiben?
Martin Luther schlug seine Thesen an ein Kirchentor. Es folgten Reformation und Gegenreformation. Es kam zu Unruhen und Aufständen. Neue Glaubensrichtungen entstanden und kämpften nicht nur um ihr Existenzrecht, sondern auch um die Macht, alle anderen als Ketzer zu vernichten. Inquisition und Verfolgung wüteten. Die Blüte der Renaissance verwelkte auf dem Schafott. Die Toleranz und Akzeptanzbereitschaft der Aufklärung lagen noch Jahrhunderte in der Zukunft. Es war und blieb, wie ein Gelehrter sagte, eine vom Feuer erhellte Welt.
Im Jahr 1562 wurde Montaigne, der zu diesem Zeitpunkt im Dienste Karls IX. stand, Zeuge des Gemetzels bei der Belagerung von Rouen, einem gewaltsamen katholischen Aufstand, bei dem mehr als tausend Menschen in blutigen Auseinandersetzungen aufgrund der religiösen Spannungen, die damals in Frankreich herrschten, ums Leben kamen. Nur wenige Monate zuvor hatte der Herzog von Guise Dutzende französischer Hugenotten massakriert, die in der Stadt Vassey einen Gottesdienst besuchten. Ein Jahr später wurde der Herzog selbst am Straßenrand von einem anderen französischen Adligen erschossen, der ihm aufgelauert hatte. Als der Attentäter gefasst wurde, wurde er gevierteilt – allerdings wurde das Urteil nicht ordnungsgemäß vollstreckt, und als es nach mehreren Versuchen nicht gelang, die Gliedmaßen des Mannes aus den Gelenken zu reißen, wurde er schließlich durch das Schwert des Henkers von seinen Qualen erlöst.
Es folgte eine Vergeltungsmaßnahme nach der anderen, mit dem Höhepunkt in der Bartholomäusnacht, als Zehntausende Menschen getötet und die Leichen in die Seine geworfen wurden.
All dies muss besonders schrecklich für einen Mann gewesen sein, dem intellektuelle Demut beigebracht worden war, der glaubte, dass Ideen hinterfragt werden sollten und dass Menschen zu Fehlern neigen. »Es bedeutet, die eigenen Mutmaßungen sehr ernst zu nehmen«, sagte Montaigne, »jemanden dafür lebendig zu verbrennen.« Doch dies war während seines gesamten Lebens gängige Praxis; Tausende wurden wegen meist imaginärer Verbrechen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Zur Zeit der Inquisition waren mehrere Verwandte von Montaigne auf diese Weise hingerichtet worden, darunter auch ein Ur-Ur-Urgroßvater.
Die französischen Religionskriege dauerten Jahrzehnte und führten zum Tod von über einer Million Menschen, von denen viele auf unbeschreiblich grausame Weise starben.
Wie weit war dies von den idyllischen und behüteten Tagen seiner Jugend entfernt, als sein Vater ihn vor dem Gemetzel und dessen Auswirkungen um ihn herum bewahrt hatte, als seine Lehrer ihn mit einem Lächeln bedachten und all seine Neugier und Exzentrik förderten.
In einer Welt, deren Praxis noch mittelalterlich war, die geprägt war von Furcht und Verfolgung, war es riskant, ein freier oder unkonventioneller Denker zu sein. Ebenso wie sich von der Masse abzuheben. Als neureiche Händler konnten die Montaignes nicht anders als aufzufallen. Die Familie mütterlicherseits bestand aus Marranos, spanischen Juden, die während der Inquisition unter Androhung des Todes zum Christentum konvertiert waren. Seine Onkel väterlicherseits waren hingegen Protestanten.
Wenn Montaigne etwas über Menschen las, die anders waren als er selbst, insbesondere Berichte über die gerade entdeckten Völker der »Neuen Welt«, war er eher neugierig als wertend. »So viele Temperamente, Sekten, Urteile, Meinungen, Gesetze und Bräuche lehren uns, über unsere eigenen vernünftig zu urteilen«, sagte er. Haben die Menschen im Amazonasgebiet denn einander gevierteilt, auf dem Scheiterhaufen verbrannt und sich gegenseitig der Hexerei bezichtigt? Wer waren eigentlich die Barbaren?
Später ließ er sich eine Münze prägen, die er als Erinnerung daran bei sich trug. »Ich urteile zurückhaltend«, stand darauf. Er wollte sich nicht in Fanatismus und Fundamentalismus hineinziehen lassen. Er wollte sich nicht an Streitigkeiten und Konflikten beteiligen. Er wollte nicht dem nachjagen, was alle anderen jagten, und nicht danach streben, andere zu besiegen oder zu übertreffen. Er wollte einen kühlen Kopf bewahren, während der Rest der Welt ihn verlor.
Diese Mäßigung, diese Toleranz brachten ihm nicht so viele Freunde ein, wie er verdient hätte. Er spürte, dass er ein Mann ohne Heimat war. Er wusste, dass er eine Zielscheibe auf dem Rücken trug. »Ich wurde von allen Seiten angegriffen«, beklagte sich Montaigne, »für die Ghibellinen war ich ein Guelfe, für die Guelfen ein Ghibelline.« Wer sich weigerte, Partei zu ergreifen, machte sich doppelt so viele Feinde.
Er muss gemerkt haben, dass er am Ende seiner Karriere im Staatsdienst angelangt war – wie kann jemand öffentliche Angelegenheiten regeln, wenn Mord und Verfolgung von der Gesellschaft akzeptiert werden? Wann war Extremismus zur Normalität geworden? Wann hatte sich die Zukunft jemals so ungewiss angefühlt?
»Nur er weiß«, schrieb der Schriftsteller Stefan Zweig, als er sich in der Frühzeit des aufkommenden Nationalsozialismus den Werken Montaignes zuwandte, »dass es keine mühsamere und schwierigere Aufgabe gibt, als die eigene geistige und moralische Unabhängigkeit zu bewahren und sie durch eine Massenkatastrophe unbeschädigt zu erhalten.« Um sich von dem Wahnsinn um einen herum nicht verrückt machen zu lassen, benötigt man Mut, Disziplin, Gerechtigkeit und Weisheit.
Die Katastrophe ereignete sich für Montaigne Ende der 1560er-Jahre auf unerwartete Weise. Als er auf seinem Anwesen ausritt, stieß er mit voller Geschwindigkeit mit einem anderen Reiter zusammen und wurde zu Boden geworfen. Während seine Freunde seinen gebrochenen, sterbenden Körper ins Haus trugen, spürte Montaigne, wie sein Leben entwich und seine Seele ihm zu entfliehen schien.
Genauso plötzlich kehrte das Leben jedoch zurück, und Montaigne erhielt eine zweite Chance. »Stelle dir vor, du wärst gestorben«, schreibt Mark Aurel in seinen Selbstbetrachtungen. »Nimm nun das, was von deinem Leben übrig ist, und lebe es richtig.«
Mark Aurel ist einer der wenigen Stoiker, die Montaigne nie erwähnt, aber er hatte dieselbe Einstellung. Angesichts dieser Nahtoderfahrung war das Gerichtswesen für ihn nicht mehr so wichtig. Die Angelegenheiten und Rituale des Hofes müssen ihm fast schmerzhaft dumm, sogar grotesk erschienen sein.
Deshalb nahm er seinen Abschied.
»Anno Domini 1571«, so lautete eine die Wand der Familienbibliothek zierende Inschrift in lateinischer Sprache, die Montaigne nach den Methoden seines Vaters gelernt hatte, »hat Michel Montaigne, im Alter von 38 Jahren, an seinem Geburtstag, dem Tag vor den Kalenden des März, weil er bereits seit langem der Knechtschaft der Gerichte und der öffentlichen Ämter überdrüssig war, sich mit noch ungebrochenen Kräften in die Arme der gelehrten Jungfrauen zurückgezogen, um dort in aller Ruhe und Sicherheit die ihm noch verbleibenden Tage seines bereits mehr als halb vergangenen Lebens zu verbringen, falls die Parzen ihm erlauben, so lange an dieser Stätte und diesem altehrwürdigen Rückzugsort zu verweilen, wo er Freiheit, Ruhe und Muße genießen kann.«
Hier nun nahm der Mann, dessen Erziehung so lange gelenkt und überwacht worden war, vollständig die Zügel in die eigene Hand. Sein Vater war verstorben, seine Karriere war zum Stillstand gekommen. Er selbst war dem Tod knapp entronnen. Sein Leben, das er dem Studium anderer Menschen und der Arbeit an den Problemen anderer gewidmet hatte, war nun mehr als zur Hälfte vorbei.
Nun sagte er: »Es reicht«, und machte sich daran, dem antiken Gebot des großen Orakels von Delphi zu folgen: Erkenne dich selbst.
In den ersten Jahren nach dem Unfall schien Montaigne nichts anderes zu tun, als zu lesen. In einem Turm auf dem Anwesen, das ihm sein Vater hinterlassen hatte, ordnete er seine Bücher in langen, umlaufenden Regalen, die sich an die Wände des runden Gebäudes schmiegten. Er konnte seine gesamte Bibliothek auf einen Blick ins Auge fassen, Tausende von Büchern, ein Leben voller Wissen, das sich vor ihm ausbreitete. Montaigne verwandelte den Raum, den sein Vater als Kapelle genutzt hatte, in einen Tempel der Weisheit. »Bücher sind mein Königreich«, sagte er. »Und hier möchte ich als uneingeschränkter Herrscher regieren.«
Wenn er nicht las, dachte er nach, genoss seine eigene Gesellschaft und die Freiheit, seinen Gedanken nachzugehen und seinen Geist in Bewegung zu halten.
»Er läuft im Zimmer herum«, beschreibt ein Biograf Montaigne in seinem Element, »nimmt ein Buch nach dem anderen aus dem Regal, schlägt es an einer zufälligen Stelle auf, liest eine Passage und spricht dann darüber. So geht das eine lange Weile weiter. Er gibt weise, geistreiche, einfühlsame Überlegungen von sich, während das flackernde Kaminfeuer sein feinfühliges, intelligentes Gesicht beleuchtet und der Mond der Gascogne ein Muster auf den Boden wirft, bis die gewohnte Welt sich unter seinen Worten auflöst und ihre Bestandteile im Licht des Kamins wanken und flackern.«
Auf den Regalbrettern stand seine Terenz-Ausgabe aus der Schulzeit. Dort standen die Stoiker. Dort standen Lukrez, Horaz, Vergil und Diogenes Laertius. Dort befand sich sein geliebter Plutarch. »Welchen Nutzen man doch aus der Lektüre der Leben unseres geschätzten Plutarch ziehen kann!«, sagte Montaigne begeistert und lobte diesen antiken Biografen weniger für die Erwähnung des »Datums des Untergangs von Karthago …, als für die Beschreibung des Verhaltens Hannibals und Scipios …, weniger für den Namen des Ortes, an dem Marcellus starb, als vielmehr für die Erklärung, dass sein Tod ihn der Aufgabe unwürdig erscheinen ließ«.
Montaigne hatte sich die Mühe gemacht, einige seiner Lieblingszitate in die Balken der Decke seines Arbeitszimmers direkt über den Büchern zu schnitzen. Viele stammten von Sextus Empiricus, dem griechischen Philosophen. ΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΩ (Ich verstehe nicht). ΕΠΕΧΩ (Ich halte inne). ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ (Ich untersuche). Von Terenz: »Ich bin ein Mensch, und nichts Menschliches ist mir fremd.« Von Sokrates: »Die Gottlosigkeit folgt dem Stolz wie ein Hund.« Von Plinius: »Das einzig Sichere ist, dass nichts sicher ist.« Und natürlich von Epiktet: »Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinungen darüber.«
Ist es daher verwunderlich, dass Montaigne, als er sich zum Schreiben hinsetzte, mit einer Frage begann und nicht mit einer Behauptung? »Que sais-je?« Was weiß ich? Was wusste Montaigne über sich selbst? Was hatte er durch seine einzigartige Erziehung gelernt? Aus seinen Büchern? Von seinen bäuerlichen Paten? Von seinem Vater? Von seinen Lehrern? Was wusste er wirklich?
Er zog sich zurück von der wahnwitzigen Gewalt seiner Zeit und beschloss, die Conditio humana in Form von freien Reflexionen zu erkunden, von denen einige nur eine Seite lang waren, andere hingegen fast die Länge eines kleinen Buches hatten. Diese Gattung sollte fortan Essay heißen, von französisch essai, Versuch.
Montaigne schrieb über viele Themen – Furcht, Müßiggang, die liebevolle Zuneigung der Eltern für ihre Kinder, Grausamkeit, Erfahrung. Er schrieb auch über seine Lieblingsautoren und die Kannibalen, von deren Existenz in der Neuen Welt er gehört hatte. Aber die Gegenstände dieser Essays waren höchstens ein Ausgangspunkt – ein Vorwand, um alles zu erforschen und zu betrachten, was ihm interessant erschien. Und am Ende kamen all diese Überlegungen wieder auf die Hauptfigur seiner Suche zurück, auf ihn selbst. »Ich möchte lieber ein Experte für mich sein als für Cicero«, sagte er.
»Er folgt seinem Thema wie ein junger Hund einer Kutsche, der dabei Hunderte von Malen die Straße verlässt, um die Umgebung zu erkunden«, schreibt ein Biograf. »Sein leichtfüßiger Geist ist unbeschwert und locker, aber dennoch ernsthaft. Er schält die Schale der Dinge ab und riecht genüsslich an der Frucht. … Er ist ein Erwäger, ein Prüfer, ein Skeptiker. Er durchforstet die Überzeugungen, Meinungen und Bräuche der Menschen und greift einen Gedanken auf, um ihn dann, als würde er eine Artischocke schälen, Stück für Stück von den Schichten der Gewohnheiten, Vorurteile, der Zeit und des Ortes zu befreien. Er verteidigt zunächst die Meinung einer bestimmten Denkschule, lobt und bewundert sie, und dann die gegensätzliche Meinung einer anderen Schule, lobt und bewundert auch diese. Auf seiner inneren Waage wägt er Idee gegen Idee ab, Mensch gegen Mensch, Brauch gegen Brauch.«
Dass er in eine so chaotische Welt geboren wurde, stellte für Montaigne eine Chance dar. Zu lange war die Kirche die alles überragende Autorität gewesen. Immer noch lag zu viel Wissen in Klöstern von der Welt abgesondert, unzugänglich und nicht verwendbar. Jahrhundertelang war dem Einzelnen gesagt worden, er sei unbedeutend. Wahrheiten, die lange Zeit als unumstößlich galten, wurden von Kolumbus und Kopernikus als lächerlich falsch entlarvt. Grundlegende Fragen, die lange Zeit nicht gestellt worden waren und dadurch unbeantwortet blieben, brachen sich nun Bahn. Allein die Tatsache, dass noch nie jemand zuvor einen Essay geschrieben hatte, ist ein Beleg dafür!
Als er eines Tages seine Katze beobachtete und sie mit einem Spielzeug beschäftigte, hielt er inne und fragte sich: »Wer spielt hier eigentlich mit wem?« Seine Essays sind voller Tiergeschichten, die verdeutlichen sollen, dass es da draußen eine riesige, wunderschöne Welt gibt, die wir kaum erleben und uns in manchen Fällen nicht einmal vorstellen können. Was dachte wohl seine Katze, als er mit ihr spielte? Wer war er für diese Katze? Er ist ebenso verblüfft von seiner eigenen Anatomie, seinem Sexualtrieb, seinen Bedürfnissen. Er möchte einfach alles wissen.
All dies war neu, innovativ und sogar revolutionär. Die Überzeugung, dass das Lernen und die Wahrheit wichtig waren, dass Montaigne – dass das Individuum – ein Gegenstand war, der es wert war, erforscht zu werden. Aber nur weil einiges davon einfach war und Spaß machte, hieß das nicht, dass die Antworten leicht zu finden waren. Es sei ein »dorniges Unterfangen«, sagte er, »einem so unsteten Pfad wie dem des Geistes zu folgen und in die dunklen Tiefen seiner inneren Falten vorzudringen«. Er wollte den Lesern klarmachen, dass es schwieriger war, als es aussah.
Fast ein Jahrzehnt lang arbeitete Montaigne an diesen Essays, die insgesamt mehr als tausend Seiten umfassten. Er schrieb sie in erster Linie für sich selbst und schuf dabei eine ganz andere Art der »Selbstverbesserung«. Die Frage war, ob das jemanden interessieren würde. Während in Frankreich ein Bürgerkrieg tobten und Menschen um religiöse Doktrinen stritten, führte er einen Krieg gegen seine eigene Unwissenheit und erforschte die Dinge, die den Menschen merkwürdig und wunderbar machen. Dies sollte sein bleibender Beitrag zur Menschheit sein – er spann das Garn, mit dem Künstler, Journalisten, Sozialwissenschaftler, Psychologen und Memorialisten seitdem weiter weben.
Im Jahr 1580 veröffentlichte er seine ersten Essays, die schnell ihren Weg in die Häuser fast aller gebildeten Herren von Stand in Frankreich fanden. König Heinrich III. besaß ein Exemplar. Francis Bacon las sie ebenfalls und war begeistert. Als Montaigne 1603 ins Englische übersetzt wurde, erwarb ein autodidaktischer Dramatiker (der ebenso Plutarch schätzte) namens William Shakespeare ein Exemplar – tatsächlich finden sich deutliche Anklänge an eine Passage aus Montaigne in Der Sturm wieder, und auch einer von Shakespeares berühmtesten Versen könnte von Montaigne inspiriert sein: »Dies vor allem: Sei dir selbst treu.« Die Bücher, die er ausschließlich für sich selbst geschrieben hatte, erwiesen sich als für jedermann geeignet und wurden zu dem, was wir heute als Bestseller bezeichnen würden (und sind es bis heute geblieben).
Montaigne feierte die Fertigstellung seines Werks und dessen Erfolg mit etwas, das er seit vielen Jahren nicht mehr getan hatte: Reisen. Vordergründig musste er geschäftlich von Frankreich nach Italien, aber hauptsächlich nutzte er diese Reise als Gelegenheit, neue Orte zu sehen und neue Erfahrungen zu sammeln, und dabei lernte er ständig dazu, schrieb und nahm alles in sich auf.
Er erkundete alte Ruinen, saß lesend unter einem Baum, stand in den Straßen Roms und sprach laut zu Cäsar, Cato und Cicero, »ihre großen Namen zwischen meinen Zähnen murmelnd und sie in meinen Ohren widerhallen lassend«. Er saß in einem Gasthaus, seine Essays vor sich ausgebreitet, begeistert von etwas, das er geschrieben hatte, oder, wenn ihm etwas peinlich war, es ohne Zögern ändernd. Wenn er einen Einfall hatte, diktierte er ihn seinem Pagen, während sie beide weiterritten. Er kaufte neue Bücher und fügte seinen Satteltaschen weitere schwere Bände hinzu. »Bücher«, sagte er, »sind die beste Ausrüstung, die ein Mensch auf seiner Lebensreise mitnehmen kann.«
Letztendlich konnte er sich aber nicht vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. Kein weiser Mann kann das. Er beriet das Parlament in Fragen der Festungsbaukunst. Er wurde von Heinrich von Navarra, dem künftigen König von Frankreich, zum Kammerherrn ernannt. Er empfing bedeutende Gäste zum Abendessen. Er unternahm diplomatische Missionen. Er stand in Briefkontakt mit den führenden Köpfen seiner Zeit. Er wurde zum Bürgermeister von Bordeaux, einer mittlerweile großen und bedeutenden Stadt, gewählt und anschließend wiedergewählt. Schließlich ereilte ihn die von ihm gefürchtete Verfolgung, und er wurde in die Bastille geworfen, aber nun rettete ihn sein Ruhm, und er wurde von Katharina von Medici befreit. Während alledem las er weiter, schrieb weiter und überarbeitete seine Essays. Sogar in den letzten Monaten seines Lebens beriet er noch König Heinrich III. und versuchte, ihn zu einem Philosophenkönig zu machen.
Er wäre gerne Ehrenbürger von Rom geworden, aber tatsächlich war er zum Weltbürger geworden. Als Freund seiner selbst und aller Menschen lebte er außerhalb von Zeit und Raum – er hielt sich unter »den würdigsten Köpfen, die in den besten Zeiten gelebt hatten« auf und unterhielt sich mit ihnen – und das seit seiner Kindheit.
Er hinterließ keine Spuren in der Politik, nicht auf dem Schlachtfeld, nicht einmal in Form von wissenschaftlichen Durchbrüchen oder Werken der Gelehrsamkeit. Stattdessen hielt er an dem pädagogischen Experiment fest, das auf seine Kindheit zurückging, auf die Vision seines Vaters für seinen Sohn und auf das Bestreben des Sohnes, sich all der Erwartungen und Anstrengungen würdig zu erweisen, die seine Lehrer ihm gewidmet hatten. Er hatte einen unbekannten und nie betretenen Kontinent erkundet – sich selbst.
Er hatte mehr Fragen gestellt als beantwortet, mehr gelesen als geschrieben, mehr gesehen als verstanden. Er versuchte, sich selbst und seine Zeit zu relativieren. »Es wäre schon viel«, schrieb er, »wenn sich die Menschen in hundert Jahren noch ungefähr daran erinnern würden, dass es zu unserer Zeit Bürgerkriege in Frankreich gab.« Er wusste, dass er größtenteils in Vergessenheit geraten würde. Er weigerte sich zu verzweifeln. Er lehnte es ab, die Menschheit abzuschreiben. Und darin war er ein wahrhaft weiser Mann.
Was wissen wir also nun über Montaigne, was haben wir aus seinem Leben gelernt? Zunächst einmal, dass Bildung etwas ist, das niemals endet. Wir wissen, dass Bildung, auch wenn sie anfangs fremdbestimmt ist, letztendlich wieder von unserer eigenen Entscheidung abhängt – wir müssen uns selbst unterrichten, wenn wir etwas lernen wollen. Von Montaigne haben wir erfahren, dass das Ego der Feind der Weisheit ist, dass Selbstüberschätzung dem Wissenserwerb im Wege steht. An seinem Beispiel lernen wir, dass wir stets neugierig bleiben müssen, alles unaufhörlich hinterfragend, immer offen und bereit, etwas Neues zu lernen. Und schließlich haben wir verstanden, dass wir für das Leben lernen, dass die seltenste und kostbarste aller Errungenschaften die Selbsterkenntnis ist.
Seine Erziehung begann mit einer neuen Vision und basierte auf unkonventionellen Methoden; ihre einzigartigste Charakteristik bestand darin, dass sie niemals endete. Als junger Mann erklärte er: »Anfangs habe ich gelernt, um damit anzugeben; später, um ein wenig weiser zu werden; heute tue ich es zum Vergnügen, niemals um unmittelbaren Nutzen daraus zu schlagen.«
Er lernte weiter bis zu seinem Tod, und die Fragen, die er sich stellte, seine von ihm so eloquent beschriebene innere Reise, leben in jedem von uns bis heute weiter.
Vorausgesetzt, wir sind mutig und diszipliniert genug, um sein spirituelles Vermächtnis zu empfangen.
Sprechen Sie mit den Toten
Er war aus Phönizien gekommen. Es war eine lange Reise gewesen, von Hafen zu Hafen über das Mittelmeer, wobei er mit Purpurfarbstoff handelte, zum Färben der Umhänge, die die reichsten Griechen trugen.
Aber heute war der junge Zenon nicht geschäftlich unterwegs.