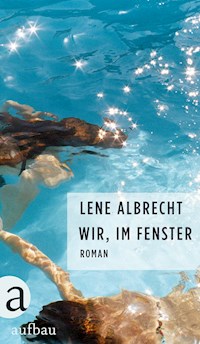18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf den Spuren des deutschen Kolonialismus bis in die eigene Familiengeschichte Eine junge Frau reist nach Togo, im Gepäck ein Aufnahmegerät und den Auftrag, zu Flucht- und Migrationsursachen zu forschen. Vor Ort trifft sie Menschen, die ihr von sich erzählen: eine Schneiderin, die ihrer Abschiebung aus Deutschland zuvorkam, einen jungen Mann, der mit seinem Dienst im Waisenhaus hadert, und den Bibliothekar, der sie aufmerksam macht auf die Europäerinnen und Europäer, die wie Gespenster das Land bevölkern. Immer mehr zweifelt sie ihre Rolle im Land an und beginnt, sich mit ihrer eigenen Familie auseinanderzusetzen: Warum ging ein Onkel nach Nigeria und wurde dort vermögend? Warum brachte ihr Ur-Urgroßvater nur eines seiner drei Kinder aus Panama nach Deutschland? Warum weiß sie so wenig über ihre Urgroßmutter Benedetta? Lene Albrecht erzählt in ihrem Roman »Weiße Flecken« von der Suche nach ihrer Ur-Großmutter und begegnet dabei der eigenen Unsicherheit, der eigenen Verantwortung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lene Albrecht
Weiße Flecken
Roman
Über dieses Buch
Über meine Urgroßmutter wusste ich lange nichts. Erst als mir das Foto in die Hände fiel, erinnerte ich mich wieder an Bruchstücke und fragte mich fortan, wie ich sie hatte vergessen können. Die Geschichte von einem Kind, das um 1900 mit seinem deutschen Vater von Panama nach Hamburg übersetzt. Mutter und Geschwister bleiben zurück.
Eine junge Frau reist nach Togo, im Gepäck ein Aufnahmegerät und den Auftrag, zu Flucht- und Migrationsursachen zu forschen. Vor Ort trifft sie Menschen und fragt nach ihren Geschichten: eine Schneiderin, die ihrer Abschiebung aus Deutschland zuvorkam, einen jungen Mann, der mit seinem Dienst im Waisenhaus hadert, und den Bibliothekar, der sie aufmerksam macht auf die Europäer*innen, die wie Gespenster das Land bevölkern. Immer mehr zweifelt sie ihre eigene Rolle im Land an und beginnt, sich kritisch mit der eigenen Verstrickung und den Erzählungen ihrer Familie auseinanderzusetzen.
Ein kaleidoskopischer Roman über familiäre Schuld, persönliche Scham und die Frage danach, wie wir unseren Kindern die Welt erzählen wollen.
Warum er ausgerechnet sie auswählte, ist ungewiss, aber es hieß, sagte meine Mutter, als ich sie danach fragte, dass meine Urgroßmutter sein Lieblingskind war - und, das fügte sie nach einer Pause hinzu, für ein Kind afro-panamaischer Abstammung ungewöhnlich helle Haut hatte.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Lene Albrecht, geboren 1986 in Berlin, studierte Kulturwissenschaften in Frankfurt (Oder) und am Literaturinstitut Leipzig. 2019 erschien ihr Debütroman »Wir, im Fenster«. Für die Arbeit an »Weiße Flecken« erhielt sie das Recherchestipendium des Berliner Senats. Als Mitglied des Kollektivs WRITING WITH CARE/RAGE organisierte sie 2021 eine gleichnamige Konferenz zur Frage nach der Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Autor*innenschaft. Sie arbeitet als freie Lektorin, Journalistin und Moderatorin u. a. für die Redaktion Radiokunst von »Deutschlandfunk Kultur«.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Gefördert durch die Senatsverwaltung für Gesellschaftlichen Zusammenhalt
Covergestaltung: KOSMOS - Büro für visuelle Kommunikation
Coverabbildung: Shaylin Wallace
ISBN 978-3-10-491804-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
EINS
GESPENSTER
CRUSOE
TOUT VA BIEN
EUROPÄISCHER FRIEDHOF
MOTIVE
FREIWILLIG
AMINA
AUSSICHT
ZIEGEN
DISZIPLIN
OPFERFEST
GEBURTSTAG
ZWEI
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
DREI
Im Internet stolperte [...]
An einem Donnerstagmorgen [...]
In meinem Kopf [...]
Seit einigen Wochen [...]
Die traurige Witzfigur [...]
Einer meiner ersten [...]
Gleich zu Beginn [...]
Vielleicht solltest du [...]
Ein paar Wochen [...]
Die Adresse aus [...]
Um meine Mitgliedschaft [...]
EPILOG
Anhang
Dank
Für Dénis, Fousseni und Roos
EINS
GESPENSTER
Nur einige wenige Tage nach meiner Ankunft in Sokodé machte mich der Bibliothekar auf die Existenz eines Mannes namens Le Blanc aufmerksam, den ich bis zu meiner überstürzten Abreise im kältesten Monat überhaupt, während des sogenannten afrikanischen Winters, nie wirklich zu Gesicht bekommen sollte. Wir standen dicht nebeneinander auf dem Balkon im ersten Stock. Der Bibliothekar hatte die Unterarme auf dem Geländer abgestützt. Beide sahen wir geradeaus. Gegenüber der Bibliothek duckte sich ein fast spiegelgleiches Gebäude in den schmalen Schatten des Gerichts. Genau dort, erzählte der Bibliothekar und zeigte mit dem ausgetreckten Arm auf die andere Straßenseite, lebte er.
Le Blanc, also den Weißen, kenne jeder, aber niemand, den der Bibliothekar kannte, sei ihm je persönlich begegnet. Das liege vor allem daran, erklärte er, dass er nur nachts das Haus verlasse. Man erzähle sich auch, er trage ein langes weißes Gewand, welches er vorn mit einem Gürtel zusammenknote.
So wie die Meister der Martial Arts, sagte er und deutete mit den Armen eine Kampfbewegung an.
Seit diesem Tag stellte ich manchmal aus dem Augenwinkel eine Bewegung dort drüben fest. Ein Flattern. Eine kleine, unkontrollierte Hast. Aber jedes Mal, wenn ich die Aufmerksamkeit darauf richtete, lag alles still, wie in diesem Moment auch; das flache Dach, der Garten mit seinen ordentlich beschnittenen Hecken und den relativ hohen Mauern, die das Grundstück von der Straße her abschirmten.
Er hat graues, schütteres Haar, beschrieb ihn der Bibliothekar, dabei ist er weder alt noch jung, nur einsam. Das ist es im Wesentlichen, was man sich über ihn erzählt. Niemand weiß, warum er nach Togo gekommen und dann geblieben ist.
Ich versuchte, mir den Mann vorzustellen, aber alles, was meine Einbildungskraft zustande brachte, war eine Art Gespenst, und dafür war ich definitiv zu alt.
Auf jeden Fall ist er wohlhabend, schob der Bibliothekar nach einer Weile hinterher, so viel steht fest.
Ich sah ihm fragend ins glatte Gesicht.
Alle Weißen, die hier sind. Sie können sich den Flug leisten.
Er machte eine Pause, sein Blick ruhte prüfend auf mir, wie um zu sehen, ob ich wirklich so unbedarft war oder nur so tat. Der kostet doch ein Vermögen, oder etwa nicht?
Er kniff die Augen zusammen.
Ich rauchte und schwieg.
Unter der Terrasse, von der man eine gute Sicht auf das Verwaltungsviertel der kleinen westafrikanischen Stadt hatte, liefen lärmende Pulke von Schüler*innen in Richtung des Gymnasiums den steilen Hügel hinauf. Manche von ihnen nutzten bunte aufgespannte Regenschirme, um sich vor der Strahlkraft der Sonne zu schützen, die um diese frühe Uhrzeit schon massiv war. Seit Tagen war es heiß und still, sehr trocken, der Himmel hatte fast alle Farbe verloren, und ich wusste, es konnte nicht ewig so bleiben.
Eine knappe Woche wohnte ich jetzt hier. Nur einmal hatte ich seither das Computerkabinett im Erdgeschoss betreten, in dem tagsüber Fortbildungen stattfanden. Die meiste Zeit verbrachte ich oben im Lesesaal mit den dunkel gebeizten Bücherregalen, dem größten Raum im ersten Stock. Daneben gab es eine kleine Küche und zwei weitere Räume, die normalerweise von den Praktikant*innen bewohnt wurden. Für den Rest der Zeit standen die Zimmer leer.
Die Bibliothek gehörte einer Organisation, die zwar lokal agierte, aber – wie die meisten der NGOs hier – aus Deutschland oder einem anderen europäischen Land finanziert wurde. Wie mir der Bibliothekar erklärt hatte, war es eine Zeitlang lukrativer gewesen, eine Organisation zu gründen und um Spenden zu werben, als in ein eigenes Geschäft zu investieren, weshalb sie wie Pilze aus dem Boden geschossen waren. Er hatte mit den Schultern gezuckt. Nur die Gebäude mit rostfleckigen, großformatigen Schildern zeugten noch von ihrer ehemaligen Existenz. Halb verfallen wurden sie für dubiose Geschäfte genutzt.
Dieses Haus war anders. Gut in Schuss. An der Spitze stand eine wohlhabende Familie aus München, die ihr Vermögen gestiftet hatte und regelmäßig Geld fließen ließ, jedoch immer streng kontrollierte, wohin.
Hinter dem Haus verbrannte jemand Müll. Der scharfe Geruch zog als dichter, grauer Rauch über unsere Köpfe, wo er sich langsam in winzigen Partikeln verteilte, bis er schließlich unsichtbar wurde. Ich drückte meine aufgerauchte Zigarette in die Schale einer alten Kokosnuss. Der improvisierte und übervolle Aschenbecher war eins der Dinge, die meine Vorgänger*innen hier zurückgelassen hatten. Unterm Schrank hatte ich außerdem einen zusammengefalteten Zettel gefunden, auf dem Mailadressen handschriftlich notiert waren. Daneben die Namen der Menschen, die auf eine Nachricht hofften, die sie nun wahrscheinlich niemals erreichen würde. In der hintersten Ecke des Schranks hatte ich ein hellblaues, etwas staubiges Hemd aus Baumwolle gefunden. An Brust und Schultern spannte es ziemlich, dennoch trug ich es fast jeden Abend, wenn es dunkel wurde und die gefräßigen Moskitos aufzogen.
Langsam geriet die Stadt unter uns in Bewegung.
Menschen überquerten die Kreuzung. Jemand klatschte in die Hände. Es klang mutig und froh. Dabei fiel mein Blick auf einen Mann mit gesenktem Kopf und auf dem Rücken verbundenen Händen, der von zwei Uniformierten in den Seiteneingang des Gerichtsgebäudes geführt wurde. Beides – der Ton des Klatschens und das Bild des Gefangenen – schien nichts miteinander zu tun zu haben und gleichzeitig ab diesem Moment untrennbar miteinander verbunden zu sein. Von der Hauptstraße drang beständig das Geräusch der fahrenden Lastwagen, die auf ihrem Weg in den Norden waren. Dazwischen klangen die Laute der Ziegen erschütternd menschlich.
Ich muss jetzt an die Arbeit, der Bibliothekar deutete mit dem Kopf zur Tür. Dann schlurfte er hinein, seine Lederslipper waren an der Ferse heruntergetreten, und er trug einen dieser grob gestrickten Pullunder, die ich bisher nur an älteren Männern gesehen hatte, wobei mir schlagartig bewusst wurde, dass auch der Bibliothekar schon bald zu dieser Gruppe zählen würde. Er war, wie man sagt, in die Jahre gekommen, selbst wenn er noch kein einziges graues Haar hatte. Seine Gesichtszüge waren weich und freundlich, anders als die Gesichter älterer Männer, die ich kannte, in die mit der Zeit etwas Unnachgiebiges einzog.
Gleich würde die Bibliothek wie jeden Wochentag (den Sonntag ausgenommen), ihre Türen für die Schüler*innen öffnen, die gerne herkamen, um an einem der großen Tische zu lesen, ihre Schulaufgaben zu machen oder in den Sportmagazinen zu blättern. Ihre kleinen Gesichter waren hoch konzentriert, niemand musste sie zur Ruhe ermahnen.
Ich blieb, wo ich war, und strich mir die vom Duschen nassen Haare zurück. Erst in diesem Moment bemerkte ich die Schüler*innen, die sich unten am Fuß der Treppe gesammelt hatten, und die jetzt zu mir hochstarrten wie auf eine Bühne. Unwillkürlich drehte ich mich um, suchte nach etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt haben könnte. Aber da war nur die Tafel. Eine ebene Fläche, gerade frisch gewischt. Das Nasse zeichnete sich noch als eine dunkelgraue Wolke darauf ab.
Ich war es gewohnt, im Hintergrund zu bleiben; die unauffällige Person, die auf einem Foto am hinteren Bildrand steht und so aussieht, als wäre sie nur ganz zufällig Teil der Komposition.
Ein Schüler, der wie die gesamte Gruppe khakifarbene Schuluniform trug, zeigte jetzt auf mich. Ein Mädchen mit kurzen Haaren lachte, Hand vorm Mund, und ich hob den Arm zum Gruß, schwenkte ihn, unsicher darüber, was man jetzt von mir erwartete.
CRUSOE
Auf dem Langstreckenflug von Paris nach Lomé hatte ich neben einem Fotografen gesessen. Er hatte dunkles, kurzes Haar, aus dem ein paar zinngraue Haare hervorstanden wie lose Enden einer Drahtspule. Offensichtlich war er an einer Unterhaltung interessiert, immer wieder räusperte er sich, sortierte seine viel zu langen Gliedmaßen neu, nur um sich dann für seine Unruhe zu entschuldigen. Ich war schläfrig. Beim Umsteigen in Paris hatte ich mich verirrt und war schließlich in ein unterirdisches System aus Parkdecks geraten. Verzweifelt hatte ich zuvor eine Putzkraft gefragt, wie ich am schnellsten zum Terminal gelangen würde, weil es mir nicht gelungen war, die komplexe Karte des Flughafengebäudes auch nur annähernd zu entschlüsseln.
Kommen Sie, sagte die Putzkraft entschlossen.
Wir stiegen in einen Fahrstuhl, fuhren nach unten. Der Wagen, ausgestattet mit einem Mopp, diversen Reinigungsmitteln und Eimern, verströmte einen intensiven, chemischen Geruch.
Ich lächelte verlegen, die Putzkraft lächelte nicht.
Hier entlang, sagte sie. Immer geradeaus. Sie deutete mit der Hand den Weg, blieb selbst hinter mir zurück. Ich lief eine Weile, aber fand keinen Ausgang. Von irgendwoher hörte ich das Schleifen der Rollen des Putzwagens auf dem Beton. Ein rhythmisches Klappern hallte ohne Richtung immerfort. Die Decke hing niedrig, die Wände warfen meine Schritte zurück. Währenddessen stellte ich mir das Treiben über mir vor. Die Massen, die an Schaltern abgefertigt, durchleuchtet und anhand ihrer Pässe und ihrer Körper auf Bedrohlichkeit hin eingeschätzt wurden. Menschen, die aufwendig Grenzen passierten, während ich sie hier unten fast unbemerkt durchschritt.
Plötzlich trat alles klar als Fiktion hervor.
Ich versuchte, mir die Vorgänge genauestens zu vergegenwärtigen: Die französischen Uniformierten mit ihren Knüppeln und Gewehren, Hand am Schaft, die Flugbegleiterinnen in Bleistiftröcken und mit hohen Pfennigabsätzen, die in diffusen Formationen durch die Hallen zogen. Menschen, die in Gruppen durch enge Gänge getrieben wurden, allein dafür entworfen, ihre Kauflust zu steigern. Stimulation, Pappaufsteller, bewegte Bilder, Bänke aus Metall, verglaste Wände; und draußen flogen die Schatten der startenden Flugzeuge über den Asphalt.
Es war zu warm für Ende September.
Im Gehen warf ich einen Blick auf mein Handy. Kein Empfang hier unten. Dafür zeigte es eine neue Nachricht. Neda wünschte mir einen guten Flug und in einem etwas kryptischen Halbsatz, dass ich fündig würde. Mein Herz überschlug sich. Ich hörte ihre Stimme:
Wovor hast du eigentlich Angst?
Neda hätte nicht eher aufgegeben zu fragen, ehe ich gesagt hätte, dass die Putzkraft ein Mann war und Schwarz und ich mich dafür schämte, beides überhaupt registriert zu haben.
Bei einer unserer ersten Begegnungen, es musste vor oder nach einem Seminar im ersten Semester Sozialanthropologie während einer Raucherpause auf der Steintreppe gewesen sein, hatte sie mir diese Geschichte erzählt. Sie kursierte vor allem in den Achtzigern. Eine ältere, alleinstehende Frau reist nach New York. Angesichts der steigenden Kriminalität ist sie besorgt um ihre Sicherheit. Aus diesem Grund mietet sie sich in eines der nobelsten Hotels der Stadt ein, das eigentlich weit über ihrem Budget liegt. Nach einem ausgedehnten Stadtbummel steigt sie eines Abends in den Lift. Kurz bevor sich die Türen schließen, springt ein Schwarzer Mann mit Sonnenbrille hinein. An seiner Hand führt er einen großen Hund an der Leine, eine Dogge. Kaum hat sich der Lift in Bewegung gesetzt, murmelt der Mann hinter seiner Sonnenbrille: Leg dich hin. Die Frau tut, was er sagt; starr vor Angst und dem, was sie nun erwartet. Der Mann aber tritt irritiert einen Schritt zurück, weg von ihr; eigentlich, sagt er nüchtern, meinte ich ja den Hund.
Neda hatte über die Geschichte gelacht, auf ihre Art, trocken. Als würde sie über den Dingen stehen. Trotzdem traf es sie, jeden Tag, aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie lachte darüber, wie sich der Rassismus einer weißen Frau selbst entlarvt.
Weiße Frauen, sagte sie, sind Teil des Problems, gerade weil sie das oft nicht wahrhaben wollen.
In einer Version der Geschichte war der Mann Lionel Richie, in einer anderen ein lange vergessener Soap-TV-Star, der der Frau anschließend einen Strauß teurer Lilien aufs Zimmer schickte. Weil sie sich so sehr erschreckt hatte, sagte Neda. Seitdem waren dreißig Jahre vergangen.
Ich verlangsamte.
Die Luft hier unten war kühl und staubig, das Licht fiel weiß von oben herunter, vollkommen künstlich. Ich schwitzte zwischen den Schulterblättern, unter den Achseln. In meinem Rücken immer noch die Schritte, jetzt entfernt. Schließlich gelangte ich in den richtigen Gebäudeteil, den ich an einem großen, nüchternen Buchstaben erkannte. Endlich. Dort stieg ich in den Fahrstuhl und war, sobald sich die Türen oben öffneten, auf einmal wieder mitten im Gedränge.
Jetzt, im Flugzeug sitzend, roch ich den kalt gewordenen Schweiß, unter dem meine Haut seltsam spannte. Obwohl mein Körper müde war, fühlte ich mich erfrischt und klar, wie nach einer eiskalten Dusche. Ich las, und den größten Teil der Strecke konnte ich den Fotografen neben mir auf Abstand halten. Aber er benahm sich, als hätte er ein Recht darauf zu erfahren, wer ich war, und irgendwann wurde es mühsamer, seinem Blick auszuweichen, als ihm einfach zu begegnen. Rechts von mir saß eine zarte, ältere Frau, die mit halb geschlossenen Lidern einen mir unbekannten Film auf dem kleinen Bildschirm verfolgte. Die blaue Decke mit dem eingeprägten goldenen Logo der Fluggesellschaft hatte sie bis unters Kinn gezogen. Immer wieder rutschte der Kopf auf die Brust, dann rappelte sie sich auf. Ich beneidete sie um diesen Moment, in dem das Bewusstsein aus dem Körper weicht und alles leicht und schwer zugleich wird. Ein bodenloser Moment, ein Sturz ohne Aufprall.
Der Fotograf warf mir einen Blick zu, offenbar, um zwischen uns eine Art Bündnis herzustellen, wobei die einzige Gemeinsamkeit darin bestand, dass wir beide wach waren, während die dritte Person mehr oder weniger schlief. Schließlich fragte der Fotograf, was ich las. Ich schlug resigniert mein Buch zu. Er hatte ein junges Gesicht, nur die Augen wirkten müde. Als wären sie zu schnell gealtert für den Rest. Er lächelte.
Robinson Crusoe, im Ernst?
Kennen Sie es?
Wer nicht. Er lachte, als hätte ich eine ganz und gar abwegige Frage gestellt, hielt dann aber inne; ich meine, sagte er, jede*r kennt doch Robinson Crusoe, oder nicht?
Es ist interessant, sagte ich, wie viele Menschen der Meinung sind, das Buch zu kennen, ohne es jemals gelesen zu haben.
Er verschränkte die Arme vor der Brust, klemmte die Finger unter seine Achseln.
Ich lese prinzipiell nicht viel, sagte er. Literatur interessiert mich nicht. Wenn ich ein Buch in die Hand nehme, dann ein Sachbuch. Oder es muss unterhaltsam sein, verstehen Sie, sehr unterhaltsam; ist es das denn?
Im Gegenteil, harte Arbeit, sagte ich. Wir lächelten beide, jetzt wieder versöhnt. Unter anderem war ich davon überrascht, erzählte ich, dass der Teil, in dem Crusoe auf der Insel lebt, nur sehr wenig Raum einnimmt. Das Buch war bei Erscheinen 1719 ein richtiger Kassenschlager gewesen. Auf den ersten Teil folgte schnell ein zweiter und dann sogar ein dritter. Bevor ich das Buch begonnen hatte zu lesen, war ich auf einen Artikel gestoßen, der über die reale Vorlage spekulierte; einen Seemann, der allein auf einer Insel ausgesetzt worden war und wie durch ein Wunder überlebt hatte. Defoe, der eigentlich als Foe geboren worden war, mit dem Präfix den Anschein adliger Herkunft erwecken wollte, hatte den Seemann wohl getroffen, zumindest von ihm gelesen. Alle Zeitungen berichteten seinerzeit von dem Schotten, der ganz allein vier Jahre und vier Monate auf einer verlassenen Insel überlebt hatte. Abgesehen von dem Rahmen jedoch glich der Schotte Crusoe in nichts. Es gab keinen Freitag, keine Kannibal*innen, weit und breit niemanden, die oder den er hätte christlich erziehen können, außer sich selbst, denn er war ursprünglich nur auf dem Schiff gelandet, weil er an Land in Konflikt mit dem Gesetz gekommen war. Die Reise war im eigentlichen Sinn eine Flucht gewesen. Er soll sich geweigert haben, den Weg fortzusetzen, weil das Boot leck war, und er vermutete, es würde bald untergehen. Der Kapitän war anderer Meinung, und so sah der Schotte sich gezwungen, zwischen zwei Szenarien zu wählen; ging er an Bord, würde er ertrinken, blieb er an Ort und Stelle, würde er höchstwahrscheinlich verhungern.
Der Legende nach, sagte ich, soll der Seemann dem ablegenden Schiff hinterhergerufen haben, er habe es sich doch anders überlegt.
Der Fotograf gluckste. Vermutlich stellte er sich vor, was alle sich an dieser Stelle ausmalten; wie der von Angst entstellte Schotte dem Schiff hinterherlief, in die Fluten hinein, dort stand, bis zum Hals drin in der Scheiße, bis das Schiff am Horizont verschwand. Ein Verschwinden, das auch sein eigenes Verschwinden meinte. Unweigerlich stellte sich Komik ein, wo Verzweiflung herrschte.
Eine kluge Entscheidung. Kurz darauf erlitt die Besatzung tatsächlich Schiffbruch. Sein Überleben hatte der Seemann aber nicht der Vorahnung, sondern den Ziegen zu verdanken, die die ersten spanischen Siedler*innen als eine Art Proviantreserve auf der Insel zurückgelassen hatten. Die Juan-Fernández-Ziege, wie sie heute genannt wird, war eine Art verwilderte Hausziege, die sich so rasant vermehrt hatte, dass binnen kürzester Zeit der untere Teil der Insel komplett kahl gefressen war. Bis heute war das komplette Ökosystem zerstört. Vor nicht allzu langer Zeit, so hatte ich gelesen, war auf jeden Ziegenschwanz eine Tötungsprämie von sechzig Cent ausgesetzt worden; heute waren die Tiere deshalb überaus scheu. Außerdem überwucherte die von den Europäern eingeschleppte wilde Brombeere die Insel und nahm der einheimischen Vegetation das Licht.
Nachts nagten die Ratten an dem Seemann, sagte ich, er wurde krank. Um nicht den Verstand zu verlieren, erzählte er später den Journalisten, habe er sich selbst Kirchenlieder vorgesungen. Die Freibeuter, die ihn schließlich entdeckten und dann retteten, wollten ihn zuerst erschießen, weil sie dachten, er sei ein wildes Tier. Er war in Ziegenhäute gehüllt, seine Haare waren zu einem Knoten verfilzt.
Bei diesem Detail fragte ich mich stets, was genau das Menschliche an seinem Erscheinen gewesen war, das die Freibeuter schließlich davon abgehalten hatte, auf ihn zu schießen. Die Entscheidung musste innerhalb weniger Augenblicke gefallen sein. Und was wäre gewesen, wenn sie geschossen hätten?
Dass es etwas gewesen sein müsste, was in ihnen Empathie geweckt hatte, mutmaßte der Fotograf. Als er Vater geworden war, sei er überrascht gewesen, dass das sogenannte Engelslächeln bei Neugeborenen ein Reflex war, um ihr Überleben zu sichern. Ein niedliches Baby lässt man schließlich weniger leicht zurück als eines, das den ganzen Tag nur plärrt und schläft.
Aus seiner Jackentasche zog er ein Päckchen. Er wickelte einen Streifen Kaugummi aus dem silbernen Papier und steckte ihn sich am Stück in den Mund. Ich konnte seine Kaumuskeln arbeiten sehen; einer der stärksten Muskeln am Menschen überhaupt.
Wollen Sie, fragte er.
Ich lehnte dankend ab. Das Interessante jedenfalls war, sagte ich, dass der Seemann anders als Crusoe im Buch kein Happy End fand. Trotz seines Ruhms soff er, prügelte – wie auch zuvor – und starb schließlich verarmt. Es war erstaunlich, wie die Konturen der Erzählung übereinstimmten, aber die Inhalte entgegengesetzt waren. Als hätte man das Negativ und ein dazugehöriges Foto vor sich liegen. Schob man beides übereinander, verschwanden die Bilder komplett.
Der Fotograf schüttelte energisch den Kopf, er räusperte sich. Die Frau neben mir, die gerade erst in den Schlaf gefunden hatte, schreckte kurz zusammen, aber öffnete die Augen nicht.
Seltsam, dass wir darauf zu sprechen kommen, sagte der Fotograf. Er habe erst kürzlich über die Beziehung von Wirklichkeit und Fiktion nachgedacht. Als Fotograf habe er den Eindruck, dass er – sobald er die Apparatur vor sein Auge schob – eine Rahmung vornahm; die Fiktion sich also ganz selbstverständlich aus gewähltem Ausschnitt, Perspektive und Brennweite zusammensetze. Nicht als Gegensatz müsse man beides betrachten, sondern als jeweilige Fluchtpunkte füreinander. Die Gegenwart ließe sich schließlich nicht ohne Geschichte lesen. Und Geschichten stünden per se in einer Beziehung zur Wirklichkeit. Man müsse sich nur Bauwerke vor Augen führen, Denkmäler. Als Berlinerin kannte ich doch sicher das klägliche Schicksal des Berliner Stadtschlosses? Ein Ort genau in der Stadtmitte, die wie eine grausame Wunde auseinanderklaffe, immer wieder wurde diese Stelle neu bebaut und abgerissen. Sie verkörpere das Zentrum der Macht, eine leere Patronenhülse. Das Fundament, als einziges Material vom Palast übrig geblieben, sei mit nassem Kies aufgeschüttet worden, habe es in der Zeitung gelautet, um dem Schimmel von unten vorzubeugen. Dieses Bild zeige doch sehr deutlich die ungeheure Angst der Menschen vor ihrer eigenen Geschichte, wie man versucht, sie im Keim zu ersticken, auf eine Weise unsichtbar zu machen. Unsere Städte seien getränkt von fiktiven Formationen. Ganz gleich, wo er hinkomme, in welche Stadt, und er sei in den letzten Jahren durch seinen Job wirklich viel herumgekommen, ließe er sich immer von mindestens fünf Personen das Wahrzeichen und seine Entstehung erklären. Meist erzähle jede*r die Geschichte etwas anders, aber im Kern stimme sie immer überein, das sei doch ganz erstaunlich, oder etwa nicht?
Eine Flugbegleiterin glitt lautlos durch den Gang. Als sie bei unserer Reihe angelangt war, bückte sie sich kurz und nahm die Decke auf, die der Schlafenden von der Brust gerutscht war. Die Beiläufigkeit ihrer Fürsorge rührte mich. Dem Fotografen schien die Geste nicht einmal aufgefallen zu sein. Er sprach weiter, als hätte er nur darauf gewartet, dass wir wieder ungestört waren.
Kürzlich ist etwas Seltsames passiert, sagte er. Er sah für einen Moment zum nachtdunklen Fenster. Die Geschichte war ihm offenbar unangenehm, trotzdem schien er sie loswerden zu müssen.
Ich nickte ihm aufmunternd zu.
Man geht immer davon aus, sagte er, dass man diejenigen Menschen, die einem am nächsten sind, auch am besten kennt. Aber vielleicht ist ja das Gegenteil der Fall; liebt man einen Menschen zu sehr, bringt man ihn gewissermaßen zum Verschwinden. Es wird unmöglich, ihn wirklich zu sehen oder etwas anderes als die Geschichte, die man mit ihm teilt. Mein Werk umfasst mittlerweile Porträts von Personen aus nahezu allen Regionen der Welt, aber meine Frau habe ich noch nie professionell fotografiert, nur mit dem Handy, ein Schnappschuss hier und da. Oder im Urlaub. Sie hat sich nie darüber beschwert oder es komisch gefunden, jedenfalls glaubte ich daran sehr fest, bis zu diesem Tag vor wenigen Wochen. Wir waren zusammen essen, tranken zu viel, wie wir es für gewöhnlich nie tun; ich trinke eigentlich nicht, müssen Sie wissen, seit Jahren habe ich nichts Hochprozentiges mehr zu mir genommen. Aber an diesem Abend hatten wir etwas zu feiern. Ich hatte gerade die Zusage eines Verlags für ein Fotobuch erhalten. Meine Frau bestellte einen Gin Tonic nach dem anderen, die Stimmung war ausgelassen. Ihre Augen glänzten, ich war sehr glücklich. Anscheinend hat sie die Frage danach, warum ich sie nie fotografieren wollte, schon lange beschäftigt. Irgendwann rückte sie mit der Sprache raus, mir schwirrte der Kopf, die Luft war schlecht, der Kellner wollte den Laden dichtmachen. Da, an diesem Abend, habe ich ihr versprochen, sie zu fotografieren.
Haben Sie vorher wirklich nie darüber nachgedacht, Ihre Frau zu fotografieren? Es kam mir unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich vor.
Ich kann es mir selbst kaum erklären, antwortete er, vielleicht war es auch eine Art Selbstschutz, denn was folgte, war nichts anderes als ein Desaster. Ich wollte mir wirklich Mühe geben. Komischerweise war ich aufgeregt, obwohl meine Frau mich schon oft bei der Arbeit beobachtet hat, aber eben noch nie als Modell. Wir waren beide verkrampft, und je länger ich durch den Sucher starrte, umso mehr verblasste sie. Im Garten steht ein Baum, eine alte Kirsche. Sie stellte sich davor. Es war ein gutes Motiv, aber alle Bilder ungenügend; mal hatte sie die Augen geschlossen. Oder sie zog eine unfreiwillige Grimasse. Ihre eigentlich sehr schönen Kurven wirkten unvorteilhaft. Als sie die entwickelten Fotos sah, wurde sie wütend und weinte; ob ich sie tatsächlich so sehen würde. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mittlerweile ist der Rauch verzogen, zumindest für meine Frau. Mir gehen die Bilder allerdings einfach nicht aus dem Kopf; ständig sehe ich meine Frau an, aber sehe nur die missglückten Fotos vor mir, und mittlerweile frage ich mich sogar, ob sie mehr Wahrheit enthalten, als ich mir selbst zugestehen könnte, ob unsere Ehe am Ende ist.
Vielleicht sollten Sie neue Fotos machen, schlug ich vor.
Er wirkte etwas beschämt, nestelte an den Enden seines Sitzgurtes herum. Die Leuchtzeichen über unseren Köpfen waren schon lange erloschen. Der Fotograf dachte eine Weile nach, starrte aus dem Fenster. Wahrscheinlich hatte er mir gar nicht zugehört, denn am Ende sagte er selbstvergessen in die Scheibe hinein, die besten Fotos entstünden genau dann, wenn man das Gegenüber gar nicht kannte. Dabei sah er aus wie jemand, der da draußen verzweifelt nach sich selbst Ausschau hielt.
In Togo wollte er auf einer Tagung eine Reihe von Schriftsteller*innen fotografieren. Absurderweise reisten die meisten von ihnen genau wie er aus Frankreich an. Nun flog er die ganze Strecke, von Paris nach Lomé, nur um Menschen zu treffen, denen er zu Hause direkt vor seiner Haustüre hätte begegnen können.
Ich sagte, das wirklich Erstaunliche daran sei ja wohl, dass man ihn einfliege, anstatt jemanden vor Ort zu beauftragen.
Selbstverständlich, sagte er. Wirklich überraschend war es allerdings nicht, da die Veranstaltung von einer französischen Kultureinrichtung organisiert und vor allem finanziert wurde. Er hätte die Veranstalter*innen darauf hinweisen müssen, sicher, aber, unter uns gesagt – er hielt sich gespielt konspirativ eine Hand an den Mund, als würde er flüstern – könne er das Geld zu gut gebrauchen.
Er sah mich an, einen Moment zu lang, um es wie Zufall aussehen zu lassen.
Sagen Sie Bescheid, wenn Sie einmal Fotos von sich brauchen, sagte der Fotograf, ich würde Sie wirklich gern fotografieren. Sie haben etwas Herbes an sich, sehr interessant.
Er nickte anerkennend. In der Reihe vor uns brach jemand prustend in Gelächter aus. Augenblicklich fragte ich mich, ob das Lachen auf unser Gespräch bezogen und die Geste des Fotografen zu anzüglich war.
Ich nahm die Visitenkarte, steckte sie unkommentiert und demonstrativ nachlässig in eine Ritze meiner Handtasche. Unsere Unterhaltung versiegte, und ich schlief tatsächlich noch einmal ein. Nach der Ankunft winkte er mir an der Gepäckausgabestelle von weitem zu, ich tat, als hätte ich ihn nicht gesehen, und das nächste Mal, das ich in seine Richtung schaute, war er im Gedränge der Halle verschwunden.
In der ersten Nacht schrieb ich eine Kurzmitteilung an Neda. Dass ich gut angekommen war. Und ob ihr spontan ein Buch einfalle, vielleicht ein Klassiker, in jedem Fall eines, in dem die Protagonistin weiblich gelesen wurde und allein reiste.
Ich wartete.
Meine Schlafsachen waren im Gepäck ganz unten. Ich hatte kopflos gepackt, und jetzt lag ich nur in Unterwäsche bekleidet, die mir am schweißnassen Hintern klebte, unter dem provisorisch aufgehängten Moskitonetz, lauschte in die lebhafte Nacht und verlor den Mut.
Die Unterkunft war einmal ein Seemannsheim gewesen, hatte mir der Pförtner bei der Ankunft erzählt, auch deshalb stand sie direkt beim Meer. Wenn ich den Lärm der Stimmen in meinem Kopf abschaltete, hörte ich das Rauschen. Heute wurde das Gebäude vom deutschen Staat verwaltet; hier brachte er seine Gäste in Togo unter. Vor dem Balkon stand eine einzelne, zerrupfte Palme, deren trockene Blätter im Wind aneinanderrieben. In der übermäßig gepflegten Anlage wirkte sie wie ein gigantischer Fremdkörper. Der Rasen war kurz geschnitten, über den Zaun sah man auf die schummrig beleuchtete, sehr aufgeräumte Straße. Der Platz des Nachtportiers war unbesetzt.
Wie gerne hätte ich jetzt ein Bier gehabt oder mit jemandem ein Wort gewechselt.
Eine Weile versuchte ich, mich zu erinnern, was ich in Berlin vor dem Einschlafen gehört hatte (Autos, die über ein Kopfsteinpflaster fahren, Äste eines Baums, die im