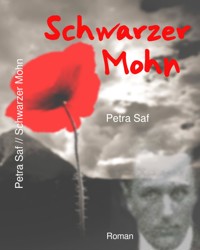Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
New York City 2008 Anne sitzt fest, ein Schneesturm hat die Ostküste für einige Tage fest im Griff. Für Anne der Beginn einer Reise, ihrer Reise in die Vergangenheit ihrer Familie. Nordschweden 1865 Jonas sitzt auch fest, in einem kargen Leben am elterlichen Hof und in einer Schneiderlehre. Er will eine bessere Zukunft in einem fernen Land im Süden, das später Schlesien heißen soll, und bricht auf. Eine Familie in Gedanken auf dem Weg zueinander. Dafür ist es nie zu spät.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra Saf
Weißer Schnee
Zur Erinnerung
Petra Saf
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Roman, Trilogie, Band 1
Impressum
Texte: © 2019 Copyright by Petra Saf
Umschlaggestaltung: © 2019 Copyright by Petra Saf
Photography
Druck und Vertrieb: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Für Euch
1
Anne
Anne sitzt in einem dieser Cafés, die kein Café sind, zumindest nicht so eines, wie sie es aus Europa kennt. Die Nacht war kurz, die Notlandung am gestrigen Abend heftig, das Wetter grauenvoll, wie das eben oft so ist in den Monaten der Winterstürme an der amerikanischen Ostküste.
Glück im Unglück, sie hat in letzter Minute eines der wenigen, noch verfügbaren Hotelzimmer in Manhattan gefunden. Nicht im Waldorf wie sonst, sondern in einem neuen Boutique Hotel in einer Seitenstraße. Moderner und nicht so modrig wie das noble alte Waldorf, das sich mit seinen Kristalllustern in den Gängen immer ein wenig wie die Titanic anfühlt. So zumindest empfindet sie das jedes Mal, wenn sie dort durch die verwinkelten Gänge geht.
Anders in diesem neuen Hotel. Die Lobby riecht frisch gestrichen, die Rezeptionistin auch. Alles ist, als sei es noch nie berührt worden. Der Front Desk, der Lift, der Teppichboden im Zimmer - weniger modern, aber so amerikanisch - das Bad und alles übrige auch. Aber an einem Tag wie diesem ist alles Neue eine Wohltat auf der Seele.
Das Wetter soll sich in den nächsten Tagen weiter derart verschlechtern, dass eine Totalsperre aller Flughäfen verordnet worden sei, teilt ihr die Rezeptionistin mit. Was für eine Willkommensnachricht gleich beim Check-in, sozusagen Hand in Hand mit der Magnetkarte fürs Zimmer. Sie bucht ohne langes Nachfragen gleich vier Nächte, das ist die durchschnittliche Verweildauer von heftigen Schneestürmen über New York. Anne weiß das, sie ist nicht zum ersten Mal in der Stadt. Dann folgt Routine, wie immer gleich ins Zimmer, Dusche und schlafen.
Um 7h weckt sie das Geräusch des Aufzuges, das klingt, als würde sich die Tür gleich neben ihr öffnen und wie angenehm, der Zimmerservice mit dem Frühstückswagen hereinrollen. Allein das bleibt ein Wunschtraum, denn es gibt keinen Zimmerservice an diesem chaotischen Wintermorgen, der die Stadt, ihre Einrichtungen und Bewohner lähmt. Der Zimmerservice geht nicht einmal ans Telefon und die Rezeption erklärt ihr, dass viele Mitarbeiter heute morgen nicht zum Dienst erschienen seien, da verkehrstechnisch gar nichts mehr geht.
Anne wird also auswärts frühstücken müssen.
Die Straßen sind nicht geräumt, der Schnee liegt fast kniehoch, es gibt kaum Taxis und eines der wenigen Zeichen von Leben sind die Warmluftschwaden, die aus den Kanaldeckeln emporsteigen.
Anne liebt den Schnee, seitdem sie denken kann, aber warum, das weiß sie nicht so richtig. Sie umrundet mehrere Blöcke, die meisten Coffee Shops sind noch geschlossen, aber dann nach fast einer halben Stunde, ist da eine kleine Bäckerei, die gerade als sie vorbeigehen will, die Lichter anmacht und in der, sie traut kaum ihren Augen, ein alter Mann mit weißer Bäckerschürze in diesem Moment einen Mohnstrudel in eine der Vitrinen stellt.
Richtigen Mohnstrudel, saftig, dick und goldbraun gebacken, überzogen mit einer dichten Schicht aus Puderzucker, weiß wie der Schnee. Mohnstrudel wie er in Polen oder besser gesagt im schlesischen Teil Polens Tradition ist. Mohnstrudel wie ihn der Vater liebt, als wäre darin die Süße der Kindheit verpackt. Immer wieder verlangt er danach, frisch gebacken, und sehr süß muss er sein. Denn es ist wohl in Wirklichkeit keine süße Kindheit gewesen, glaubt sie. Das ist ihre Annahme, ein Verdacht, denn er hat nie wirklich von seiner Kindheit erzählt.
Anne findet, dieses Café ist der richtige Ort für Ihr Frühstück und tritt ein. Da sitzt sie nun vor einem halben Liter schwarzem Kaffee und einem Stück lauwarmem Mohnstrudel.
Der Duft des warmen Mohns steigt ihr in den Kopf und mit dem Duft wirre Gedanken, wie es gewesen sein könnte, damals als eine Familie sich auf den Weg machte, um eine Familie zu werden, deren einzelne Mitglieder sich dann wiederum auf den Weg machten, um keine Familie mehr zu sein.
Das Leben ist seltsam.
Man wird geboren, wächst heran, beginnt auf eigenen Füssen zu stehen und zu gehen, betritt und bereist die große weite Welt, kennt fast alles und nie
genug, erlebt vieles und will immer mehr.
Aber wo man herkommt, das wissen viele nicht, denkt Anne. Das trifft auch für sie selbst zu.
Ihre Geschichte und Zeitzählung beginnen mit den Eltern und den Großeltern mütterlicherseits. Die Zeit davor hat irgendjemand geschwärzt. Antworten auf Fragen bekommt sie nicht, man solle die Vergangenheit ruhen lassen.
Das ist es, was die Vergangenheit am besten kann, sagen die Eltern.
Wie kann man nur so ignorant, uninteressiert, unreflektiert sein, so banal im Jetzt dahinleben? Wie kann man die nächste Generation über frühere Generationen im Unwissen lassen? Haben die Eltern denn nicht verstanden, dass Vergangenes Teil der Gegenwart ist und die Vergangenheit die beste Lehrerin der Zukunft ist?
Manchmal kann Anne nur schwer glauben, dass ihre Eltern so sind wie sie sind.
Und nachdem sie weiß, dass es den ganzen Tag schneien wird und es selbst in New York für sie nichts zu kaufen gibt, was sie nicht schon besitzt, beginnt sie zu träumen.
Davon wie es gewesen sein könnte, wozu es geführt haben könnte, warum es nicht anders kommen konnte und was von allem geblieben ist.
Wovon nie erzählt wurde, weil die Worte nicht gefunden werden konnten oder wollten.
Annes Traum von der Geschichte einer Familie beginnt an einem verschneiten Dezembertag des Jahres 2008 in New York City.
Wo und wann er enden wird?
Das wird man sehen.
2
Jonas
Jonas ist zwanzig Jahre alt, heute ist sein Geburtstag, ein kalter und hungriger Tag, wie fast alle Tage in diesem kargen Winter, ganz oben im Norden Schwedens. Sie schreiben den 26.November, im Jahr 1865.
Die Eltern betreiben einen kleinen Hof, der längst seinen bescheidenen Glanz verloren hat. Der Anstrich ist verblasst, die Fensterläden knarren, die Türen ächzen, es gibt nur einen gemeinsamen Wohnraum, dort wärmt ein Herd das Wasser für alle Bedarfe. Dann sind da noch zwei kleine Räume, die zum Schlafen dienen.
Jonas hat drei Schwestern, kühle Schönheiten, blond mit blauengrauen Augen, alle älter als er und unverheiratet, denn wer heiratet schon gerne arm. Das wird einmal auch für ihn gelten, fürchtet er. Die Mutter hat darauf bestanden, dass die Mädchen die Schule besuchen. Sie waren gute Schülerinnen. Seitdem helfen sie am Hof, es gibt genug zu tun. Eine weitere Ausbildung für Mädchen steht nicht zur Diskussion, denn eines Tages wird schon jemand kommen, der sie zur Frau nimmt.
Alle Kinder haben ihr Aussehen vom Vater geerbt,
seine blaugrauen Augen leuchten heute unter silbernem Haar, der einst drahtige Körper ist von der vielen Arbeit abgenutzt. Er soll einmal ein schöner Mann gewesen sein, sagen die Leute.
Ja und die Mutter, Haare schwarz wie Mohn, eine Haut weiß wie Schnee, und stets einen traurigen Blick, traurig wie ihr Leben.
Der Vater hat sie aus einer für die Zeit wohlhabenden jüdischen Handelsfamilie heraus geheiratet, gegen den Willen aller, gegen den Willen seiner lutherischen Kirche. Hinein in eine Mischehe, in der die Mutter versucht hat, alles Jüdische zu vergessen, und in der sie doch mit jedem Kind, das sie gebar, innerlich daran zerbrochen ist, zu wissen, dass es ein lutherisches Kind sein würde. Die Mutter hatte damals keine andere Wahl, der Vater hatte sie geschwängert. Das war und ist der einzige Grund für ihre Verbindung, wissen die Leute, aber nicht die Kinder.
Von den Großeltern weiß Jonas nur sehr wenig. Väterlicherseits sind da keine mehr. Sie haben sich am Hof in einen frühen Tod geschuftet. Beide Großeltern und deren Vorfahren sollen nie etwas anderes als das Dorf gesehen haben. Ja und vor vielen Jahrhunderten sollen sie aus Finnland eingewandert sein, so die Überlieferung.
Der Großvater und die Großmutter mütterlicherseits leben noch. Jonas kann sich aber nur dunkel an sie erinnern. Sie seien weggezogen, hat die Mutter einmal gesagt, in die große Stadt.
Der Großvater handelt mit allerlei Waren, dafür braucht man das Meer und einen Hafen in der Nähe, das weiß Jonas. Wenn die Kinder fragen, warum man die Großeltern denn nicht öfter besuche, kommt meist die Antwort, weil man dort in der feinen Gesellschaft nicht gerne gesehen sei.
Und dann sind da noch zwei weitere Blondschöpfe mit blaugrauen Augen, aber sie leben auf einem anderen Hof, mit einer anderen Mutter und keinem Vater. Offiziell.
Jonas hat die beiden nie kennengelernt, aber damals in der Schule hat er sie gesehen und die Leute tuscheln gehört. Ein Gesicht hätten sie, sein Gesicht oder besser gesagt, das des Vaters.
Das nächste Dorf ist eine gute halbe Stunde Fußmarsch entfernt, dort arbeitet Jonas, er ist Schneiderlehrling, eine andere Ausbildungsmöglichkeit gibt es nicht, es ist ein kleines Dorf.
Tagein tagaus vermisst er junge, alte, schöne, hässliche, freundliche, widerwärtige und manchmal auch heitere Kunden, die sich alle paar Jahre einen neuen Wintermantel leisten, besser gesagt leisten müssen. Die Arbeit ist so wie das Leben hier oben, eintönig, karg und ohne große Perspektiven.
Und Trinkgeld für den Schneiderlehrling? Was ist das, wer hat das schon. Aber Jonas will nicht klagen. Viele seiner ehemaligen Schulfreunde, die meisten auch Kinder eines Bauern, haben keine Lehrstelle oder Arbeit gefunden.
Er selbst ist nun im dritten Lehrjahr, wird seine Ausbildung bald abschließen und dann, ja dann will er etwas schaffen. Nur was, das weiß Jonas noch nicht so genau. Besser, grösser, aufregender und wohlhabender soll es sein. Bunter, fröhlicher und glücklicher als sein heutiges Leben. Wie, wo und wann das sein kein, das ist offen.
Der Vater hingegen hofft, dass Jonas eines Tages den Hof übernehmen wird. Mindestens einmal die Woche erwähnt er es am Frühstückstisch. Jonas antwortet nie, aber sein Blick sagt alles. Dann lässt der Vater missmutig den alten Löffel in den dampfenden, geschmacklosen Getreidebrei fallen, trinkt den letzten Schluck bitteren Tee, schaut ihn still an, sagt nichts und doch alles, und verlässt die Stube. Zurück bleibt der Rest der Familie, ebenso wortlos, denn was hat man sich schon zu sagen in einem Leben, das jenseits des Hofes nichts kennt.
Bei der Arbeit erzählen die Kunden Jonas von der anderen Welt da draußen, der reichen, der schönen, der lebenslustigen. Nein, nicht hier im Norden Schwedens, man muss südlicher reisen und am besten über das Meer, auf das Festland, ins Reich der Preußen oder Habsburger. Dort gibt es die prunkvollsten Städte, Kultur, Kunst, Musik, wunderschöne Frauen, den besten Kuchen und die Hochburgen der Stoff- und Textilindustrie, von denen auch der Schneider kauft.
Für die Kunden, die es sich leisten können.
Jonas versucht die Arbeit bei solchen Erzählungen immer ein wenig in die Länge zu ziehen, da noch ein Stich, hier noch eine Korrektur. Zu schön ist der Film vor seinen Augen. Eine Reise in eine bessere Welt, eine eigene Schneiderei und eine Familie, der er alles bieten kann.
Meist endet der Traum mit einem harschen Rüffel vom Meister. Er solle nicht rumtrödeln, sonst müsse man ihm etwas vom Lohn abziehen. Und überhaupt sei die Arbeit keine Märchenstunde und das Leben kein Preiselbeerkompott, wie der Meister immer zu sagen pflegt.
Das macht Jonas traurig und er fragt sich, wie denn all die Menschen, die heute ein besseres Leben als er führen, eben dorthin gekommen sind. Nur durch Geburt und Erbschaft? Das glaubt er nicht. Er wird die noble Kundschaft weiter aufmerksam beobachten. Solange bis er herausgefunden hat, was zu tun ist, um selbst ein nobler Herr zu werden.
Und dann ist da dieser eine Tag.
Jonas bahnt sich früh morgens den Weg durch den knietiefen Neuschnee zur Arbeit. Es ist noch dunkel, als er in der Schneiderei ankommt. Zu seinen Aufgaben gehört es, alles für den Meister und die Kunden vorzubereiten. Schnittmuster sortieren, Schneiderkreide und Nadeln ordnen, Garne farblich abstimmen, alles für jedes Modell und jeden Kunden. Dann noch Schnee schmelzen und mit dem gewonnenen Wasser Tee aufgießen, aus einer Art Baumflechte,
die angeblich gut gegen Erkältungen wirkt, denn mit der Kundschaft kommen die Grippe, Husten, Fieber und vieles. Und so manches bleibt.
Er hat seine Arbeit fast beendet, als es an der Tür klopft. Glasfenster sind unleistbar für den Schneider, also muss Jonas die Tür öffnen, um zu sehen, wer es ist.
Er öffnet die Tür, erstarrt wie zu Stein - die Türklinke ist sein einziger Halt - und versinkt in den tiefsten, braunen Augen, die er je gesehen hat. Ein wenig wie die seiner Mutter. Unter dem Umhang ragt ein schwarzer langer Zopf hervor, den der schmelzende Schnee in einen Eiszapfen verwandelt hat.
Das Wunderwesen ist klein, zart und irgendwie erbarmungswürdig.
Und als ihn die großen braunen Augen loslassen und er den Blick hebt, sieht er ein anderes, wesentlich größeres, braunäugiges Wesen, mit zornigem Blick aus ebenso dunklen Augen.
Man habe ihnen gesagt, die Schneiderei sei nicht weit von der Kutschenstation entfernt, der Weg mit Sicherheit freigeschaufelt und nebenan ein Café. Wohl alles frei erfunden und dreiste Lügen, noch dazu bei einer Neukundschaft.
Jonas erinnert sich an all das, was er über gutes Benehmen gehört hat, nicht zuhause, sondern von Kunden. Er bittet die griesgrämige Dame und das Zauberwesen in die Stube, klopft den Schnee von
ihren Mänteln, bittet sie abzulegen, hängt die Mäntel fein säuberlich an den Ofen und eilt in den Hinterhof - dort ist die Abstellkammer, die als Küche dient - trocknet zwei der eben gewaschenen, ärmlichen Teetassen und eilt mit dem warmen Gebräu zurück in die Stube.
Das Zauberwesen hat den Zopf gelockert, um das Haar zu trocknen. Jonas sieht wildes, schwarzes Haar um sanfte Augen.
In dem Moment betritt der Meister den Laden und entschuldigt sich vielmals für das tölpelhafte Verhalten seines Lehrlings. Natürlich sei der Weg normalerweise geschaufelt und das mit dem Café nebenan, das müsse ein Missverständnis gewesen sein.
Er nennt die Dame Frau Doktor, macht unentwegt den Diener und tritt Jonas heftig ins Schienbein, wie er es immer tut, wenn er ihm zeigen will, dass etwas absolut nicht stimmt.
Die Frau Doktor ist keine eigentliche Frau Doktor, sondern vielmehr nur die Gemahlin eines Herrn Doktor aus der nahegelegenen Stadt. Die Schneiderei wurde ihr für ihre Tochter empfohlen. Das Mädchen ist so zierlich, dass niemand für sie nähen will oder besser gesagt für die Mutter, deren Ruf sich im ganzen Land mit Windeseile verbreitet hat.
Frau Doktor erzählt, ihre Tochter brauche den Mantel für eine lange Reise. Der Herr Doktor habe einen Lehrstuhl in einer Stadt im Habsburger Reich angenommen und in zwei Wochen sei Abreise.
Nein, man werde dann dort leben und hoffentlich nie wieder nach Schweden zurückkehren. In der neuen Heimat werde alles viel nobler sein als im hier oben im ungehobelten Norden.
Der Meister weist Jonas an, die Vermessung beim Fräulein Tochter vorzunehmen, der Beginn einer kleinen, schmerzhaft süßen Ewigkeit. Er beginnt mit der Rückenlänge, dann Armlänge, Gesäß, Halsumfang und als er die Taille umfasst, nimmt er eilig Abstand, entschuldigt sich für einen Moment und läuft in die Abstellkammer. Nur dieses Mal nicht, um Tee zu holen.
Wenn er doch nur mit dem Wunderwesen auf Reisen gehen könnte, träumt Jonas.
Zurück im Raum wird schnell noch der Anprobetermin vereinbart und schon steht die nächste Kundschaft in der Tür. Es ist die Magd vom Nachbarhof, die ihr ganzes Erspartes zum Schneider trägt, nur um Jonas nahe zu sein.
Aber der blickt durch sie hindurch, zu den beiden Gestalten, die die Straße zurück zur Kutschenstation stapfen.
Und das Mädchen blickt zurück zu ihm, tiefbraune Augen auf einer Haut weiß wie der Schnee, mit Haaren schwarz wie Mohn.
3
Viktoria
»Mam, darf es noch ein Refill sein?«, fragt der Kellner.
Die schwarze Brühe ergießt sich in ihre leere Tasse, vom Mohnstrudel sind nur noch ein paar Krumen Zucker geblieben. Sie weiß nicht, wie lange sie so gesessen hat, ob sie im Tagtraum gesprochen hat oder wer in all der Zeit neben ihr gesessen hat. Aber wahrscheinlich niemand, denn ein Blick auf die Uhr sagt ihr, Manhattan schläft noch und wird bei dem Wetter weitere ein bis zwei Stunden die Straße meiden.
Ihr Telefon meldet eine E-Mail. Ihre Freundin aus Maine fragt, ob es ihr gut gehe. Der Wetterbericht habe sich noch weiter verschlechtert, sie solle Manhattan auf keinen Fall verlassen. Eigentlich schade, denn Anne hatte an einen Ausflug in die Hamptons gedacht.
Und dann ist da noch eine Mail, von gestern, die ihr wohl im Chaos der Anreise entgangen ist. Von ihm. Er findet das alles gar nicht gut, ausgerechnet eine Notlandung und nun tagelang in New York, wieso das denn sein müsse. Sie wisse doch, dass er von seiner damaligen Freundin eben in diese Stadt betrogen und verlassen worden sei. Er ertrage das kaum, wisse nicht wie er diese Tage ohne Hilfe überstehen solle, die Angst steige wieder in ihm auf, sie solle ihn sofort anrufen, das Hotel nicht verlassen und auf keinen Fall ausgehen. Er warte, es gehe um ihn.
Natürlich, es geht immer um ihn.
Keine Frage,wie es ihr denn gehe, ob alles den Umständen entsprechend gut sei, sie noch ein Zimmer bekommen habe, er irgendetwas für sie tun könne. Alles dreht sich ausschließlich um ihn, das geht nun schon seit zwei Jahren so. Seine Bedürfnisse, seine Ängste, seine sexuellen Vorlieben, seine Ehe, seine Mutter, seine Kinder, seine Geschäfte und überhaupt ausschließlich alles, was in diesem Orbit so um ihn kreist.
Aber heute nicht. Sie drückt die Ausschalttaste, diese Tage gehören ihr und nur ihr.
Am Nebentisch hat sich eine ältere Dame Platz genommen. Schlank, schwarz gekleidet, rote Nägel, das lange graue Haar zu einem Zopf gebunden, auffallend geschminkt, am Handgelenk eine silberne alte Uhr und eine Zahl, dick tätowiert, viel zu breit für das zierliche Gelenk.
Sie bestellt Kaffee und Mohnstrudel, wie Anne, und bemerkt Annes Blick auf der Zahl.
»Sie sind aus Deutschland mein Kind, nicht wahr?«, sagt sie.
Anne nickt wortlos, ist wie vom Blitz getroffen, fasst sich dann aber rasch und stellt sich kurz vor.
»Ja, Anne ist mein Name, guten Morgen!«
»Ach schön, wie meine verstorbene Schwester, guten Morgen! Ich bin Viktoria!«, sagt die würdevolle Dame.
Anne nimmt einen Schluck Kaffee, weiß nicht wie und ob sie die Unterhaltung fortsetzen soll. Vielleicht will Viktoria ja ihren Frieden.
Viktoria nimmt ihr die Entscheidung ab.
»Sie haben die Nummer auf meinem Handgelenk so angesehen. Das ist meine Erinnerung an zuhause, an Schlesien, an Auschwitz. Eigentlich wurden die Tätowierungen stets weiter oben am Arm gesetzt, aber ich war zu der Zeit an der Elle verletzt, trug einen Verband und so hat sich der Mann in der Uniform eben mein Handgelenk als Platz für die Zahl ausgesucht«, erklärt Viktoria.
Und sie beginnt zu erzählen.
Nein, sie sei nicht verhärmt. Sie habe in einem kleinen, armen Dorf in Schlesien namens, Weißbach gelebt, mit ihrer Mutter Bertha - einer Jüdin - und ihrer Zwillingsschwester Anne. Die Mutter sei Näherin gewesen. Einen Vater habe es nicht gegeben.
Eine alleinstehende Frau mit unehelichen Zwillingen zu der Zeit, das muss hart gewesen sein, denkt Anne, will aber nicht unhöflich sein und lässt es dabei bewenden.
Es sei schwer gewesen, in einer jüdischen Familie noch dazu ohne Vater aufzuwachsen, in einem Land, in dem sich fast alle feindselig begegneten.
Polen gegen Deutsche, Deutsche gegen Polen, Katholiken gegen Protestanten, ja und alle gegen die Juden.
Und so viele Familientragödien bis zum Krieg, den sie aber nur noch teilweise vorort erlebt habe, denn eine wohlhabende Verwandte in Amerika hatte sie im Jahr 1941 zu sich geholt, warum das wolle sie nicht erzählen. Die Mutter und die Schwester seien geblieben und früh verstorben. Warum darüber wolle sie ebenso wenig sprechen. Nur soviel, es sei kein freiwilliger Tod gewesen und auch kein schöner. Hätten die beiden damals doch nur auf sie gehört.
»Seien Sie froh und dankbar, Kind, dass sie so leben können, wie sie das heute tun. Wir hätten das auch gerne getan, zuhause in Schlesien« sagt sie. Dann entschuldigte sie sich, sie wolle nun ein wenig lesen, was sich in der Welt zutrage. Nach einer Weile zahlt sie, streift sich lange schwarze Handschuhe über die zarten Hände und die schwarze Nummer, lächelt Anne an, bedankt sich für das kurze Gespräch, besser gesagt das nette Zuhören und verlässt anmutig das Café.
Anne blickt ihr nach, dieser Gang, diese Gestik, dieses Gesicht, faszinierend und irgendwie vertraut.
Es gibt sie diese Momente, in denen wir Menschen begegnen, in die wir mehr hineininterpretieren, als da ist.
So erklärt sich Anne eben diesen Moment. Sie hat zufällig eine Dame getroffen, die sie berührt, aus welchem Grund auch immer.
Der Schneefall ist stärker geworden, ein starker Wind weht um die Häuserblöcke und lässt die Schneeflocken seitwärts durch die Straßen peitschen. Weniger einladend kennt Anne New York nicht, aber noch ein Kaffee ist auch keine Option und ein wenig durch die leeren Straßen zu schweifen, das grenzt bei dieser sonst so hektischen Stadt an ein kleines Wunder. Also wird sie ein wenig durch die Stadt streifen.
Sie zahlt an der Theke, packt sich warm ein und taucht ein in das Winterwunderland New York. Zuerst Lexington, dann Fifth Avenue, die ersten Geschäfte öffnen und Bloomingdales singt den Tag mit I am dreaming of a White Christmas ein, des Vaters liebstes Weihnachtslied.
Anne weiß nicht, ob und wie idyllisch seine Kindheit und seine Weihnachtsfeste waren. Sie weiß nur, dass das Lied wohl dafür steht, wie er sich Weihnachten vorstellt.
Oh nein, das Telefon klingelt, sie hatte zwar die Emailfunktion deaktiviert, aber nicht den Handyempfang. Das Display zeigt keine Nummer, sie nimmt ab und realisiert binnen Sekunden, dass sie das wohl besser nicht getan hätte.
Er, für ihn vier Uhr morgens, für sie das Ende der Winterromantik. Wieso sie denn keine Nachricht gesendet habe, verschlüsselt versteht sich von selbst, warum sie denn nicht sofort auf einen neuen Flug umgebucht habe, ob sie denn allein sei, was sie so mache und ob sie überhaupt wüsste, wie schlecht es ihm gehe.
Ja, weiß sie, und versucht die Ruhe zu bewahren. Was sagt man einem Menschen, zu dem nichts durch dringt außer die Dramatik des eigenen Seins?
Sie testet die Wahrheit, es gebe für mindestens zwei Tage keine Flüge nach Deutschland, das liege nicht an ihr.
Sie wird nicht gehört, es folgt der übliche Monolog, endlos, in allen Details, bis die Verbindung abreist.
Es muss der Wind gewesen sein oder der niedrige Batteriestand oder ….
Es ist Anne, sie hält das Mobiltelefon mit gestrecktem Arm in den Wind bis die Tastatur voller Schnee ist, der geduldig zuhört. Dann drückt sie die Aus-Taste, für alle Funktionen, marschiert weiter, orientierungslos, von einem weihnachtlich dekorierten Schaufenster zum nächsten.
Sie muss mindestens zwei Stunden so durch die Straßen gestapft sein, ihre Stiefel sind nass, die Sohle beginnen einzufrieren, alle Zeichen stehen auf Rückzug an einen warmen Kamin.
Sie geht am Waldorf vorbei, das diese Art von Gemütlichkeit in den Lobbies leider nicht bietet, biegt die nächste Straße links ab und geht eine Weile ostwärts. Die Geschäfte, Sushi Restaurants, Deli Läden und Steakhäuser werden weniger, der Eindruck der Gastfreundlichkeit passt sich dem Wetter an und sie will bereits umkehren, als sie ein Fenster sieht, umrahmt von dunkelrotem Stoff, in dem sich ein Kaminfeuer spiegelt.
La Patagonia steht da über dem Eingang geschrieben, also ein Stück Argentinien, mutterseelenallein in einer Seitenstraße New Yorks, ohne Bäume, ohne Berge, ohne Seen und wohl auch ohne Gäste, wie sie beim Betreten feststellt. Vor dem Kamin ein altes, braunes Ledersofa, schon etwas abgesessen, darauf Flanellkissen mit Forellemotiven, am Tisch neben der Speisekarte eine Teekarte mit einer langen Liste von Mate Teesorten.
Vor zwanzig Jahren hätten vermutlich auch noch ein Aschenbecher auf den Tischen gestanden. Heute zieren rote Kerzen diese Plätze. Sie entledigt sich ihres Mantels, der Haube und Handschuhe, und macht es sich auf dem Sofa gemütlich.
Ihre Gedanken wandern nach Argentinien, an einen sehr ähnlichen Platz, zu schönen Stunden mit einem Glas Malbec und guten Gesprächen.
Für ein Glas Wein ist es noch zu früh, aber warum eigentlich? Sie bestellt den Hauswein, einen Malbec, was sonst, hört wie der Korken gezogen wird und da ist er, dieser süße Himbeerduft, diese Note von trinken und versinken, in diesem dunklen Rot, das alles verspricht und vieles nicht hält.
Gerade so wie die Liebe, denkt sie, und träumt weiter.
4
Andreas
Jonas kennt keinen Wein, nur den bitteren Tee, den sie in der Schneiderei und zuhause trinken. Nach der magischen Begegnung mit den großen braunen Augen der Arzttochter war der Winter ereignislos verlaufen. Jeden Tag mehr Schnee und ein noch beschwerlicherer Weg zur Arbeit. Aber etwas hat sich verändert, Jonas hat sich verändert. Plötzlich hat er einen Plan. Von seinem mageren Lohn liefert er nur das mindeste Zuhause für Kost und Logie ab, der Rest wird zur Seite gelegt.
Natürlich darf niemand von seinem Vorhaben wissen, also versteckt er das Geld in einem seiner Kreidebeutel, den er auf dem Strohboden unter einem Brett lagert. Er hat ausgerechnet, dass sechs Monate sparen ausreichen müssten, um die Kutsche bis Stockholm und eine Fähre nach Danzig zu bezahlen. Einfach, denn eine Rückkehr an den elterlichen Hof schließt er aus. Sein Reiseziel soll Schlesien sein, den Landweg von Danzig bis Schlesien werde er zu Fuß zurücklegen müssen. Alles andere hieße, noch einen weiteren Winter in Schweden vergeuden und das will er auf keinen Fall.
Ihm ist klar, dass dieser Plan noch eine andere Komplikation mit sich bringt.
Er spricht kein Deutsch und für Unterricht hatte er weder die Mittel noch die Zeit. Deutsch ist aber die vorherrschende Sprache in allen Teilen Schlesiens.
Er muss einen anderen Weg finden. Zwei Höfe weiter hat der Bauer und Rentierjäger Lasse vor fünf Jahren ein deutsches Mädchen zur Frau genommen. Das Paar hat zwei Söhne mit denen die Mutter nur Deutsch spricht, sehr zum Leidwesen des Bauern, denn ohne Schwedisch werden seine Erben in der Dorfgemeinschaft keinen Platz finden.
Jonas geht zum Bauer und bietet ihm an, mit den Kindern immer sonntags nach dem Kirchgang ein wenig Schwedisch zu lernen. Dass dies auch seine Chance ist, Deutsch zu lernen, auf die Idee kommt niemand. Und so soll es sein, Jonas lernt Deutsch, zumindest so viel, dass er sich in Schlesien zurechtfinden wird.
Schwer fällt ihm die Heimlichtuerei zuhause, vor allem vor der Mutter. Er weiß, sie würde ihn verstehen, ihr Geist ist grösser als der des Vaters. Aber er muss schweigen.
Die Monate verstreichen, der Sommer zieht ins Land und Jonas beginnt am Scheunenboden seinen Reisesack aus Jute vorzubereiten, ebenso gut versteckt unter den Scheunenbrettern.
An einem Montag beginnt er den Tag wie jeden anderen auch, mit seiner Familie, am kargen Frühstückstisch. Er isst fertig, stellte seine Tasse auf die
Anrichte neben der Holzspüle, wünscht den Schwestern einen schönen Tag und nimmt die Mutter in die Arme. Das tut er sonst nie und es verrät ihn. Er sieht die Tränen in ihren Augen, aber keiner sagt ein Wort. Sie drückt ihm einen halben Laib Brot in die Hand, streicht ihm mit der Hand über die Wange und geht zur Tür hinaus, dem Vater nach, denn da ist ihr Platz. Sie kennt keinen anderen.
Jonas nimmt den Jutesack, den er am Abend davor unter sein Bett gelegt hat, und verlässt fluchtartig den Hof.
Die Kutsche nach Stockholm hat schon vorgespannt, er bezahlt die Fahrt, steigt ein und spürt, wie sie die Räder zu drehen beginnen. Noch ein Blick zur Schneiderei, die er nie wieder sehen will. Er wird es besser machen, alles, das weiß er.
Die Fahrt dauert sieben Stunden und er will unbedingt die Fähre am frühen Abend nehmen, denn eine Übernachtung würde sein Reisebudget zu sehr strapazieren. Er rennt von Kutschenplatz zum Hafen, so schnell er kann, und geht im letzten Moment an Bord. Der Mann auf der Brücke erklärte ihm, dass das Schiff voll besetzt sei und er an Deck schlafen müsse, dafür sei die Fahrkarte billiger. Welch ein Glücksfall, denkt Jonas.
Die Nacht ist stürmig, klirrend kalt und zuletzt setzt auch noch Schneefall ein. Bei Ankunft in Danzig ist Jonas halb erfroren. Er muss sich aufwärmen. Also sucht er eine Gaststube, nicht um vornehm zu speisen und am Kamin zu sitzen, auch dafür ist das Geld zu knapp, sondern um sich am Küchenschacht in der warmen Abluft zu trocknen, nur so viel, dass er seinen Fußmarsch nach Schlesien antreten kann. Nach ein paar Stunden ist er soweit und macht sich auf die letzte Etappe seiner Reise, eine ernüchternde Etappe, wie er sie nicht erwartet hat.
Karges, trockenes Land, arme Dörfer, verhärmte Menschen, hungrige Kinder. Wenig Arbeit in den ländlichen Gegenden, die von patriarchalischen Großgrundbesitzern beherrscht werden. Sind sie da in Schweden nicht freier, geht es ihnen dort nicht besser?
Dann die ersten Städte, hier ist das Bild ein ganz anderes. Überall sprießen Fabriken, die Menschen eilen von und zur Arbeit, die Kinder in Schulen. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Und umso südlicher er kommt, umso stärker ist diese Stimmung zu spüren.
Nach zwei Wochen erreicht er Breslau, eine der deutschesten Städte Schlesiens, mit Ringstraßen wie im prachtvollen Wien, Universitäten, technischen Hochschulen, Theatern und Cafés wie er sie noch nie in seinem Leben gesehen hat. Die Menschen sind fröhlich, die Liebe zu ihrer Stadt steht ihnen ins Gesicht geschrieben, und ohne zu wissen, ob Breslau auch das Ziel der schwedischen Arztfamilie und der braunäugigen Tochter gewesen ist, beschließt er, sich hier niederzulassen.
Er findet ein kleines Zimmer in einem Gasthof am Stadtrand. das heißt eine Stunde Gehzeit bis ins Stadtzentrum, mehr kann er sich nicht leisten und das auch nur noch für ein paar Wochen. Er muss Arbeit finden und verbringt Tage damit, von Schneiderei zu Schneiderei zu ziehen. Er betritt sie aber nicht, lässt nur das Schaufenster, Schnittmuster und Probekleider auf den Puppen auf sich wirken. Abends notiert er dann jeweils die beiden Läden, deren Schaufenster am meisten Eindruck auf ihn gemacht haben.
Schnell sind auf seiner Liste zwanzig Schneidereien vorgemerkt, bei denen er zügig vorsprechen will. Die ersten zehn Gespräche sind ernüchternd.
Woher, aus Schweden? Schlechtes Deutsch? Keine Zeugnisse? Kein Meisterabschluss? Andere Stichtechniken, andere Mode - wenn man von Letzterem im hohen Norden überhaupt sprechen kann. Wie er sich denn das alles vorstelle.
Soviel Gegenwind deprimiert ihn. Aber abends im Bett erinnert er sich an die Worte seiner Mutter, die immer gesagt hat, wenn man es träumen kann, dann kann man es auch erreichen. Sagt gerade sie, aber daran will er jetzt nicht denken.
Jonas beschließt, weiter an seinem Traum zu arbeiten.
Am nächsten Tag beginnt er seine Vorstellungsrunde bei einem kleinen Betrieb gleich hinter dem Breslauer Rathaus. Klein aber fein, wie man an der Kundschaft sehen kann, die das Geschäft verlässt.
Ihm fällt sofort auf, wie ordentlich alles ist, mit welcher Hingabe die Stoffballen geschlichtet wurden, in ihrer Reihenfolge farblich aufeinander abgestimmt.
Als er eintritt, klingelt die Türglocke und aus einem hinteren Zimmer kommt ein schon älterer Herr den Gang entlang. Leicht gebückt, die Brille hochgesteckt im Haar, die Schneiderschürze voller Kreide, das Metermaß um den Hals und ein freundliches, warmes Lächeln auf den Lippen.
Was er denn für den jungen Herrn tun könne, fragt der Meister. So wie der Mann aussieht, kann er nur der Meister sein, denkt Jonas.
Und es sprudelt nur so aus Jonas heraus. Er erzählt was er kann, wie weit er gereist sei, wie sehr er arbeiten und wie sehr er seinen Traum verwirklichen wolle. Denn wenn man es träumen kann, dann könne man es auch erreichen.
Der Meister lässt seine Brille vom Haar auf die Nase fallen, mustert ihn von Kopf bis Fuß, greift nach seinen Händen, sieht sich die Handflächen und Finger an, dreht ihn einmal um die eigene Achse und sagt: »Gut junger Mann, dann morgen um sieben Uhr. Und seien sie pünktlich.«
Jonas verschlägt es die Sprache. Er will noch große Dankesworte auf den Weg bringen, aber der Meister lässt ihm dafür keine Zeit und geht zurück in sein Arbeitszimmer, noch schneller als er von dort gekommen war.
Am nächsten Morgen steht Jonas bereits eine halbe Stunde früher in Sichtweite der Schneiderei. Er ist so aufgeregt, dass er auf keinen Fall zu spät kommen will. Um Punkt sieben steht er dann auf den Stufen zur Schneiderei und da ist es wieder, dieses warme, freundlich Lächeln, und es sperrt ihm die Tür auf.
Meister und Geselle werden schnell vertraut, als hätten sie schon ewig miteinander gearbeitet. Der Meister zeigt Jonas, was in Breslau gerade Mode und gewünscht ist. Jonas zeigt dem Meister ein paar Kunststiche, die in Schweden Tradition sind. Und bald entsteht aus diesem Austausch ein unverkennbarer Stil, den es in ganz Breslau nur bei ihnen gibt.
Der Kundenkreis wird grösser, bunter und vornehmer. Selbst aus dem fernen Wien reisen Damen an, um sich etwas Besonderes nähen zu lassen.
Jonas liebt seine Arbeit, jeder Tag ist Glück, und der Meister ist ein wahrer Meister, das ganze Gegenteil vom Meister in Schweden.
Im November zieht ein strenger, viel zu früher Winter in die Stadt und der Arbeitsweg wird für Jonas immer beschwerlicher und länger.
Das entgeht dem Meister nicht. Er lebt alleine, war nie verheiratet und hat keine Kinder. Das Haus ist eigentlich viel zu groß für ihn, aber es gab kein kleineres als er seine Schneiderei gründete. Eines Morgens als Jonas schnee- und eisbedeckt den Laden betritt, fasst er sich ein Herz und bietet ihm an, das Zimmer im zweiten Stock zu beziehen.
Und wieder ist Jonas sprachlos.
Noch am selben Abend packt er seine Habseligkeiten in den Jutesack, es sind immer noch gleich wenige wie damals, als er von zuhause fortging.
Am nächsten Morgen ist er früher im Geschäft, geht durch den Laden schnurstracks in den zweiten Stock und legte seine Jutesack auf das Strohbett, über das der Schneider eine dunkelbraunes Tuch geworfen hatte, fortan sein Laken und das edelste Stück das er bis auf weiteres besitzen wird.
Danach macht er sich an die Arbeit, der Meister lächelte und er auch.
Zeit der Arbeit, Zeit der Dankbarkeit.
Es folgen Jahre beharrlicher, harter aber gern getaner Arbeit. Jonas perfektioniert sein Deutsch, lernt neue Stiche und Schnitte und sitzt oft nächtelang über Entwürfen von neuen, zeitgemäßen Modellen, die er dem Meister am nächsten Tag vorstellen will.
Alles geht ihm leicht von der Hand, denn im Gegensatz zu seiner Lehrzeit in Schweden werden sein Einsatz, seine Kreativität und seine Phantasie hier geschätzt.
So kommt es, das nach und nach immer mehr seiner Ideen ihren Weg in die Stoffe und auf die Schaufensterpuppe finden. Und das ist eine Ehre, denn sie haben nur eine solche Puppe, deren Anschaffungswert viele Monate Nähen bedeutet.
Die Schneiderei Beil, das ist der Nachname des Meisters, wird schnell stadtbekannt. Sie steht für Qualität, Extravaganz und besten Kundenservice.
Der Meister ist überglücklich, das Leben hat ihm eine Familie verwehrt, aber nun ist Jonas da und manchmal, wenn er ihn so aus den Augenwinkeln heraus beobachtet, dann sieht er in ihm fast einen Sohn. Der Gedanke macht ihn froh, nimmt ihm die Schwermut der letzten Jahre. Ja, und im Haus ist nun auch mehr Leben. Jonas kocht oft für den Meister, danach sitzen sie noch beisammen und reden über dies und jenes und über den nächsten Arbeitstag.
Nach wenigen Monaten sind sie ein eingespieltes Team, so als hätte es den einen nie ohne den anderen gegeben.
Das Jahre verfliegen und es sind die besten, die die Schneiderei je gesehen hat. Andreas und Jonas fehlt es an nichts, sie haben sich einen kleinen Wohlstand erarbeitet.
Sie schreiben das Jahr 1878. Der Winter zieht mit Eiseskälte und klirrenden Schrittes durch die Stadt. Ihre Auftragsbücher sind so voll, dass sie neue Kundschaft auf nach Weihnachten vertrösten müssen.
Und als Jonas mit ebenso einem Neukunden den Kalender nach einem möglichen Termin durchforstet, sieht er neben den Büchern einen Brief der Stadt offen liegen, in dem der Bürgermeister dem Meister
zu seinem bevorstehenden siebzigsten Geburtstag am achten des Monats gratuliert.
Jonas tut so, als hätte er das Schreiben nicht gesehen, notiert einen Termin für die neue Kundschaft, schließt das Pult, der auch als Kasse dient, wieder ab und kehrt zu seiner Arbeit zurück.
Bis zum Jubiläum des Meisters bleiben ihm noch vier Tage und neben der Arbeit springen seine Gedanken von einer Idee zur anderen, wie er dem Meister wohl eine Geburtstagsfreude bereiten kann.
Von einem gemeinsamen Essen im noblen Gasthof gleich neben dem Rathaus - das ein Viertel seines Monatslohnes verschlingen würde - zu einer Kutschenfahrt durchs winterliche Breslau - bei der sie sich beide eine deftige Grippe holen könnten - bis zu einem Eintagesausflug in die Hofreitschule des kaiserlich schönen Wiens - von dem sie möglicherweise erst am nächsten Tag zurückkehren würden.
Alle Ideen scheinen ihm zu riskant, denn sie können sich keinen Geschäftsausfall leisten, schon gar nicht vor Weihnachten.
Letztendlich entscheidet er sich für ein Abendessen, das er kochen würde, ein ganz besonderes, und einen Umhang aus Walkstoff, den er nach einem Muster schneidern würde, das er in einer französischen Zeitschrift gesehen hat.
Der Speiseplan ist schnell zusammengestellt. Es wird ein schwedischer Abend, mit einer Art Fleischeintopf, dazu soll es geschmortes Gemüse geben, als Nachspeise wird er Zimtschnecken aufwarten, so wie sie die Mutter gemacht hat, der er oft beim Kochen geholfen hat. Zu oft für den Geschmack des Vaters, der immer sagte, er hätte besser ein Mädchen werden sollen, wenn er ihn in der Küche am Werken sah.
Morgen wird er ausziehen, um alle Zutaten zu kaufen. Der Meister darf davon nichts bemerken, also wird er vor der Arbeit auf den Frühmarkt laufen und die erstandenen Zutaten dann unter seinem Bett oder auf dem Dachboden in der Kälte lagern.
Den Walkstoff wird er in Bielitz oder Biala besorgen, das ist eine kleine Reise, die er daher für Samstag einplanen muss. Damit bleibt eine Nacht für die Näharbeiten, aber das trifft sich gut, denn der Meister wird übers Wochenende aufs Land zu einer Hochzeit fahren.
Der Frühmarkt ist eine chaotische Sache, noch ist nichts an seinem Platz, einige Händler kommen überhaupt erst an oder sind verspätet. Es bedarf also einer gewissen Geschicktheit in dem Durcheinander fündig zu werden.
Hefe, Mehl, Zucker - viel Zucker - Eier und Zimt für die Nachspeise sind kein Problem.
Aber beim Fleisch wird es schwierig. Die Metzger bieten großteils Schwein an, eine Fleischart, die zuhause nie verwendet wurde und die ihn anekelt. Er zieht die Marktreihen auf und ab. Die Mutter hatte
immer Rentierfleisch verwendet, das musste er nun irgendwie ersetzen, denn in Schlesien gibt es keine Rentiere. Außer Schwein wird nur Hase, Geflügel und Rind angeboten, und obwohl letzteres sehr teuer ist, entschließt er sich dafür, da es am ehesten wie das Fleisch in Mutters Eintopf aussieht.
Nun noch etwas Gemüse, dann hat er alles zusammen. Das Brot will er dann am Geburtstag morgens frisch besorgen und vielleicht auch noch ein kleine Flasche Wein. Den soll es ja nun auch hierzulande geben, hat er gehört.
Am Samstag reist der Meister früh ab. Jonas bedient noch drei Kunden und macht sich dann nach der Mittagssuppe auf den Weg nach Bielitz. Er ergattert einen billigen Kutschenplatz.
Sie fahren übers Land, weiter ein armes sobald man die Stadt verlässt. Die Industrialisierung und der Wohlstand konzentrieren sich noch immer auf die Städte, der kleine Mann auf dem Land fristet ein tristes Leben. Meist reicht es nicht für das Nötigste.
Mit jedem Meter, den sie Bielitz näher kommen, wandelt sich das Bild. Die Häuser werden bürgerlich bis nobel, es gibt schöne Alleen und das Zentrum ist prachtvoll. Manchen nennen die Stadt ,kleines Paris’. Die Textilfabriken liegen am anderen Ende der Stadt, an der Grenze zu Biala, ursprünglich ein Bauerndorf, das kontinuierlich gewachsen ist und nun fast nahtlos an Bielitz anschließt. Zwischen den beiden Städten liegt nur noch der Fluss.
Die Fabriken sind beeindruckend, so etwas hat Jonas noch nie gesehen. Hinter den Fabriken in den Straßen Bialas findet man viele Geschäfte und auch Schneidereien mit den schönsten Waren und unzählig vielen Stoffsorten.
Angekommen schlendert Jonas durch die Gassen und wählt dann am Ende einen Laden, dessen Auslage ihn farblich am meisten anspricht. Sie ist schlicht in Weiß, Schwarz und Erdtönen gehalten, sehr edel. Auf den Stoffen sind Silberknöpfe arrangiert und ein kleines, handgeschriebenes Schild mit dem Warenangebot und einigen Preisen gibt ihm das Gefühl, hier ist man in guten Händen.
Er tritt in das sehr geräumige Geschäft ein - es gibt sogar eine Stoffsitzbank mit Kaffeetisch - und eine Dame mittleren Alters begrüßt ihn und fragt, was sie für ihn tun könne. Ja, Walkstoffe habe man ganz neu im Angebot und noch im Lager, da sie erst heute eingetroffen seien. Sie werde einige Ballen holen und gleich wieder da sein. Alleine im Geschäft sieht Jonas die Eigentümerurkunde an der Wand hängen und liest den Namen Beil, Ewald und Johanna Beil, Schneidermeistereiurkunde aus dem Jahr 1838.
In dem Moment hört er wie Stoffballen auf den Ladentisch fallen, er geht zum Tisch und begutachtet die Ware. Wie edel und schön, denkt er, und wagt es kaum, nach dem Preis zu fragen.
Doch heute ist sein Glückstag, die Dame sagt, er bekomme den Stoff zum halben Preis, da er der erste Kunde sei, der nach Walkstoff frage.
Jonas berechnet schnell überschlagsmäßig, wieviel Meter er für den Umhang benötigen würde. Als Farbe wählt er ein helles Mahagonibraun, dazu kauft er drei altsilberne, schlichte Knöpfe und das passende Garn.
Er bezahlt, verabschiedet sich, tritt auf die Straße und als er nochmals zurückblickt, sieht er einen Mann aus einem hinteren Zimmer zur Frau in den Laden treten. Es ist ein älterer Herr, der ihn an seinen Meister erinnert.
Einbildung denkt er - Schneider sehen eben oft gleich aus - und geht zur Kutschenstation, wo er einige Stunden auf einen freien Platz in der letzten Kutsche warten muss.
Er kommt weit nach Mitternacht zuhause an und macht sich auch gleich ans Nähen.
Der Walkstoff ist anders, weicher, wärmer, in der Verarbeitung fast schon entgegenkommend. Er zeichnet, schneidet, zeichnet nochmals nach und wählt eine extravagante Position für die Knöpfe. Nach wenigen Stunden ist der Umhang fertig, in der Zeitung hat er gelesen, diese Art von modernem Umhang heiße Cape.
Zum Abschluss hängt er das Cape auf die Puppe, um zu sehen, wie der Stoff fällt.
Schön ist es geworden, wirklich gut gelungen.
Und wie er es so betrachtet, übermannt ihn die Müdigkeit und er schläft am Tisch im Laden ein.
Die Puppe in ihrem neuen Gewand bleibt im Schaufenster stehen und blickt in eine Winternacht, die der Schnee weiß eingefärbt hat.
5
Malbec
Ja, himbeer-hölzerner Malbec, erzähl mir von der Liebe, oder nein, lass mich besser dir von ihr erzählen.
Anne nimmt einen kräftigen Schluck Wein, es ist ihr zweites Glas. Und mit jedem Tropfen werden die Gedanken freier. Es ist Mittag und während der Wein sich um ihre Seele kümmert, befriedigt frisch gebackenes Brot mit geschmolzenem Käse in einem Staubgefäß ihren Magen. Das ist eine ihrer Leibspeisen, wenn sie in Buenos Aires ist, geschäftlich versteht sich von selbst, denn für Urlaubsreisen fehlt ihr die Zeit oder besser gesagt die Bereitschaft, schon wieder in ein Flugzeug zu steigen.
Also liebe Liebe, hier sitzen wir nun im tierverschneiten New York und endlich kannst du mir einmal nicht davonfliegen und musst dir in Ruhe anhören, was ich von dir denke.
Während ich fortwährend versuche, mich mit dir um dich und mich und die anderen zu drehen und zu winden, scheinst du eine ganz klare, wahrscheinlich rote, Linie zu haben. So eine Art Drehbuch für jeden Menschen und manchmal für Familien.
Aber vielleicht sehe ich das jetzt durch den Wein zu emotional, denkt Anne vor sich hin.
Tatsache ist, der Vater sagte einmal »Anne, du hast wie ich einfach kein wirkliches Glück in der Liebe«.
Falsch, lieber Vater - ich wünschte, ich hätte dir damals schon so antworten können - die Liebe hat kein Glück mit mir, weil keines ihrer Drehbücher meinen Ansprüchen und Vorstellungen gerecht wird.