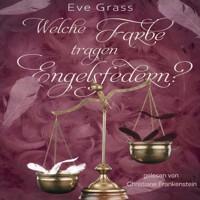Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Shadodex - Verlag der Schatten
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In den eiskalten Raunächten 1929 bangen die Einwohner von Eisenhütt um ihr Überleben. Ein Wesen aus uralter Mythologie wird daher um Hilfe gebeten. Doch die sogenannte »Gehörnte« fordert dafür eine menschliche Seele. Niemand ahnt, dass das ausgewählte Mädchen damit eine große Bürde übernehmen wird. Theresia Bauer ist ein ganz besonderer Mensch. Sie ist vom »dunklen Engel« dazu auserwählt, die Waagschalen der Ewigkeit wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Im Laufe ihres Lebens verblasst die Erinnerung an diese essenzielle Aufgabe aber immer mehr. Mit fatalen Folgen, denn die Waage, in der nicht weniger als das Wohl der Weltbevölkerung liegt, gerät immer mehr aus dem Lot und die Menschen vergessen die »Gesetze der Ewigkeit«, welche ihre Existenz auf Erden sichern. Religionen lehren uns seit Tausenden von Jahren, dass wir uns gegen das Böse zur Wehr setzen müssen. Doch wer definiert eigentlich, was gut und böse ist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Welche Farbetragen
Engelsfedern?
vonEve Grass
Alle Rechte, insbesondere auf digitale Vervielfältigung,
vorbehalten.
Keine Übernahme des Buchblocks in digitale Verzeichnisse, keine analoge Kopie ohne Zustimmung des Verlags.
Das Buchcover darf zur Darstellung des Buches unter Hinweis auf den Verlag jederzeit frei verwendet werden.
Eine anderweitige Vervielfältigung des Coverbilds ist nur mit Zustimmung des Verlags möglich.
Die Handlungen sind frei erfunden.
Evtl. Handlungsähnlichkeiten sind zufällig.
www.verlag-der-schatten.de
Erste Auflage 2024
© Eve Grass
© Coverbilder: Depositphotos MarcoGovel, VadimVasenin
Covergestaltung: Bookcover4everyone by Tom Jay (www.tomjay.de)
© Bilder: Depositphotos krzysztof12 (schwarze Feder), Dr.PAS (weiße Feder)
Eve Grass (Gehörnte, Brosche, Autorenfoto)
Lektorat: Shadodex – Verlag der Schatten
© Shadodex – Verlag der Schatten, Bettina Ickelsheimer-Förster, Ruhefeld 16/1, 74594 Kreßberg-Mariäkappel
printed in Germany (www.wir-machen-druck.de)
ISBN: 978-3-98528-031-5
In den eiskalten Raunächten 1929 bangen die Einwohner von Eisenhütt um ihr Überleben. Ein Wesen aus uralter Mythologie wird daher um Hilfe gebeten. Doch die sogenannte »Gehörnte« fordert dafür eine menschliche Seele. Niemand ahnt, dass das ausgewählte Mädchen damit eine große Bürde übernehmen wird.
Theresia Bauer ist ein ganz besonderer Mensch. Sie ist vom »dunklen Engel« dazu auserwählt, die Waagschalen der Ewigkeit wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Im Laufe ihres Lebens verblasst die Erinnerung an diese essenzielle Aufgabe aber immer mehr. Mit fatalen Folgen, denn die Waage, in der nicht weniger als das Wohl der Weltbevölkerung liegt, gerät immer mehr aus dem Lot und die Menschen vergessen die »Gesetze der Ewigkeit«, welche ihre Existenz auf Erden sichern.
Religionen lehren uns seit Tausenden von Jahren, dass wir uns gegen das Böse zur Wehr setzen müssen. Doch wer definiert eigentlich, was gut und böse ist?
Inhalt
Prolog
Alles begann im Winter 1929
Im Frühling 1930
Einzug des Herbstes 1936
Der Winter 1936 klopft an
Ende 1936
Letztes Kriegsjahr 1945
Kurz darauf
Harte Nachkriegszeit
Die 50er-Jahre brechen an
Hochzeit im Jahr 1954
Ehealltag Mitte der 50er-Jahre
Nachwuchs kündigt sich an 1956
Im Frühling des Jahres 1957
Mai 1957, Geburt des Kindes
Sommer 1957
Im Frühling 1958
In der darauffolgenden Nacht
Anfang des Jahres 1959
Am Morgen darauf
Tristesse einer Ehe um das Jahr 1963
Einzug ins Eigenheim 1965
Ein paar Tage später
Tragischer Sommer 1965
Am selben Tag
Beerdigung, einige Tage später
Am Nachmittag des tragischen Tages
Eine Woche später
Besuch beim Kinderpsychiater 1966
Nur kurze Zeit danach
Vierzehn Tage vergehen
Der Weg führt bergab, Herbst 1977
Am darauffolgenden Tag
Im Sommer des Jahres 1982
Zwischen den Jahren 1983 und 1984
Zeitgleich passiert Ungewöhnliches
Zur selben Zeitin Theres’ Wohnzimmer
Derweil in anderen Sphären
Minuten danachgestalten die Zukunft 1984
Beginn eines neuen Jahrtausends
21 Jahre später,die Uhr zeigt fünf vor zwölf
Showdown 2021
Epilog
Über die Autorin
Prolog
Mit hochrotem Gesicht quälte sich der Mann keuchend durch hüfthohen Schnee den Pfad hinauf. Eine flackernde Fackel zauberte dämonenhafte Lichtspiele auf die glitzernde weiße Pracht. Primitive Schneeschuhe verhinderten das Einsinken.
»Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder.«
Es würde weiterhin schneien und die Einwohner des Dorfes in eine Katastrophe stürzen.
Während er sich mit zitternden Beinen weiter bergan kämpfte, formten sich schlimme Szenen in seinem Kopf. Junge und Alte, löchrige Tücher um die Häupter gewunden, drängten sich in die Kirche, um bei der Heiligen Mutter Schutz zu finden. Magere, vom Arbeiten gerötete Finger verschränkten sich ineinander, beteten in stiller Inbrunst. »… Jetzt und in der Stunde unseres Todes …« Aber die blau gewandete Madonna stand weiterhin stumm auf ihrem Podest, wiegte ihr Neugeborenes im Arm und schaute mit mildem Blick auf die frierenden Dorfbewohner herab. Warum prüfte Gott die Seinen so sehr? Dieser Winter schien alles Leben verschlucken zu wollen.
Er musste zum Hochfels aufsteigen, und keiner durfte ihn dabei beobachten. Das war er den armen Leuten im Dorf schuldig.
Nach einer unendlich erscheinenden Wanderung durch den Wald öffnete sich der schmale Pfad ein wenig, und im Licht der Fackel erschien grauer Fels, der beinahe senkrecht vor ihm aufragte. Durch den Nebel des eigenen Atems hob er den Blick, dann sackte sein magerer Körper auf die Knie.
Der Stein trotzte hier seit Jahrmillionen dem Wind, dem Regen und dem Schnee. Weder Hitze noch Kälte noch Erdbeben hatten ihn je erschüttert. Es war, als hätte Gott den Fels für die Ewigkeit erschaffen. Geknickte Baumstämme, die sich wie Zahnstocher eines riesenhaften Wesens um seine Talsohle gruppierten, zeugten von der Vergänglichkeit des Lebens.
Der steif gefrorene Körper eines toten Rehs lag unter den kahlen Ästen eines Brombeerstrauches. Doch die Augen des Mannes starrten weiter hinauf in das Dunkel der Winternacht, dorthin, wo der Fels mit dem Himmel verschmolz. Er senkte die Fackel ein wenig. Die Kälte drang unerbittlich durch seine wollene Kleidung.
»Hilf uns, Gehörnte«, flüsterten die rauen Lippen.
Dass er eine Sagengestalt aus dem Bayerischen Wald anrief, kam ihm absurd und unwirklich vor. Aber besonders bei der älteren Bevölkerung aus dem Dorf und auch dem benachbarten Böhmisch Eisenstein existierte die gruselige Hexe seit Urzeiten in den Köpfen. Außerdem erinnerte er sich dabei an seine Jugend, die er in einem winzigen Weiler nahe Kötzting verbracht hatte.
Immer wieder war ihm als Bub ein scheußlicher Teufel im Traum erschienen, der ihn nicht nur erschreckte, sondern auch lockte. Wie sehr hatte er sich einst zum Geburtstag ein Fahrrad gewünscht, aber nie bekommen, weil die Eltern bettelarm waren. Nie würde der Mann vergessen, als ihm Beelzebub des Nachts zugeflüstert hatte: »Nimm dir, was du möchtest. Braucht ja keiner zu erfahren, wo du es herhast, Bursche. Du hast es in der Hand, entscheide, ob du so enden willst wie all die anderen armen Trottel.«
Natürlich hatte er niemals ein Rad gestohlen. Aber eine Tüte mit Karamellbonbons war daraufhin in einer Tasche seiner viel zu weiten Hose verschwunden, als er für die Mutter im Kramerladen ein Viertelpfund Butter besorgte.
Die Zuckerstückchen waren ihm nicht bekommen. Das schlechte Gewissen, welches ihn täglich heimgesucht hatte, verwandelte die Bonbons in bittere Medizin.
Bald hatte er deswegen den Mut gefasst, dem Traumteufel die Stirn zu bieten, und ihn in die Schranken verwiesen mit den Worten: »So will ich nicht sein, du garstiger Quertreiber. Ich möchte für das Wohl der Menschen da sein, solange ich auf dieser Welt verweile.«
Da wandelte sich die Ausgeburt der Hölle in den Heiligen Sankt Leonhard, den er aus dem Religionsunterricht kannte, und antwortete: »Du hast deine Wahl getroffen.«
Von dem Tag an träumte er nicht mehr von dunklen Gestalten. Und beim Kramer hatte er sich für den dreisten Diebstahl auch entschuldigt. Auf die Prügel des Vaters, die er danach bezogen hatte, war er heute noch stolz.
Ein Kauz schrie im Wald, ansonsten war nichts zu hören. Bange Sekunden lauschte der Mann in die Dunkelheit, dann erhob er sich aus dem knirschenden Schnee. Eine salzige Träne rann ihm die Wange hinab, während er die Fackel wieder anhob, um den Rückweg auszuleuchten. Die Spuren seiner Schneeschuhe waren deutlich zu erkennen.
Er wandte sich zum Gehen, und die Enttäuschung, keine Antwort erhalten zu haben, schmerzte in diesem Moment mehr als die klirrende Kälte. Doch während er seufzend den ersten Schritt tat, veränderte sich nahe dem Fels etwas. Ein grauer Schleier bildete sich in der Höhe und wand sich um den Stein wie hauchzarter Stoff. Langsam glitt das durchscheinende Gebilde herab.
Wieder setzte er einen Fuß in den Schnee, aber diesmal klang das Knirschen der primitiven Schneeschuhe fast wie unheimliche Worte. Er hielt mitten in der Bewegung inne.
»Was willst du, Mensch?«
Bebend drehte er sich um. Der Fackelschein erhellte den Stein, an dem der wallende, unheimliche Schleier herabglitt, als wäre er nicht von dieser Welt. Zwischen dem Totholz sammelte sich die Masse und richtete sich zu einem schemenhaften Wesen auf. Im Licht des Feuers schälte sich eine Frauengestalt aus dem Grau. Gewundene Hörner ragten aus deren Haupt und verliehen den düstersten Befürchtungen Realität. Ein Schreck jagte ihm durch den Leib, als er erkannte, dass die Erscheinung Flügel trug. Sie bewegten sich hauchzart, und ihre Schatten tanzten im Licht der Fackel. Die Federn daran wirkten weiß, aber die Nacht verlieh ihnen dunkle Nuancen. So hatte er sich das weibliche Ungeheuer aus den Sagen seiner Heimat wahrlich nicht vorgestellt. Eine Mischung aus Dämon und Engel stand ihm gegenüber.
Welche Farbe tragen Engelsfedern?,fuhr ihm durch den Sinn, aber er verdrängte den Gedanken, den viele Einheimische als gotteslästerlich bezeichnet hätten. Die Gestalt, die sich hier zeigte, konnte kein Gottesbote sein.
Hastig senkte der Mann den Blick und fiel erneut auf die Knie. Dieser Anblick war mit den Träumen seiner Kindheit nicht zu vergleichen. Er lag nicht in einem warmen Bett, und der Nachtmahr wäre mit dem abrupten Öffnen der Augen auch nicht vorüber. Er war hierhergekommen, um Hilfe zu erbitten, aber die Angst vor der Erscheinung raubte ihm den ohnehin spärlichen Atem. Doch was hatte er für eine Wahl?
»Der Winter setzt dem Dorf so sehr zu, dass viele Menschen den Tod finden werden«, jammerte er frierend. »Die Kirche ist mit Verzweifelten gefüllt, doch Gott erhört uns nicht. Und zu allem Überfluss erwartet die blutjunge Ehefrau vom Xaver in den nächsten Tagen ihr erstes Kind.«
Leichter Wind kam auf und ließ die pulvrige Schicht des Schnees aufwirbeln. Tausend winzige Diamanten tanzten im Feuerschein wie Irrlichter.
Die zischende Stimme der Erscheinung antwortete ihm unmittelbar: »Wieso machst du Gott für die Jahreszeiten verantwortlich? Auf einen harten Winter folgt stets ein Sommer. Alles auf dieser Welt ergibt einen Sinn. Die Kräfte müssen ausgeglichen sein, Mensch. Ich denke, das ist dir bewusst. Deswegen verzeih ich dir die Störung, auch wenn ich deine Angst bis in den Himmel hinauf riechen kann.«
Die Fackel drohte zu erlöschen. Hastig positionierte sie der Mann hinter seinem Rücken. Er würde den Rückweg ohne das lebensspendende Licht nicht mehr finden und im Wald elend erfrieren, so wie das Reh zwischen den Sträuchern.
Die geisterhafte Stimme begann zu lachen. Es hörte sich an wie das Keckern von Kindern auf einer Sommerwiese. »Ihr werdet den Winter alle überleben. Du hast mein Wort. Kehre zurück ins Dorf und spende den Deinen Trost. Aber bedenke …« Ein heftiger Windstoß fegte über die Lichtung vor dem Hochfels. »Eine Seele schuldest du mir mit dieser Bitte. Sie muss die Waagschale ins Gleichgewicht bringen. So will es das ewige Gesetz.«
»Die Seele wirst du bekommen«, bestätigte der Hagere, erhob sich aus dem Schnee und wandte sich zum Gehen. Diese Forderung würde er nicht erfüllen und in den nächsten Stunden einen Plan entwickeln. Vielleicht gelänge es ihm, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen? Es war doch der Teufel, oder einer seiner Handlanger, der gerade zu ihm sprach? Mit Willenskraft verdrängte er die aufkommenden Zweifel, die ihn zwickten wie Ameisen unter den Hosenbeinen. War seine schnelle Zusage klug gewesen? Manchmal waren Gottes Wege unergründlich, und doch musste man sie beschreiten.
»Es sind Zwillinge, die in den Raunächten geboren werden. Und eines der Kinder – ein Mädchen mit großem Verstand – werde ich prägen. Es ist an der Zeit, wieder starke Charaktere unter die Menschen zu mischen, die in der Lage sind, den richtigen Pfad zu erkennen. Denn viele von euch sind blind«, flüsterte die Stimme ihm hinterher, bevor sie in einem sanften Lufthauch verstummte und zusammen mit der sich auflösenden Frauengestalt den Fels hinaufkroch, um mit der Dunkelheit zu verschmelzen.
Der frierende Kerl erschauderte zutiefst, aber er wagte es nicht, ein weiteres Wort an die mystische Gestalt zu richten. Die Gehörnte hatte Macht, darüber wussten besonders die Alten und Weisen zu berichten. Viele dunkle Geschichten grassierten insbesondere an den Stammtischen der Wirtshäuser. Auch wenn der liebe Gott den Aberglauben der Dorfbewohner missbilligte, die weibliche Erscheinung vom Hochfels war bekannt und gefürchtet. Man sollte sie niemals erzürnen. Aber manchmal – das würde nie ein Eisenhütter Bürger während der Beichte in der Kirche zugeben – hatte sie dem einen oder anderen schon aus einer misslichen Lage geholfen. Wie hoch der Preis dafür gewesen war, konnte er nur erahnen.
Mit einem tiefen Atemzug packte er die lodernde Fackel entschlossen fester und hielt sie vor sich. Dann stapfte er den steilen Pfad wieder hinab. Die versprochene Seele bekäme das garstige Dämonenweib nicht. Da gab es die Taufe, die heilige Kommunion und die Aussegnung, wenn das Leben zu Ende ging.
Beinahe hätte er bei dem Gedanken gelächelt. »Du sollst nicht lügen«, lautete das achte Gebot Gottes. Den Teufel getäuscht zu haben, würde ihm selbst der Heiland gnädig verzeihen.
Während des Abstiegs verschloss er die unheimliche Wanderung in einer geheimen Kammer seines Kopfes. Niemand durfte je erfahren, was er getan hatte.
Alles begann im Winter 1929
Eiskalte Flocken rieselten herab und ließen die kahlen Äste der Laubbäume am Straßenrand erstarren. Hinter den durch gekreuzte Sprossen geteilten Fensterchen schimmerte Licht. Aus den Kaminen drang Rauch und verband sich mit dem bleigrauen Himmel, als wolle er den harten Winter zurückdrängen.
Der Frost hielt das Dorf am Fuß des großen Albsteines fest im Griff. Die Raunächte demonstrierten ihre Macht. Vor Mitte April würde der Schnee wohl nicht schmelzen und die Einwohner von Eisenhütt auf eine harte Probe stellen. Man lebte von den wenigen Kartoffeln, die im Keller lagerten, der fetten Milch von den vereinzelten Bauernhöfen rund um das Dorf und den Erzeugnissen von Bäcker und Metzger, sofern die Zufahrtsstraße nach Zweiweil befahrbar war. Pfarrer Otto Seidl predigte jeden Sonntagmorgen eifrig von der Kanzel der Kirche, die Mutter Gottes um einen baldigen Frühling anzuflehen. Besonders die Alten taten dies auch. Dick eingepackt in Mantel und Schal suchten sie Zuflucht im ungeheizten Gotteshaus, um den tröstlichen Worten des Geistlichen zu lauschen.
Den Launen der Natur waren die Bewohner des Albsteintals seit jeher ausgesetzt. Ackerbau war durch die hügelige Landschaft so gut wie ausgeschlossen. Die kargen Gemüsebeete, die man in Häusernähe anlegte, hütete man wie einen Augapfel. Die wenigen Viehweiden waren nur von Juni bis September benutzbar, da der Rest des Jahres von den rauen Ostwinden dominiert wurde. Kalte Luftströme aus dem Böhmischen ließen Kühe und Ochsen erkranken. Die Bauern fuhren im kurzen Sommer reichlich Heu ein, um die Versorgung der Tiere zu sichern. Wenn wochenlang Regenwolken über den Albstein ins Tal zogen, musste das getrocknete Gras gefüttert werden. Ziegen waren genügsamer. Man schätzte sie wegen ihrer gut verträglichen Milch und des feinen Käses, den man daraus herstellen konnte. In der Abenddämmerung näherten sich manchmal Wolfsrudel aus den böhmischen Wäldern und rissen die gutmütig meckernden Tiere. Gelegentlich brachen sie sogar in die windschiefen Holzställe ein, wenn der Hunger sie dazu trieb. Sie ließen nur Fell und Knochen übrig, die die abergläubischen Bauern im Feuer verbrannten.
Wölfe, darüber munkelte man mit vorgehaltener Hand, trügen das Böse in sich. Durch ihre scharfen Augen spähe der Teufel seine Opfer aus. Deswegen schnitzten die Bergbauern während der dunklen Jahreszeit an Furcht einflößenden Holzmasken, mit denen sie zum Perchtenlauf ihre Gesichter verbargen. Böse Geister trieb man damit in die Flucht, daran glaubte jeder echte Waldler. Die Heilige Jungfrau Maria konnte ja nicht unter die Maske blicken und den Träger darunter entlarven. Aberglaube war verpönt, wenn man den Gottesdienst mit all seinen Heiligen und vor allen Dingen dem Herrn Pfarrer am Sonntag besuchen wollte.
Aus der Schlafkammer des Grenzhäuschens drang erschöpftes Stöhnen auf die verschneite Straße, die ins Böhmische hineinführte. Immer wieder durchmischten spitze Schreie das Jammern und Zetern.
Ludmilla, die Ehefrau des Holzfällers Xaver Bauer, lag seit beinahe vierundzwanzig Stunden in den Wehen. Sie gebar ihr erstes Kind. Ihre blassblauen Augen starrten angstvoll auf das Gesicht der Geburtshelferin. Ihr blondes Haar klebte an der Kopfhaut. Angst zeichnete ihre Gesichtszüge.
Die Hebamme wischte sich den Schweiß von der Stirn, obwohl es kühl in der Kammer war. Die versierte Wehfrau wirkte verhärmt. Hunderte von Geburten hatte sie in Eisenhütt schon erlebt, aber immer wieder schmerzte sie der Anblick der jungen Weiber, die sich in unaussprechlichen Schmerzen im eigenen Blut auf dem Lager wälzten. Sie war strenggläubige Katholikin. Nie würde sie laut aussprechen, welche Gedanken ihr während einer Niederkunft immer wieder durch den Kopf schossen. Warum zeigte Gott keine Gnade mit den werdenden Müttern?
»Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen!«1
Die Erbsünde, das war natürlich ein ernstes Thema. Eva hatte im Paradies schwer gesündigt. Doch ein Blick auf die Schwangere rührte das Herz der Hebamme an. Diese brave Frau sollte nicht so hart für die Tat von Adams Weib büßen müssen. Was hatte sie schon Böses getan? Ludmilla war die Tochter eines Glasbläsers aus Zweiweil. Von Kindesbeinen an hatte sie hart gearbeitet, immer nach dem Schulunterricht, weil ihre Mutter mit Schwindsucht im Bett lag und ihre kleinen Geschwister Hilfe benötigten. Später war der Holzfäller aus Eisenhütt in ihr Leben getreten und heiratete sie, nachdem Bruder und Schwester in der Lage waren, sich selbst zu versorgen. Von Beginn an war ihm Ludmilla ein perfektes Eheweib gewesen. Sie hatte solch schlimmes Leiden nicht verdient, Sündenfall hin oder her. Das würde die Hebamme vor dem Herrn Pfarrer jedoch niemals laut aussprechen.
Das Kindlein wollte nicht geboren werden. Die Gattin von Xaver Bauer kämpfte schon viel zu lange gegen die unsäglichen Schmerzen. Bald käme die Zeit, um den Schädel des Kindes mit einem Werkzeug anzubohren, damit er in sich zusammenfiel. So rettete sie wenigstens der jungen Frau das Leben. Nachwuchs könne Ludmilla noch genügend zur Welt bringen, sofern es Gott gefiele.
Ernst blickte sie auf die Gebärende hinab, die blass und ängstlich auf den blutdurchtränkten Laken ruhte. Entschlossen wandte sie sich ab, schlug das Tuch auf, in welchem sie ihr Werkzeug verwahrte, und schlurfte zur niedrigen Zimmertür, die sie sofort einen Spalt öffnete.
»Lauf geschwind, Xaver!«, rief sie in den eiskalten Flur hinaus. »Hol den Herrn Pfarrer her, damit er dem Kindlein die letzte Ölung gibt. Ich muss es mit Gewalt aus dem Bauch deiner Frau ziehen, sonst wird sie sterben.«
Die Hebamme wartete nicht auf eine Antwort. Sie wusste, dass der Holzfäller in der Ecke im Dunkeln lauerte, aus Angst um seine Gattin und das ungeborene Kind.
Kurz darauf huschte eine gebückte Gestalt auf der Straße in Richtung Dorf davon. Die Fußspuren wurden vom frisch fallenden Schnee sofort überdeckt.
In dem Moment fuhr Ludmilla auf dem Lager hoch. Schmerzverzerrt kniff sie die Augen zusammen, und mit einem irren Schrei fing sie an zu pressen. Die Hebamme eilte zu ihr und spreizte ihr die Beine, so weit es ging. Ein Köpflein mit wenig Haaren erschien im Licht der Petroleumlampe. »Heilige Maria Mutter Gottes …«, wisperte sie.
Vorsichtig umfassten ihre Hände, die mit Melkfett eingerieben waren, den Schädel des Winzlings. Mit jeder Presswehe arbeitete sich das Baby weiter nach vorne. Die Kreißende schrie ihren Schmerz hinaus, als sei sie von Sinnen.
»Gleich ist es geschafft, Ludmilla«, murmelte die Hebamme mit beruhigender Stimme. Stumm würgte sie das Mitleid, das sie für die junge Frau empfand, hinunter. Die starrte sie aus angstgeweiteten Augen an. Eine heftige Kontraktion trieb die Schultern des Neugeborenen heraus, dann glitt der winzige Körper in die Arme der Geburtshelferin.
»Gut gemacht! Es ist ein Mädel.« Sie lächelte der frischgebackenen Mutter aufmunternd zu, während sie behände die Nabelschnur durchtrennte. Doch Xavers Weib verzog abermals das Gesicht. Die Hebamme runzelte die Stirn, wickelte ein Tuch um das Baby und legte es in den Weidenkorb, der neben Ludmillas Lager stand. Hastig tastete sie deren Bauch ab.
»Jesus, Maria und Josef«, rief sie aus. »Da kommt ein zweites Kind.«
Xaver und der Herr Pfarrer betraten die Kammer. Beinahe eine ganze Stunde war vergangen. Die beiden Männer trugen Schnee herein, der sofort zu Pfützen auf dem sauber gescheuerten Holzboden schmolz.
Bleich, aber erleichtert saß die junge Mutter mit einem Federkissen im Nacken auf der Bettstatt. Sie wiegte zwei Neugeborene in ihren Armen, die sich seltsam ruhig verhielten. Kein Laut entwich den winzigen Mündern.
Xavers braune Augen wurden groß. Er hastete zu dem Lager aus dunklem Holz, fiel auf die Knie, und seine von der Arbeit gehärteten Hände versuchten Mutter und Kinder gleichzeitig an sich zu ziehen.
»Heiland im Himmel, ich danke dir!«, schluchzte er. »Meine Ludmilla lebt.«
»Die Kinder werden in der Nacht noch sterben«, murrte die Hebamme und schob sich verschwitzte Haarsträhnen aus dem Gesicht. »Sie atmen nur flach, schreien nicht und ihre Lippen sind blau.«
Der Holzfäller schien gar nicht zuzuhören. Er hatte nur Augen für seine Frau, die ihn erschöpft anlächelte.
Wenig später schritt Pfarrer Otto Seidl zur Tat. Mit geübtem Griff legte er sich die schwarze Stola über das Priestergewand, bevor er die todgeweihten Zwillinge auf den Namen Dorothea und Theresia taufte. Sie würden eingehen in Gottes Reich, auch wenn das nur ein schwacher Trost für die frischgebackenen Eltern sein dürfte.
»Durch diese heilige Salbung lasse dir der Herr nach …« Ruhig tönte Otto Seidls Stimme durch die spärlich beleuchtete Kammer. »… was immer du gesündigt hast.«
Irgendetwas im Raum veränderte sich.
Mit einem Mal schien die warme, friedliche Gemütlichkeit wie kalter Zigarrendunst durch ein unsichtbares Loch abzuziehen.
Aus dem Augenwinkel heraus erkannte der Pfarrer den grauen Schatten, der über den Herrgottswinkel der Stube glitt. Fast hätten die Finger, die er zuvor in das geweihte Öl getaucht hatte, zu zittern begonnen. Aber sein unerschütterlicher Glaube ließ ihn fortfahren. Das Böse würde ihm keinen Schaden zufügen können, solange er im Namen des Herrn unterwegs war.
Der geheimnisvolle Schatten, der wie Rauch das hölzerne Kreuz und die getrockneten Birkenreiser in der Zimmerecke umkreiste, wurde durchscheinender, bevor er sich auflöste. An den zuckenden Mundwinkeln der Hebamme erkannte er allerdings, dass auch sie die gruselige Erscheinung wahrgenommen hatte. Aber die fromme Frau schwieg ebenso, obwohl ihr Gesicht sich verfärbte, als sei es aus Kreide.
Erst als Otto Seidl die Salbung beendete und sich den Lodenmantel über die Schultern warf, flüsterte ihm die alte Wehfrau leise ins Ohr: »Beten Sie den Rosenkranz für die Kindlein, Herr Pfarrer. Der Leibhaftige schleicht um sie herum.«
Er ignorierte das Gefühl der Kälte, welches ihm über den Rücken nach oben kroch, lächelte gütig und antwortete ihr: »Das ist eine Selbstverständlichkeit, liebe Frau, und nun geh nach Hause. Wir können nichts weiter tun. Die Raunächte sind angebrochen.«
In diesem Augenblick begannen die Neugeborenen wie auf ein geheimes Kommando gemeinsam zu schreien. Ihre Brustkörbe unter den weißen Wickeltüchern hoben und senkten sich, als würden sie den Lebenswillen in die Welt hinausposaunen und über die Befürchtung der Hebamme spotten.
Der Pfarrer erschrak. Hier ging etwas nicht mit rechten Dingen zu.
Im Frühling 1930
Die Perchten, unheimliche Gestalten, mit ihren Fratzen und Hörnern waren bereits durch das Dorf gezogen, hatten mit ihren Schellen und ihrem grässlichen Gebrüll nicht nur die Kinder am Straßenrand eingeschüchtert, sondern auch den bitteren Winter. Für viele Eisenhütter Bürger war das nicht verwunderlich. Es gab so einiges zwischen Himmel und Erde, was man nicht real erklären konnte. Nicht umsonst blieben die uralten Mythen und Legenden in den Dörfern lebendig und wurden von Generation zu Generation weitergegeben.
Seit Tagen fiel kein Schnee mehr. Eine blank geputzte Sonne strahlte herab und verwandelte die Schneelandschaft rund um den Albstein in ein Märchenland. Die Verbindungsstraße nach Zweiweil war nun befahrbar, und beim Metzger gab es endlich wieder frische Blut- und Leberwürste zu kaufen, um die sich die Kunden balgten.
Auf dem Podest der Mutter Gottes in der Eisenhütter Kirche lagen Opfergaben. Getrocknete Blumen, Glasperlen, Münzen und sonstiger Zierrat verdeckten das Blattgold und zeugten von der Dankbarkeit der Kirchenbesucher. Das Dorf atmete auf. Der Winter war zwar noch nicht vorüber, aber es gab Hoffnung, die Jahreszeit noch heil zu überstehen.
Auch im Grenzhäuschen herrschte friedliches Glück. Das Gebäude war groß genug, um nicht nur der Holzfällerfamilie Bauer ein Dach über dem Kopf zu bieten. Der Zollbeamte – Xavers Bruder Ferdl mit Weib und vier Kindern – wohnte im ersten Stock.
Ludmilla hatte sich von der schweren Geburt inzwischen gut erholt. Ihre Wangen wirkten rosig, während sie in der Küche, die von beiden Familien benutzt wurde, einen deftigen Eintopf aus Rüben, Kartoffeln und Kesselfleisch zubereitete. Die Fußböden im Haus rochen nach Bohnerwachs, und aus der Schlafkammer im Erdgeschoss drang das Gekreische von zwei Säuglingen, die ihre Mutter auf Trab hielten. Theres und Dorle lagen Seite an Seite in einem übergroßen Weidenkorb und hatten ständig Hunger. Ihre kleinen Münder glänzten rot und prall. Theres hatte ihrer Schwester mit den winzigen Fingernägeln bereits einen Kratzer im Gesicht zugefügt, doch Ludmilla wollte ihren Mädchen noch nicht mit der Schere zu Leibe rücken. Eine Legende besagte, man solle einem Säugling niemals die Fingernägel schneiden. Die Gefahr, dass aus dem unschuldigen Kind ein Dieb werden könne, war hoch. Xaver würde sie für den Humbug zwar schelten, aber sie gab viel auf die Überlieferungen. Dass die Zwillinge die Geburtsnacht überlebt hatten, verband die junge Mutter mit ihren inbrünstigen Gebeten zur Jungfrau Maria und der Opfergabe, die im Herrgottswinkel prangte. Noch in derselben Nacht hatte sie eine Brosche aus funkelnden Granaten an das trockene Birkensträußchen vom letzten Fronleichnamsfest gehängt, weil auch sie den grauen Schatten in der Geburtsnacht bemerkt hatte, der schandhaft über den gekreuzigten Herrn Jesus gekrochen war. Das edle Schmuckstück hing noch immer da, allerdings fehlte ihm nun ein Steinchen. Xaver würde sie davon nichts erzählen, denn die Brosche stammte aus dem Nachlass ihrer verstorbenen Großtante. Es handelte sich um wertvolles Geschmeide, das Ludmilla in einer Holzkassette unter der Bettstatt aufbewahrte. Man konnte nie wissen, welche Notzeiten die Familie noch träfen. Das Gold und die Perlen der Verblichenen bedeuteten ihr nicht viel. Außer einem silbernen Kruzifix, das ihren schlanken Hals zierte, würde sie alles zu Geld machen, um ihren Lieben das Überleben zu sichern.
Zum Frühsommer siedelte sich eine Kramerfamilie in Eisenhütt an. Vinzenz und Margarete Sigl aus Bodenmais übernahmen den Kiosk nahe dem Hotel »Botschafter«, wo man bis vor einem Jahr noch Milchprodukte erwerben konnte. Nach dem Tod der Inhaberin war der Laden ein Jahr leer gestanden. Jetzt barg er bereits nach kurzer Zeit Spezereien, die das Herz eines jeden Dorfbewohners höherschlagen ließen. Duftende Seifen, Besen aus echtem Rosshaar, bunt gefärbte Sockenwolle und Stricknadeln füllten die Holzregale. Sogar Zeitschriften bot der sommersprossige Vinzenz mit seiner blütenweißen Schürze im Kiosk feil. Besonders die jungen Frauen aus dem Dorf verharrten oft vor der Auslage und betrachteten verträumt das Titelblatt der »Eleganten Welt«, auf welchem meist gertenschlanke Weibsbilder aus der Großstadt mit viel zu großem Ausschnitt an einem Getränk nippten, das in Eisenhütt völlig unbekannt war. Kritisch beäugt von den älteren Dorfbewohnern setzten sich die Kramer mit ihrem Angebot beharrlich durch. Das bequeme, moderne Leben verbreitete sich auch im Bayerischen Wald. Binnen kürzester Zeit verwandelte die Kramerfamilie das Dorf in eine fesche Kleinstadt. Niemand dachte mehr an die Entbehrungen des harten Winters. Die Opfergaben auf dem Sockel der Jungfrau Maria fielen irgendwann zu Boden, wo sie der Messner nach der heiligen Messe achtlos zusammenfegte.
Nur der hagere Mann, der im Frühling wieder heimlich zum Hochfels aufstieg, blieb skeptisch. Was wäre, wenn sich die Gehörnte doch noch die unschuldige Seele holen würde? Bisher war ihm nicht zu Ohren gekommen, dass es ein Kindlein oder auch einen anderen unbescholtenen Bürger getroffen hätte. Die Zwillinge aus dem Grenzhaus gediehen prächtig. Der Winter war endgültig gewichen. Laue Winde wehten und bescherten dem Dorf fröhliche Einwohner.
Trotzdem, die gruselige Gestalt vom Hochfels forderte vehement ihre Bezahlung ein, wenn man ihre Dienste in Anspruch nahm. Das war bekannt und bereitete ihm Unbehagen.
An jenem Morgen lag noch Bodennebel über den sattgrünen Farnen, die den Pfad durch den Wald säumten. Seine Hosenbeine hatten sich bis zu den Knien hinauf mit Feuchtigkeit vollgesogen. Er schien es nicht zu spüren, als er auf die Lichtung hinaustrat und die Augen über die Baumstämme gleiten ließ, die vor dem majestätisch wirkenden Fels im Gras lagen. Von dem toten Reh unter dem Brombeerstrauch war nichts mehr zu sehen. Vermutlich hatten sich die Wölfe den Kadaver über den Winter schmecken lassen.
Vorsichtig hob er den Blick und betrachtete den Granit, der wie eine Wand vor ihm aufragte. Er erwartete mit jedem Wimpernschlag, dass der graue Schatten wieder zu Tal sinken würde. Doch dieses Mal bewegte sich nichts. Nicht einmal der Ruf eines Vogels ertönte. Das Grauen, welches diesen Ort mit giftigem Atem überzog, war dennoch greifbar.
Schweißperlen zierten bald seine Stirn. Die Stille war für den Mann unerträglich. Er atmete flach und hastig. Was sollte er tun? Warten oder zurückgehen? Mit jeder Sekunde, die in der Einsamkeit der Lichtung verstrich, fühlte er sich mehr von unbekannten Augen beobachtet. Er begann zu zittern. Seine Beine wollten weg aus diesem Wald. Er fühlte die Muskeln, die unter der Haut nervös zuckten. Alle Fasern seines Körpers signalisierten ihm, den Ort so rasch wie möglich zu verlassen.
»Suchst du wieder meinen Rat, Mensch?«, säuselte plötzlich eine unwirkliche Stimme. Sie klang umgarnend, aber er war nicht in der Lage, herauszufinden, woher sie stammte.
Langsam drehte er sich um. Hinter ihm war nur dunkler Wald. Zuerst erkannte er Bäume und Sträucher, doch dann schälte sich schemenhaft eine wunderschöne Frauengestalt aus dem morgendlichen Dunst. Der Hagere musste schlucken. Angst und Bewunderung kämpften in seinem Kopf, als er sie erblickte. Die Unbekannte trug ein bodenlanges, schwarzes Kleid aus Samt. Feinste Spitze zierte die Ärmel der Robe. Volle, rotblonde Locken wallten über die makellosen Schultern. Zöpfe durchwirkten kunstvoll die Haarpracht.
»Hast du nicht alle Erklärungen erhalten, damals in der kalten Schneenacht?«
Woher kam diese geisterhafte Frau so plötzlich? Sie trug keine Hörner auf dem Kopf. Außerdem wirkte sie nicht wie ein Dämon oder eine Hexe, denn auf ihrem Rücken breiteten sich prächtige Flügel aus. Schneeweiße Federn bewegten sich im leichten Wind und bildeten einen Kontrast zur Farbe des Kleides. Doch was suchte ein Engel in derartigem Gewand mitten im Wald? Und … existierten weibliche Gottesboten? Er kannte nur die Erzengel Gabriel, Michael und Raphael.
Der Mann mit dem schütteren Haar versuchte zu antworten. Doch nur ein kläglicher Laut drang aus seinem Mund. Er schien völlig aus dem Konzept zu geraten, als ihr glockenhelles Lachen ertönte.
»Du bist verwirrt?« Das s klang wie das Zischen einer Schlange. »Wie einfältig ihr Menschen euch entwickelt habt. Was möchtest du wissen, Gottesfürchtiger?«
Der Hagere nahm allen Mut zusammen. Die Engelsdame durchschaute ihn mühelos. Da sie über seine Gattung spottete, trug sie offensichtlich etwas Teuflisches im Leib. Menschen waren nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das stand in der Heiligen Schrift.
Hastig bekreuzigte er sich, bevor er seine Frage stellte. »Du dienst der Gehörnten, nicht wahr? Deine Flügel sind Blendwerk.«
Wie ein Wirbelwind sauste ihr Gelächter über die Lichtung. »Ich diene ausschließlich den Gesetzen der Ewigkeit, die das Allwissende geschaffen hat. Aber ich werde dir eine weitere Frage beantworten, bevor du sie stellst. Du bist gekommen, um zu erfahren, wann sich die Gehörnte die Seele holen wird, die du ihr mit deiner Bitte im Winter versprochen hast.«
DAS Allwissende? Gott allein durfte diese Bezeichnung tragen, DER Allwissende.
Er drängte den Gedanken zurück und sagte: »So ist es. Ich hatte befürchtet, das gehörnte Weibsbild holt sich eines der Zwillingsmädchen, die in den Raunächten geboren wurden. Aber sie sind gesund und munter, und das soll auch so bleiben.«
Ein Rauschen erhob sich über die Baumwipfel, als nähere sich ein Sturm. Die Haare der Schwarzgewandeten bauschten sich, obwohl sich kein Lufthauch regte.
»Vielleicht ist die Gehörnte nicht an toten Seelen interessiert? Vielleicht verfolgt sie ein anderes Ziel?«
Ihre rätselhaften Worte glichen einem grausamen Spiel, ähnlich dem einer Katze, die ihre Beute zu Tode quält. Der Spott in ihrer Stimme war nicht zu überhören.
»Aber die Heilige Schrift lehrt uns …«
Das Gesicht der weiblichen Gestalt veränderte sich von einer Sekunde auf die andere. Ihre Augen loderten auf wie frisch entzündetes Strohfeuer.
»Die Heilige Schrift verbietet euch Menschen nicht das Denken. Auch Lebende verfügen über eine Seele, habt ihr das vergessen? Diese können viel bewirken, sofern sie sich für den richtigen Pfad des Lebens entschieden haben.« Um den bedeutungsschweren Worten noch mehr Gewicht zu verleihen, hob die Erscheinung vom Boden ab und schwebte auf ihn zu wie ein Seraph. Die Gesetze der Schwerkraft schienen für die Schwarzgekleidete nicht zu existieren.
Der Hagere schlug sich die Hand vor den Mund, während sein Körper kraftlos auf die Knie sackte. Nur wenige Zentimeter vor seinem Gesicht verharrte die Gestalt und schrumpfte zu einem Antlitz, das ihm in die Augen starrte. Ein Geruch von Verwesung und nassem Laub stieg ihm in die Nase. Der übel riechende Dunst passte nicht zur Wahrnehmung seiner Augen, und er würgte die Galle, die ihm durch die Speiseröhre nach oben drängte, mühselig hinunter.
»Woher willst du wissen, dass sich die, die du Gehörnte nennst, nicht doch noch die Seele von einem der Zwillinge holen wird oder sie bereits besitzt? Vielleicht schlägt eines der Kinder einen anderen Lebensweg ein und ist zu Höherem berufen, als eingebrannten Traditionen zu folgen, welche die Gesetze der Ewigkeit immer mehr verletzen. Wer weiß schon, ob sie eure Religion reformieren wird?«
Diese gotteslästerlichen Worte störten den Hageren, obwohl er die Angst beinahe nicht mehr im Zaum halten konnte. Mit äußerster Anstrengung presste er hervor: »Spotte nicht der Bibel, Weib, wer immer du auch sein magst. Die Jungfrau Maria hält ihre Hand persönlich über Xavers Mädchen, denn bei ihrer Geburt soll sogar der Leibhaftige seine stinkenden Finger nach ihnen ausgestreckt haben. Aber auch er konnte den Kindlein bisher nichts anhaben, so erzählt man sich im Dorf.«
Fauliger Atem hüllte ihn ein. Das schemenhafte Gesicht des düsteren Engels schwebte nun übergroß vor seiner knienden Gestalt. Der Rest des Körpers, außer den Flügeln, löste sich im Morgendunst auf.
»So erzählt man es sich also. Die Gehörnte hat dir im Winter versichert, dass beide Kinder überleben werden, obwohl sie nur eine Seele begehrt. Eine großzügige Geste, findest du nicht?« Wieder dominierten Zischlaute die seltsame Stimme, bis diese in ein irres Kreischen wechselte.
Der verängstigte Mann riss die Augen weit auf und war somit gezwungen, die dämonische Verwandlung des Engels in die gefürchtete Gestalt der Gehörnten mit anzusehen.
»Was weißt du schon vom Leibhaftigen. Du liest in einem uralten Buch, welches von euren eigenen Vorfahren geschrieben wurde. Denkst du wahrhaftig, du kannst in die Waagschalen der Ewigkeit eingreifen?«
Was faselt das Weib hier? Ich habe noch niemals etwas über ewige Waagschalen gehört.Gilt nicht Gottes Wort über alledem? Ist nicht er derjenige, der über unser aller Schicksal bestimmt? Und wer kann sich erdreisten, ein Gleichgewicht zwischen Gut und Böse zu fordern, wo man doch das Böse ausrotten muss?
Der dürre Waldler erstarrte innerlich, als sich die Gedanken im Kopf überschlugen.
Das Buch der Bücher soll von Menschen geschrieben worden sein? Hatte nicht Gott seinen Jüngern die Worte diktiert? Was wäre, wenn das nicht der Wahrheit entspräche?
Er kniff die Augenlider so heftig zusammen, dass grelle Blitzlichter über die Netzhaut huschten wie ein Gewitter.
Mit Disziplin brach er die dunklen Überlegungen hinter seinem Schädelknochen ab. So etwas durfte er als Christenmensch nicht denken. Das war Blasphemie in Reinform.
Das Wetter schien sich urplötzlich zu verschlechtern. Ein Sturm zog auf, obwohl kurz zuvor noch keine Wolke den Himmel verdunkelt hatte. Hart zerrten die wütenden Luftströme an den zu dünnen Kleidungsstücken des Mannes. Vor ihm blähte sich das Frauengesicht immer mehr auf, verschwamm in seinen Konturen und verwandelte sich in eine hässliche Fratze. Aus den rotblonden Haaren schlugen plötzlich Flammen, während sich gedrehte, rot schimmernde Hörner aus dem Kopf schoben. Der Hagere hätte schwören können, dass die Erscheinung nicht aus Fleisch und Blut bestand. Aber das Geräusch, welches das eigenartige Geweih beim Durchtritt durch die Schädelknochen erzeugte, erinnerte ihn an morsche Äste, die im Herbstwind entzweibrachen. Vor seinen Augen ergrauten die Federn der Engelsschwingen wie das Haar eines Greises. Einen Moment dachte er, Luzifer persönlich würde ihn packen und in die Hölle hinabziehen. Die Welt, wie er sie kannte, schien aus den Fugen geraten zu sein.
Zitternd tastete er nach dem hölzernen Kreuz, welches er immer unter dem Pullover trug. Er umschloss es mit der Hand, als wolle er es zerquetschen. »Gepriesen sei der Herr, denn er hat sein Volk gesucht und ihm Erlösung geschaffen …«
Das Gebet schien Wirkung zu zeigen, denn das dämonische Antlitz mit den Widderhörnern löste sich in einer schmutzig wirkenden Rauchsäule auf. Trotzdem erhob sich erneut die unheimliche Stimme.
»Wage dich erst wieder hierher«, säuselte es aus dem Dunst, »wenn du bereit bist, die Gesetze der Ewigkeit zu respektieren.«
Dann verpuffte das letzte Quäntchen Grau und der Hagere kauerte allein im stillen Wald, als hätte er die vergangenen Minuten nur schlecht geträumt.
Kurz darauf begann ein Amselmännchen hoch oben in den Tannen ein Liedchen zu trällern.
Verwirrt machte sich der Mann an den Abstieg ins Dorf. Ihm wurde bewusst, dass die Teufelin, oder um was auch immer es sich handelte, wandelbar war. Ob er gar Luzifers Weib begegnet war? Er vernahm ein unangenehmes Ziehen in seiner Magengegend bei diesem Gedanken.
Einzug des Herbstes 1936
Die Jahre zogen dahin und verwöhnten die Eisenhütter Bevölkerung mit guten Ernten, kerzengerade gewachsenen Holzstämmen, fetten Schweinen und fröhlichen Bierfesten.
In jenen Herbsttagen, im September 1936, wirkte das Tal am Fuße des Albsteins wie ein Wanderzirkus. Rote, leuchtend gelbe und sogar orangefarbene Blätter verzierten die riesigen Laubbäume, als hätte jemand sie mit Fähnchen geschmückt, die im Wind flatterten. Die Sonne schien von einem tiefblauen, wolkenlosen Himmel, und tagsüber wäre man beinahe der Illusion erlegen, der Sommer ginge nie zu Ende. Die Nächte allerdings waren schon jetzt schaurig kalt. Jeder im Dorf wusste, dass der Winter mit großen Schritten nahte. Doch solange der bunt gefärbte Wald ein Lächeln auf die Gesichter von Jung und Alt zauberte, verdrängte man die dunklen Gedanken an Schnee und grimmigen Frost. Die letzten Jahre war Eisenhütt ohnehin von meterhohen Schneewehen verschont geblieben.
Etliche abergläubische Weiber, die noch im vorigen Jahrhundert geboren worden waren, tuschelten seit geraumer Zeit über das Wetter mit vorgehaltener Hand. Wer oder was hatte hier die Finger im Spiel? Wenn es im Wald dunkelte, spähten sie mit ängstlichen Augen hinaus, ob die Irrlichter zwischen den dichten Tannenästen tanzten. Oder schritt gar der gefürchtete Oleluk durchs Holz? Der riesige Gnom mit seinem Buckel führte einen knorrigen Stock mit sich. Mitunter, wenn er hungrig war, verschlang er Hasen und Rehkitze samt Fell. Selbstredend fürchtete sich jedes Kind vor ihm, denn oft benutzte man seine grauenvollen Taten, um den Nachwuchs einzuschüchtern. Welcher Bub würde da nicht brav nach Hause eilen, sobald die Sonne hinter dem Albstein unterging? Wenn der Oleluk den Stock mit Wucht in den feuchten Waldboden trieb, flüchteten die Elflein aus den Erdlöchern, und der Frost konnte sich blitzschnell im Tal ausbreiten. Niemand im Dorf wunderte sich, wenn am Waldrand nahe dem Friedhof mitunter getrocknete Würste und Schinken zu finden waren, die an einem rostigen Nagel an der Rinde einer Tanne baumelten. Oleluk musste unbedingt bei Laune gehalten werden.
An diesem Tag dachte keiner an die bösen Geister des Waldes. Die Erstklässler wurden in der Dorfschule eingeschult. Schüchtern betraten Buben und Mädchen das Gebäude mit dem imposanten Erkertürmchen durch das Portal, über dem sich ein Blechdach wölbte. Auf der kopfsteingepflasterten Straße standen Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten. Sie alle winkten ihren Schützlingen zu. Die meisten Mädchen in ihren schlichten, teils geflickten Kleidchen trugen streng geflochtene Zöpfe, um deren Enden sich Schleifen wanden. Scheu hielten sie sich paarweise an den Händen, während die Buben in ihren Lederhosen mit ernster Miene voranschritten. Ein echter Waldlerbub würde niemals Furcht zeigen, schon gar nicht bei der Einschulung. Es würde vermutlich bald wieder Krieg herrschen und aus den Schülern mussten rasch Soldaten werden.
Selbst Eisenhütt zählte zum Deutschen Reich, auch wenn es fernab der großen Machtzentren wenig vom Treiben des Führers mitbekam.
Heinrich Himmler, dessen Name in den Köpfen der Landbevölkerung Angst und Schrecken verbreitete, war zum obersten Chef der Polizei ausgerufen worden. Für die Armen, bei denen der Dorfpolizist im Fall eines kleinen Diebstahls ein Auge zugedrückt hatte, galten jetzt andere Regeln. Außerdem zeigte man auch hier jetzt immer mehr mit Fingern auf die Juden. Selbst das Annerl von nebenan zählte nun zu den Bösen. Seit vielen Jahren erwarben die Eisenhütter in ihrem Laden Socken und Unterwäsche, Wolle und Stoffe, Ledergürtel und andere nutzvollen Dinge. Plötzlich klebte an der Schaufensterscheibe ein Schild mit der Aufschrift: »Deutsche, kauft nicht bei Juden!« Neunzig Prozent der Einwohner wussten gar nicht, dass das Annerl jüdischer Abstammung war. Wahrscheinlich hatte sie selbst keine Ahnung davon gehabt. Und warum die Juden nun am Unglück der Bevölkerung schuld sein sollten, begriff keiner aus dem Dorf. Aber man tat so, als würde man darin einen Sinn erkennen. Schließlich wusste niemand, von wem er gerade beobachtet wurde, wenn er Annerls Laden betrat.
Eisenhütt, das Fleckchen Erde am Ende der Welt, konnte nicht länger so tun, als schaffe es sich seine eigenen Regeln.
Schlichte, abgetragene Kinderschuhe trippelten, hasteten und polterten über die Treppenstufen, die mit dem Knarren gar nicht mehr nachkamen, und betraten den Klassenraum, der nach frischer Farbe roch.
Pfarrer Seidl stand am Pult und betrachtete mit gespielt strengem Blick die Erstklässler, die nun wie farbige Murmeln in den Raum drängten.
Deren Augen streiften die ernste Mimik des Geistlichen, dann verstummten sie mehr und mehr. Paarweise besetzten sie die Bänke, auf denen schon so viele Kinder vor ihnen gesessen hatten. Auch die Bauer-Zwillinge befanden sich unter den neuen Schülern.
Seidls Pupillen huschten über die akkurat geflochtenen Zopffrisuren. Wo mochten die beiden nur stecken?
Sein Herz hüpfte vor Freude, als er die schüchterne Dorothea neben der molligen Kramertochter aus dem Judenladen in der letzten Reihe entdeckte. Gottlob wurde das unschuldige Kind vom Annerl noch nicht wegen seiner Abstammung geächtet. Weiße Schleifen zierten Dorles Zöpfe und ihre Wangen glühten vor Aufregung. Noch immer hatte Seidl die grauenvolle Geburtsnacht im Grenzhaus nicht vergessen. Beinahe wären die Zwillinge gestorben, hätte sich die Jungfrau Maria nicht ihrer erbarmt. Aber wo war Theresia?
Der Pfarrer erkannte sie fast nicht. Am vordersten Tisch neben dem Fenster saß ein Mädchen mit kokettem Augenaufschlag. Sie trug die naturblonden Haare kurz und offen. Die Strähnen waren ungleichmäßig geschnitten und wirkten, als habe Theres sie mit einer Schneiderschere selbst gekürzt.
Ungläubig starrte Otto die Sechsjährige an, die seinem Blick, ohne das leiseste Zucken, standhielt.
Zu der auffälligen Frisur trug das dürre Mädchen teuren Schmuck um den Hals. In ganz Eisenhütt gab es seiner Erkenntnis nach niemanden, der einem Kind Granatschmuck um den Hals legen würde. Außerdem passten die schimmernden Edelsteine nicht zu dem Kleid aus Wolle, welches an manchen Stellen geflickt war.
»Suchst du dir denn keine Banknachbarin, Theres?« Otto Seidl versuchte es mit einem unschuldigen Lächeln. »Schau mal, in der dritten Reihe neben der Luise vom Hadlingerhof wäre noch ein Platzerl frei.«
Die Augen der Rothaarigen vom Milchhof am Berg, die einsam in der Mitte des Klassenraumes auf einer Bank saß, leuchteten auf.
Luises Kleider rochen nach Kuh, deswegen saß sie auch allein vor dem abgeschrägten Pult. Das Mädchen half der Mutter regelmäßig im Stall. Ihre Hände wirkten rissig und ungepflegt. Unter den Fingernägeln schimmerten schwarze Halbmonde. Luise liebte Tiere. Sie war fast zwei Jahre älter als die übrigen Erstklässler, da sie sich nicht so sehr für Buchstaben und Zahlen interessierte. Ihre Leidenschaft galt den Kühen auf dem Hof, und ihr Wissen über Flora und Fauna war schon jetzt umfangreich. Zu einer Mathematikerin würde sie sich sowieso nie entwickeln. In einem Dorf wie Eisenhütt störte sich niemand daran. Wie gern hätte Luise aber eine Schulfreundin gefunden, mit der sie im Pausenhof schwatzen und spielen konnte.
Theres reckte nur trotzig das Kinn nach vorn, bevor sie gestelzt antwortete: »Mir gefällt der Platz, Herr Pfarrer. Außerdem stinkt Luise und pflegt sich nicht. Mit solchen Kindern mag ich mich nicht abgeben.«
Luise heulte auf. »Du bist so gemein«, kreischte sie durch das Klassenzimmer, während sie sich mit den schmutzigen Fingern die Augen rieb. »Ich kann schon mit dem Eimer melken und du nicht.«
Franzl, der Sohn des Metzgers, sprang auf und funkelte Theres wütend an. »Grenzhäuslerin«, rief er. »Du hältst dich für was Besseres? Brauchst wohl eine Abreibung?«
Otto Seidl klopfte mit der Faust hart auf das zerkratzte Stehpult. Streit und Zank in der ersten Schulstunde würde er nicht dulden. Doch die zierliche Theres, die provozierend mit der Brosche an ihrem Hals spielte, war nicht zu beeindrucken. Sie hatte das Schmuckstück zu einem Anhänger umfunktioniert. Es baumelte an einem Lederband.
Spöttisch antwortete sie, und ihre Antwort klang wie die einer Erwachsenen. »Ich fürchte mich nicht vor dir, Franzl, und vor allen anderen Kindern auch nicht. Ja, ich bin was Besseres. Wenn ich groß bin, dann ziehe ich weg von Eisenhütt. Ich werde in der Stadt leben, einen reichen Mann heiraten und teure Kleider kaufen.«
Im Klassenraum entbrannte lautes Gekicher. Finger erhoben sich und zeigten auf die Sechsjährige mit den ungewöhnlich kurzen Haaren. Auch die heulende Luise lachte wieder und heizte die Stimmung unter den Schülern weiter an.
Der Grundstein für das Leben als Außenseiterin war gründlich gelegt.
Der Pfarrer bemühte sich aus Leibeskräften, die Erstklässler zu beruhigen. Während er von Bank zu Bank eilte, die maulenden und lachenden Kinder streng ermahnte, stand Resl, wie man ihren Namen gern abkürzte, mit hocherhobenem Kopf auf und verließ ohne ein Wort das Klassenzimmer. Die Doppelbank, auf der sie seelenruhig den Anfeindungen der Klasse gelauscht hatte, fiel dabei polternd um.
Über das hölzerne Kreuz an der Rückwand des Raumes huschte zur selben Zeit ein dunkler Schatten, aber niemand bemerkte ihn.
An der Suche nach Theres hatten sich außer ihren Eltern auch noch der Lehrer, der Pfarrer, der Bäcker und der Metzger beteiligt.
Nachdem die Kleine aus dem Unterrichtsraum verschwunden war, hatte sie niemand im Dorf mehr gesehen. In Anbetracht dieses Verhaltens, welches so gar nicht zu einem Kind von gerade einmal sechs Jahren passte, wucherte in den Köpfen der Suchenden Unheimliches heran.
Gab es da nicht die Geschichte von der verarmten Magd, die vor langer Zeit einen Wechselbalg aufgezogen hatte? Das Weib war nicht verheiratet gewesen. Des Nachts hatten die Waldzwerge ihr blasses Neugeborenes aus dem Weidenkorb entfernt und ihr dafür etwas Kindsähnliches hineingelegt. Der Wechselbalg, ein Hexenkind, war herangewachsen und hatte Missernten, verkrüppeltes Federvieh und Naturkatastrophen heraufbeschworen. Im Vergleich zu dem eigenartigen Zwillingsmädchen gab es aber einen markanten Unterschied. Theres war zusammen mit ihrer Schwester getauft worden. Die Druden, Hexen oder Dämonen hätten sie gar nicht mehr berühren dürfen in ihrer Wiege, sonst wären sie zu Asche zerfallen. Es sei denn, die Hebamme hatte das Weihwasser vertauscht. Man munkelte schon lange hinter vorgehaltener Hand, dass die Geburtshelferin ketzerische Ansichten vertrat. Letztendlich war man jedoch auf die Hilfe der versierten Wehfrau angewiesen.
Schließlich, als der Abend bereits hereinbrach, fand der Wirt vom Gasthof und Hotel »Botschafter« in einem angrenzenden Lagerschuppen das Kind. Er staunte nicht schlecht, als er Theres in ihrem Wollkleid zwischen den Vorräten fand. Sie hatte sich bereits wohnlich eingerichtet. Zwei große Blechdosen, die mit Sauerkraut gefüllt waren, dienten als Stühle und eine leere Weinkiste ersetzte den Tisch. Blütenweiße Servietten waren darauf ausgebreitet. In der Ecke hatte das Mädchen Holzwolle aufgeschüttet und eine Tischdecke darübergelegt. Offensichtlich sollte dies zu ihrem Nachtlager werden.
»Oh, schön, dass Sie mich besuchen kommen«, begrüßte Theres den verdutzten Wirt. Sie schien bester Laune zu sein. »Gefällt Ihnen mein Haus? Schade, dass Sie nicht früher gekommen sind. Die Engelsdame mit den schwarzen Flügeln ist gerade eben gegangen. Wir haben uns gut unterhalten. Sie fand übrigens meine Halskette wundervoll.« Mit einem Lächeln ließ sie die Brosche am Lederbändchen durch ihre Finger gleiten wie einen Rosenkranz.
Die Art und Weise, wie sich das Mädchen ausdrückte, war selbst dem Botschafterwirt fremd, obwohl er schon viel Seltsames im Hotel erlebt hatte. Sie sprach wie eine Erwachsene. Und die Erwähnung einer Engelsdame mit schwarzen Flügeln ließ ihn frösteln.
War ihr einer der unheimlichen Waldgeister begegnet oder gar ein Dämon? Er war zwar ein realistischer Geschäftsmann, dennoch trug er die dunklen Sagen und Märchen seiner Heimat im Hinterkopf.
»Du bist doch die Kleine vom Xaver?«, fragte er behutsam nach, bevor er das Mädchen von der Sauerkrautdose hob und auf seine Arme nahm. »Sie suchen dich bestimmt schon. Am besten ist es, wenn ich dich sofort nach Hause bringe.« Ohne eine Antwort des Kindes abzuwarten, trug er Theres hinaus in die beginnende Nacht.
Ludmilla war in Tränen aufgelöst, als es an der Tür klopfte. Noch bevor sie auf den Beinen war, hatte ihr Ehemann bereits geöffnet und starrte in das bärtige Antlitz des Wirts, der sein Töchterlein trug.
»Ich bring dir deine Theres wieder, Holzfäller. Hast sie eh schon vermisst, he?« Vorsichtig, als wäre das Mädchen aus Glas, stellte er sie auf ihre Füße und fuhr sich verlegen über den Bart. »Hab sie in meinem Schuppen gefunden«, erklärte er entschuldigend, weil inzwischen auch Xavers Ehefrau im spärlichen Licht des Hausflurs aufgetaucht war und ihr vermisstes Kind sogleich schluchzend an sich drückte. »Sie hat sich dort ihren eigenen Hausstand beschafft mit Tisch, Stuhl und Bett.« Der Wirt schmunzelte. Was er den verzweifelten Eltern da erzählte, sollte aufheiternd klingen. Aber in deren Augen stand pure Verzweiflung. Es hatte nicht zum ersten Mal Probleme mit diesem außergewöhnlichen Mädchen gegeben.
»Mama, ich mag nicht mehr zur Schule gehen. Die Kinder dort sind hässlich zu mir.« Als die Mutter nicht antwortete, setzte Theres fort: »Die Engelsfrau trug heute ein sehr hübsches Kleid und sie erzählte mir …«
Ludmillas Körper zuckte wie unter einem Stromschlag zusammen. Blitzschnell hielt sie Theres den Mund zu. »Maria, Mutter Gottes«, murmelte sie rasch, »bitte für uns Sünder …«
Ohne auf ihren Mann und den Wirt zu achten, schleifte sie ihre Tochter von der Tür weg in die Schlafkammer, wo bereits Dorothea in der Ecke kauerte und verängstigt auf den Herrgottswinkel starrte. Die Brosche mit den tiefroten Granaten war nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort. Sie hing um den Hals der Zwillingsschwester.
Hastig setzte Ludmilla das Kind auf den Flickenteppich und knotete das Lederband um Theresias Hals auf. Sie betrachtete das Schmuckstück. Weitere winzige Steinchen fehlten. Es wirkte, als habe eine Ratte daran genagt.
Fieberhaft huschten ihre Augen über den Boden, suchten die roten Splitter, aber sie blieben verschwunden. Resl musste sie irgendwo verloren haben.
»Die geflügelte Dame liebt Schmuck, Mama«, plapperte Theres unbekümmert und lächelte dabei.
Ludmillas Pupillen erweiterten sich schlagartig. Eine unsichtbare, eiskalte Hand ergriff ihren Nacken. Hier ging etwas nicht mit rechten Dingen zu. Waberte das Böse bereits über dem Grenzhaus? Welche Sünden hatte sie nur begangen, dass man sie mit einem derartigen Balg bestrafte?
Das Gekreische Ludmillas drang durch die Schlafstube bis hinaus auf die Straße. Xaver und der Wirt stürzten herein und konnten sie gerade noch an den Armen ergreifen. Drohend richtete sie die Fäuste gegen ihr eigenes Kind, während das Dorle weinend hinausstürzte und sich in der Küche unter dem Tisch versteckte.
Unheil zog ins Grenzhaus ein.
Der Winter 1936 klopft an
Eine Woche später – noch immer schien die Sonne und der Herbst wollte nicht enden – huschte eine magere Frau die Steinstufen hinauf zur Kirche. Schwer atmend zog sie ihr grob gewebtes Kopftuch noch weiter in die Stirn. Aber sie hielt nicht auf das markante Eingangsportal des Gotteshauses zu, welches dem heiligen Sankt Nepomuk geweiht war. Sie hastete daran vorbei und steuerte auf das angrenzende Gebäude zu, wo der Pfarrer mit seiner Haushälterin wohnte. Immer wieder wendete sie den Kopf, um sicherzugehen, dass niemand aus dem Dorf sie erkannte. Das Getuschel und Gerede der Leute wäre fatal, denn die Geschichte ihrer kleinen Tochter, die sich selbst die Zöpfe abgeschnitten hatte, machte ohnehin in Eisenhütt die Runde. Beim Einkaufen spürte sie die Blicke der Weiber im Rücken. Die Metzgersgattin schnitt sie vor allen Leuten. Neulich erst hatte diese sie am Tresen behandelt wie Luft.
Ludmilla klopfte an die Tür, wartete aber nicht auf ein freundliches »Herein«. Sie öffnete die unverschlossene Pforte einen Spalt und verschwand augenblicklich im Flur.
Otto Seidl stellte eine frisch aufgebrühte Tasse Tee auf seinem Sekretär ab, der überhäuft war von biblischen Schriften aller Art. Er saß im Arbeitszimmer mit Blick auf den Albstein, als die Gattin des Holzfällers keuchend eintrat. Ihr Gesicht wirkte fahl. Tiefe Sorgenfalten verwandelten sie in eine früh gealterte Frau.
»Herr Pfarrer.« Ludmilla bekreuzigte sich beim Betreten des Zimmers. »Ich muss Sie sprechen, jetzt.«
Um ein Haar hätte der Geistliche die Teetasse vor Schreck von der Tischplatte gefegt. Aber er erlangte schnell die Kontrolle wieder über sich und wies auf den freien Stuhl auf der gegenüberliegenden Seite. »Frau Bauer, setzen Sie sich doch erst einmal. Sie wirken ja, als wäre ein ganzes Rudel böhmischer Wolfsviecher hinter Ihnen her«, murmelte er beschwichtigend.
Ludmilla konnte den Humor des Pfarrers nicht teilen. Ihre Mundwinkel zuckten heftig, als sie sich das Kopftuch aus der Stirn strich. Zaghaft setzte sie sich. Ihre rauen, von der Arbeit geröteten Hände, verknäulten sich ineinander.
Otto Seidl hörte die Finger in den Gelenken knacken.
»Hochwürden, Sie müssen meiner Theres den Teufel austreiben. Das Kind ist verflucht.« Ihre Stimme klang verzweifelt. »Xaver und ich legen schon jede Nacht Leinensäckchen gefüllt mit Baldrian auf die Eingangsstufen, und das gute Weihwasser haben wir auch verbraucht. Der Leibhaftige schickt ihr eine gruselige Hexe, die ihr bis ans Bett folgt. Das Kind erkennt nicht die Bösartigkeit dahinter.«
Dicke Tränen kullerten ihr nun aus den Augen. Otto Seidl reichte ihr ein frisch gebügeltes Taschentuch, welches er in der Tasche seiner schwarzen Strickweste trug.
»Theres hat sich aus dem Herrgottswinkel ein Schmuckstück stibitzt. Ich bewahre die wertvollen Stücke normalerweise für schlechte Tage auf. Man weiß schließlich nie, was kommen wird. Aber die Granatbrosche, die meiner verstorbenen Großtante gehörte, habe ich an das Birkensträußchen gehängt, um unseren Heiland gütig zu stimmen. Ich hab sie ihr entschieden abgenommen, sie mit einem Hieb auf den Hintern bestraft und das Schmuckstück danach auf dem Speicher versteckt.« Ludmilla schluchzte auf. »Die Tür zum Dachboden ist immer verschlossen, Herr Pfarrer. Schon am nächsten Morgen lag das vermaledeite Lederband mit der Brosche daran wieder um ihren Hals. Das ist Hexerei.«
Otto Seidls Kehle wurde mit einem Schlag trocken. Er hüstelte unterdrückt, dann trank er einen Schluck Tee. Die verzweifelte Holzfällergattin sollte ihm nicht in die Seele blicken können. Einmal mehr begriff er hautnah, wie tief verwurzelt Aberglaube und Religion Hand in Hand gingen. Trotzdem würde er dieses Thema während der Predigt am Sonntag niemals ansprechen. Er war an die strengen Regeln der Kirche gebunden. Für Mutmaßungen und Beschwichtigungen gab es keinen Spielraum. Eigene Gedanken durfte er als Geistlicher nicht aussprechen, obwohl er es gern getan hätte. Gottes Schäfchen würden das hören, was in der Bibel stand, nicht mehr und nicht weniger. Der Leibhaftige war machtlos, solange die Leute brav die Messe besuchten, so verkündete es die Lehre der katholischen Kirche. Aber … wer war er überhaupt, der stinkende Dämon mit den Hörnern auf dem Kopf? Der Gegenspieler des Herrn? Ein gefallener Engel, der dessen Zorn erregt hatte? Und welche Heerscharen befehligte er? Gehörte dazu eine gruselige Hexe, die kleine Mädchen verführte? Gab es gar unzählige bitterböse Gestalten, die im Schatten der Menschen Unheil brachten und deren Zahl er nicht annähernd begriff? Man musste Augen und Ohren offen halten in diesen Tagen. Männer wie Joseph Göbbels riefen die Jugend mit inbrünstigen Reden auf, sich nicht vor dem Tod zu fürchten. Mit keinem Wort erwähnte der Propagandaminister dabei das Himmelreich. Gehörten er und die übrigen Hetzpolitiker der Gegenseite an? Warum unternahm Gott nichts dagegen? Zweifel wirbelten in seinem geistlichen Haupt umher wie ein Herbststurm.
Er verdrängte entschieden die brandgefährlichen Eingebungen und antwortete gespielt selbstsicher: »Dafür gibt es sicher eine ganz natürliche Erklärung, denn das Mädel hat niemals den Teufel im Leib. Ich selbst habe es getauft.«
Ludmillas blassblaue Augen starrten den Pfarrer zweifelnd an. »Sie glauben mir nicht?«, fragte sie mit gefährlich leiser Stimme. Dann rückte sie näher an den Schreibtisch heran und flüsterte ihrem Gegenüber zu: »Neulich hat Theres in der Schlafkammer getanzt und ihre Ärmchen um ein unsichtbares Wesen geschlungen. Vermutlich war es wieder die Engelsfrau mit den schwarzen Flügeln, die nur meine Tochter sehen kann. Außerdem hielt sie dabei die Augen geschlossen und summte eine Melodie mit, die niemand, außer sie selbst, hören konnte. Ihre Zwillingsschwester fürchtet sich inzwischen vor ihr.«
Dem Geistlichen kroch eine unsichtbare, eiskalte Berührung über den Rücken. Sein Blick streifte den Herrn Jesus am Holzkreuz an der Wand. Das geschnitzte Gesicht des Heilands betrachtete ihn unendlich traurig und anklagend, als wolle es sagen: »Gib mir nicht die Schuld daran.«
»Ich werd mit der Theres reden, Frau Bauer. Sie ist ein fantasievolles Mädchen voller Träume. Machen Sie sich keine allzu großen Sorgen.« Zaghaft ergriff er die Hand der bleichen Frau und drückte sie. Dabei hielt er den Blick stur gesenkt. Xavers Gattin sollte sich in Sicherheit wiegen. Oftmals war der Pfarrer in der Gemeinde der einzige Vertraute. Seine Ratschläge wirkten in den Köpfen der Dorfbewohner, als wäre er Gottes direktes Sprachrohr.
Erst als Ludmilla zur Tür hinaushuschte, fuhren Otto Seidls Hände hektisch über den Schreibtisch. Polternd fielen einige gebündelte Schriftstücke zu Boden. Es kümmerte ihn nicht. Dann zogen seine Finger das Brevier, sein geschätztes Gebetsbuch, unter einem Stapel Kirchenblätter hervor. Liebevoll strich er über den ledernen Einband. Das Buch mit den kraftspendenden Stundengebeten bot ihm in düsteren Stunden immer wieder Zuversicht.
Otto Seidl schlug es an der Stelle auf, wo ein zerknittertes Lesezeichen zwischen den Seiten steckte. Er ergriff einen Bleistift aus dem Köcher mit den Schreibutensilien und kritzelte winzige Buchstaben auf die unbedruckten Ränder. Die Gedanken, die ihn nach den Worten der Holzfällergattin bewegten, sprudelten nur so aus ihm heraus. Es war ihm, als hätte jemand für einen kurzen Moment das schwarze Tuch über einer unangenehmen Wahrheit weggezogen. Er musste die Sekunden nutzen, um die Eindrücke zu Papier zu bringen, bevor sie wieder in seinem christlich geprägten Verstand verschwinden würden wie Regentropfen auf einem sonnigen Blechdach.
Er hörte erst auf zu schreiben, als ihm die rechte Hand schmerzte. Er erhob sich und kniete vor dem geschnitzten Holzkreuz mit dem leidenden Herrn Jesus nieder. In einem gemurmelten Gebet bat er ihn um Verzeihung.
Die Gelegenheit, mit dem vermeintlich besessenen Mädchen zu reden, ergab sich nach einigen Wochen. Nach der Schule, in die man Theres täglich zu gehen zwingen musste, weil sie eigene Vorstellungen davon hatte, was sie lernen wollte, passte sie der Pfarrer am Eingang ab.
»Wart noch einen Augenblick, Resl.« Seine Rechte versuchte das Mädchen sanft an der Schulter zu fassen. Sofort fiel ihm auf, dass der Granatschmuck noch immer um ihren Hals lag. Vermutlich trug sie das Geschmeide Tag und Nacht. Der Kontrast zum braunen Kleidchen, welches am Kragen einige Mottenlöcher aufwies, hätte nicht größer sein können.
Das Mädchen drehte sich mit einem trotzigen Augenaufschlag zu ihm um. Ihr Widerwille, sich rechtfertigen zu müssen, schlug ihm wie ein Faustschlag entgegen.
»Ich sollte schnell nach Hause gehen, Hochwürden«, antwortete die Sechsjährige in einem Tonfall, der eher zu einer Sechzehnjährigen gepasst hätte. »Vater hat mir verboten zu trödeln. Wenn ich zu spät komme, dann schlägt er mich mit dem ledernen Gürtel.« Trotz glomm in ihren blauen Augen auf. »Ich möchte nicht, dass er meine Schönheit mit Striemen beschädigt.«
Otto Seidls Hand glitt von der Kinderschulter herab. Diese Argumente befremdeten ihn. Theres sorgte sich um ihr Äußeres, nicht um die Scham, die ihr Schläge vom Vater einbringen könnten. Klebte an den Befürchtungen ihrer Mutter doch ein Fünkchen Wahrheit?
Zaghaft redete er weiter. »Ich gebe dir einen Brief mit, in dem steht, dass du nach dem Unterricht noch mit mir gesprochen hast. Dann wird dir dein Vater kein Haar krümmen.«
Theres antwortete nicht. Ihre Finger spielten gedankenverloren mit der Brosche, der einige Steinchen fehlten.
Ein zweites Mal versuchte der Geistliche ein Gespräch in Gang zu bringen. »Deine Mutter macht sich Sorgen um dich. Und Dorothea fürchtet sich vor dir. Erzähl mir doch, wie es dir daheim ergeht. Vielleicht kann ich dir und deiner Familie helfen.«
Seine Hand legte sich aufs Herz, doch das Mädchen schenkte der Geste keinen Blick. Sie betrachtete verzückt das letzte fallende Laub anden Bäumen. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, als hätte jemand in ihrem Kopf einen Schalter umgelegt. Sie begann ein Lied zu summen, verstummte aber jäh nach den ersten Takten und sah zu Otto Seidl auf. »Der Winter steht vor der Tür. Ich kann ihn riechen«, flüsterte sie.
Des Pfarrers Arme überzogen sich mit Gänsehaut. Die Worte aus dem Kindermund wirkten, als stammten sie von einem unsichtbaren Wesen. Mehr und mehr kam ihm das Mädchen unheimlich vor, denn die letzten Wochen waren von einem milden Herbst bestimmt gewesen. Immer noch blühten vereinzelt die Rosen an den Hausecken und Spalieren im Dorf. Der Winter schien noch weit entfernt zu sein. Was faselte das Kind? Konnte man das Wetter riechen? Konnte der Teufel das? Hatte der Leibhaftige wirklich Besitz von einer unschuldigen Schülerin ergriffen?