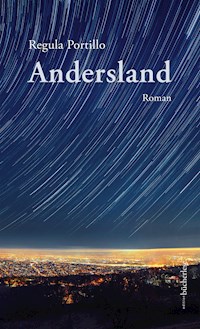Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition bücherlese
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anna arbeitet in einem Altenpflegeheim, reist gern und stellt anderen Reisenden regelmäßig ihr Sofa als Übernachtungsgelegenheit zur Verfügung. Einer ihrer Gäste ist Oliver, ein junger US-Amerikaner, der mit einem Interrailticket in Europa unterwegs ist. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut, er besucht sie an ihrem Arbeitsplatz und lernt auch ihren Freundeskreis kennen. Für ein paar Tage taucht er in ihre Welt ein. Doch dann kehrt er von einem Ausflug nach Zermatt nicht mehr zurück. Die Tage verstreichen ohne eine erlösende Nachricht, und Annas Sorge um ihn wächst. Was ist geschehen? Anna entschließt sich dazu, Oliver bei der Polizei als vermisst zu melden. Doch die quälenden Gedanken an ihn lassen sie und die anderen Menschen, die ihn vermissen, nicht mehr los. Eine Suche beginnt, die existentielle Fragen aufwirft, denen Anna auch bei ihrer Arbeit immer wieder begegnet. Worauf steuern wir alle zu? Was macht ein erfülltes Leben und würdevolles Sterben aus? Findet das Leben hauptsächlich in den Geschichten statt, die wir uns darüber erzählen? Antworten findet Anna in den Gesprächen mit der blinden Frau Steinbach und den anderen Bewohnenden, deren Lebenserfahrung sie als große Bereicherung erlebt. Im Austausch mit Caroline, Olivers Mutter, und Samuel, einem gemeinsamen Bekannten, kommt Anna Oliver immer näher und setzt nach und nach das Bild eines Menschen zusammen, den sie vor allem aus Erzählungen kennt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
REGULA PORTILLO
Wendeschleife
Roman
Inhalt
I DER BESUCH
II DIE LEERE
III IN ZERMATT
IV WINTERMONATE
V SCHNEESCHMELZE
Soy hombre duro poco
y es enorme la noche.
Pero miro hacia arriba:
las estrellas escriben.
Sin entender comprendo:
también soy escritura
y en este mismo instante
alguien me deletrea.
Mensch bin ich. Kurz währe ich
und gewaltig ist die Nacht.
Doch schaue ich nach oben:
Die Sterne schreiben.
Ohne zu verstehen, begreife ich:
Auch ich bin Schrift
und in eben diesem Augenblick
entziffert mich jemand.
Octavio Paz
I
DER BESUCH
Als ich die Wohnungstür öffnete, um im Treppenhaus nach Oliver Ausschau zu halten, stand er schon vor mir. Quer über seiner Schulter baumelte eine rote, unförmige Sporttasche, am Bauch hing ein prall gefüllter Rucksack und zwischen den Beinen klemmte eine Papiertüte.
»Am Anfang hatte ich nur den Rucksack«, sagte er grinsend auf Englisch.
Ich schmunzelte, leicht verlegen, dass ihm mein prüfender Blick sofort aufgefallen war. »Hallo, ich bin Anna«, stellte ich mich vor und bat ihn herein. Ich hatte mich beeilen müssen, um rechtzeitig von der Arbeit nach Hause zu kommen, und war in Gedanken noch irgendwo dazwischen.
Oliver hatte mich über die Sofavermittlung kontaktiert. Er war knapp zwanzig, US-Amerikaner, lebte in der Nähe von Boston und reiste mit einem Interrailticket durch Europa. Das war alles, was ich zu diesem Zeitpunkt über ihn wusste. Meinem Profil konnte er entnommen haben, dass ich ebenfalls gern reiste, ein Jahr in Australien und Neuseeland unterwegs gewesen war, dass ich als Pflegefachfrau in einem Altenpflegeheim arbeitete und Reisenden, die in Bern übernachten wollten, mein ausklappbares Sofa zur Verfügung stellte.
Über seinen Rucksackbauch schielend, schlüpfte Oliver umständlich aus seinen halbhohen Sneakers und betrat meine Zweieinhalbzimmerwohnung mit dem kleinen, gegen Osten gerichteten Balkon. Er setzte die Sporttasche ab und hob die Papiertüte in die Luft. »Ich habe für ein Gemüse-Curry eingekauft«, verkündete er, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres, als dass er heute für mich kochte.
»Oh, wie schön«, sagte ich überrascht. Ich hatte nie Pech und meistens Glück gehabt mit meinen Übernachtungsgästen, doch bekocht worden war ich noch nie.
Ich zeigte ihm die Wohnung: Das Wohnzimmer, hier würde er schlafen, daneben mein Zimmer mit der Verbindungstür, gegenüber das Bad, die Küche mit dem schachbrettgemusterten Fliesenboden und dem Balkon, wo eben erst noch die Sonnenblumen geblüht hatten und inzwischen die vertrockneten Stängel mit den herabhängenden Blütenköpfen einen traurigen Anblick boten. Ich hätte die Töpfe längst nach unten bringen und in die Tonne mit den Gartenabfällen kippen sollen.
Oliver lobte mein Englisch, glaubte sogar einen australischen Akzent herauszuhören, was mir schmeichelte. Tatsächlich war Englisch für mich wie eine zweite Muttersprache, und ich genoss es, mich auf Englisch zu unterhalten. Ich fragte ihn, wie es umgekehrt um seine Deutschkenntnisse stehe.
»Sehr schlecht«, antwortete er auf Deutsch. »Vielen Dank. Bitte. Nein, ja. Butterbrot. Ich heiße Oliver, guten Tag«, gab er lachend sein Deutschvokabular zum Besten, um dann wieder ins Englische zu wechseln. »Mein Großvater ist zwar Deutscher, doch leider ist die Sprache nicht bis zu mir durchgedrungen. Meine Mutter spricht ein bisschen Deutsch. Sie hat auch einen deutschen Nachnamen.«
»Welchen denn?«
»Lehmann. Caroline Lehmann.«
»Dein Nachname ist Evans, stimmt’s?«
Er nickte.
»Hast du sonst noch einen Bezug zu Deutschland?«
Oliver hob grinsend die Schultern. »Nur die Weißwürste, die mein Großvater manchmal zubereitet.«
Ich lachte laut auf. »Weißwürste, immerhin. Dann warst du auch in München?«
»München? Nein. Dafür aber in Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Paris, Strasbourg und zuletzt Basel.« Oliver strahlte. »Interrail ist großartig.«
Ich hatte noch nie eine Interrailreise gemacht, entweder hatte ich möglichst weit weggewollt oder war nur an einen Ort gereist und dortgeblieben. Ich war niemand, der schnell ankam – bis ich dann nicht mehr fortwollte.
»Wie lange bist du schon unterwegs?«
»Seit bald fünf Wochen.«
»Und wohin geht’s danach?« fragte ich, obwohl ich gerne gewusst hätte, warum er die Gelegenheit, nach Deutschland zu reisen, nicht genutzt hatte. Ich an seiner Stelle hätte das Land meiner Vorfahren kennenlernen wollen. Doch die Frage schien mir für den Anfang unserer Begegnung zu persönlich. Bestimmt hatte er seine Gründe.
»Bern ist schon die zweitletzte Station. Von hier fahre ich nach Rom. Und dann geht’s nach Hause.« Er seufzte. »Am liebsten wäre ich noch viel länger unterwegs.«
Das konnte ich ihm nachfühlen. Nie verging die Zeit schneller als beim Reisen.
Oliver breitete auf dem Küchentisch aus, was er eingekauft hatte: Reis, einen tiefroten Granatapfel, Pistazien, Brokkoli, Kartoffeln, Rosinen und eine Wurzel, deren Namen ich nicht kannte.
Ich füllte zwei Gläser mit Leitungswasser, legte Schneidebretter und Messer auf den Tisch, zeigte Oliver die Schublade mit den Töpfen und Pfannen und fragte, wie ich helfen könne. Zuerst lehnte er meine Hilfe ab, willigte dann aber ein und bat mich, die Kartoffeln zu schälen und in kleine Stücke zu schneiden.
»Ist es in Ordnung, wenn ich Musik anmache?«, bat er um meine Erlaubnis, nachdem er den Brokkoli gewaschen und seine Hände an den Hosen abgetrocknet hatte.
»Ja, klar«, gab ich lachend zur Antwort, zeigte auf das Geschirrtuch, als schon erste Gitarrenakkorde aus seinem Handy ertönten, und eine tiefe, warme Stimme einsetzte. Ich schloss für einen kurzen Moment die Augen. Es war lange her, dass ich mit jemandem gekocht und dazu Musik gehört hatte. Zuletzt mit Tom.
»Kennst du ›The National‹?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Meine und Obamas Lieblingsband«, erklärte er, setzte das Wasser auf und griff nach dem Schneidebrett und dem Messer. Prüfend ließ er seine Fingerkuppen über die Klinge gleiten. Während ich mit Kartoffelschälen beschäftigt war, beobachtete ich fasziniert, wie Oliver die Pistazien hackte. Mit geübten Bewegungen schaukelte er das Messer auf und ab. »Man sieht, dass du gerne kochst.«
Oliver blickte kurz auf, lächelte. »Ich jobbe neben dem Studium in einem Restaurant, da schaue ich mir das eine oder andere ab.«
»Was studierst du?«
»Psychologie.«
»Schon lange?«
Oliver schüttelte den Kopf. »Im zweiten Jahr.«
Er schob das Schneidebrett mit dem Pistazienhäufchen beiseite, griff nach dem Granatapfel, halbierte ihn und löste die Kerne sorgfältig aus der Schale. Zwischendurch gab er den Reis ins siedende Wasser, rieb mit einer feinen Raspel, die er unmöglich in meiner Küche gefunden haben konnte, die Wurzel dazu.
»Was ist das?«
»Kurkuma. Davon bekommt der Reis eine gelbe Farbe.«
Olivers natürliches und selbstsicheres Auftreten beeindruckte mich. Als ich so alt gewesen war wie er, war ich weit davon entfernt gewesen. Ich hatte mitten in der Ausbildung zur Pflegefachfrau gesteckt, mich aber nie richtig wohlgefühlt in meinem Ausbildungsbetrieb, einem großen Altenheim, wo »Pflegeeffizienz« und »maximale Bettenauslastung« die beiden am häufigsten genannten Begriffe waren. So hatte ich mir meinen angehenden Beruf nicht vorgestellt. Langzeitpflege war für mich viel mehr als ein Handwerk. Nach zwei Jahren hatte ich gekündigt, ohne jemanden davor in meine Pläne einzuweihen. Meine Mutter war nicht besonders erfreut gewesen. Sie glaubte, ich hätte vorschnell und kampflos aufgegeben, was beides nicht stimmte. Zum Glück hatte ich mir das nötige Geld zusammengespart, um auf Reisen zu gehen und mit etwas Distanz herauszufinden, dass meine Berufswahl trotz allem richtig gewesen war. Einzig mein Arbeitsort und die dort herrschenden Bedingungen hatten nicht gepasst.
»Bis wann arbeitest du morgen?«, riss mich Oliver aus meinen Gedanken.
»Bis vier. Warum?«
»Nur so.«
»Wenn du magst, können wir uns danach in der Stadt treffen«, schlug ich vor.
»Cool, gerne.«
»Hast du eigentlich sonst noch Pläne für deine Zeit in der Schweiz?«
»Bern und Zermatt.«
»Zermatt?«
»Ich kann nicht nach Boston zurückkehren, ohne das Matterhorn gesehen zu haben.« Oliver grinste. »Findest du das blöd?«
Ich lachte. »Überhaupt nicht.«
Nach einer halben Stunde war das Essen fertig. Es duftete herrlich. Nach Ingwer und süßlich nach Zimt. Bevor mir Oliver meinen Teller reichte, streute er je einen Löffel rote Granatapfelkerne und Rosinen über den gelben Reis. Das Curry-Gericht sah nicht nur aus wie ein kleines Kunstwerk, sondern schmeckte auch ausgezeichnet, und ich versprach, mich in den nächsten Tagen mal fürs Abendessen zu revanchieren, obwohl meine Kochkünste nicht an die von Oliver heranreichten. Ich war eine pragmatische Köchin, meistens kochte ich nur für mich selbst und dann musste es schnell gehen.
»Bist du das?«, wollte Oliver wissen. Nach dem Essen waren wir am Küchentisch sitzen geblieben. Ich folgte seinem Blick zur Magnetschnur mit den Fotos oberhalb des Fensters, nickte. Mein erster Schultag, posierend im Garten meiner Eltern: Auf dem Rücken der Fellranzen, den mir Oma Ann damals auszureden versucht und dann trotzdem geschenkt hatte; daneben das Foto von Tom und mir in Barcelona. Unser erster gemeinsamer Urlaub. Irgendwann würde ich das Foto entfernen. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass es noch da hing, sich festkrallte zwischen den anderen Bildern, die wie kleine, farbige Punkte Stationen auf meinem Lebensweg markierten. Ich schob den Stuhl zurück, stand auf und zeigte auf die Mitte der Schnur. »Der hier ist mein Bruder Florian mit seiner Tochter Lara. Kurz nachdem sie geboren wurde.«
Lara hatte auf einer Armeslänge Platz gefunden, ihr kleines Köpfchen in Flos Hand gepasst. Flo und Saskia waren noch nicht lange ein Paar gewesen, als sie ungeplant schwanger wurde. Obwohl Saskia mitten in den Vorbereitungen zum Master in Medizin steckte, hatten sie nie daran gezweifelt, das Kind bekommen zu wollen. Ihr junges Glück fiel in eine Zeit, in der meine jahrelange Beziehung mit Tom langsam zu bröckeln begann. Trotzdem hatte ich damals kurz mit dem verrückten Gedanken gespielt, ebenfalls schwanger zu werden. Dabei war ich mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt einmal eigene Kinder haben wollte. Doch die Tatsache, dass mein jüngerer Bruder eine Familie gegründet hatte, während eine Trennung bei mir immer wahrscheinlicher wurde, hatte mich bedrückt. Erst mit der Zeit hatte ich begriffen, dass ich Flo und Saskia nicht um das Kind beneidete, sondern um die Gewissheit, bedingungslos an einem Strick zu ziehen. Diese hatte ich mit Tom schon lange verloren. Irgendwann zwischen seinem Einzug in meine Wohnung und dem Beginn seiner Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio war sie uns abhandengekommen. Obwohl ich weit häufiger das Gespräch über uns gesucht und insgeheim wohl auch öfter über ein Beziehungsende nachgedacht hatte, war es schließlich Tom gewesen, der sich vor etwas mehr als einem Jahr von mir getrennt hatte. Daran hatte ich zu beißen gehabt. Auch weil auf einmal alles so schnell gegangen war. Nach acht Jahren zu zweit hatte er mir an einem Sonntagabend angekündigt, dass er mich verlassen und am Ende der Woche ausziehen würde. Ausgezogen war er dann schon am Mittwoch. Inzwischen ging es mir wieder gut, und doch erschauerte ich immer noch, wenn ich an diese Zeit zurückdachte.
»Wie alt ist sie?«, hörte ich Oliver fragen.
Ich zuckte zusammen. »Wie bitte?«
»Deine Nichte. Wie alt ist sie denn?«
»Lara? Sie wird bald drei.«
Ich zeigte auf das nächste Foto. »Hier bin ich in einem Nationalpark. Während meiner Australien-Reise.«
»Du siehst glücklich aus«, bemerkte Oliver.
Ich nickte lächelnd. »Ja, das stimmt.«
Dass ich auf dem Foto wahrscheinlich etwa so alt war wie er heute, nämlich gut zehn Jahre jünger, behielt ich für mich. Seit ich im Altenpflegeheim Linde arbeitete, war es mit dem Reisen schwieriger geworden. Auch deshalb mochte ich es, Menschen aus anderen Ländern in meiner Wohnung zu beherbergen. Bei der Arbeit war ich diejenige, die etwas von der Außenwelt in den nahezu geschlossenen Kosmos der Bewohnenden hineinbrachte, während es sich mit meinen Gästen gerade andersherum verhielt. Sie brachten ein Stück große weite Welt zu mir nach Hause.
Oliver lächelte, murmelte etwas.
»Wie bitte?«
Er machte eine Kopfbewegung in Richtung der Magnetschnur. »Wie Perlen an einer Schnur.«
Jetzt verstand ich erst. Ich erwiderte sein Lächeln, ließ den Blick über die anderen Fotos schweifen und spürte auf einmal einen leichten Druck auf der Brust, ohne genau zu wissen, warum. Der Kaffee begann zu blubbern, zuerst nur leise, dann immer lauter. Der würzige Duft verteilte sich in der Küche. Ich stand auf, ließ zwei-, dreimal die Schultern kreisen und war froh, dass das Engegefühl wieder verschwand. Ich stellte Milch und Zucker auf den Tisch, schenkte ein.
Oliver tippte auf seinem Handy herum, zeigte mir ein Foto von sich und einem anderen. Der andere überragte Oliver um einen Kopf und hatte verstrubelte, dunkle Haare. »Das ist Samuel. Bei ihm habe ich in Basel gewohnt. Ein toller Typ, ihr solltet euch mal kennenlernen.«
Ich blickte auf die Uhr, morgen hatte ich Frühdienst. Falls ich gleich einschlafen konnte, blieben mir noch knapp sechs Stunden, bis der Wecker klingeln würde. Ich erhob mich vom Tisch und ließ Wasser ins Spülbecken laufen. Oliver griff nach dem Geschirrtuch, erzählte von Samuel. Die beiden schienen sich gut verstanden zu haben. Basketball, eine Wohnung, Altbau, mitten in Basel, ein kleiner Sohn – ich hörte nur mit einem Ohr zu. Ich war auf einmal sehr müde.
Nach dem Abwasch betraten wir nacheinander das Bad, wünschten uns eine gute Nacht. Wenig später lag ich im Bett und bekam mit, wie sich Oliver im Zimmer nebenan ebenfalls zum Schlafen hinlegte. Meine Fotos und Erinnerungen wie zur Perlenschnur aufgefädelt, ein schönes Bild. Wie schnell doch die Jahre vorbeizogen. Ich wollte versuchen, mir den Glanz zu bewahren, auch jener Perlen, die bereits aus meinem Leben verschwunden waren. Der Lichtspalt unter der zugezogenen Schiebetür, die unsere Zimmer trennte, erlosch und kurz darauf schlief ich ein.
*
Das hell erleuchtete Stationszimmer stand wie eine Laterne mitten im Flur. Alles war ruhig. Normalerweise wurde ich frühmorgens auf dem Weg vom Foyer ins Stationszimmer bereits mehrfach zur Seite genommen von Arbeitskolleginnen, die Hilfe brauchten, meistens auch von Herrn Sieber, der nicht mehr schlafen konnte und das Eintreffen der Zeitung erwartete. Nach der kurzen Nacht war ich froh, langsam in den Tag starten zu können. Ich schob die Glastür auf und begrüßte Sara, die über die Ablage gebeugt Tabletten in kleine Plastikbehälter abzählte. Das feine, regelmäßige Klacken klang wie das Ticken der Uhren in Herrn Rothenbergs Zimmer. Sara hob den Kopf. »Anna, meine Liebe. Früh dran?«
Ich zog mein Handy aus der Tasche, prüfte die Uhrzeit. Mein Dienst begann in zehn Minuten. »Geht so«, murmelte ich und schob mich zum Umziehen an Sara vorbei in den hinteren Teil des Raums, der durch hohe Garderobenschränke abgetrennt war. Die Arbeitskleidung bestand aus einer weißen Hose und einem fliederfarbenen Oberteil mit einer asymmetrisch verlaufenden Reihe von Druckknöpfen. Noch immer mit dem Zuknöpfen beschäftigt, ging ich wieder nach vorn, nahm zwei Tassen vom Abtropfgestell, schob sie unter den Kolben der Kaffeemaschine, und schaute zu, wie der Kaffee langsam herabfloss. Ich kippte zwei Löffel Zucker in meine Tasse. Ohne Zucker im Kaffee wurde ich morgens nicht wach.
»Hattest du viel zu tun?«, fragte ich Sara. Vor sieben Jahren, als ich in der Linde angefangen hatte, waren wir nachts noch zu dritt gewesen und die Nachtschichten hatten eindeutig mehr Spaß gemacht.
Sara verstaute die Plastikboxen mit den Medikamenten im Schrank, ließ sich neben mir auf einen Stuhl fallen. Sie hatte diese Nacht bei uns ausgeholfen, normalerweise arbeiteten wir nicht in der gleichen Gruppe. Ich reichte ihr die Kaffeetasse.
»Das Übliche. Frau Rossi hat mehrmals nach einem Schmerzmittel verlangt. Bei ihr solltest du als Erstes vorbeischauen.«
»War sie immer noch verwirrt?«
»Ich hatte nicht den Eindruck. Aber du kannst das besser einschätzen.«
Bei einer Hüftoperation hatte Frau Rossi eine Vollnarkose bekommen, und nicht nur der erfolgte Eingriff, sondern auch die Narkose machten ihr zu schaffen.
»Und bei dir? Wie war dein Abend?«, fragte Sara.
»Oliver hat für mich gekocht.«
Sara runzelte die Stirn, blickte mich fragend an.
»Oliver, mein Besuch aus Boston.«
»Ach so, ja.«
Ich wollte gerade ansetzen, ihr von Oliver zu erzählen, als ich das leise Klimpern an der Scheibe hörte. Herr Felber saß in seinem Rollstuhl vor dem Stationszimmer, schlug mit den beiden goldenen Eheringen, die er am kleinen Finger trug, vorsichtig dagegen. Ich streckte den Daumen hoch, auch das gehörte zu unserem Morgenritual.
»Ich muss los. Meine Morgenrunde mit Herrn Felber, du weißt schon.«
Sara grinste. »Morgenrunde mit Kräuterkunde.«
Ich legte den Kopf in den Nacken, band mir meine schulterlangen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen. »Ob du es glaubst oder nicht, aber von ihm habe ich mehr gelernt als im gesamten Biounterricht in der Schule.«
»Ich sag ja gar nichts«, erwiderte Sara lachend.
Ich rückte den Stuhl zurück und stand auf. »Hast du heute Abend schon etwas vor?«, fragte ich und griff nach meiner Tasse.
»Kommt darauf an, wann. Nach der Arbeit bin ich mit meiner Mutter im Hammam verabredet.«
»Hammam? Mit deiner Mutter?«
»Etwas dagegen?«, fragte Sara schmunzelnd.
»Nicht, wenn es dich glücklich macht. Halb acht im Zebra? Dann lernst du Oliver kennen.«
»Ich melde mich.«
»Bring Claire mit.«
Rasch trank ich den Kaffee aus, stellte die Tasse in die Spüle. Herr Felber war Experte für Wildkräuter. Niemand sonst war so eng mit den Pflanzen verbunden wie Herr Felber. Wann immer möglich, begleitete ich ihn in den Garten, meistens schon frühmorgens. Ich verließ das Stationszimmer, legte meine Hand auf seinen Oberarm. »Guten Morgen Herr Felber. Sie möchten an die frische Luft, stimmt’s?«
Er nickte. »Können Sie mich schieben?«
»Zuerst hole ich Ihnen aber noch eine Decke, es ist kalt draußen.« Da tauchte am Ende des Flurs Herr Sieber auf und fragte aufgeregt, ob ich die Zeitung gesehen hätte. Ich begleitete ihn zur Sitzecke, versprach ihm, mich darum zu kümmern, als Wanda, die Rezeptionistin, den Kopf aus dem Büro streckte und mich zu ihr bat. Ich vertröstete sie auf später, ihre Anliegen waren selten dringend, und ich wollte Herrn Felber nicht länger warten lassen.
Als wir uns schließlich auf den Ausgang zubewegten, betrat eine junge Frau das Foyer. Sie musste die neue Auszubildende sein, die von einer anderen Pflegeeinrichtung zu uns gewechselt war. Ava, Nina oder so. Wir nickten einander zu, der lange Zopf fiel ihr dabei seitlich über die Schulter.
»Ich habe vergessen, wie sie heißt«, flüsterte ich Herrn Felber zu. Herr Felber war in Gedanken bereits bei seinen Kräutern und reagierte nicht auf meine Bemerkung. Im Glas spiegelte sich sein Gesicht mit dem vorstehenden Kinn, dann ging die Eingangstür auf. Aus der Seitentasche seines Rollstuhls kramte er seine Taschenlampe hervor und leuchtete in die Dunkelheit.
Am Abend sah ich Oliver schon von Weitem. Er saß auf einem der roten, schweren Eisenstühle, die auf dem Münsterplatz herumstanden, und blickte auf das Weltengericht oberhalb des Kircheneingangs. Ich verlangsamte den Schritt. Als Kind hatte mich das erhobene Schwert von Erzengel Michael besonders beeindruckt. Oma Ann hatte mir damals erzählt, mit der goldenen Seelenwaage würden die Herzen der Toten gewogen und anhand des Gewichts der Wert ihrer Seelen bestimmt. Die bösen Fratzen und entstellten Körper der Verdammten hatten mir Angst gemacht, zudem war ich mir nie sicher gewesen, mit welchem Herz man auf der Seite der Erlösten war: Einem leichten oder einem schweren Herzen?
Ich war bei Oliver angekommen, tippte ihm auf die Schulter. Erschrocken drehte er sich zu mir um. Seine Augen waren gerötet, als hätte er geweint.
»Anna«, sagte er und seine Miene hellte sich auf.
Lärmend zog er einen zweiten Stuhl für mich heran. Ich bedankte mich und setzte mich auf die Stuhlkante. »Falls du reingehen möchtest, müssen wir uns beeilen. Bald wird abgeschlossen.«
»Besser wir bleiben noch ein Weilchen draußen sitzen. Es ist schön hier.« Er ließ den Blick über den Platz schweifen. »Wie war es bei der Arbeit?«
Ich lächelte, vergrub meine Hände in der Jackentasche und lehnte mich zurück. »Gut, danke. Und dein Tag?«
Oliver schnitt eine Grimasse. »Dir darf ich es fast nicht sagen, aber den Großteil davon habe ich verpennt. Ich bin erst am Nachmittag aufgewacht.«
Ich lachte laut auf. »Genieß es, solange du kannst.«
Als uns kalt wurde, schlenderten wir zur Münster-Plattform, wo wir bald mit Flo und Lara verabredet waren. Auch Sara hatte angekündigt, später ins Zebra zu kommen. Wir hievten uns auf die Steinmauer und blickten auf die in der Ferne liegende Bergkette, deren Gipfel in ein glänzendes Rot getaucht waren, und auf den Fluss hinab. Dieser führte für die Jahreszeit ungewöhnlich wenig Wasser. »Dort unten haben meine Eltern geheiratet«, sagte ich und zeigte auf ein Lokal am Flussufer. Da hörte ich auf einmal Laras helle Stimme meinen Namen rufen. Als ich mich umdrehte, kam Lara angerannt. »Hallo Lara!«, rief ich zurück und ließ mich von der Mauer gleiten. Die Zipfelkapuze ihrer blauen Jacke wippte auf und ab, und die Strickmütze, unter der ihre blonden Haare hervorschauten, rutschte immer weiter nach hinten. Ich streckte meine Arme aus, um sie aufzufangen und mich mit ihr im Kreis zu drehen. Doch kurz bevor sie mich erreicht hatte, bremste sie ab, schaute kritisch in Olivers Richtung. Hinter ihr tauchte Flo auf, winkte uns zu. Ich hob Lara hoch. Als ich ihr Oliver vorstellen wollte, drehte sich Lara von ihm weg, legte ihren Kopf auf meine Schulter. Oliver machte einen Schritt zur Seite, blickte hinter meinen Rücken, Lara vergrub ihr Gesicht in meinen Haaren. Ihre Wangen fühlten sich kalt an. Oliver wiederholte das Spiel so lange, bis Flo zu uns stieß und Lara zu kichern begann. Nachdem ich ihn und Oliver miteinander bekannt gemacht hatte, ließ er den Ball, der unter seinem Arm klemmte, auf den Boden fallen, stoppte ihn mit dem Fuß und fragte, was wir trinken wollten. Er würde vorne am Kiosk etwas holen gehen. Flo sprach weder besonders gut noch besonders gern Englisch und nutzte die Gelegenheit, sich für einen Moment davonzustehlen. Ich wusste, wie Flo tickte und machte mir keine Sorgen. Nach einer gewissen Anlaufzeit und ein, zwei Bieren würde sein Englisch rasch flüssiger werden.
Als Flo mit den Getränken zurückkam, hatte Lara ihre Schüchternheit abgelegt. Immer wieder stupste sie Oliver ans Bein, um seine Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen. »Lass mal den armen Oliver in Ruhe«, sagte Flo, nachdem wir einander zugeprostet hatten.
»Das macht nichts«, entgegnete Oliver, der Flos Ermahnung verstanden haben musste. »Ich liebe Kinder.«
Als hätte auch Lara verstanden, was gesprochen worden war, und auf dieses Zeichen gewartet, nahm sie Oliver an der Hand und zog ihn mit sich fort. Flo und ich schauten den beiden nach, wie sie die Kieswege zwischen den Rasenstücken abschritten. Immer wieder blickte Lara seitlich an Oliver hoch, redete auf ihn ein.
»Sie findet ihn gut«, stellte Flo trocken fest. Ich lachte, hängte mich bei ihm ein. »Nicht wehmütig werden, lieber Bruder. Gewöhn dich besser daran.«
Später standen wir zu viert in einem Kreis und kickten einander den Ball zu. Die Sonne war längst untergegangen und man konnte kaum noch etwas sehen. Doch das war Lara egal. Sie genoss es, uns für sich haben, und ich staunte, wie sehr Oliver meine Nichte zum Mittelpunkt machte. Normalerweise unterhielten sich die Großen miteinander, während sich Lara daneben mehr oder weniger selbst beschäftigte. Doch mit Oliver drehte sich alles um Lara. Obwohl ihr vom vielen Rennen und Herumtoben schon fast die Augen zufielen, war sie überhaupt nicht einverstanden, als sie sich vor dem Zebra schließlich von Oliver und mir verabschieden sollte. Mit verzweifeltem Blick klammerte sie sich an meinem Hals fest. »Es ist Zeit, schlafen zu gehen, kleine Maus«, sprach Flo ihr gut zu, doch Lara beharrte darauf, kein bisschen müde zu sein. Dann tauchten Hand in Hand Sara und ihre Freundin Claire auf, und Flo nutzte den Moment, um sich mit Lara davonzustehlen.
Wir anderen setzten uns im Zebra an den freien Tisch neben der Tür und bestellten Bier, Weißwein und Wasser. Im Gegensatz zu Flo vorhin brauchte Sara keine Anlaufzeit. Voller Begeisterung erzählte sie vom Hammam-Besuch mit ihrer Mutter. Wenn ihr ein Wort auf Englisch nicht sofort einfiel, sagte sie es auf Deutsch, und Claire, zur Hälfte Engländerin, übersetzte nahezu simultan. Daraus entstand ein unterhaltsames Sprach- und Stimmengewirr, dem allerdings nicht ganz leicht zu folgen war. Sara ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und beschrieb die verschiedenen Stationen, an denen der Körper offenbar aufgewärmt und, wie sie sagte, gereinigt wurde. Ich war noch nie in einem Hammam gewesen und konnte mir auch nach Saras Schilderungen nicht besonders viel darunter vorstellen. Oliver schien es ähnlich zu gehen. Da endlich machte Sara eine Pause, strich über meinen Arm und strahlte mich an. »Zu deinem nächsten Geburtstag lade ich dich in den Hammam ein. Du wirst es lieben.«
Ich stöhnte laut auf.
»Oder wir gehen irgendwohin, wo es viele Rutschen gibt«, schlug Claire vor und zwinkerte Sara dabei spöttisch zu.
»Bitte verschont mich. Mir reicht ein Bad in der Aare, um glücklich zu sein.«
»Ich habe Bilder gesehen von den vielen Gummibooten«, schaltete sich nun auch Oliver ein, »schade, dass ich das verpasse.«
»Es ist ja nicht so, dass man im Winter nicht in der Aare baden könnte«, sagte Claire.
»Echt?« Oliver schaute sie mit großen Augen an.
»Hör nicht auf sie«, warnte ich ihn. »Claire ist kein gesunder Maßstab, besser du kommst irgendwann nach Bern zurück, wenn es wärmer ist. Du kannst jederzeit bei mir wohnen.«
»Oder bei uns«, schlug Claire grinsend vor, »da hast du sogar ein eigenes Zimmer mit einem richtigen Bett.«
Oliver lachte laut auf. »Danke, das ist lieb. Aber zuerst seid ihr dran. Wann besucht ihr mich in Boston?«
Sara schaute Claire fragend an. »Im Sommer?«
»Im Sommer«, bestätigte Claire und hob ihr Glas. Wir prosteten einander zu. »Auf die Boston-Reise und unsere schweizerisch-amerikanische Freundschaft.«
*
Am nächsten Tag holte mich Oliver zu Fuß von der Arbeit ab. Er wartete im Foyer auf mich, und ich beschloss, ihn mit Frau Steinbach bekannt zu machen. Ich hatte gesehen, dass sie mit ihrer Tochter in der Cafeteria saß, und wollte, dass Oliver meine Lieblingsbewohnerin kennenlernte. Die Cafeteria war öffentlich zugänglich, doch es gab kaum je Gäste von außerhalb. Auch heute war nur ein Tisch besetzt. Selbst der stadtbeste Apfelkuchen konnte nichts dagegen ausrichten, dass die Hemmschwelle, eine Alterseinrichtung zu betreten, für die meisten hoch war. Zu hoch. Kaum jemand wollte freiwillig mit dem Alter konfrontiert werden. Das war schade – und eine verpasste Chance, denn niemand wusste mehr über das Leben und das Altern zu erzählen als die Menschen hier. Man musste sich nur ein bisschen Zeit nehmen. Ich hätte mich über etwas mehr Betrieb, Begegnungen und Kinderlachen gefreut. Und Frau Steinbach bestimmt auch.
»Sie ist blind«, flüsterte ich Oliver zu, als wir auf Frau Steinbachs Tisch zusteuerten. Ihre Tochter hatte mich bereits erblickt. »Da kommt ja Anna«, hörte ich sie sagen. Frau Steinbach drehte den Kopf in meine Richtung, hob tastend die Hand. Ich trat an den Tisch, legte meine Hände um Frau Steinbachs Hand und begrüßte die beiden Frauen.
»Setzen Sie sich doch und trinken Sie eine Tasse Tee mit uns«, sagte Frau Steinbach.
»Ein anderes Mal gerne, Frau Steinbach. Heute möchte ich Ihnen nur kurz meinen Gast vorstellen.« Frau Steinbach wusste, dass ich hin und wieder Leute in meiner Wohnung beherbergte, doch Oliver war der erste Gast, den sie persönlich kennenlernen würde.
»Sie bringen Besuch mit?«
»Oliver, komm«, winkte ich Oliver heran, der in einiger Entfernung stehen geblieben war. »Ja, Oliver aus Boston. Er ist derzeit auf Europa-Reise.«
Frau Steinbach strahlte. »Das ist ja wunderbar. Oliver, wie gefällt es Ihnen in der Schweiz?«
»Sie müssen Englisch sprechen, Frau Steinbach.«
»Wunderbar. Anna ist ein netter Mensch, nicht wahr?«, wechselte sie ins Englische. Oliver, freundlich wie er war, stimmte ihr zu. »Anna ist großartig.«
»Ich werde ganz verlegen«, kommentierte ich augenzwinkernd.
»Haben Sie schon viel von der Schweiz gesehen?«, fragte Frau Steinbach und ich staunte, wie gut sie Englisch sprach. Ohnehin fand Frau Steinbach fast immer einen Weg, um mit ihren Mitmenschen ins Gespräch zu kommen. Auch im Heim. Es war nicht schwer, in ihr die beliebte Lehrerin von früher zu sehen. Immer noch wurde sie von ihren ehemaligen Schützlingen gelegentlich besucht oder zu Klassentreffen eingeladen.
»Schon einiges. Aber noch nicht genug«, gab Oliver charmant zur Antwort. »Morgen reise ich nach Zermatt.«
Ich schaute zu Oliver. Das wusste ich noch nicht. Frau Steinbach erzählte, dass sie vor vierzig Jahren einmal in Boston gewesen sei. »Das ist schon länger her, Mutter«, korrigierte ihre Tochter sie sanft. »Ich war damals ja noch nicht geboren.«
Wir unterhielten uns eine Weile über Boston, die beeindruckende Bibliothek, die Frau Steinbach dort besucht hatte, und über frühere Zeiten, in denen das Reisen noch schwieriger und teurer gewesen war. Dann verabschiedeten wir uns von Frau Steinbach und ihrer Tochter.
Als wir aus der Cafeteria traten, begegneten wir im Foyer Frau Marthaler. Sie verbrachte viel Zeit auf ihrem Zimmer, und es freute mich, sie unterwegs zu sehen. Ohne fremde Hilfe fand sie sich nicht