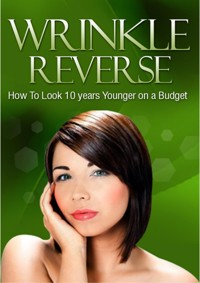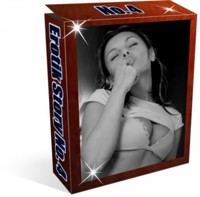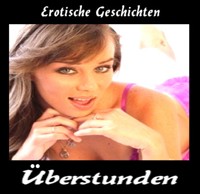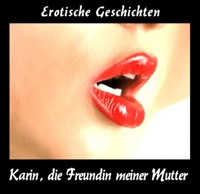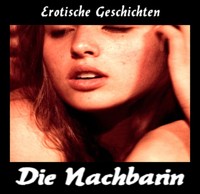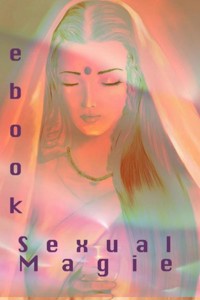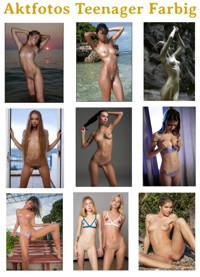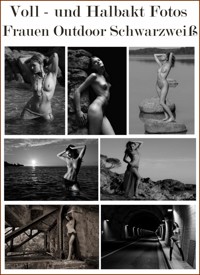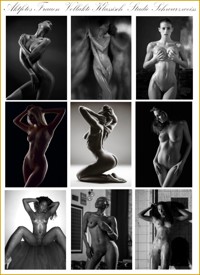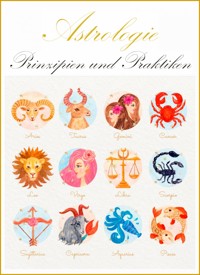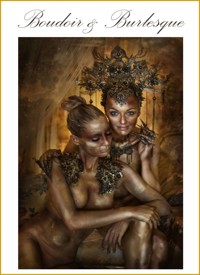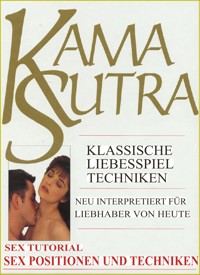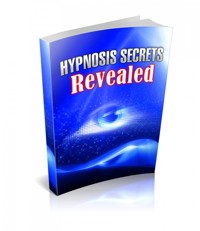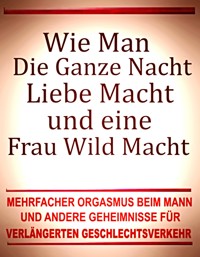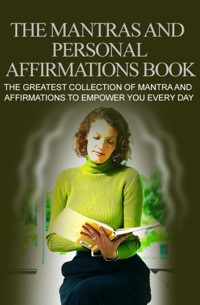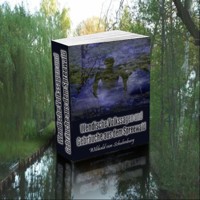
Wendische Volkssagen und Gebräuche aus dem Spreewald. Wilibald von Schulenburg. E-Book
Otmar Trierweiler
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wendische Volkssagen und Gebräuche aus dem Spreewald. Wilibald von Schulenburg. Wendisches Volkstum in Sage, Brauch und Sitte. Ein bedeutendes, regionales, deutschsprachiges eBook im Epub Format (300 Seiten). Klassikwerk deutscher Literatur. Deutsches Kulturerbe. Regionale Sagen, Volksmärchen, Legenden und Mythologie der Deutschen. Sofortdownload. Wilibald von Schulenburg (auch Willibald von Schulenburg; * 6. April 1847 in Charlottenburg; † 29. April 1934 in Berlin-Zehlendorf) war ein deutscher Landschaftsmaler und Volkskundler. Von 1876 bis 1879 lebte er beim Kleinbauern Badarak in Burg (Spreewald), zeichnete Häuser und Kleidung der einheimischen Bevölkerung, erlernte die niedersorbische Sprache und sammelte Sagen und Gebräuche – unter anderem vom Fischer Kito Pank –, die er 1880 in seinem Buch Wendische Volkssagen und Gebräuche aus dem Spreewald veröffentlichte. Rudolf Virchow erweckte 1879 sein Interesse für Vorgeschichte und führte mit ihm Ausgrabungen auf dem Schlossberg bei Burg, in Brahmow und auf Urnenfeldern in der Umgebung durch. Vorrede. Wenn ich die nachfolgenden Blätter der Öffentlichkeit übergebe, scheint es nothwendig, sie mit einigen Worten zu begleiten. Nachdem ich schon früher im Spreewalde gewesen, führten mich besondere Gründe vor drei Jahren aus dem Hessischen nach Burg. In der ersten Zeit meines hiesigen Aufenthaltes beachtete ich Sagen und Gebräuche nicht weiter, später fand ich Gefallen an ihnen und schrieb jene meist während der Erzählung nieder. Damals ganz unbelesen in diesem Zweige der heimischen Alterthumskunde, gewährte mir das Sammeln den Reiz einer Entdeckungsreise, welche immer neue Aussichten vor den Augen erschloß. Darum vermied ich auch, durch Lesen ein-schlägiger Bücher, mir die Freude des eigenen Auffindens zu nehmen. So ist diese Sammlung entstanden, ohne Zwecke und Absichten. Habe ich so Sagen und Erzählungen vereinzelt und zerstreut aus der mündlichen Überlieferung des Volkes gesammelt, so ragten ...........
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dem
Director des Königlichen
Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Posen,
Herrn
Dr. Wilhelm Schwartz,
dem unermüdlichen Förderer vaterländischer Kunde
und theilnehmenden Freunde dieses Buches
i n a l t e r Z u n e i g u n g u n d V e r e h r u n g
gewidmet.
Vorrede.
Wenn ich die nachfolgenden Blätter der Öffentlichkeit übergebe, scheint es nothwendig, sie mit einigen Worten zu begleiten. Nachdem ich schon früher im Spreewalde gewesen, führten mich besondere Gründe vor drei Jahren aus dem Hessischen nach Burg. In der ersten Zeit meines hiesigen Aufenthaltes beachtete ich Sagen und Gebräuche nicht weiter, später fand ich Gefallen an ihnen und schrieb jene meist während der Erzählung nieder. Damals ganz unbelesen in diesem Zweige der heimischen Alterthumskunde, gewährte mir das Sammeln den Reiz einer Entdeckungsreise, welche immer neue Aussichten vor den Augen erschloß. Darum vermied ich auch, durch Lesen ein-schlägiger Bücher, mir die Freude des eigenen Auffindens zu nehmen. So ist diese Sammlung entstanden, ohne Zwecke und Absichten.
Habe ich so Sagen und Erzählungen vereinzelt und zerstreut aus der mündlichen Überlieferung des Volkes gesammelt, so ragten doch einzelne Persönlichkeiten derartig aus der Masse hervor, daß sie als besondere Träger der Überlieferung anzusehen sind.
Eine derartige bemerkenswerthe Persönlichkeit, welche ich zufällig in der letztern Zeit meines Hierseins kennen lernte, war ein alter wendischer Mann, welcher bei einem außergewöhnlichen Gedächtnisse den größten Theil alles dessen wußte, was ich in kleinen Bruchtheilen von so vielen gehört hatte. Es war an einem schönen Sommerabende, als ich durch Busch und Wiesen heimkehrte und vor mir ein graues Männchen über den Weg streifen sah, dem gleich Flügeln die Bogen eines Kreuzhamens von den Seiten abstan-den. Ich winkte ihm, er blieb stehen und ich brachte eine Skizze desselben flüchtig zu Papier. Dann wünschte ich ihm: dobry wjacor (guten Abend) und folgte durch das feuchte Gras, durch Wiesen und Wei-dengebüsch. Zuletzt kamen wir an ein Wasser und gingen über den schwankenden Steg. »Hier wohne ich«, sagte das absonderliche Männchen und wies auf das dichte Blättergrün. Ich konnte kein Haus sehen, aber bald standen wir vor einem uralten Hüttchen, versunken in der Erde, mit schiefen Wänden und mit Schilf umstellt. Gebückt folgte ich jenem auf den Flur, in dessen Ecke ein Baumstamm mit Kerben lehnte, die Treppe zum Boden. Durch die kleine Thüre traten wir in die vor Alter geschwärzte Stube mit ebensolchem Schemel und Tischchen, die neben dem Bette und alterthümlichen Ofen nur wenig Raum auf dem dunkeln Lehmestriche ließen. Noch schmückten das Tellerbret und ein Schränkchen mit der Bibel die Wand. Hastig trat der Alte an den Tisch, ergriff einen Spaten und preßte mit dem Griffe unter Schmerzen seine Brüche in den Leib. Dann schlug er Feuer, stülpte die Buschka über die Pfeife und sprach:
»Jetzt, Herr, laßt uns reden.« Das war Kito Pank oder Kitko, wie ihn die Freunde nannten, der alte Erzähler in seinem Hüttchen, das teilnahmsvoll die Reisenden betrachten und die Hand fremder Maler verewigt hat.
Alter Kito! Wie oft habe ich deinen Worten gelauscht, wenn du, die mächtige Pfeife im Munde, Netze strikktest, Fässer spündetest, Uhren und Menschen heiltest oder auf gebrechlichem Nachen, in dessen Ecken die Gräser sprossen, zappelnde Fische fingst. Auch mit dir sinkt ein Stück Wendenthum in das Grab! –
Doch solche Erscheinungen waren selten. Allein auch sonst ganz unbedeutende Persönlichkeiten ge-wannen beim Erzählen Reiz, sei es, daß sie bei winterlicher Kälte auf der Ofenbank in die Zeiten der Väter sich vertieften, während anmuthige Töchter am schnurrenden Spinnrade den Faden zogen und aus dunkler Ecke die Urgroßmutter, selbst schon eine lebende Sage, über die große Nase uns anstarrte, sich hinwegsehnend aus dieser veränderten Zeit, sei es, daß sie an sommerlichen Abenden nach des Tages Last und Mühen vor der Thüre auf dem Bänkchen saßen, während hinter dem Hause Burschen und Mädchen in süßem Kosen die Zeit verkürzten und stille Klänge der Flöte oder Harmonika aus der Ferne zu uns herübertönten.
Manches wol wußten jene Alten noch, die letzten Säulen des Volksglaubens, aber wie wenig erhellt es die Geheimnisse der Vorzeit, wie wenig zeigt es, welche Wandlungen du schautest, alter heiliger Spreewald! Fern schon liegen die Zeiten, wo große Seen dieses Land bedeckten und die Bewohner, gehüllt in Thierfelle und Leinen, auf gehöhlten Baumstämmen das Wasser durcheilten, wo sie im Dickicht dem gefürchteten Stiere, dem Herrn der Schöpfung, begegneten und mit Steinbeilen die Stämme fällten zum schüt-zenden Gehege für die Behausung. Aber auch damals war Wandel, andere kamen, Kampf und Streit ent-brannte und jene nahmen als Herren das alte Land.
Die Zeiten änderten sich. Man schmiedete Waffen aus dem Eisen, das der Sumpf barg, und tauschte bronze-ne ein, welche Handelsleute brachten aus sagenhaften Landen, ebenso wie Werkzeuge, Schmucksachen und Perlen. Auch Gold fehlte nicht. Goldschmuck glänzte am Halse der Fürsten, Golddrähte zogen die Frauen über die Finger und steckten lange Nadeln von Bronze durch das gezierte Haar. Das Wasser schwand mehr und mehr, auf den Brüchen wucherten Riesen-stämme und im Luge wuchs langsam der Torf. Mancher versank mit dem Schmucke des Kriegers in der lügnerischen Tiefe und noch heute, nach vielen Jahrhunderten, findet man im Moore Halsringe und Spangen, welche einst unserer Ahnen Glieder schmückten.
Deren Leben war Kampf und Gefahr, aber auch heitere, ungetheilte Freude, wie wir sie nicht mehr kennen, erhöht durch den Trank aus Honig, den zahllose Bienen in Wäldern und Wiesen sammelten. Dann saßen die kraftvollen Gestalten behaglich und traulich in dem matt erleuchteten Gemache, bei dem Kaminfeuer, das auf den Steinen flackerte, sprachen von ihren Thaten und von alten Zeiten. Still lauschten die fleißigen Frauen, wirbelten die Spille mit dem Wirtel zwischen den Händen und setzten den irdenen Kessel voll Hirsebrei über das Feuer. Draußen auf dem Giebel aber prangten an den Windlatten die Hahnköpfe, zum Schütze gegen Dunder, wenn er mit rother Feder die Wolken schlitzte. Wenn dann der Tod kam und in ihre Reihen griff, wenn vielleicht auch ihre Seele ruhelos in den Winden flatterte, dann fuhren sie den Leichnam über das Wasser, daß weithin die Luft von ihren Klagen erscholl, hin zu den heiligen Höhen, wo auf den Todtenfeldern die Gebeine der Väter ruhten und die Geister der Verstorbenen scheuchten. Mächtige Holzstöße lohten auf steinernem Grunde und mit Gesang umtanzten sie die Gluten. Waren die Knochen gebleicht, so wurden sie gesammelt, die längsten und größten in Stücke geschlagen und sorgfältig in die Urnen gepackt, dazwischen aber legte man heilige Steine und Andenken der Todten. Dann wurden sie beigesetzt im Kreise der Reichen oder wo die dürftigen Töpfe der Armen standen. Mancherlei Gaben folgten, Gefäße und Schmuck wurden zerschlagen, Klagelieder erschollen abermals und zahllose Thränen entfielen den Augen. Aber grause Dinge geschahen auch, Diener und Frauen des Verblichenen folgten dem Herrn in die schaurige Hela. Wie grimm hat oft Todesnoth und Schmerz der Trennung von dem glänzenden Weltengotte das Antlitz der Frauen verzerrt!
Warm sie im Leben des Gebieters Begleiter, sollten sie auch dem Todten auf der Wanderung folgen. Opferthiere dampften, Spenden wurden den unterweltlichen Göttern gebracht und wild und ausgelassen verlief das Todtenmahl. Gott Wodan hatte den Helden zu sich genommen in seine ewige Walhalla. Das waren die Heiden.
Viel hundertmal hatten sich die Wiesen von neuem gelt schmückt, da brausten wilde Volksstürme durch den Erdtheil, auch der Vorfahren Beste wurden fortgerissen und zogen gen Mittag, um nimmer wiederzukehren. Fremde Völker, die slawischen Stämme der Wenden, rückten nach von Morgen in die verlassenen Ebenen, bewältigten die Zurückgebliebenen, machten sie zu Schalken und nahmen ihre Länder. Aber auch sie waren Heiden und wo die alten Deutschen ihre Götter ehrten, an ehrwürdigen Bäumen, an frischen Quellen, an großen Steinen, da opferten auch sie den ihrigen. Wiederum vergingen Jahrhunderte heiterer, fröhlicher Heidenzeit, da brausten von Abend neue Völkerstämme herein, die deutsche Welle schlug zurück und mehr als dreihundert Jahre tobten Krieg und Kampf. Christliche Deutsche standen gegen heidnische Wenden und heidnische Deutsche, welche unter jenen saßen. Kürzer wol hätte der Kampf gewährt, doch wüthender Haß spaltete das Deutsche Reich, Eigennutz schlug ihm Wunden und im Süden verloren die Kaiser ihre Kraft. Dichte Wälder, weite Sümpfe bedeckten das Land und nur auf wenigen Straßen und Dämmen konnten die Heersäulen vorrücken. An den Wenden lag es nicht. Auch sie waren gespalten, kein mächtiger Herrscher vereinigte des Volkes Kraft, sie waren muthvoll, aber ohne Helden, ohne Ausdauer, ungeschult. Wie ganze Berge rückten sie in die Schlacht, um der Unerschrockenheit weniger Ritter zu erliegen. Wie Spötter oder wie Kinder sahen sie lachend zu, wenn die Axt unbarmherziger Bekehrer ihre Götterbilder zerschmetterte oder Christenhand Feuer in ihre Heiligthümer warf. Ohne Gottesfurcht, ohne Heldenthum irrten die Wendenvölker durch die Zeit, so mußten sie erliegen. Es erreichte sie das Schicksal, das einst durch sie den Deutschen ward. Erst im Untergange erstehen Helden, Namen erglänzen, Wilk, Niklot, Pribislaw erstreiten die Unsterblichkeit. Dieser, als letzter der Wendenfürsten1, sprang, von Deutschen gedrängt, in die Fluten der Hawel, erreichte das ferne Schildhorn und wurde Christ. Dort, zwischen Spandow und Potsdam, bewahren Schild und Säule das Angedenken an die That. Allein noch lange lebte die Liebe zu den alten Göttern, die Heiligthümer flüchteten in Wälder und Sümpfe. Auch unser Spreewald barg der Heiden viele und als überall in der Runde schon die christlichen Glocken erklangen, da beteten sie noch zum heiligen Swantewit und den übrigen Göttern. Damals noch stand der alte Spreewald in Urkraft da, noch brachen Elche und Ure durch den Wald und sielten sich im schillernden Moore. Allein die Rundaxt mußte weichen und die grade Axt der Neuzeit wüthete unter den heiligen Stämmen. Höhen und Sümpfe verschwanden, die Irrlichter flüchteten vor den Menschen und ausgeglichen lagen Wiesen und Aecker da. Der alte Spreewald ist nicht mehr, die letzten Jahrzehnte sahen sein Ende.
Aber noch heute bewahrt das Land seinen alten Reiz, noch heute ist Burg mit dem ehrwürdigen Schloßberge das Ziel der Wanderer, ja selbst Fremder aus den fernsten Ländern der Erde. Auf flachen Kähnen gleiten sie durch zahllose Fließe, hinweg unter den Bänken, vorbei an blumenprangenden Wiesen, an den Blockhäusern der Wenden im schattigen Grün hoher Eschen und Erlen und noch schwankt zwischen Leipe und Burg der letzte Einbaum gefährlich durch das Wasser. Noch heute sind Burgs Bewohner ein eigenes Völkchen, ernst und verschlossen vor Fremden, heiter und froh unter sich. Noch erfreut die schlanke Wendin in den schimmernden Farben ihrer Tracht das Auge des Besuchers. Wenn der Frühling des Winters Kraft gebrochen, dann eilen sie alle hinaus auf die Aecker, der Spaten tritt in sein wendisches Recht, bunt leuchten in rothen Gewändern und weißen Tüchern weithin über die Felder Frauen und Mädchen.
Denn geschmückt und in bunter Tracht zieht auch die Wendin wieder zur Arbeit nach dem düstern Winter, sie will nicht schwarz trauern, wo die Natur in bunten Farben sich schmückt. Flachs und Weizen werden gewietet und in langen Reihen rutschen die Mieterinnen über die Aecker, oft macht der Jüngling einen Umweg, furchtsam vor den geschäftigen Zungen.
Immer länger werden die Tage und die Heuernte naht.
Fröhlich und geputzt eilt alles in die Kähne und vor lauter Sommerlust sprengen sich die Insassen mit dem glänzenden Wasser. Johanni-Mann war da, die Tage werden kürzer und die Getreideernte naht. Wie in uralten Zeiten sicheln die Wenden das Korn, sauber legen sie Garbe neben Garbe und rufen bei der letzten ihr fröhliches Kokot. Sonntags aber wallen einmüthig die Scharen der Andächtigen zum Gotteshause, um aus tiefem Gemüthe dem Herrn des Himmels, des Regens und des Sonnenscheins ihren Dank zu spenden.
Gleich langen Blumengewinden eilen die Reihen der Wendinnen zur Kirche, überall tauchen die bunten Farben auf im Grün der Büsche und Wiesen, um sich vor der Kirche zum herrlichen Bilde zu einen. Aber der Sommer ist schnell dahin geeilt, das Grummet eingeheimst, Störche und Schwalben verlassen das gastliche Burg und viele Arbeiten noch drängen zur Eile. Schnell werden die Kartoffeln dem Schose der Erde entnommen, man setzt eine Ehre darein, vor der Umgegend fertig zu sein. Keine größere Wonne als die nährende Frucht, und »Semjak, dir leb' ich, Semjak, dir sterb' ich« ruft in herzlicher Freude der Wende, wenn vor ihm die dampfende Schüssel auf dem Tische steht. Kühler werden die Abende, der »graue Mann« deckt seinen Mantel über die Erde und winterlich zieht sich alles in die Häuser zurück. Verlangt der Sommer eine rastlose Arbeit, so gestattet der Winter doch einige Erholung. Die Spinten treten in ihr Recht und wenn draußen weißer Schnee die Gefilde deckt, herrscht fröhliches Treiben bei der Jugend.
Sauber gekleidet wandeln die Spinnerinnen das Spinnrad unter dem Arme zur Spinnstube, munter schnurren die Räder und Gesang und Scherz verkürzen die Zeit. Aber wenn draußen der Sturm heult und finstere Nacht die trügerischen Bänke verbirgt, wenn der Nüx seine Opfer fordert und der Bud irreführt, dann lebt auch in der Jugendschar die Vergangenheit auf und durch die Stille des Zimmers gehen Geister und Gespenster. Jutschnja in der hundertfach erglänzenden Kirche, unvergeßlichen Anblickes, ward gefeiert, das Christkind im Lichterglanze ist erschienen, die Zeit ist da, wo die alten Götter ihren Einzug hielten, ein neues Jahr kommt herauf. Still und andächtig wird der letzte Tag des Jahres begangen. Waren wir, wie wir sein sollten und sind noch alle mit uns, die die vorjährige Pilgerfahrt antraten? Ach, nein, der Tod hat Lücken gerissen in der Familie Band, vor dem Pfarrhause schauten sie noch einmal im Sarge des Vaters Antlitz und senkten ihn dann in die kühle Gruft, mit den Gaben, die er im Leben erbat. Doch die neue Sonne bringt neues Leben und die Jugend gewinnt an Frohsinn mit ihr. Spinner und Spinnerinnen kommen zusammen, Tanz und Spiel wechseln mit Mummenschanz und Scharen Verkleideter ziehen die beschneiten Stege an den Fließen. Während die Frau spinnt, arbeitet der Mann kunstvoll in Holz und fertigt Geräth für den Sommer. Fastnacht kommt heran, der Schimmelreiter, der Erbsstrohbär, Ochse und Storch hielten den Umzug und noch einmal vereinigt der Fidel Klang weißglänzende Wendinnen zum Tanze.
Dann beginnt die Leidenszeit, kein Spiel, kein Tanz, in Trauergewändern gehen Frauen und Mädchen, bis zu Ostern die Erlösung schlägt und von neuem der Frühling seinen Einzug hält.
Doch, wie erwähnt, nur das alte Geschlecht, das die Mütter des vorigen Jahrhunderts sah, birgt voll den alten Volksgeist; mit jenen stirbt auch dieser aus.
Schon in wenigen Jahren wird begraben sein, was noch heute unter den Lebenden weilt. Hierbei ist nicht zu verhehlen, daß leider in den vergangenen Jahrzehnten, wegen Unfugs einzelner, eine Menge harmloser Sitten und Gebräuche, welche ein gefühlvolles Band mit der Vergangenheit bildeten, durch polizeiliche Verordnungen verboten worden sind. Warum? Beschränkungen etwaiger Auswüchse dürften genügen.
Solche durch das Alter geweihte Gebräuche des Landvolkes, wie die Spinten, die Holzabende, Mummen-schanz, Zampereien und ähnliche Zusammenkünfte der Jugend sollte man eher begünstigen als verbieten.
In ihnen wurde eine feinere Umgangsweise als sonstwie gepflegt, in ihnen der Geist der Dichtung von Geschlecht auf Geschlecht vererbt. Nüchterne Verstandeszeit, dem Volke auch das Bischen Dichtung zu nehmen! Ich habe wiederholt Spinten in Burg beigewohnt, und niemals jene Rohheit oder Unsittlichkeit wahrgenommen, als deren Brutstätten sie verschrien werden, wohl aber erfreulicherweise das Gegentheil.
Gegen den jammervollen und Volks vernichtenden Branntweintrunk ist gerade das gesellschaftliche Zusammenleben mit den Frauen und Mädchen das beste und einzige Mittel und wiederum die gemeinsame Spinte die beste Gelegenheit. Was sonst an langen Winterabenden in bläulichem Dunste die Schenken füllt und mit wüstem Gebrülle die Karten auf den Tisch haut, mit Branntwein das Hirn verbrennt und mit Messern die Schädel zerschlägt, das gewöhnt sich in Spinnstuben an feineres und geordnetes Verhalten, um meist frühzeitig in einer glücklichen Ehe sein Los zu sichern.
Ich bemerke nun ferner, daß ich diese Sammlung ausschließlich selbst im Volke und mit Ausnahme einiger Sagen aus dem angrenzenden Müschen und Umgegend lediglich in Burg zusammengebracht habe. Es bezieht sich daher a l l e s n u r a u f B u r g , wenn nicht ausdrücklich das Gegentheil bemerkt ist. Eine Ausnahme machen nur der Koboldsee mit den Sagen der dortigen Umgegend und die Lutchen, bei denen auch wenige Nachrichten anderer Gegenden sich finden. Was aus Büchern entlehnt schien, ist, vielleicht bisweilen mit Unrecht, übergangen worden. Nur bei dem Schloßberge find auch einige Sagen aufgenommen, welche aus Büchern stammen sollen; in zweifelhaften Fällen ist ein (B) hinzugefügt; (v) bedeutet vereinzelt. Die Nachrichten in den Anmerkungen sind ebenfalls aus Burg und den angeführten Orten und nur in einigen w e n i g e n Fällen mittelbar nach den Angaben Ortsangehöriger; Worte aus dem Munde des Volkes sind nötigenfalls mit »« eingefaßt. Die Erzählungen sind so zusammengefaßt, wie sie das Volk zusammenfaßt, und nicht getrennt, was dieses in dun-kelm Triebe einigt; daher finden sich auch Wiederho-lungen. Wenn manches unwesentliche angeführt zu sein scheint, so leiteten mich besondere Gründe, bisweilen der Abwehr anderweitiger Aussagen, sowie Rücksichten auf etwaige Beziehungen zu vorgeschichtlichen Funden, deren jedesmalige Erörterung zu weit geführt hätte. Sehr viele Erzählungen knüpfen sich an bestimmte, zum Theil noch lebende Persönlichkeiten, deren Namen indessen selten genannt wurden. Niemand möge übrigens glauben, daß diese Sammlung alle Ueberlieferungen von Burg enthält; ihre Menge ist noch lange nicht erschöpft, gerade auf der ergiebigsten Seite, an der Schrebeniza und Bluschniza, habe ich fast gar nicht geforscht.2 Aus einer Menge stehender Redensarten darf man auf den Untergang mancher Sagen schließen. Ich hätte in verschiedener Richtung mehr an das Licht fördern können, hätte ich vorher andere Sammlungen gekannt.
Noch ein Umstand verdient Erwähnung. In Stradow hat irgendjemand verkleidet Drescher erschreckt, in Vetschau haben andere bezüglich der wendischen Königin mit Fräulein B. ihr Spiel getrieben, auf dem malkschen Acker hat man brennende Lappen geschwenkt u. dgl. m. Das berührt das Wesen der entsprechenden Sagen nicht, auf welchen fußend jene ihre Täuschungen vornahmen.
Hört man jahrelang diese Sagen und auch die Angaben über ihr Herkommen bei den einzelnen, so entwickelt sich allmählich ein Bild über ihr Zusammenströmen an einem Orte, welches mancherlei zu denken gibt, namentlich im Hinblicke auf Folgerungen, welche aus dieser und jener Sage gezogen werden könnten; es ist alles sehr wandelbar. Für Burg treten noch besondere Verhältnisse auf. Lassen wir die alten, durch viele Jahrhunderte festsitzenden Bewohner, über deren Volksthum Zweifel bestehen können, außer Acht, so hat sich die Bevölkerung noch im vorigen Jahrhundert, vornehmlich durch Ansiedelung vieler Ausländer unter Friedrich dem Großen aus verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetzt. In Burg gibt es aus dieser Zeit Nachkommen von sächsischen Wenden, von Böhmen, von Ungarn und von Leuten aus verschiedenen andern Ländern des damaligen Oesterreichs, ja selbst von Russen und Livländern, welche bei der Rückkehr aus den Freiheitskriegen, angeheimelt durch verwandte Töne und den dichterischen Zauber des alten Spreewaldes, heimlich in Burg verblieben. Sie alle haben ihr Theil zu der vorhandenen Sagenmasse gesteuert. Auch die allgemeine Wehrpflicht hat viel zur Vermengung der Sagen beigetragen. Die Darstellung ist nach dem Volksmunde und würde sich allerdings bei feinerer Behandlung gefälliger lesen. Letztere wäre um so erwünschter, je weniger sich der Leser in der Stimmung und den Kreisen befindet, denen Sagen ihre Herkunft verdanken.
Was beim Lesen nüchtern und langweilig, ohne Handlung und Ziele erscheint, gewinnt Seele und Leben bei denen, welche mit liebevoller Hingabe in die Natur sich vertiefen und in ihrem Walten sich wiederfinden. Allein Veränderungen verändern den Eindruck, was jedoch nicht ausschließt, daß dem sprachlichen Ausdruck hier und da etwas nachgeholfen worden ist; es war nicht die Absicht Sprachproben des wendischen Deutsch zu geben und sonach hätte es kaum einen Zweck gehabt, alle Slawismen (z.B. Weglassung des Artikels, Verwechselung des Geschlechts der Worte, Anwendung intransitiver Verba als reciproke u.a.), die vom gewöhnlichen Mann in die deutsche Sprache gemischt werden, ganz genau wiederzugeben.
Verschiedene Gebräuche und Sitten, welche in Burg heimisch sind oder waren, finden sich nicht in diesem Buche. Sie sollten später, falls die Umstände die Bearbeitung gestatteten, in einem andern Werke mit Abbildungen erscheinen. Dasselbe sollte mehr das gesammte äußerliche Leben der Spreewaldwenden umfassen, ihr Thun und Treiben, Sinnesweise, Feste, Bauart, Trachten, alte Funde u. dgl. Zu diesem Zwekke habe ich auch mehrfach Theile des preußischen wendischen Gebietes durchwandert, war unter den sächsischen Wenden und im frühern Kaschubenlande in Hinterpommern. Deshalb fehlt in diesem Buche manches, was im andern sich finden würde.
Als Ausgangspunkt für örtliche Bestimmungen hat der sogenannte Busch (Kaupengemeinde) gedient, danach sind Bestimmungen: vor und hinter dem Dorfe und ähnliches zu deuten. Burg zerfällt in drei Gemeinden: in die Dorfgemeinde, wójsaŕska gmejna, Colo-niegemeinde, prisaŕska gmejna, und Kaupergemein-de, kupaŕska gmejna, die genannt werden: Burg-Dorf, Burg-Colonie und Burg-Kauper (fälschlich statt Kaupen). Das bisher unerklärte Wort prisa (Mehrzahl prisy) ist weder wendisch noch deutsch, sondern eine Abkürzung von entreprise, welches zur Bezeichnung einer Landstrecke in den Erlassen und Erbverschreibungen gelegentlich der Ansiedelungen durch Friedrich den Großen gebraucht wurde. So ist z.B. die Rede von der Erbverschreibung für Hans Schicha aus Bleschwitz in Böhmen bei der geschehenen Losung über die Entreprise mit Nr. 30 d.d. 1779; das entre fiel im Volksverkehre fort. Unzählige größere und kleinere Landstücke, bestehende und vergangene Höhen, haben und hatten wiederum besondere Namen, welche, mehr den Aeltern als den Jüngern bekannt, oft werthvolle Aufschlüsse über frühere Verhältnisse geben. Wenig bekannt, selbst unter den Wenden, sind an der neuen Spree: die škrokowa góra (Fichtenberg), die Chmelischtscha unweit der Schiletarka, Noaksberg und gen Morgen vom Stawenzfließe der Töpferberg, sämmtlich verschwundene Höhen. Ebenso viele Namen bieten die Fließe. Eine der üblichsten Ortsbestimmungen ist Pank (Gasthof). Die einzig zuverlässige Karte, welche auch die geringsten Einzelheiten in größter Genauigkeit gibt, ist die Generalstabskarte.
Alle andern sind um so weniger zuverlässig, je mehr sie von diesem Vorbilde sich entfernen.
Zur Veröffentlichung dieser Blätter hat mich zuvörderst der Wunsch vieler Wenden bewogen, ebenso später die Absicht, in d i e s e r Richtung ein treues, unverfälschtes Bild des V o l k s g e i s t e s , wie er zu meiner Zeit sich darstellte, ohne Zuthaten und Deu-tungen zu geben. Daher haben außer den eigentlichen Sagen viele Nachrichten Aufnahme gefunden, welche nicht im e n g e r n Sinne als sagenmäßig gelten können; deshalb ist die Bezeichnung »Sagen« im Titel dieses Buches in weiterm Sinne zu fassen. Solche Nachrichten dürften von diesem Gebiete der Lausitz nicht unangebracht sein, denn der Spreewald mit seinem sagenumwobenen Schloßberge ist und bleibt ein Stück Land, das besondere Theilnahme beansprucht, auch wenn man nicht in ihn den heiligen Hain der Semnonen verlegt, wie das schon geschehen ist. Tacitus sagt in der Germania (39) ausdrücklich, daß man nur gefesselt den Wald betreten durfte; wer fiel, mußte sich auf der Erde hinauswälzen. Das aber war ein Ding der Unmöglichkeit bei dem Schlamme und Moraste, der mit Ausnahme weniger Berghöhen den Wald füllte. Der Spreewald zu B u r g kann daher in dieser Beziehung nicht in Betracht kommen.
Die vorkommenden wendischen Worte gehören dem niederwendischen Dialekte an, und es ist bei deren Wiedergabe die diesem Dialekt eigentümliche Orthographie angewendet sowie von einem sprach-wissenschaftlichen Wenden durchgeführt worden. Die vom Deutschen abweichenden Laute und Schriftzeichen des Niederwendischen sind:
Niederwendisch Deutsch
(Dieser aus kj oder cj entstandene Laut hat sich
nur im Worte
źówčo, das
Mädchen, erhalten; in andern
Worten ist c dafür
getreten.)
gepreßt), tschj
(Entstanden aus tj, findet sich nur nach s, š,
ž, c; in andern
Lautverbindungen tritt dafür
ś ein.)
hartes l, in Burg meist wie
w gesprochen
(mouillirt), etwa wie: lj
Nachschlag)
ó
uo (etwa)
(Steht nur nach labialen und
gutturalen Lauten in
betonter Silbe, und dort
nur, wenn kein labialer oder
gutturaler Laut folgt.)
ř
sch (Kommt nur in den
Lautgruppen př,
tsch, ksch vor.)
s
ss oder ß
š
sch
ś
schj (weicher als sch)
(Ursprung und Anwendung s.
unter ć. )
y
ü (etwa), griechisch
υ; verflüchtigt sich
in vulgärer Sprache am Ende
der Worte oft fast zu e
z
s (in Salbe, sehen)
ž
sch (in Niesche), d.i. wie
das französische j in jourź
žj (also gelinder als
ž)
(Entstanden aus dj,
entspricht dem
oberwendischen dź. )
Als Sprachproben folgen noch im »Anhang« einige Zusammenhängende niederwendische Texte, über die dort das Nöthige bemerkt ist.
Die »Nachträge und Verbesserungen« (Seite 297) wolle der Leser nicht übersehen. Es finden sich in denselben Ergänzungen, welche zur Klarstellung mancher Angaben im Texte dienen, ebenso wie Verbesserungen sachlicher Fehler. Wenngleich es nicht unzweckmäßig gewesen wäre, aus der Fülle der Gebräuche und der oft reich ausgebauten Sagen der an-stoßenden deutschen Gegenden, aus welchen schon seit langer Zeit wendische Sprache und wendisches Volksthum bis auf leise Nachklänge zurückgewichen sind, und welche gleichsam eine Uebergangszone zwischen den rein wendischen Gebieten der Lausitz und den deutschen der Mark bilden, Beispiele als Beweise des allmählichen Ueberganges wendischer Volksauffassung in die deutsche zu geben, so hätten doch dergleichen Zusätze den Umfang dieses Buches zu sehr erweitert. Aus diesem Grunde schien es auch besser, mit wenigen Ausnahmen, vergleichende und erklärende Anmerkungen fernzuhalten und nur das einer nähern Erklärung zu unterziehen, was als besondere Eigenthümlichkeit des Spreewaldes oder der Wenden überhaupt solcher Erörterung für weitere Kreise bedurfte.
Schließlich erfüllen wir eine Pflicht, wenn wir das Gedächtniß bewahren des Oberpfarrers Christian Friedrich Stempel (1823–64) zu Lübbenau, von dem es in der Geschichte der Stadt Lübbenau heißt: »Rastlos hat er stets für sein liebes Wendenthum gearbeitet und manche Nacht mit dem Aufzeichnen wendischer Fabeln, Sagen und Märchen verbracht. Leider sind diese kostbaren Schätze, von seinen Erben nicht genügend gekannt und geschätzt, der Vernichtung geweiht und der Wissenschaft entzogen worden.«3
B u r g , im September 1879.
W. von Schulenburg.
Fußnoten
1 W. Schwartz, »Bilder aus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte«, S. 93.
2 Hierbei möchte ich nicht unterlassen auf die s a g e n r e i c h e Gegend bei Scheibe hinzuweisen.
3 Nur eine Kunstdichtung Stempel's ist erschienen:
» Faedrusowe basnicki z łatynskeje do serbskeje rěcydołojcnych Łužycow přełožone přez Chr. Fr. Stem-pla, hušego fararja w Lubnowje. Hudawaŕ J.E.
Smoleŕ. Die Fabeln des Phädrus aus der lateinischen in die niederlausitzisch-serbische Sprache übertragen von Chr. Fr. Stempel, Oberpfarrer in Lübbenau. Herausgeber I.E. Schmaler« (Bautzen 1854. 8. VIII, 56 S.)
Erster Abschnitt.
Der wendische König.
Der wendische König auf dem Schloßberge zu Burg.
Der wendische König1 hat auf dem Schloßberge zu Burg gewohnt und war ein Räuber. Er schlug die Hufeisen verkehrt auf, daß niemand wissen sollte, ob er heraus- oder hineingeritten war, und hatte eine lederne Brücke, die sich von selbst hinten zusammen- und vorn wieder aufrollte. Darüber ist er geritten; so konnten sie ihn nicht abfassen, denn damals war alles Sumpf und Wasser. Sein Weg ging immer nach Guhrow2. Er hatte viel Geld, darum ist der Schloßberg verwünscht worden. Zuletzt kam ein Gewitter und erschlug den König, und das Schloß versank. Das kann man noch sehen, denn in der Mitte ist der Schloßberg tief, und stößt man mit einer Stange auf, so klingt es hohl.3
Vor dem wendischen Könige war niemand auf dem Schloßberge, bis er sein Schloß da gebaut hat. Er stand mit dem Teufel im Bunde, und der half ihm den Berg anschippen. Letzterer war rings herum hoch und innen tief, die Bewohner waren Räuber.
Zu seiner Zeit waren fünf Budchen im Dorfe und eins in Leipe, und die Leute lebten nur von Fischerei, – damals waren noch keine Leute in Burg, es war noch unbewohnbar, und drei Fischer fingen an zu bauen.
Ein Schloß war nicht auf dem Schloßberge; sie wohnten unterirdisch an der Seite im Rande (Walle), da hatten sie Gewölbe unter der Erde (B.).
Der wendische König hat sich eine Gegend ausgesucht, wo niemand herankommen konnte. Sie haben ihn in die Wildniß gejagt, und er ist allein in den Spreewald gekommen.
Er war im Kriege überwunden und vertrieben, und sein Land ihm genommen worden. Da schaffte er sich ein Corps an und zog mit ihm in den Krieg; er konnte aber nichts ausrichten. Da schaffte er sich eine Räuberbande an, aber es ging ihm nicht besser; er konnte auch mit ihnen nichts anfangen, weil niemand in der ganzen Gegend wohnte. Da ist er herumgegangen und suchte, wo er allein könnte wohnen. Er hatte blos z w e i G e s e l l e n bei sich und fand hier das sumpfige Land, wo niemand gehen konnte. Da hat er sich mit dem Schwarzen verbunden, mit einem kleinen Männchen einen Vertrag geschlossen, der sollte ihm in einer Nacht eine Burg machen, oben zu und innen die Wohnung. So wurde der Schloßberg in einer Nacht fertig gemacht, da, wo lauter Sumpf und Morast war. Drebkau war damals das erste Dorf und Cottbus die erste Stadt. Vom Schloßberge aber bis nach Cottbus, bei Androws, geht ein unterirdischer Weg, der ist da erst sichtbar; auch den hat in einer Nacht das kleine Männchen gemacht. Rogazki hieß der wendische König und Schistowa die Königin.4 So haben sie lange Zeit da gewohnt. Allein die Königin war unzufrieden, weil sie keine Kinder hatte, so sollten die beiden (Gesellen) zwei Kinder schaffen. Da sagten die Zwei: »Die Kinder sind christlich, das wird nicht passen«. Dann raubten sie die Kinder bei einem Förster in Drehnow, und in Drehnow soll noch die Jahreszahl von dem Kinderraube sein. Das eine Kind war sechs Jahre alt, das andere jünger, ein Junge und ein Mädchen. Sie waren gerade beim Baden, und die Räuber steckten sie in einen nassen Sack, legten sie in den Kahn und fuhren zurück bis in den Weidenbusch.
In den alten Weiden suchte ein Junge Staare (Olestern, d.s. Elstern), darum hieß die Stelle lange Zeit Werbowa.5 Da wurden sie müde und legten sich schlafen. Die Mutter der Kinder war ihnen aber nach-gefahren, und der Junge zeigte ihr die Räuber, und sie nahm ihnen die Kinder wieder weg. Dann fuhren die Räuber nach der Burg zu, und es kam ein Ungewitter herauf, sodaß sie nicht nach Hause kommen konnten.
Wie sie andern Morgens früh an den Schloßberg kamen, war die Burg zerschmettert und der König vom Blitze erschlagen, die Königin aber nicht. Sie wurde mitsammt dem Gelde von den beiden verwünscht.
Der wendische König hat erst als König ein Reich gehabt, nachher hatte er nur zwei Personen bei sich von der Räuberbande.
Ein wendischer Fürst lebte in Serbien (die wendische Sprache kommt aus der Türkei) und der schrieb an den sächsischen Fürsten6, daß er seine Tochter heirathen wollte. Und der Sachse schrieb: »Einem solchen wendischen Hunde gebe ich meine Tochter nicht.« Da antwortete der serbische Fürst: »Ich werde mich auch zeigen wie ein Hund«, nahm alles zusammen, seine ganze Macht, und zog hierher gegen die Sachsen. Aber die überwältigten ihn und jagten ihn hinein in die Wildniß. Hier mußte er in den Sumpf und hat den Schloßberg gebaut. Hier hat er gelebt und immer Ausfälle gemacht und geraubt und alles weggenommen. Seine Frau soll er von einem Förster irgendwo bei Lübben gehabt haben. Vor der großen Bank über die Mühlspree (Werchosch-Wezlauk) hatte er seine Brücke, daß er da, und auch nach Drehnow, Peiz zu eine Brücke, daß er auf der andern Seite hinauskommen konnte. Wo er in ein Dorf der Umgegend kam, war er nie allein, immer mit seiner Mannschaft.
Andere haben nie gewußt, wo er war, denn alles war Sumpf und Wald. So hat er es verschiedentlich getrieben. Zuletzt schickte er die Zwei nach Drehnow. Den Tag war es schwül und heiß. Und wie ihnen die Kinder weggenommen waren, und sie das dem Könige sagten, da soll er gesagt haben: »Böse Botschaft«.
Den Tag kam eine schwarze Wolke herauf über den Schloßberg, mit Blitz und Donner, und machte dem wendischen Könige ein Ende. Da ist alles durch Gottes Hand mit Feuer vernichtet worden.
Ueber die Rollbrücke, die sich von selbst aufrollte – immer vorn ausbreitete –, ist er geritten – gefahren – gezogen. Sie soll auf eichenen Pfählen über den Sumpf weggegangen sein, so breit, als er gerade mit Pferd und Wagen darauf fuhr. Sie war von Leder – von Gummi (v) – von Holz – von Eisen (v), ging nach Schmogrow – Werben, heißt da jetzt noch die Ruda – zu Lapank7 hin, am Wege nach Dorf Burg – über den Teich – hinter Werchosch, westlich der Ein-mündung der Sprewiza in die Spree, da ist bei kleinem Wasser noch ein Pfahl zu sehen, – zwischen Schmogrow und Byhlegure.
Sein Weg ging nach Werben – Dorf Burg – nach Lübben, da hatte er seine Zusammenkünfte mit Kameraden und fuhr dahin mit der Kutsche die Wilischtscha entlang, über Förster Raschik, den Zaucher Berg und durch die Mutniza, da soll noch von damals her ein großer Stein im Wasser liegen. Der wahre Weg des wendischen Königs, serskego krala droga, ging nach Guhrow, da ist er immer mit dem Wagen gefahren. Da hatte er seinen Durchgang durch die Spree, und von der Brücke ist noch ein Pfahl im Wasser zu sehen. Dieser Weg ist noch jetzt vorhanden.8
Er hatte seinen Ausweg bis nach Cottbus, unter der Erde. Dazu hatte er eine unterirdische lederne Brücke, deswegen konnte ihn niemand ausspüren, außer an dem Loche, wo er hinausgeritten war.
Er war ein Raubkönig – König der Räuber – Räuber – Spitzbube.
Er hieß Strudeski – Trudeski – Prodenski – Prudenski (soll ein Pole gewesen sein, denn Sußki hieß ein burgscher Colonist, und der war aus Polen, und soll der erste gewesen sein) – Pschisto – Rogazki –Ragazki.9
Die Königin hieß Strudeska, – Testoa und war aus Oßnik (?) – Schestoa – Zestoa – Strudenska und war aus Storkow bei »Lucke«. Sie hatte einen Schatz in Storkow und mochte den wendischen König nicht.
Der wollte sie aber heirathen, und der Vater fürchtete sich vor dem Räuber, und sie mußte ihn nehmen. Auf der Swopiza (?) hinter Lübben hatten sie ein Gefecht auf dem Wasser und schössen mit Bogen. Testoa siegte und brachte auf dem Kahne seine Braut nach dem Schloßberge (v).
Der König hatte keine Kinder – eine Tochter, die im Schloßberge verwünscht sein soll.
Die umliegenden Dörfer mußten ihm Hafer und Brot, und wessen er bedürftig war, liefern.
Er hatte z w e i bei sich – viele Reiter – Soldaten – hunderte von Mannschaften, die immer mit ihm ausritten und immer noch mehr Leute raubten. Sein erstes Dorf im Spreewalde war Drehnow.
Auf den drei Gleichen bei Erfurt10 wohnten drei Ritter, die kamen immer mit dem wendischen Könige auf dem Schloßberge zusammen und hatten ihre Brük-ke über die Mühlspree (Werchosch).11
Er ist mal fortgeritten und nicht wiedergekommen.
Einmal ist er nach Briefen geflüchtet, da haben sie ihn gefangen. Soldaten aus Magdeburg haben ihn vertrieben. Die Schweden haben ihn beschossen. D e r K a i s e r h a t d e n S c h l o ß b e r g e r o b e r t .
Wie der wendische König gestorben war, zankten sie sich wegen des Schlosses und führten Krieg. Und es kamen viele Soldaten und brannten das Schloß nieder. Und wie sie zurückgingen, zerschlugen sie die Brücke hinter sich, und die Stücke sind fortge-schwommen. Das Wasser verlief sich auch, und sie haben Häuser gebaut (B).
Albrecht der Bär wollte den Schloßberg nehmen.
Weil überall Sumpf war, konnte er nicht herankommen. So holte er sich eine große Kanone und schoß über den Sumpf weg alles in Flammen. Erst als es fror, konnten sie den Sumpf passiren (v).
Die Oesterreicher konnten ihn von Werben aus nicht ordentlich beschießen. Weil aber der Winter stark war, kamen sie auf dem Eise näher. Dabei geschah es, daß des Königs Tochter auf lange Zeit verwünscht wurde. – Sie hatten hölzerne Kanonen mit Reifen12 und schossen vom Berge hinter der Kirche im Dorfe und zerstörten das Schloß. Die Leute konnten sich nicht mehr halten, da wurde alles zerstört; die Festung hatte der wendische König eingerichtet (B).
Er hatte eine Bande von 200 Mann. Einer von diesen hat ihn an die Vetschauer verrathen, dadurch wurden sie auf dem Schloßberge in der Nacht überfallen und sämmtlich ermordet (v).
Die Schweden standen hinter Schmogrow bei Sakasne und schössen bis zum Schloßberge. Sie haben den König gefangen genommen, in Ketten gelegt und fortgeführt. Früher kämpfte man nur auf dem Wasser, es war zu dichtes Holz.
Ein byhlegurer Schulmeister hat erzählt: ein Schwede hat ihn vertrieben, und zwischen Liebitz13
und Mochow haben sie ihn geschlagen.
Die Oesterreicher haben den Schloßberg bombardirt, den König gefangen genommen und auf einem Leiterwagen mit goldener Kette nach Sibirien unter die Sklaven geführt. Die Königin aber machte sich mit dem Sohne, der unterwegs starb, auf nach Magdeburg und hat die Stadt Burg erbaut (B).
Bei Krabat an der Mühlspree, oberhalb der Mühle, fand sich ein Wagen, der vom wendischen Könige herrühren soll, weil er seinen Weg da hatte.14
Fußnoten
1Serski kral.
2 Richtung von Nordwest nach Südost.
3 So weit ist die Sage ganz allgemein bekannt.
4Kralowka.
5Wjeŕbowa.
6 Des Gebietes des jetzigen Königreichs.
7 Dort sind Pfähle zum Vorschein gekommen.
8 Ein kleines Stück aufgeschütteten Erddamms wird hinter dem »alten Kunzak«, südöstlich vom Schloßberge, gezeigt, ein anderes, hundert Schritt langes, oberhalb Krabat, beide in der Richtung auf Guhrow.
9 Ragazki heißt auch der Räuberhauptmann in einer burger Räubergeschichte (B). Als Freier verlockt er eine junge Gräfin in den Wald. Hingestreuten Erbsen folgend gelangt sie durch eine Eiche in die Räuber-wohnung, hascht dort den Finger eines andern Schlachtopfers und gelangt glücklich wieder in des Vaters Schloß. Dort werden bei einem scheinbaren Hochzeitsmahle die 80 Räuber umgebracht.
10 Erfuhren Soldaten aus dem Buche eines Quartiermeisters bei Erfurt.
11 Dort s o l l ein Conducteur Pfähle mit eisernen Spitzen gefunden haben; zur Zeit des Sammlers ward in der Nähe ein eisernes Rundbeil gefunden.
12 Sogenannte lederne Kanonen (Kupferröhre mit Ei-senreifen, Stricken, Gips, Leder u.s.w.), eingeführt unter Gustav Adolf 1626; sie waren bei den Oesterreichern 1627–28 im Gebrauch.
13 S. Stäber, Chron. v. Cottbus, I, 7.
14 Der jetzt im Königlichen Museum zu Berlin befindliche Wagen lag unweit der Spree in nasser Niederung, aber unterhalb des angeblichen Durchganges des wendischen Königs.
Der wendische König auf dem brahmoer Schloßberge.
Früher stand auf dem brahmoer Schloßberge ein Schloß, in dem wohnte der wendische König. Er war aber auch auf dem burgschen Schloßberge, denn beide gehörten zusammen. Er war ein Räuber und hat die Christen beraubt. Die Hufeisen hatte er verkehrt aufgeschlagen, und es war immer so, als wäre er ausgeritten; sie konnten ihn nicht abfassen. Ueber die Brükke ist er durch die Luft geflogen, als wenn er auf Erden ginge. Es hat kein Mensch erfahren, wo er geblieben ist; auf einmal war er weg. –
Der wendische König soll einen silbernen Sarg gehabt haben; vier haben ihn begraben. Sie wurden todtgeschossen, daß niemand wissen sollte, wo er begraben ist. Er soll mit den Schweden da gelagert haben.1
Fußnoten
1 Diese Nachricht fand der Verfasser nur bei den jüngern, vielfach zugezogenen Bewohnern von Babow, in Müschen war sie nur einem bekannt, aber nicht, daß das Grab an der Fundstelle der babower Ringe (im Königlichen Museum zu Berlin) gewesen sei.
Den Schloßberg1 haben in einer Nacht drei Riesenweiber mit ihren Schürzen zusammengebracht – neun Weiber neunmal mit ihren Schürzen (als es 12 Uhr schlug, ließ eine, welche faul war, die Schürze voll Sand fallen; da entstand Rumposchs Bergchen2) – die alten Männer mit Erde von Maulwurfshügeln – ein Bauer mit Ochsen und drei Weiber mit Schürzen –
Leute haben ihn zusammengekarrt – der Teufel ihn zusammengebracht (was von der Schippe abfiel, wurde die Wilischtscha.3) – drei Weiber von Leipe4 haben die Erde hergebracht (unterwegs ruhten sie ans, und die eine ließ Sand fallen, davon entstand die Wilischtscha).
Früher war alles viel höher am Schloßberge als jetzt. Das Schloß5 war groß, schön, jetzt ist nichts mehr vorhanden, – es ist unterirdisch – untergesunken – während es beschossen wurde, denn es war verwünscht – in der Mitte, wo es versunken ist, war Wasser.
Die Bewohner waren Räuber, welche Kinder stahlen.
Auf dem Schloßberge war früher ein großes Loch in der Erde – in der Mitte, in der Gegend des Fußsteiges – an der Ecke bei Laschki – an der Ecke zwischen dem Fußsteige und dem schmogrower Wege; sie fanden es beim Sandgraben. Dabei brüllte ein Löwe oder so etwas, es ging jede Nacht wieder auf, mit einer Schoberstange konnten sie keinen Grund finden, ein Stein schlug erst nach fünf Minuten auf. Das Schloß soll untergesunken sein, davon war das Loch.6
Einmal kam ein Reisender in die burgsche Mühle.
Da fingen sie an vom Schloßberge zu reden und losten zuletzt, wer an einer Leine in das Loch hineingelassen werden sollte. Das Los traf auf den Müller.
Wie sie ihn dann in das Loch, den Gang, hineinließen, kam er an eine eiserne Thüre. Da befiel ihn große Furcht7, und er zupfte an der Leine, und sie zogen ihn wieder heraus.
Vor mehr als hundert Jahren kam ein fremder Mühlenbescheider nach Burg. Den machten sie betrunken und ließen ihn an einem Stricke in das Loch hinab.
Da sah er unten, daß es ganz hell und vier Thüren dort waren, eine gegen Morgen, eine gegen Abend, eine gegen Mittag, eine gegen Mitternacht, und alle diese Thüren hatten gelbe Schlösser und gelbe Bänder, und vor jeder Thüre lag eine große Schlange. Wie die ihn gewahr wurden, streckten sie ihre Köpfe gegen ihn in die Höhe, da ließ er sich wieder herausziehen.
Manche sagen: es sind zwei eiserne Thüren.
Vom Schloßberge soll ein unterirdischer Gang gehen bis Marienberg bei Biebersdorf (Lübben) – zu Handrows in Cottbus, da kommt er heraus – bis zum Gefängnisse in Cottbus.
Auf dem Schloßberge ist viel Spuck, vornehmlich Nachts. Die Pferde werden scheu, denn das Thier sieht mehr wie der Mensch. Der alte wendische König reitet ohne Kopf über den Berg; es geht immer in der Dämmerung eine Frau herum, ganz weiß gekleidet, bei Tage schwärze Männerchen; viele Flammen sieht man, auch im Winter auf dem Schnee. Selbst am hellen lichten Tage hat das Geld »gespickt« und dagelegen. Unten im Schloßberge ist noch eine goldene Wiege, silberne Messer und Gabeln.
Auch eine Verwünschte ist im Berge, eine Jungfrau – die Königin – die Tochter des wendischen Königs –; sie sitzt und spinnt an einem Spinnrade – sie sitzt in der Erde tief und soll zwölf Hemden machen, doch jedes Jahr blos einen Stich, dann ist sie gelöst, dann wird alles wieder herauskommen, der König auch – sie kommt alle hundert Jahre blos heraus an das Tageslicht, an die Sonne – sieben Mannshemden soll sie fertig machen, alle hundert Jahre an jedem Hemde einen Stich. Wenn einer sie treffen wird und das Hemde nehmen, so ist sie gelöst, aber wer wird sich das zutrauen? Hätte sich der Soldat, hat sie gesagt, damals alles Geld genommen, so brauchte sie nicht mehr zu sitzen.
Der wendische König hat das Schloß und alles darum und daran verwünscht, weil er so viel Reich-thum hatte, und alles dableiben sollte; daher stammt der Schatz.
Als Urbenz vor mehr als hundert Jahren hinter dem Schloßberge Pferde hütete, ist nachts um 12 Uhr ein Wagen mit vier Hunden vom Schloßberge gekommen und nach Schmogrow querüber gefahren. Urbenz ging heran, wollte sehen, was es war, da hat ihn der eine Hund gebissen; bei den Hunden war ein kleines Männchen. Da ist Urbenz sehr erschrocken und auf dem Berge gestorben.
Vier (zwei) Windhunde, blitzeblank, waren es, die haben den Wagen gezogen. Feuerige Flammen haben ihnen aus dem Maule gebrannt, und das Feuer ist nur so geflogen, und sie sind in der Nacht durch die Luft gefahren. Das war das Geld des wendischen Königs, und sie haben es durchgefahren bei Krabat. Da soll eine Brücke in der Mühlspree sein, wo der wendische König seinen Durchgang hatte (přez rudy).
Nachmals kam ein Mühlenbescheider, der fragte nach dem wendischen Könige und nach allen diesen Geschichten und wo das Geld geblieben wäre. Da sagten sie in der Mühle, wo der König wäre; wo das Geld war, wußten sie nicht. Und der Bescheider meinte, das würde er schon erfahren und ging hin auf den Schloßberg. Den ersten Tag kam er nicht mit dem Könige zu sprechen, den zweiten auch nicht. Den dritten Tag ging er wieder hin und traf die rechte Stunde, in der er mit dem Könige sprechen konnte. Und citirte den König, daß er persönlich vorgekommen ist, und fragte: »Wo haben Sie das Geld hingeführt, das in dem Schloßberge verscharrt war, und die Windhunde, die das Geld wegführten?« Da antwortete der wendische König: » Zwischen Burg und Magdeburg, da steht eine Linde, und unter der Linde ist alles verscharrt.« So viel hat er erfahren.
Fußnoten
1g rod.
2 Am Wege nach dem Dorfe, bereits verschwunden.
3 Ein Höhenzug.
4 Manche sagen, der wendische König habe sie im Kriege gefangen und mitgenommen; denn, was er fand, nahm er mit.
5pytko.
6 S. Engelien und Lahn, Volksmund, Burghof bei Scholläne u.a.
7 Auf dem Czorneboh bei Bautzen »gingen mal zwei durch den Wald. Da sahen sie eine Thüre und erschracken so, daß sie fortliefen. Das war vor vierzig Jahren, der eine lebt noch.«
Die wendische Königin.
Auf der Brücke1 zwischen Stradow und der stradower Mühle haben die Alten gesehen, wie eine adelige, ganz adelige Frau mit Perlen und solcherlei versehen, an der Brücke gewesen ist. Sie fragten die Person, was sie wünschte, und sie sagte: »Ich habe keine weitere Sorge, als gelöst zu werden.« Es ist nun schon lange her, wie da in Vetschau bei P.....ke2 eine Tochter war. Zu der Tochter kam eine Frau und sagte: »Du sollst mich retten. Wenn ich Dich werde heißen in einen Keller zu gehen, da werden drei Männer sitzen und ein Schwert hängen, und da sollst Du das Schwert nehmen und dem mittelsten den Kopf abhauen. Das soll zu einer bestimmten Zeit sein, da werde ich wiederkommen.« Zu der bestimmten Zeit kam die Frau und sagte dem Mädchen: »Komm, ich werde Dir zeigen.« Da ging das Mädchen mit in den Keller hinein, – es war aber kein Keller –, die Frau ging voran, das Mädchen hinterher. Die Frau aber hatte ihr vorher gesagt: »Wenn Du hineinkommst, zieh Dich um.«
Wie nun das Mädchen innen war, da zog sie sich aus, bekam ein anderes Kleid und zog das an. Da kam ihr Bruder, der ihr nachgegangen war, und griff sie an der Hand. Da sagte das Mädchen: »Verrücktes Luder, laß mich zufrieden.« Und wie sie das Wort gesprochen hatte, da fing es an zu brausen, und das Mädel wurde über und über mit Asche besprüht, und das Kleid fiel voneinander, wie von Zunder und wie verbrannt.
Nachher kam die Frau wieder, brachte dem Mädel ein Kästchen mit und sagte: »Wenn Du in die Kirche gehst und das Vaterunser betest, sollst Du die Hände auf das Kästchen legen.« Eine Zeit lang that sie das, zuletzt nicht mehr. Dann wurde sie wie wahnsinnig, ganz schwach in Gedanken. Die Frau hatte ihr auch gesagt: »Du sollst eine Linde im Garten pflanzen.
Wenn von der Linde Breter geschnitten werden, und von den Bretern eine Wiege gemacht wird, und welches Kind in der Wiege gewiegt wird, das wird mich retten.« Diese Linde war in P.s Garten gepflanzt worden. Da kamen zwei Landstreicher, und der eine sagte zu dem andern: »Komm, wir werden die Linde ausreißen.« Und er ging in den Garten, und riß die Linde aus, dabei bekam er eine solche Ohrfeige, daß er zwei Tage blutete. Gerade zu jener Zeit war auch an unserm Schloßberge eine Linde gepflanzt, und in der selbigen Nacht war auch sie da ausgerissen worden.
Das haben viele Menschen gewußt und gesagt.
Fußnoten
1 S. die Wasserjungfern, im 9. Abschnitt.
2 richtiger: B-n.
Der Soldat und das Männchen
Es wird weiterhin erzählt werden, wie Malks das Geld vom Schloßberge holten, und wie oft Männer zu der Tochter des feldschen Malk kamen, die doch das Geld alles haben sollte. Später ist auch die Königin in der Nacht zu ihr gekommen und sprach: »Dir ist Glück bescheert, Du sollst es holen. Du sollst hineingehen in den Berg, da wird eine Lampe brennen, und dann wirst Du ganz in die Erde hineinsehen.« Andere haben abgerathen, aber sie ging doch hin. Sie war schon da, wollte in die Höhle hinein und sah da eine Lampe brennen. Da kam ihr Bruder, der war ihr nachgegangen, faßte sie am Rock, riß sie zurück und rief sie beim Namen und ging mit ihr zur Höhle hinaus.
Da war es vorbei, und die Königin wurde nicht gelöst.
Nach langer Zeit kam ein Soldat, Makariz, mit einem Tornister den Weg nach dem Schloßberge entlang und ging auf Urlaub nach Hause. Da kam ein Männchen, ging mit ihm und sagte: »Wohin? wirst wol viel Geld haben?« Da sagte der Soldat: »Ach, Du wirst wol wissen, daß die Soldaten nicht viel Geld haben.« Sagte das Männchen: »Dir ist heute viel Glück bescheert, Du kannst heute zu Gelde kommen.
Wo Du wirst vorbeikommen am Schloßberge, da wird eine Frau sitzen (mit einem Tischchen) und bei einem brennenden Lämpchen spinnen. Die wird bei der Höhle sein, da geht der Eingang hinein. Da werden drei Haufen Geld sein, da darfst Du dreimal von jedem Haufen in den Tornister scharren. Die Frau wird Dich sehr nöthigen, alles zu nehmen, damit sie nicht mehr zu spinnen braucht. Das thue aber nicht, denn sonst wird sie gelöst sein, und Du mußt spinnen.« Dann bat das Männchen den Soldaten um seinen Säbel, es hätte einen großen Krieg vor und würde ihm keinen Schaden thun und den Säbel wieder herausbringen. Aber er sollte genau aufpassen, ob helle glänzige weiße Blasen heraufkommen würden, dann hätte er den Kampf gewonnen; wenn aber blutige herauskämen, so hätte er verspielt, und der Soldat sollte schnell seiner Wege gehen. Dann ging das Männchen mit dem Säbel in das Wasser; das war bei Lapanks, wo der Nur war. Bald kamen große Blasen, sehr viele sprangen heraus, weiße, hellglänzende. Da unten war eine Verwünschte, die hatte er gelöst, eine schöne seine Jungfrau. Nachher kam euch das Männchen heraus, brachte die Jungfrau mit und sagte: »Den Kampf habe ich glücklich gewonnen.« Der Säbel war blutig, aber der Soldat sollte ihn selbst abwischen; so wischte er ihn ab. Dann sagte das Männchen, er wäre einer von dem Gelde.
Wie der Soldat nun auf den Schloßberg kam, saß die Frau da, und er nahm dreimal von dem Gelde, nicht öfter, ging seiner Wege und wurde ein reicher Mann. Die Königin aber sitzt noch heute auf dem Schloßberge.
Zweiter Abschnitt.
Burg.
In alten Zeiten stand Burg1-Dorf noch nicht, auch die beiden andern Gemeinden waren nicht, und Werben war das erste Dorf vor dem Spreewalde. Nur wenige Leute wohnten hier, es war alles Sumpf und Wald.
Sie lebten von Fischfang und brachten die Fische in kleinen Eimern zum Verkauf nach Cottbus. Die Eimer waren aus Buchenborke2 gemacht, darum hießen sie Borken, wie noch jetzt zbórk. Wenn dann die Burger mit ihren Fischeimern kamen, sagten die Werbener:
» Nět se póraju te bórkarje z tymi rybami k předan-koju, jetzt kommen die Vorckrigen mit den Fischen zum Verkauf« oder die Cottbuser: » Nět se póraju tezběrkowarje (die Burkauer)« und nannten sie darum Burkauer, wie denn die Alten in Cottbus und andern Orten noch heute so sagen. Davon hat Burg seinen Namen.3
Die ersten im Dorfe waren drei Fischer an der Mühle und hießen: Nezker, Werchosch, Gibow und ein vierter: Ganik, ein Holzknecht, der Aufseher war, daß die Leute nicht zu viel Holz nahmen. Zu denen sind die Lutchen immer gekommen und haben sich von ihnen dies und jenes geborgt. Die vier wohnten, wo jetzt die Dorfmühle steht. Wo jetzt die Familie Schorradt auf den Kaupen wohnt, war früher ein Bergchen. Da waren Lutchen, ein Mann und eine Frau, und damals auch wilde4 Leute. Wie die Leute das Haus bauten, kam immer eine wilde Frau, die war nackend und hat sich am Feuer Frösche gebraten; die burgsche Mühle war zu der Zeit gebaut. Es heißt auch, ein Bramer auf den Kaupen soll der erste in Burg gewesen sein.
Die ganz Alten, die sich hier ansässig machten, waren Wenden – Wendekaschuben, die sind dann wieder fortgegangen in die danziger Niederung. Danach kamen Ausländer (v). Die Wenden sind von Serbien gekommen, und die Alten sagten: Serbje, serbi-ske (luže), Serben, serbische (Leute).5
Die Wilischtscha ist aus einem großen Regengusse – durch eine Wasserflut entstanden. Krügers-(Grunewalds-) Berg bei dem Dorfe hat vormals der Wind in einer Nacht von Ssykoriz-Kaupe dahin getrieben.
Die schwarze Ecke heißt so, weil früher viel Wald da war, und der Töpferberg, gjancarska góra, ebenda so, weil ein Töpfer da gewesen sein soll. Daselbst fand man viele alte Scherben (Gefäße), Kohle und Knochen. Da liegen auch jetzt noch die Gebeine von einem Schweden (Kosaken), der von Vetschau auf Raub nach Burg geritten kam; es soll gerade Dürre gewesen sein. Da schoß ihn einer (Förster Lanschke) vom Pferde, die Leiche aber versenkten sie im Luche.
Das Pferd lief nach Vetschau zurück. Ein vetschauer Schmied, Namens Bartholomäus, hatte, wie es heißt: nach einer Urkunde, einen Mann in Vetschau erschlagen und floh über die Grenze nach Burg, auf preußisches Gebiet. In der Wildniß siedelte er sich auf dem Töpferberge an und lebte nur von Fischerei. Später, in Kriegsnöthen, zeigte er den Herrschaften von Sese (Radusch) den Weg zu seinem Verstecke, daher heißt in der Gegend ein Stück Land noch: na bžežkim.
Heber den Töpferberg sind die Schweden einmal von Straupitz nach Vetschau gezogen und haben über die Mühlspree vor der großen Bank (Werchosch) eine Brücke geschlagen. Von der ist bei kleinem Wasser noch ein Pfahl zu sehen. Einmal sollen sie auch von Lehde aus auf Kähnen durch den Spreewald gefahren sein.
Was sonst noch alles der Volkssage nach in Burg geschehen ist, wird an andern Orten in diesem Buche berührt werden.
Fußnoten
1Bórkowy; Bórkojski, der Burger.
2skóra; Siebe u. dgl. aus Rothbuchenrinde haben sich bei einzelnen noch bewahrt.
3 Burg ist geschichtlich bereits vor mehr als fünfhundert Jahren nachweisbar und wird schon in einer lateinischen Urkunde vom Jahre 1353 (mitg. v. Falisch, »Geschichte von Lübbenau«) als »Borck« erwähnt, dagegen ebendaselbst in »Borgwelchen« (unbestimm-bar, eine Höhe?) anders geschrieben. Es wird eine »molendina de villa Borck«, Mühle vom Dorfe Borck genannt. Burg mußte also damals schon eine größere Anzahl Bewohner haben, weil die fernern Dörfer jedenfalls nicht auf dieser Mühle mahlen ließen (nach mündlichen Berichten soll die burgsche Mühle früher an der Stelle der alten Kschischoka-Mühle gestanden haben?). Das jetzige Naundorf (w. Njaboškojce) heißt ebendaselbst nova villa, »neues Dorf«, offenbar im Gegensatze zu Burg und andern Nachbardörfern. Burg kann also g e s c h i c h t l i c h noch früher zurückverlegt werden. Es ist aber nachweislich in noch frühern Jahrhunderten von heidnischen Leuten bewohnt gewesen, welche eiserne Ausrüstung besaßen und ihre Tobten verbrannten. Von diesen mehr zu erzählen, ist hier nicht der Ort. Kunde von ihnen geben allein die alten Scherben und Lutchentöpfe, die alten Steine, altes Eisen, alte (gelbe, grüne) Bronzesachen, Golddraht u. dgl. m., kurz, alles was in der Erde, im Acker, auf Wiesen, unter Baumwurzeln u.s.w. gefunden wird. Dergleichen soll man nicht wegwerfen oder zerschlagen, sondern alles s o r g f ä l t i g s a m m e l n und a u f h e b e n , das ist j e d e r m a n n s P f l i c h t , weil es uns die e i n z i g e n Nachrichten gibt von den V o r f a h r e n , welche vor uns d i e s e s L a n d b e w o h n t e n . In der erwähnten Urkunde wird noch der Höhenzug» Wilizki«, jetzt Wilischtscha (Wilišća) und der »Lan-genhorst«, zweifellos der jetzige »Horst«, genannt.
Der Spreewald ging bis Byhlegure, das »Belgar« heißt. Im werbener Kirchenbuche (Burg war dort ein-gepfarrt) von 1642–1709 schreiben die Geistlichen bald Borg, bald Borgck. Ein Dorf Burg ist noch im Wendischen bei Burghammer, ferner bei Bautzen, sowie in der Mark, deutsch und wendisch Bork genannt u.s.w.
4 Bedeutet oft so viel wie heidnisch.
5 Der Name Lausitz ist bei den alten Leuten oft unbekannt.
Leipe.
Die Leiper1 stammen ab von – Riesen (die Riesen sind einmal verjagt worden und entflohen und nach Leipe gekommen auf den Berg und haben sich dort Hütten gebaut, weil sie niemand da auffinden konnte) – einem Riesen (dieser lebte auf dem Berge2 hinter Leipe und lief mit einer Hirschkuh.3 Da entstand ein Mann, der hatte aber nur einen halben A...., und dann noch mehrere, oder: sie hatten Kinder, das erste wurde halb Mann, halb Hirsch, das zweite war wie ein Mensch) – einem Rehe4 – Türken, die in einem Kriege zurückblieben; früher war mal ein Krieg mit den Türken. Die hatten keine Weiber und die ersten Kinder stammen von einem Rehe ab.
Durch Fischerei sind die Leiper hergekommen und haben die Insel gefunden; neun Mann waren die ersten.
Das Dorf Leipe stammt von den Wilden ab.5 Denn die Leiper waren alle von Anfang an Wilde; dazumal waren auch in Burg wilde Leute. Als nun auf dem Berge (Insel) ihrer mehrere geworden waren, fingen sie an sich Hüttchen zu bauen, daß sie in Sicherheit wohnen konnten. Damals standen viele Linden da, daher hat das Dorf den Namen Lipje. 6 – So wird erzählt, allein das ist nicht wahr. Zu der Zeit, wie das Dorf entdeckt wurde, waren keine wendischen Leute im Spreewalde, sondern, die da waren, waren aus B o m a r n , P o m a r n 7 (v). Leipe, Lehde und die Buschdörfer waren alle tief im Busche, da waren Deutsche; von Pomarn stammen sie der Sprache nach ab, das ist noch bei den Alten in Leipe, etwas auch in Lehde, zu hören. Wenn die Leiper sprachen, haben sie immer so gesungen und so lang gezogen8 und so starke Stimmen gehabt. Wenn sie »pomogaj bog« (helf' Gott) sagten, zogen sie eine Viertelstunde. Sie waren auch früher noch wie Riesen so groß, haben nicht viel gearbeitet, fischten und krebsten blos, aßen Saubohnen und konnten so ordentlich auswachsen.
Fußnoten
1Lipjanje; der Ort heißt wendisch Lipje, Gen. - jego.
2 Leipe war früher ein Berg, der als Insel im Wasser lag.
3 helenica (jelenica), helenjeca; der Hirsch: heleń(jeleń, Elen, Elk; alces Caes.).
4sarnja, Ricke; Ure und Elche waren noch nach 1682 im Spreewalde (Falisch, »Geschichte von Lübbenau«).
5 Heiden.
6 Von lipa, die Linde.
7 Pommern.
8 Die Burger bezeichnen es mit hä-haw. Die Leiper sagen hä für co u.s.w. In Lehde ist das Wendische fast ausgestorben, in Leipe nur noch bei den älteren Leuten gebräuchlich, dann deutsche Reden wie: bei der Wußwone kann man auch Rukajze gebrauchen, kannst mir deine Botawa (Axt) borgen, mit der wirst du auch nicht lange mehr plizaien (Ohrfeigen geben, gemeint: hauen).
Die wilden Leiper.
Früher war in Leipe eine wilde Gesellschaft, drinnen im Busch. Wie einmal der Prediger H. mann aus Vetschau nach Stradow ging, begegnete ihm an der s t r a d o w e r B r ü c k e ein alter Leiper. Der sah, daß jener ein Prediger war, und grüßte ihn: »Pomogajbog.« Der Prediger dankte nach seiner Gewohnheit zweimal: »Bog źěkuj, bog źěkuj« (Gott danke, Gott danke). Dann fragte er den alten Leiper, weil er so wild aussah, nach diesem und jenem und zuletzt:
»Woher seid ihr?« – »Ich bin aus Leipe.« »Kennt ihr auch Christus?« Da sprach der wilde Leiper: » To jomóžno, až za tymi krjami tam niźi ganja, das ist möglich, daß im Gebüsche so etwas herumläuft.« –
»Christus ist doch wieder auferstanden!« »Ist das wahr? wir wissen davon nichts.«
Bei dem Unterrichte fragte der Prediger einen Jungen: »Kennt ihr die Gebote?« – » We tom našom dundyr błośe take njezgonjomy, in unserm Dunderbusche erfahren wir so etwas nicht.«
Ein Leiper war mal in der Kirche, da hieß es im Evangelium: »Er trieb einen T e u f e l aus durch Beelzebub, wón gónjašo janogo c a r t a wen přezbeelcebuba. « Wie er nach Hause kam, fragte ihn die Frau: »Was hat der Prediger gesagt?« – »Einen B u l l e n haben sie durch die Welzig1 getrieben, b y k a su přez Welcyce wen gónili. «
Ein anderer war in der Kirche, und sie sangen:
»Munter werde mein Gemüthe.« Da nahm er seine Mütze und ging nach Hause. Weil er so bald wieder kam, fragte die Frau dieses und jenes und: »Was haben sie gesungen?« Da sagte er: » Munter wozmitwóju měcu, nimm Dir flugs Deine Mütze, da nahm ich meine Mütze und ging ab.« Als derselbige gestorben war, und der Prediger die Frau fragte: »Wann ist der Mann gestorben?« sagte sie: »Drei Axtstiele war die Sonne noch von der Erde.«
Fußnoten
1 Ein Wald bei Byhlegure.
Die Leiper und der sächsische Kurfürst
Der sächsische Kurfürst besuchte mal den Grafen in Lübbenau, und die Unterthanen sollten die zu veranstaltenden Feste mitfeiern. Auch die Leiper kamen und standen da in ihren braunen Kappen1 und Bären-mützen, jeder Mann mit seiner Frau unter dem Arme.
Wie nun der Kurfürst herangalopirte und die Musikanten spielten, fingen die Leiper an zu tanzen. Da fragte der Kurfürst: »Was sind das für Leute?« und gräfliche Hoheit gab zur Antwort: » To su Lipjanje zeSpreewalda, das sind die Leiper aus dem Spreewald.«
Dann sagte der Kurfürst: »Das sind rechte polsche (polnische) Ochsen, to su redlich woły. « Wie die Leiper nach Hause kamen, fragten die andern: »Was war denn da?« – »Na« sagten die, »Etliche bissen die Stöcke von der Seite, andere von der Quere und am Ende, und der Kurfürst ging immer mit seinem Schimmel auf die Quere. Solche Ehre haben wir uns da geholt!« –
Fußnoten
1 Röcken; kapa, der Rock.
Lübbenau.
Das ganze alte Schloß in Lübbenau1