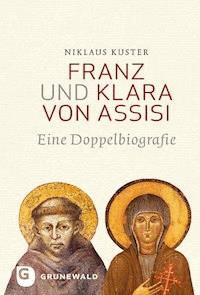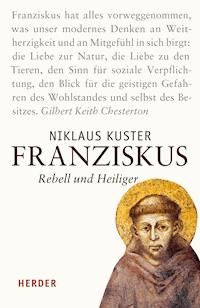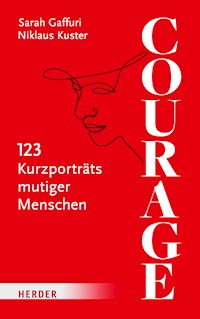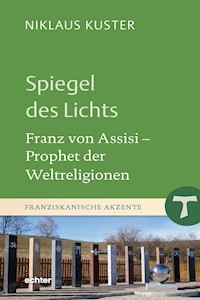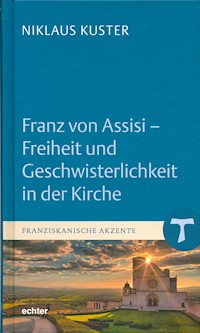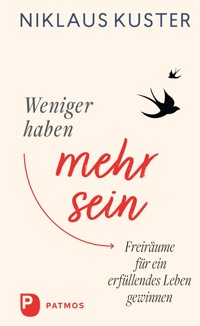
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Weniger Dinge schaffen mehr Bewegungsraum, weniger Gepäck macht leichtfüßiger, weniger Termine lassen mehr Zeit, weniger Ablenkung macht achtsamer und weniger Kontakte kommen tieferen Beziehungen zugute. Doch es hilft wenig, ein Übermaß an Dingen oder Terminen zu reduzieren, wenn ich mich mit weniger Stress zu langweilen beginne. Erst wenn die Leere zum Freiraum für etwas wird, wirkt Verzicht beflügelnd und macht kreativ. Bewusstes und entschiedenes Weglassen ist eine Kunst, die sich üben lässt. Ein Weniger will sich mit einem Mehr verbinden: mehr Raum und Zeit für anderes, mehr Gesundheit und Vitalität, die mir und anderen zugutekommt. Ziel jedes Weglassens ist ein größeres oder tieferes Glück, sei es individuell oder gemeinsam. Niklaus Kuster ist seit 40 Jahren Kapuziner und erlebt es als Privileg, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Hier gibt er seine Erfahrungen weiter, welche Chance darin liegt und wie es gelingt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort 5
1 Mit leichtem Gepäck unterwegs: Pilgerweisheiten 13
Von Touristinnen, Geflüchteten und Pilgern: Drei Grundhaltungen 15
Warum das Pilgern boomt: Drei Freiheiten 19
Maximal Wünschbares und minimal Notwendiges 23
2 Viel und wenig: eine Spannung 29
Viel und wenig – alltagspraktisch 29
Viel und wenig – gesellschaftlich 39
Viel und wenig – wirtschaftlich 47
Viel und wenig – politisch 60
Viel und wenig – spirituell 68
3 Weniger Dinge und mehr Leben 83
Essentialismus – Nicht »Was brauche ich?«, sondern »Was macht mich glücklich?« 84
Naturverbundenheit – Befreiung aus einer splendid isolation 89
Begegnungskultur – Vom maßlosen Konsum zu tragenden Beziehungen 92
Miteinander – Vom oberflächlichen Austauschzu realem Teilen 97
Nachhaltigkeit – Vom Wegwerfverhalten zur Mitweltsorge 103
4 Viel und nicht wenig: Leben in Fülle 111
Von der Einsiedelei in die Welt 114
Vom Ich zum Wir 121
Vom Weltschmerz zur Schöpfungsfreude 130
Vom Reichtum zur Lebensfülle 138
Vom Freiraum zur Freiheit 148
Über den Autor 153
Über das Buch 155
Impressum 156
Hinweise des Verlags 157
Vom selben Autor 157
Anmerkungen 163
Vorwort
Dieses Buch geht von der Lebensweisheit aus, dass weniger oft mehr ist: Weniger Dinge schaffen mehr Bewegungsraum, weniger Gepäck macht leichtfüßiger, weniger Termine lassen mehr Zeit, weniger Ablenkung macht mich achtsamer und weniger Kontakte kommen tieferen Beziehungen zugute.
Die praktische Frage hinter dieser Weisheit lautet: Wie kommen Menschen zu einem guten oder sogar einem beglückenden Weglassen? Das Lassen ist eine Kunst und kann geübt werden. Doch ist das Weglassen zunächst mit Verzicht verbunden: Dinge und Lebensinhalte fallen weg. Dabei gilt es zu bedenken, dass Verzichte nicht immer frei gewählt sind: Es gibt nicht nur das selbstbestimmte Ablegen oder Weitergeben, sondern auch zugemutete Verzichte und ein schmerzliches Verlieren. Das Lassen fühlt sich unterschiedlich an, wenn es ein Verlieren oder ein aktives Ablegen, ein Zurücklassen oder ein beherztes Weitergeben ist. Weglassen zu können erweist sich in all diesen Erfahrungen als Chance, auch wenn es emotional sehr unterschiedlich herausfordert.
Die vielschichtige Herausforderung, durch gutes Weglassen und befreienden Umgang mit Verzichten mehr Lebensqualität, neue Freiräume und tieferes Glück zu finden, begleitet uns auf dem Weg durch dieses Buch. Es geht um das Lassen – sowohl frei gewählt wie zugemutet –, das Lassen-können, -dürfen, -wollen und -lernen, und es geht um das gute Gefühl, das Verzichte leichter und befreiend macht: Was ich getrost weglassen kann, tue ich gelassen und in manchen Situationen auch getröstet. Individuelles Weglassen ist eine Kunst, doch das gemeinsame Weglassen stellt höhere Anforderungen. Die vier Kapitel dieses Buches werden beides in den Blick nehmen, das Lassen des Ich und das Lassen-Können des Wir.
In einer fünfköpfigen Familie haben sich alle drei Teenager in der »Klimajugend« zu engagieren begonnen. Innerhalb weniger Monate mussten die Eltern daher viel Vertrautes aus ihrem Leben streichen: In der Urlaubsplanung fielen alle Optionen weg, die mit Flugreisen verbunden waren, in der Freizeit der Familie der Gebrauch des Privatwagens und bei Tisch der Fleischkonsum. Die Familie hatte Übung darin, ihr Leben gemeinsam zu bestimmen und alle wichtigen Entscheidungen nach reiflicher Diskussion einmütig oder per Mehrheitsbeschluss zu treffen. Das Weglassen verschiedener Speisen und Freizeitoptionen zugunsten eines nachhaltigeren Lebens und eines kleineren ökologischen Fußabdrucks haben die Jungen beherzt und die Eltern mühevoll umgesetzt. Ein gutes Weglassen-Können gründet auf Einsicht und Erkenntnis: Je deutlicher es sich nicht einfach als Verlust, sondern letztlich als Gewinn erweist, desto leichter fällt es.
Der Gewinn kann mich selber oder andere betreffen. Am Beispiel der klimabewegten Familie ist es zunächst die Mitwelt und die Nachwelt, die von einem nachhaltigen Lebensstil profitiert: Weniger CO2-Ausstoß schafft mehr Atemluft und weniger Klimaerwärmung, was allen Lebewesen heute und morgen zugutekommt. Ziemlich bald allerdings haben sich die gemeinsam getätigten Verzichte auch für die Familie als Chance erwiesen: Ihr Freizeitverhalten gestaltet sich nun regionaler, ihr Urlaub entdeckt neue Möglichkeiten und ihre Küche entfaltet eine überraschende Kreativität. Das Weglassen ist oft mit einem Weg verbunden: Es braucht nicht selten mehrere Schritte, bis sich Leere in Freiraum verwandelt und das Weggeben von Gegebenem ein neues Handeln mit freien Händen ermöglicht.
Weggeben kann frei gewählt oder zugemutet sein. Eine Freundin, die ihr Leben lang im Urlaub Pilgerwege durch halb Europa zurücklegte, wurde im Älterwerden durch Arthrose gezwungen, auf diese Leidenschaft zu verzichten. Ihr Weglassen war zunächst schmerzlich und keineswegs getrost. Nach einiger Zeit wandelte sich die Leere in einen Freiraum: Die Freundin entdecke, wie wertvoll das innere Pilgern ist, der Gang durch das eigene Leben, das Vertiefen gemachter Erfahrungen und Gefährtenschaft im eigenen Alltag. Ähnliches kann mit Verzichten und Verlusten geschehen, die Beziehungen und die Arbeitswelt betreffen: Das Ende einer Freundschaft, ob frei gewählt und bejaht oder auferlegt und zugemutet, hinterlässt zunächst eine Leere. Diese wandelt sich schrittweise in einen Freiraum, wenn sie nicht einfach erlitten und passiv beklagt, sondern als Freiheit aktiv für einen Aufbruch in Neuland genutzt wird. Vergleichbares kann mit dem Verlust der Arbeitsstelle oder der Wohnung geschehen.
Getrost weglassen können wir Dinge – Objekte, Gegebenheiten und Lebensinhalte –, wenn sich der Verzicht als lebensförderlich erweist: sei es für mich selber, für das Miteinander im Alltag, für andere oder das größere Ganze.
Ein Freund liebte in seinem jungen Singleleben eine Risikosportart und gönnte sich jeden Sommer Abenteuerurlaube. Als er seine Frau fürs Leben fand und diese mit Blick auf seine Hobbies schlaflose Nächte hatte, verzichtete er auf den geliebten Nervenkitzel. Er entdeckte mit seiner Partnerin dafür andere Formen von Sport, Freizeit und Urlaub, gemeinsam gestaltet und auf neue Weise erfüllend. Als die beiden zusammenzogen, ließ auch die Freundin im gemeinsamen Alltag viele individuelle Freiheiten zurück, um gemeinsame Freiheiten zu entdecken. Als die beiden nach zwei Jahren ihr erstes Kind bekamen, hatte dies einschneidende Auswirkungen auf ihr gewohntes Leben zu zweit: weniger ungestörte Zweisamkeit und Schlaf in der Nacht, weniger und andere Reisen, weniger kulturelle Events in der Freizeit, weniger Bewegungsfreiheit in so vielem. Die persönlichen und gemeinsamen Verzichte fühlten sich bei aller Einschränkung allerdings weder zugemutet noch verfügt an, sondern im Interesse ihres Kindes bejaht und im neuen Familienleben gewählt. Die neue Realität wog Verzichte denn auch mit ganz neuen Formen des Glücks und der Erfüllung auf.
Was bei Heirat oder Elternschaft zu familiär motiviertem Weglassen und Neuentdecken führt, hat bei ehrenamtlichen Tätigkeiten ein größeres Ganzes im Blick. Menschen verzichten auf Freizeit und individuelle Freiräume, um sich sozial, kulturell, ökologisch oder politisch zu betätigen. Sie verzichten dazu auf vieles, um sich für ein gutes Miteinander in der Gesellschaft oder für die Umwelt einzusetzen. Auch darin liegen neben aller Arbeit und Mühe innere Erfüllung und Glück.
Hinter den folgenden Betrachtungen liegen grundlegende Einsichten und Unterscheidungen: Gewählte oder bejahte Verzichte sind sinnvoll, wenn sie zunächst mir selber guttun: in meinem Wohnen und Leben, in meiner Arbeit und Freizeit, für meine Gesundheit und Lebensqualität. Weniger Dinge, weniger Kontakte, weniger Stress, weniger Ablenkung kommen dem eigenen Leben zugute. Gewählte oder bejahte Verzichte können auch dem Miteinander im Lebensalltag guttun: in einer Partnerschaft oder Familie, in einer Gemeinschaft oder einem Team. Das gemeinsame Leben verändert Freizeit, Wohnen und Beziehungsnetz. Wo individuelle Freiheit wegfällt, eröffnen sich gemeinsame Freiräume.
Gewählte oder bejahte Verzichte können sodann gesellschaftlich motiviert sein: Das zeigt sich etwa in ehrenamtlichen Tätigkeiten, welche im kulturellen, sozialen, politischen Bereich wertvolle Früchte tragen und die in einem größeren Ganzen zu mehr Lebensqualität und Glück beitragen.
Gewählte oder bejahte Verzichte können sich schließlich ökologisch nahelegen: Im Reise- und Freizeitverhalten, in Wohnkomfort, Konsum und Küche, Einkauf und Abfallvermeidung kann sich bei allen Einschränkungen mehr Nachhaltigkeit mit einer tiefen Zufriedenheit verbinden: dem guten und dankbaren Gefühl, in unserem »gemeinsamen Haus« der Welt der globalen Vielfalt des Lebens Sorge zu tragen und ihr Zukunft zu ermöglichen!
Verzichte als solche tragen noch nicht zum Glück bei, wenn sie sich nicht als Chance erweisen. Es hilft wenig, ein Übermaß an Dingen oder Terminen zu reduzieren, wenn ich mich mit weniger Stress und mehr Kargheit zu langweilen beginne. Ein Weniger will sich mit einem Mehr verbinden: mehr Raum und Zeit für anderes, mehr Gesundheit und Vitalität, die mir und anderen zugutekommt. Ziel jedes Weglassens ist ein größeres oder tieferes Glück, sei es individuell oder gemeinsam. Führen Verzichte in eine passive Leere, wirken sie bedrückend und nicht erfüllend. Erst wenn die Leere zum Freiraum wird, wirken Verzichte beflügelnd und machen kreativ. Die selbstgewählte oder verordnete »Freiheit von« wird dann zu einer »Freiheit für«, die neue Optionen nutzt. Wer in der Leere verharrt, fixiert sich auf das Verlorene und hat das Nicht-mehr im Blick. Wer den Freiraum entdeckt, erkennt das Neuland, neue Möglichkeiten und Chancen. Aufbruch wiederum beflügelt die eigene Phantasie oder die gemeinsame Kreativität.
weniger und mehr
weniger dinge und mehr raum
weniger gepäck und leichtere füße
weniger termine und mehr zeit
weniger kontakte und tiefere beziehungen
***
haben und leben
äußere und innere werte
tragbares und tragendes
habhaftes und vitales
gegebenes und erfüllendes
***
leere und erfüllung
ablegen und weitergeben
zurücklassen und freiwerden
leere aushalten und lebensfülle finden
freiheit von und freiheit für
Das Buch geht von meiner eigenen Lebenspraxis und von Erfahrungen in meinem Umfeld aus. Es hat die praktische Lebenskunst wie auch die Spiritualität im Blick. Und ich trete als Franziskaner ins Gespräch mit verschiedensten Lebensentwürfen, mir selbst vertrauten wie auch fremden. Leserinnen und Leser finden Impulse für die eigene Lebensgestaltung, grundlegende Erkenntnisse aus der Geschichte der Menschheit sowie philosophische und spirituelle Betrachtungen. Wo solche das eigene Leben inspirieren, mögen sie zum persönlichen Glück beitragen. Wo sie der eigenen Lebensphilosophie fremd erscheinen, dürfen sie getrost stehen gelassen werden.
Br. Niklaus Kuster
1Mit leichtem Gepäck unterwegs:Pilgerweisheiten
Vier Personen treffen in einem Intercity-Zug aufeinander. Alle haben ein Minimum an Gepäck dabei, obwohl ihre Reise weit ist. Ihre Freiheit unterscheidet sich ebenso grundlegend wie ihr Lebensglück. Die existenzielle Befindlichkeit der vier Reisenden macht eines deutlich: Materielle Einschränkung kann Ausdruck von innerer Freiheit wie auch von bitterer Not sein. Es gilt gut hinzuschauen! Dieses Buch handelt von Formen der Bescheidung, die mit innerer und äußerer Freiheit zusammenhängen.
Zwei der vier Reisenden, die sich im Frühling 2022 im Viererabteil eines gut gefüllten Zuges der Deutschen Bahn zusammenfinden, sind aus der Ukraine geflohen. Die junge Mutter ist mit dem Töchterchen an der einen Hand und einem großen Rollkoffer an der anderen eingestiegen, die Kleine mit einem Rucksäckchen und ihrem liebsten Stofftier. Nach tagelanger Flucht reisen sie nun durch ein fremdes Land und werden in der Schweiz stranden, ohne zu wissen, was sie da erwartet. Ich wage kaum, mir vorzustellen, wie es mir erginge: aus einem verheerenden Krieg evakuiert zu werden, eine Stunde Zeit zum Packen zu haben, einen Koffer mitnehmen zu können und ihn mit Kleidern, Verpflegung und zwei, drei liebsten Gegenstände zu füllen – und Tage später von Dagebliebenen zu erfahren, dass das eigene Zuhause nun zerstört, die Wohnung zerbombt, das Zurückgelassene verbrannt ist. Die fliehende Ukrainerin hat zudem die quälende Sorge auszuhalten, dass ihr Mann im Krieg weiterkämpft; dazu hat sie ihm die Kreditkarte für das ersparte Geld in der bedrohten Heimat gelassen.
Den beiden gegenüber sitzen ein Pilger und ein Minimalist. Der Pilger reist nach Le Puy-en-Velay, wo unweit der Loire-Quellen ein historischer Ausgangspunkt der französischen Jakobswege liegt. Von da aus wird er zu Fuß rund 1500 Kilometer weit nach Santiago de Compostela pilgern. Sein Gepäck hat er so leicht wie möglich gehalten, um unbelastet und leichtfüßig unterwegs zu sein. Hightech-Kleider und -Materialien reduzieren das Gewicht. Mit Schlafsack und Isomatte liegen auch improvisierte Übernachtungen drin, doch vertraut er auf Pilgerunterkünfte mit Duschen, Wasch- und Kochgelegenheit. Vor ihm liegen zwei Monate Freiheit, die am Morgen nicht wissen muss, wo sie am Abend lagert. Erwartungsvoll blickt er auf diese Auszeit vom Alltag und freut sich auf wechselnde Gefährtenschaft. Im krassen Gegensatz zu den beiden Geflüchteten erwartet ihn danach wieder das vertraute Zuhause, seine Angehörigen und Freunde, sein berufliches Leben und seine Hobbies.
Der Vierte in dieser zusammengewürfelten Gruppe ist ein junger Schweizer Unternehmer auf der Rückreise nach Zürich. Da er weltweit tätig ist und kaum mehr als drei Tage an einem Ort bleibt, hat er seine Wohnung verkauft und lebt seither in Hotels und bei Freunden. Auch er hat sein Gepäck reduziert, dauerhaft! Alle seine Gegenstände sind schwarz, um ihm auch die tägliche Kleiderwahl leicht zu machen – und weil so seine Objekte beim schnellen Einpacken auf weißen Hotellaken weniger leicht verlorengehen. Der moderne Minimalist ist begegnungsfreudig und reist daher auch mal in der 2. Klasse der Bahn. Er lässt den Pilger an seiner Seite in eine Doku des Schweizer Fernsehens schauen, die seinen Lifestyle darstellt. Genau 64 Gegenstände reichen ihm für sein Leben, und sie haben im Handgepäck Platz, was ihm die Flugreisen enorm erleichtert. Hinzu kommen ein gut dotiertes Bankkonto und Besitzanteile an mehreren Firmen rund um den Erdball. »Darum ist er immer unterwegs. Sein Büro ist dort, wo es Internet gibt«, hält die TV-Journalistin fest.1 In einem Monat fliegt der Unternehmer nahezu zweimal um die Erde. Damit hat der dynamische Single zwar ein spannendes Leben ohne drückendes Gepäck, doch auch einen verheerenden ökologischen Fußabdruck. Es bräuchte eine Vielzahl von Erden, um seinen Verbrauch an Energie und Ressourcen hochgerechnet auf die Weltbevölkerung zu decken.2
Von Touristinnen, Geflüchteten und Pilgern:Drei Grundhaltungen
Der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman (1925–2017) hat von der modernen Mobilität auf zwei Grundhaltungen in unserer Gesellschaft geschlossen. Seine Diagnose lautet etwas zugespitzt: In Europa und den USA leben viele Menschen in der inneren Haltung von Touristinnen und Touristen, andere in der von Vagabundierenden. Auf die zusammengewürfelte Vierergruppe im Zug angewandt: Der um die Welt jettende Unternehmer, der sich in Hotels verwöhnen lässt und Flugmeilen summiert, steht für die erste Grundhaltung: Wer arbeitet, darf es sich auch gut gehen lassen, sich etwas gönnen und als Gast König sein.
Für Bauman spiegelt sich im klassischen Tourismus die perfekte Konsumhaltung: Der Tourist wählt in Freiheit, wohin er gehen will, und er bestimmt Reisemittel und Aufenthaltsorte nach eigenem Geschmack. Die Touristin hat weder Lust noch Zeit, sich mit etwas abzugeben, das sie unnötig in die Pflicht nimmt, und sie findet keine Zeit, sich um die Probleme anderer zu kümmern. Auch eigene existenzielle Fragen sind oft aufgeschoben. Die Welt lässt sich genießen – und es gilt, von ihren Angeboten möglichst zu profitieren.
Vagabunden und Geflüchtete sind die anderen, die unterwegs sind: Auch sie sind in Bewegung, allerdings ohne die Wahlfreiheit, ihr Ziel zu bestimmen, sondern von Verzweiflung getrieben und von der Not, ihr Überleben zu sichern. Ihr Geschick erinnert daran, dass die Welt kein selbstgemachtes Paradies ist, sondern dass das Prekäre hinter jeder Ecke steht. Auch viele Migranten und Migrantinnen vagabundieren. Sie reisen auf der Flucht vor wirtschaftlicher oder politischer Not durch die Welt in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Viele hoffen, einmal den Standard zu erreichen, den sie bei Touristinnen und Touristen erleben.3
Was Baumans Skizze nicht mitberücksichtigt, ist eine dritte Grundhaltung: die von Pilgernden. Familienmenschen und Singles ziehen ein paar Tage, Wochen oder Monate zu Fuß durchs Land, setzen sich Wetter und Wegen aus, scheuen auch vor Ungewissem und Prekärem nicht zurück, gehen zielgerichtet, bleiben durch Auf und Ab unterwegs, kommen dabei mit Freuden und Sorgen der Bevölkerung in Kontakt, und sie erfahren, dass das gemeinsame Ziel schon unterwegs unterschiedlichste Menschen verbindet. Das glückliche Ankommen wird – so erzählen Pilgernde aus vielen Jahrhunderten – für Leichtfüßige wie für Strapazierte zum großen Fest. Unterwegs dahin lebt das Pilgern von der Kunst, ohne unnötige Last zu wandern, solidarisch auf dem Weg zu sein, liebe Orte loszulassen und täglich Neuland zu wagen, zielgerichtet zu bleiben, persönlich voranzuschreiten und sich von guter Gefährtenschaft ermutigen zu lassen.
Alle drei Grundhaltungen lassen sich auf das Alltagsleben beziehen: Die Maximierung des individuellen Genusses unter großzügigem Einsatz der eigenen Mittel in Wohnen, Essen, Kleidung und Freizeitgestaltung steht dem Geworfensein von Menschen gegenüber, die äußerlich oder auch innerlich nirgends zu Hause sind, ihre Sicherheiten verloren haben und bang in die Zukunft schauen. Pilgerspiritualität im eigenen Alltag begnügt sich mit dem materiell Notwendigen, bindet sich nicht an Dinge und Orte und sieht das Leben als Weg in einer herausfordernden Welt, die sich ebenso reizvoll zeigt wie sie Strapazen kennt.
Dieses Buch handelt nicht von materieller Not und davon, was hilfreich sein kann, Armut und Elend zu überwinden. Es handelt auch nicht von der Glücksuche jener, die sich materiell gut absichern und sich vieles leisten. Es geht hier um eine Lebenskunst, die Pilgernde erahnen und von der Philosophien aller Zeiten und unterschiedlichste Religionen sprechen. Vier ausgewählte Zitate können dafür illustrativ stehen:
Nichts gehört uns wirklich, außer der Zeit! –Geld hat noch keinen reich gemacht. –Nicht wer zu wenig hat, sondern wer mehr begehrt, ist wahrhaft arm. –Betrachte alles Irdische um dich herum als Ausstattung einer Herberge:Mache dich auf den Weg und setze deine Wanderung fort!
SenecaBriefe an Lucilius4
***
Wir lieben … unser Haus und unseren Hof und unsere Tiere.Wir haben Freude an der Seide aus Benaresund genießen den Duft des Sandelholzes.Ein Verzicht auf diese Freudenkommt uns wie der Sturz in einen Abgrund vor (…).Solchen Hausleuten habe ich dann immer gesagt,dass es mir einmal genauso ging, als ich noch im Haus lebteund die Sinnenfreuden genoss,als ich noch nicht das Glück der Stille erfahren hatte,noch nicht aus dem leidvollen Lebenstraum erwacht war.
Siddhartha Gotama BuddhaMein Weg zum Erwachen5
***
Jede Nation ist ihnen Heimat,und jedes Vaterland ist ihnen ein fremdes Land.Die frühe christliche Kirche über ihre MitgliederBrief an Diognet6
***
Ein Rabbi bekam Besuch.Außer einem Bett, einem Tisch, einem kleinen Schrankund ein paar Büchern war nichts im Zimmer.Der Besucher:»Haben Sie keinen weiteren Besitz?«Darauf der Rabbi:»Sie haben ja auch nur wenige Dinge bei sich.«Der Besucher:»Ich bin doch nur auf der Durchreise.«Der Rabbi:»Genau wie ich!«
Weisheit der jüdischen ChassidimAuf Durchreise7
Warum das Pilgern boomt:Drei Freiheiten
Alle diese Weisheiten sehen das menschliche Leben, das sich in einer selbsterrichteten kleinen Welt häuslich einrichtet, kritisch: Lebe wie in einer Herberge und setze deine Wanderung vor, rät Seneca. Lebt nicht wie Hausleute und erwacht, wünscht Buddha wahren Glücksuchenden. Der jüdische Rabbi wohnt in seinem Dorf innerlich auf Durchreise. Sich auch in seiner Heimat als Gast zu sehen, rät der frühchristliche Brief an Diognet mit der biblischen Klarheit, dass Menschen immer und überall »Pilgernde und Gäste auf Erden« sind (1 Petrus 2,11).
Die Tatsache, dass moderne Menschen – seien sie religiös sensibel oder auch entschieden unreligiös – in den letzten drei Jahrzehnten das Pilgern wiederentdeckt haben, erklärt sich mit einer tiefen existenziellen Wahrheit. Kein Mensch bleibt ewig auf dieser Welt, und das ganze Leben ist ein Weg, der sich von Etappe zu Etappe verändert. In der Geburt verlässt der Säugling den bergenden Mutterschoß und wird ungefragt in diese Welt gesetzt. Kita und Schule setzen Kinder einem größeren Kreis aus, der die Kinderstube sprengt. Jugendliche lassen ihre Kindheit hinter sich und so vieles, was diese geprägt hat. Erwachsenwerdende lösen sich von der Welt ihrer Jugend, Paare vom Single-Leben, junge Eltern verzichten auf ein großes Stück Zweisamkeit, und Jahre später lassen sie die herangewachsenen Jungen ziehen. Pensionierte müssen sich von ihrer Arbeitswelt verabschieden, Alternde verlieren früher oder später ihre Mobilität wie auch vertraute Menschen, und Sterbende verlassen diese Welt. Pilgerwege machen gleichnishaft erlebbar, was das Leben insgesamt prägt, zumutet und gelingen lässt: unterwegs zu sein mit mutigen Füßen, wachen Augen und freien Händen!
Das Leben bringt immer wieder Aufbrüche mit sich. Jede Biografie wartet mit Neuland auf: sei es das Land neuer Lebensabschnitte oder neuer Beziehungen, neue Formen der Gefährtenschaft, neue berufliche Felder oder sich ändernde Wohnorte mit neuen Beziehungsnetzen. Pilgernde erfahren Aufbruch und Neuland gleichnishaft: Täglich geht es auf ein neues Stück Weg, täglich überraschen andere Landschaften und warten wechselnde Pfade. Pilgern erfordert den Mut zum Aufbruch – in größerem Maße beim Start ins Pilgerleben und dann alltäglich, immer wieder von Neuem unterwegs. Vieles lässt sich abschätzen, und doch warten von Tag zu Tag Überraschungen, fordert das Unbekannte heraus und bleibt der Weg ein Wagnis. Pilgernde brauchen kraftvolle und mutige Füße.
Mutige Füße können auf Abwege geraten, stolpern oder in Sackgassen steckenbleiben, wenn Menschen nicht mit wachen Augen unterwegs sind: weitblickend, umsichtig und wach für Wegverzweigungen. Pilger- wie Lebenswege erfordern eine Wachheit, welche die Realität wahrnimmt. Es gilt, nahe und ferne Ziele im Blick zu behalten und zugleich den Bedürfnissen im Hier und Jetzt Sorge zu tragen. Genügend Trinkwasser und Nahrung sowie passende Kleidung und gutes Schuhwerk dabeizuhaben ist unverzichtbar für ein Pilgern, das ausdauernd bleiben will.