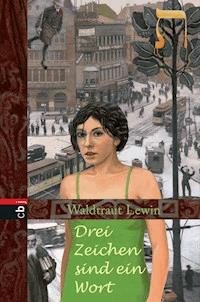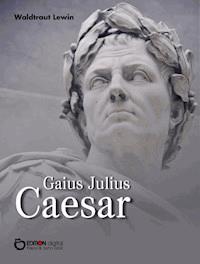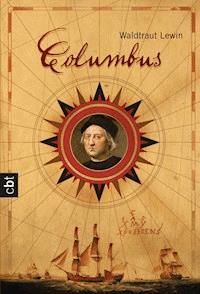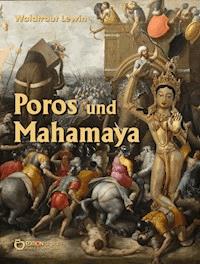13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Längst ist das lebenslustige jüdische Mädchen, das sich zwei Jahre lang in der Prinsengracht zu Amsterdam vor den Nazis verstecken konnte und dort Tagebuch führte, zu einer Ikone erstarrt und geistert als Lernstoff durch die Klassenzimmer Deutschlands. Waldtraut Lewin wagt es, das Denkmal von seinem Sockel und Anne in unsere Welt zu holen, um sie besser kennenzulernen. Bei ihrer fiktiven Begegnung lässt sie Anne staunen über das, was sich in den siebzig Jahren seit ihrem Tod verändert hat. Und erzählt ihr vom Staat Israel oder vom neuen Deutschland, in dem Juden leben dürfen und Menschen gegen Rechtsradikalismus auf die Straße gehen. Zusammen wagen sie den Blick von heute auf das Gestern und das Morgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Waldtraut Lewin
Wenn du jetzt bei mir wärst
Eine Annäherung an Anne Frank
Kinder- und Jugendbuchverlagin der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage 2015© 2015 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House, MünchenAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: init | Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen,unter Verwendung zweier Bilder von © iStockphoto Europe GmbHKK · Herstellung: AJLektorat: Burkhard HeilandSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-15359-5www.cbj-verlag.de
»Ich will fortleben, auch nach meinem Tod.«
Aus dem Tagebuch der Anne Frank
I
Das Haus ist leer. Da wohnt niemand.
Die da lebten, sind vor langer Zeit umgekommen. Davon sprechen die Bilder an den Wänden, Fotos, Installationen. Zeugnisse.
Das Haus ist stumm. Es hat keine Gerüche bewahrt und keine Töne und nicht den leisesten Hauch der Ängste, die in seinen Mauern ausgestanden wurden.
Das Haus ist schrecklich voll. Dieses Haus in der Prinsengracht.
Stunde für Stunde durchstreifen die Menschen Raum für Raum, mit neugierigen oder gleichgültigen Blicken – eine Attraktion mehr im Besuchsprogramm einer wunderschönen Stadt oder gar eine Pflicht für Jugendliche, die ihnen von didaktischen Erziehern aufgenötigt wird –, mit bewegtem Herzen oder ungerührt, eingezwängt im Strudel, in die Enge der anderen um sie herum, so wie einst die Bewohner eingezwängt waren hier, freiwillig-unfreiwillig, um zu überleben.
Man denkt, das Haus müsste sich wehren.
Einmal sollte es abgerissen werden. Vielleicht wäre das gnädiger gewesen.
In diesem Haus hat einst ein Kind ein Tagebuch geschrieben, bis es über dem Schreiben zur jungen Frau wurde. Genau hinsehend, ungezügelt in Zuneigung und Abneigung, bereit, alles aufzuzeichnen bis hin ins Unerträgliche, Unsägliche.
Diesem Tagebuch verdankt das Haus, dass es noch steht.
Soll ich wirklich hineingehen?
Der Geist wohnt doch in diesem Fall im Geschriebenen, nicht im Gebauten.
Ich lernte dies Kind, die junge Frau, übrigens nicht durch das Tagebuch kennen, sondern auf dem Theater.
Es war im Jahr 1956 auf einem Schauplatz in Berlin. Es gab ein Stück, von zwei Amerikanern geschrieben. Das Stück heißt: »Das Tagebuch der Anne Frank«.
Das ist nun über ein halbes Jahrhundert her, dass ich eingefangen wurde vom Schicksal dieses jüdischen Mädchens und der Menschen um sie herum.
Ich war damals gerade dabei, mir meine eigenen jüdischen Wurzeln bewusst zu machen – umso stärker war die Wirkung.
Wenn ich die Augen schließe, ersteht der Theaterabend lebendig vor mir.
Das mit Möbeln und Koffern voll gestellte Bühnenbild, das die drangvolle Enge des Hinterhauses vor Augen führt, die acht Menschen, ihre Ankunft mit Taschen und Koffern; die Judensterne, die sie auf ihrer Kleidung tragen, scheinen mir riesig – und um mich herum spüre ich die betroffene, von Gefühlen aufgeladene Reaktion der anderen Zuschauer. Es ist immerhin erst ein Jahrzehnt her, dass diese Sterne, furchtbare Zeichen, »gültig« waren, und sicher haben sich die Leute bis dahin mit vielerlei anderem beschäftigt, nur nicht mit der Aufarbeitung dieses Teils ihrer Vergangenheit. Nun nimmt ihnen dieses Mal auf der Kleidung den Atem. Die Besucher des Theaters sind in einem Sog atemloser Erwartung. Eine Spannung, die den ganzen Abend anhält.
Und sie steigert sich. Die Schauspieler da oben bewegen sich notgedrungen in der vorgegebenen Enge der Bühne miteinander und umeinander wie in einem schrecklichen Tanz; der Raum gibt nicht mehr her. Man weiß schon jetzt: Das kann nicht gutgehen. Reibungen unter den Zusammengesperrten sind unvermeidlich. Und sie treten ein, stürzen uns im Zuschauerraum in ein Wechselbad von Mitgefühl und Erregung.
Und dann ist da diese blutjunge Schauspielerin. Anne Frank, zart und zerbrechlich, mit riesigen Augen und runden, fast kindlichen Wangen – ein Mädchen voller Witz und Feuer, voller Anmut, Klugheit und Verletzlichkeit. Wenn sie an die Rampe vortritt, um den Zuschauern eine solche nervenaufreibende Tatsache mitzuteilen, wie, dass sich die Eingesperrten im Moment nur von Bohnen ernähren, weil nichts anderes da ist, dann verkündet sie diese bittere Bagatelle mit solcher funkelnden Bosheit, mit solchem Charme, mit so klingender Stimme, dass der Saal vor Entzücken spontan applaudiert. »Das Zeitalter der Bohnen ist angebrochen …«, sagt sie. Und wir lieben sie.
Atemlos taumeln die bis ins Mark ergriffenen Zuschauer auf das unvermeidliche Ende zu. Der Verrat, die Verhaftung. Die letzten Worte des Darstellers von Annes Vater. Das Schlimmste sei nun eingetroffen. –
Ich wusste nicht, dass man so weinen kann nach einer Vorstellung. So zutiefst aus dem Innersten weinen.
Die Erinnerung an diesen Abend bewegt mich denn doch, hineinzugehen in das Haus in der Prinsengracht.
Es trifft mich wie ein Hieb: Das Erste, was meine Augen fassen, ist das Theaterplakat jener Aufführung: Berlin 1956. Das Tagebuch der Anne Frank.
He, sage ich leise. Das können sie doch nicht meinetwegen hier aufgehängt haben?
Aber gibt es irgendeinen Grund, Zufälle nicht auszuschließen? Alles, was mir ab jetzt geschehen wird, geschieht ausschließlich mir und zum Zweck für diese Geschichte. Diese Geschehnisse.
Ich spaziere durch die Räume, mit jener seltsamen Art von träumerischer Benommenheit, die der Vorbote sein kann für etwas Besonderes, für das Unverhoffte. Etwas liegt in der Luft. Kommt es mir nur so vor, oder haben sich diese Zimmer auf einmal für mich geleert von Besuchern, dafür aber gefüllt mit Gegenständen, den Utensilien des täglichen Gebrauchs, Lampen und Geschirr, Vorhängen und Betten und Kissen, Tischen, einem Schreibtisch? Einem kleinen Schreibtisch.
Jetzt geht vor mir jemand her.
Eine schmale Gestalt. Schmal, aber groß. Ein Mädchen. Das dunkle Haar ist lockig. Gehe ich schneller, beeilt sie sich auch, verlangsame ich meinen Schritt, tut sie das Gleiche. Aber sie sieht mich doch gar nicht! Woher weiß sie …
Dann erkenne ich die Schuhe.
Eine der Vertrauten, eine der Boten zwischen der Innenwelt des Hinterhauses und der Außenwelt, der die Versteckten ihr Leben verdanken, hat sie eingekauft für 27 Gulden fünfzig. Gebraucht. Denn es wollte Anne kein Schuh mehr passen. Sie war gewachsen.
Das sind die wunderbaren Schuhe aus bordeauxrotem Leder mit dem hohen Absatz. Elegante Schuhe. Schuhe für eine Dame. Schuhe, die man am liebsten auch nachts im Bett anbehalten würde vor Entzücken.
»Anne!«, sage ich. »Anne M. Frank.« So wie sie sich im Tagebuch nannte gegenüber der imaginären Vertrauten, Kitty, an die sie schrieb.
Sie bleibt stehen. Dreht sich um. Lächelt das berühmte Lächeln mit den Grübchen in den Wangen.
Heute ist der 12. Juni.
»Anne«, sage ich. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.«
»Danke«, erwidert sie, und ihre Stimme ist unverkennbar die jener jungen Schauspielerin von damals. »Wie alt werde ich denn gerade?«
Ich zögere. Dann spreche ich es aus. »Du wirst in diesem Jahr fünfundachtzig.«
»Oh«, sagt sie. Und wiederholt: »Oh. Ich hatte aufgehört, zu zählen. Es ist hier drin eigentlich egal. Es dauert. Es wird wohl nicht so schnell aufhören.«
»Woher kommst du?«
Sie zuckt die Achseln. »Du hast mich doch gerufen.« Wieder das Lächeln.
»Aber mit wem bist du zusammen die ganze Zeit?«
»Mit Kitty. Nur mit Kitty. Mit ihr erlebe ich das alles immer wieder. Immer wieder. Es ist mir eigentlich genug, unter uns gesprochen.«
»Aber den anderen nicht. Für die bist du … eine Ikone.«
Nun seufzt sie. »Ich weiß. Manchmal verwünsche ich mich, dass ich diese … diese Aufzeichnungen gemacht habe, in das karierte Buch hinein. Und in die beiden alten Kontobücher, die man mir gegeben hat. Papier war knapp. Andererseits: Ohne sie gäbe es mich ja nicht.«
Sie hat sich an das Tischchen gesetzt, jenen kleinen Schreibtisch, auf dem das Buch aufgeschlagen liegt, der Füller daneben. »Es hört niemals auf, Tag für Tag. Eine Endlosschleife.«
Ich versuche, zu verstehen. »Du meinst: Du bist eingesperrt in deinem eigenen Werk, dem Buch?«
Sie runzelt die Stirn. »Ja. Die sperren mich ein. Die hier durch die Räume wandern. Ich soll sie belehren über eine Vergangenheit, die die meisten eigentlich nur vergessen wollen. Aber das darf nicht sein. Und so muss ich nun mit meinen – was hast du gerade gesagt? – mit meinen 85 Jahren den ewigen Backfisch spielen, altklug; ein Objekt, an dem man absehen kann, was die unschuldigen Juden zu leiden hatten. Oder was sie erleiden, das weiß ich ja nicht. Ich fürchte, es sieht nach einer Unsterblichkeit aus. Nach einer, auf die ich nicht scharf bin. Ich bin – ein Anschauungsobjekt. Ich diene der Belehrung.«
Sie – als Teil eines Museums, wie die Welt es braucht angesichts drohender Verdrängung des Gewesenen –, aber immer noch eingesperrt im gleichen Haus, das sie so sehnlich zu verlassen wünschte. Hinaus ins Leben. In die Freiheit.
Sie spielt mit dem Füller, dreht ihn zwischen den Fingern hin und her.
Ich zögere mit meiner Frage, stelle sie dann doch, so behutsam wie möglich.
»Und wenn du …?«
Sie versteht sofort.
»Wenn ich dies Buch und dieses Haus verlasse, an der Stelle, wo alles endet, und nach draußen gehe, dann gibt es für mich und für die anderen nur den einen Weg. Den Weg der einstigen Wirklichkeit. Dann brauchst du mir nicht mehr zu meinem 85. Geburtstag zu gratulieren. Zu gar keinem mehr.«
Mir kommt es so vor, als würde dies lebensvolle Gesicht auf einmal verblassen …
Er hieß Karl Josef Silberbauer, Oberscharführer der SS, ein Österreicher.
In Holland zahlte man für jeden Juden, dessen Versteck verraten wurde, sieben Gulden fünfzig. Das war bei acht Menschen eine hübsche Summe. Nur weiß man bis heute nicht, wer diese »Kopfgeldprämie« kassiert hat. Silberbauer, später in Wien danach befragt, zuckte die Achseln. Es hatte derartig viele solcher Anzeigen gegeben, wer sollte sich da noch an den einzelnen Denunzianten erinnern?
Es war August, ein heller Vormittag und nicht etwa Nacht und Nebel, als das Polizeiauto in der Prinsengracht vorfuhr. Die Versteckten im Hinterhaus konnten es nicht hören. Sie waren, wie immer, intensiv beschäftigt: Die beiden Mädchen und Peter, der Sohn der zweiten Familie, mit Lernen und Lesen, unterstützt vom Vater Frank, der ihnen Unterricht gab, die Frauen mit Kochen, Herr von Pels las.
Und dann waren da Schritte auf der Treppe. Schritte, die keine Rücksicht auf die Heimlichkeit des Verstecks nahmen. Polternde Schritte. Stiefelschritte. Schritte von mehreren.
Sie hielten den Atem an.
Denn diese Treppe war ja verborgen, versteckt hinter dem drehbaren Regal mit Ordnern, dem geheimen Zugang.
Das Ende war da.
Als Silberbauer mit seinen Helfern das Versteck betrat, die Waffe im Anschlag (man kann ja nie wissen!), standen ihm acht verstummte Menschen gegenüber, gelähmt, geisterbleich. Nach zwei Jahren der Hoffnung nun der Vernichtung preisgegeben.
Die üblichen Befehle. Jeder ein Gepäckstück. Hausdurchsuchung.
Abführen.
Silberbauer hatte es besonders auf die Schwestern abgesehen, Anne und Margot. Er trennte sie von ihren Eltern, zerrte sie brutal ins Auto, um sie auf dem Gestapo-Hauptquartier selbst zu verhören. Sicher erhoffte er sich von den beiden jungen Mädchen, dass sie noch irgendwelche Verstecke von Wertsachen preisgeben würden, wenn man sie nur »ordentlich rannahm«. Hat er die Schwestern geschlagen? Ich wage nicht, Anne zu fragen. Silberbauer war bekannt für seine brutalen Vernehmungsmethoden.
Immerhin. Seiner Achtlosigkeit verdankt die Welt das Tagebuch. Er hatte auf der Suche nach Gold und Geld den Inhalt der Aktenmappe, in der sich auch Annes Aufzeichnungen befanden, auf den Fußboden ausgeleert. So stießen die Helfer aus dem Vorderhaus später auf die Notizen …
Verhör, Lager Westbork dann. Güterwaggon nach Auschwitz. Bergen-Belsen. Da ist nur Schwärze. Das Ende.
Nein. Das soll nicht sein.
Das alles gibt es nicht, das ist der Abgrund, an den man nicht heran muss. Wenn man denn im Buch bleibt.
Wird es gelingen? Werden wir den dunklen Teil, den End-Teil wegdrücken, diese Schatten? Wird ihr Wille zum Leben stark genug sein, das alles zu vergessen?
Ich hoffe.
»Aber«, sage ich eindringlich. »Aber.«
Sie sieht zu mir auf, erwartungsvoll.
»Aber?«
»Aber du bist lebendig.«
»Du hast mich gerufen. Ich bin gekommen.«
»Wieso war das möglich?«
»Sag du es mir.«
»Es ist eigentlich ganz einfach. Du lebst in deinen Worten. Du hast sie hervorgebracht. Und dann halten sie dich entweder fest oder lösen sich von dir und gehen ihren Weg. Du bist eine Schreibende. Ich bin es auch.«
»Aber ich bin nur ein Kind. Ein vierzehnjähriges Mädchen, das Tagebuch führt.«
»Ein vierzehnjähriges Mädchen, dessen Tagebuch zu Weltruhm gelangt ist. Da kann ich nur vor Neid erblassen, Anne! Und so sage ich: Hättest du Zeit gehabt, jene Zeit, die man dir gestohlen hat – du wärst eine der ganz Großen geworden.«
»Ja«, erklärt sie ohne Scheu. »Das habe ich immer gewollt und gewusst.«
»Gut. Außerdem, Kind: Du bist eine alte Frau. Sogar ein paar Jahre älter als ich. Es wird allerhöchste Zeit, dass du aussteigst. Dass du das Hinterhaus verlässt. Du bist voller Neugier.«
»Ich platze fast vor Neugier«, sagt sie und schlenkert mit den Füßen, mit ihren schönen bordeauxfarbenen Schuhen.
»Also«, sage ich, »nun ist es beschlossene Sache. Komm mit mir! Komm ins Freie! Komm in die Welt, die man dir über sechzig Jahre vorenthalten hat! Komm!«
Sie steht auf. Wirft einen Blick auf das Tagebuch.
»Damals«, sagt sie, »da lag es an der Erde.«
»Das war die Rettung. So blieb erhalten, was du geschrieben hast. Miep Gies, deine Freundin, hat es aufgesammelt und bewahrt.«
»Ja. Miep Gies.« Sie zögert. »So kann ich es wohl jetzt auch zurücklassen.«
»Unbesorgt! Es ist inzwischen millionenfach in allen Sprachen der Welt erschienen.«
»Na«, sagt sie trocken, »das klingt ja beeindruckend.« Aber am Funkeln ihrer Augen merke ich, dass sie wirklich beeindruckt ist. Beeindruckt und stolz, wie man mit vierzehn oder mit fünfundachtzig sein darf über einen Erfolg.
»Komm!«
»Halt. Noch zwei Fragen. Bin ich nur … ein Geist? Ich meine: Kann ich fühlen, fassen, essen, trinken wie ein Mensch?«
»Du bist ein Mensch, alte Frau, ein Mensch, der fühlen, fassen, essen, trinken – und lieben kann. Was wäre das sonst für ein dummes Spiel.«
Sie nickt eifrig.
»Welche Sprache sprechen wir miteinander?«, frage ich. »Ich kann kein Niederländisch.«
»Und ich spreche kein Deutsch.«
»Ich weiß. Du hast geschrieben: Deutsch ist keine Kultursprache. Bei dem, was geschehen ist.«
»Also?«
Ich muss lachen. »Wir sprechen ja schon die ganze Zeit miteinander. Wir sprechen das Esperanto der Fantasie.«
Sie stutzt, dann lacht auch sie. »Wer bist du in diesem Spiel?«
»Eine Jüdin wie du.«
»Das dachte ich mir schon. Wie du heißt!«
Ich überlege. Mein bürgerlicher Name kommt nicht infrage. Er gehört in eine andere Welt.
Dann fällt mir etwas ein.
»Nenn mich Corelli.« Ich lächle.
Sie blinzelt. »Aber Corelli – ist das nicht ein italienischer Komponist? Einer aus der Barockzeit?«
»Ja, nach dem hab ich mich benannt. Als ich so alt war wie du, als ihr ins Versteck gehen musstet, da hörte ich genauso leidenschaftlich gern Radio, wie ihr es immer getan habt. Und eines Tages spielten sie ein Konzert von Corelli. Es ging mir weniger um die Musik. Der Namen hatte so etwas Zärtliches, wie ein Streicheln. Und ich wollte gern einen Namen haben, der wie Streicheln ist.«
»Das kann ich verstehen«, sagt sie, »Corelli!«
Sie spricht den Namen so aus, wie ich es getan habe, mit einem leicht gerollten R und das E betont. Ich habe die Stimme jener Schauspielerin von damals im Ohr, es klingt genussvoll, scherzhaft.
»Und nun komm!«, wiederhole ich energisch und strecke die Hand aus.
Und da ist ihre Hand in meiner. Fest, kühl, kräftig.
Wenn ich eine Comiczeichnerin wäre, würde ich jetzt zwischen unseren beiden Händen, ach was, zwischen unseren Körpern einen Energiestrom fließen lassen; zitternde, zuckende Blitze, so etwas wie den Moment der Vereinigung.
Und nun gehen wir durch das Haus, verlassen ihr Zimmer mit den Fotos von großen amerikanischen Filmstars und der niederländischen Königsfamilie an den Wänden, schweben vorbei an Säcken mit übel riechenden Kartoffeln mit langen bleichen Keimen (ja, die sollten eigentlich auf dem Dachboden sein, so steht es im Tagebuch), vorbei an dem winzigen Bad ohne Wanne und Dusche, an den Gefäßen aus Emaille oder Porzellan (tagsüber durfte die Toilette nicht benutzt werden), an Weckgläsern, an Lampen, Koffern, Körben, vorbei an Stühlen mit verwaschenen Sitzkissen, Bücherbrettern, hinunter die knarrenden Stufen, die sie nur nachts betreten durften, wenn das Bürohaus vorn leer war, zu jener Tür, die von der anderen Seite mit dem drehbaren Regal kaschiert wird. Durch das Lager der Firma hindurch und dann, da ist die Haustür.
Ich drücke die Klinke.
Die Tür öffnet sich langsam und wir gehen gemeinsam hindurch.
Krachend fällt sie hinter uns ins Schloss.
Wir sind draußen.
Es geht auf den Abend zu. Die Schatten werden länger.
Sie ist stehen geblieben auf der Gracht, wie angewurzelt. Macht ein paar zögernde Schritte, wie ein Tier, dem man die Käfigtür geöffnet hat und das seine Freiheit nicht fassen kann.
Sie sieht sich um, betrachtet die Passanten.
Dann legt sie ihre Hand auf die linke Seite, dort, wo das Herz ist.
»Du ja auch nicht …« murmelt sie, den Blick auf mich gerichtet, und ich begreife erst, was sie meint, als sie losschreit:
»Keinen Stern! Ich muss keinen Stern mehr tragen! Ich bin ein Mensch unter Menschen!«
Sie tanzt die Gracht entlang, erst grotesk wie ein Clown, dann immer schöner, mit fließenden Bewegungen.
»Ich kann überall hin! Ich muss nicht auf den Fahrweg ausweichen, wenn mir ein vollwertiger arischer Mensch entgegenkommt, darf mich auf jede Bank setzen, kann spazieren gehen, zu welcher Zeit auch immer ich will, bei Tag und Nacht, unter Sonne, Mond und Sternen, darf einen Park besuchen, ein Schwimmbad, einen Sportplatz, darf Fahrrad fahren, darf … darf … darf laufen! Meine Beine bewegen! Nicht nur treppauf, treppab, tagelang, wochenlang, jahrelang. Laufen! Geradeaus laufen, egal, wohin!«
»Langsam!«, mahne ich lachend. »Vergiss nicht, du bist fünfundachtzig Jahre alt! Übernimm dich nicht!«
Sie bleibt stehen, sieht mich starr an. Meinen Einwand überhört sie.
»Und ich darf reden, sprechen, plappern den ganzen Tag, wenn mir danach ist! Krach machen, schreien, mit den Füßen stampfen!«
Sie ballt die Fäuste, stampft tatsächlich auf, als wolle sie die Erde unter ihren Füßen spüren. Passanten kommen auf uns zu, und sie unterbricht ihre heftige Regung abrupt, bleibt stehen, aufrecht, die Schultern gerade, den Hals gereckt.
Man geht an uns vorüber. Gleichgültig. Plaudernd, lächelnd. Beachtet sie nicht.
»Du«, sagt sie zögernd. »Was ist mit denen? Können die mich nicht sehen?«
»Warum sollten sie dich nicht sehen können? Du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut.«
»Aber sie reagieren gar nicht, wenn sich jemand so – exzentrisch aufführt wie ich.«
»Man regt sich in dieser Stadt nicht auf, nur, weil jemand ein bisschen exzentrisch ist, Anne. Hierher kommen Leute von überall, um glücklich zu sein. Es ist eine der schönsten Städte der Welt.«
Sie hebt den Kopf, ihr Blick streichelt die perfekt gepflegten dreistöckigen Häuser, bleibt hängen an den vorspringenden Balken am hohen Giebel der Kaufmannshäuser, dem Haken für die Befestigung des Seils – so zog man die wertvollen Handelsgüter, die die Grachten aus Übersee erreichten, hoch zum Speicherraum.
»Was ist das?«
Ich bin erstaunt und erkläre es ihr. »Aber wie lange lebst du denn in dieser Stadt?«
Sie zuckt die Achseln. »Ich war ein Kind. Meine Augen hatten andere Ziele als die Giebel der Häuser. Ich spielte auf der Straße, ich ging zur Schule, ich war mit meinen Freundinnen zusammen, ich fuhr mit dem Rad, ich flirtete, ich lachte und weinte. Die Stadt war einfach gegeben – und dann … dann war ich fort. Im superpraktischen Versteck. So hat Pim es genannt.«
Pim. Otto Frank, ihr Vater.
»Jetzt kann ich alles entdecken. Alles ist neu.«
»Wohin willst du zuerst? Zu dem Haus, wo du deine Kindheit verbracht hast? Zum Merwedeplein, wo ihr wohntet?«
Sie schüttelt energisch den Kopf. »Was soll ich da? Hast du mich herausgeholt, um mich in die Vergangenheit zurückzuschicken? Wie viele Jahrzehnte liegt das hinter mir? Nichts will ich davon wissen, nichts sehen.«
»Ihr hattet dort eine schöne Wohnung im zweiten Stock, gediegene Möbel, Spitzendecken auf dem Tisch …«
»Woher weißt du das?«
»Man hat es rekonstruiert. Du kannst es sehen als …« Ich zögere. Zum ersten Mal wird mir die Kühnheit meines »Befreiungsschlags« bewusst. Sie kennt kein Internet, keine CD, kein Handy, kein gar nichts. Doch. Das Kino. Also sage ich: »… als einen Film.«
Sie zuckt die Achseln, unbeeindruckt. »Wer soll sich denn so etwas ansehen?«
»All jene, die täglich dein Tagebuch lesen, die zusammenströmen, das Hinterhaus zu besichtigen, die …«
Sie hebt beide Hände, wild. »Davon will ich nichts wissen! Ich bin kein Phantom, kein Idol, kein … kein Stück Lehrmaterial über das Schicksal der Juden während der Nazizeit! Du hast mich nicht deshalb herausgeholt. Ich will leben! Leben!«
Sie runzelt plötzlich die Stirn, scheint in sich hineinzulauschen.
Dann sagt sie prosaisch: »Weißt du, was für Hunger ich habe?«
Wir haben von den unzähligen Restaurants, die sich auf der Prinsengracht befinden, ein kleineres ausgesucht; Tische und Stühle stehen auf dem Bürgersteig im Licht der Abendsonne, die Speisekarte besteht aus einem einzigen Blatt Papier, das Anne voller Eifer studiert hat.
Und nun isst sie. Sie isst und isst. Zunächst eine Suppe, die sie atemlos, stöhnend vor Wonne in sich hineinlöffelt. Dann einen Teller voller Muscheln und Garnelen, dazu weißes Brot. Sie isst schnell, heißhungrig, beseligt. Ein Salat, ja, den auch.
Wir trinken weißen Wein. Sie hält das Glas mit beiden Händen. Ich sehe, wie sich ihre Kehle beim Schlucken bewegt, sehe es voller Glück und Rührung. Anne Frank sitzt neben mir und trinkt Wein.
Jetzt ist sie beim Dessert angelangt. Ein Stück warmes Schokoladengebäck und dazu Eis mit Orangengeschmack. Sie schlingt. Lustvoll, die Augen halb geschlossen.
Mir ist, als würden all diese Speisen sie mit einer Aura des Gegenwärtigen umgeben, als sei sie nun erst ganz und gar angekommen im Heutigen.
Nachdem unser Wein bis auf den letzten Tropfen getrunken ist, sagt sie wie erwachend: »Kommst du für mich auf? Ich habe ja gar kein Geld mitgenommen.«
»Das würde dir heute ohnehin nichts mehr nützen«, erwidere ich – und mir wird erst jetzt klar, welche Schwierigkeiten es geben würde für ein Wesen aus der anderen Dimension, sich im sogenannten bürgerlichen Alltag zu etablieren.
Abgesehen davon: Diese fünfundachtzig Jahre alte junge Frau Anne Frank an meinem Tisch ist höchstwahrscheinlich Milliardärin, wenn man ihr denn die Autorenrechte an ihrem Buch zuerkennen würde … Aber darüber nachzudenken, habe ich jetzt keine Lust.
Neugierig betrachtet sie die Euro-Scheine, die ich aus der Tasche gezogen habe.
»Keine Gulden?«
»Keine Gulden. Keine deutsche Mark wie während der Besatzung. Euro. Eine Währung, die achtzehn europäische Staaten gemeinsam benutzen.«
Sie nimmt mir einen 10-Euro-Schein aus der Hand, dreht ihn hin und her, betrachtet den Silberstreifen, die Flagge mit den Sternen, das Tor auf der einen, die Brücke auf der anderen Seite.
»Aber welches Land hat denn gesiegt?«, fragt sie leise.
Ich verstehe sie nicht.
»Doch nicht Deutschland, oder? Sonst könnte ich nicht so herumlaufen – ohne den gelben Stern überm Herzen.«
Ich beginne zu begreifen. Sie nimmt an, die Währungsunion könne nur durch das Diktat einer Siegermacht zustande kommen, die alle anderen beherrscht!
»Deutschland«, sage ich und lege meine Hand auf die ihre, die so beruhigend kühl und fest und irdisch ist, »hat vor siebzig Jahren verloren an allen Fronten, und zwar gründlich. Die Siegermächte – als ihnen denn das ganze Ausmaß des Völkermords nicht nur an den Juden bewusst wurde – wollten das Land eigentlich entmündigen, die Städte, sofern sie nicht schon in Schutt und Asche lagen, kaputtgebombt, entvölkern, alles umpflügen, ein Agrarland in der Mitte Europas … Sie haben es dann mit Umerziehung versucht. Wie es scheint, hat es gefruchtet. Jedenfalls jetzt, nach mehr als zwei Menschenaltern, sind die Deutschen ein geachtetes Mitglied der Völkerfamilie, so heißt es.«
Anne hält noch immer den Geldschein zwischen den Fingern. »Ein geachtetes Mitglied«, wiederholt sie mit gerunzelter Stirn. »Man hat ihnen also vergeben.«
»Es war für sie wohl am schwersten, zunächst einmal die Schuld anzuerkennen, die auf ihren Schultern lastet. Inzwischen ist da eine andere Generation. Die Taten ihrer Voreltern sind ihnen fern und fremd«, sage ich.
»Aber dies Geld …?«
»Es gibt keinen, der die anderen gezwungen hat. Man hat keinen Krieg mehr geführt in Europa, nachdem Hitler besiegt war. Irgendwann haben die Staaten sich gesagt: Warum sollen die Grenzen nicht fallen? Warum soll man nicht hin und her reisen können, wie man will, und weshalb soll man ständig Währungen umrechnen, wo es doch viel bequemer ist, wenn alle das gleiche Geld haben. Sie haben sich also zusammengeschlossen. Nun gibt es den Euro.«
Sie dreht den Schein. »Das da ist griechische Schrift.«
»Griechenland ist ein Mitglied dieser Währungsunion.«
»Griechenland. Ich habe die griechischen Sagen geliebt.«
»Die Griechen heute …« Ich breche ab. Gerade ist sie angekommen. Ich sollte sie nicht gleich mit all den Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten behelligen, in denen wir auch leben.
Sie dreht sich zu mir um, gibt mir den Schein zurück, und ihre Augen strahlen.
»Du sagst mir wunderbare Dinge … Corelli.« Wieder rollt sie auf Theatermanier das R. »Dinge, wie im Märchen!«
Während ich den Kellner heranwinke, um zu bezahlen, wird mir klar, dass ich in meiner stürmischen Zuneigung zu ihr, meinem Willen, sie neben und bei mir zu haben und ihr etwas ihrer geopferten Jugend wiederzugeben, viele Dinge außer Acht gelassen habe, die mir nun wohl bald Kopfzerbrechen bereiten werden.
Der Kellner ist jung, blond und hübsch, und er hat ein anmutiges Lächeln. Anne betrachtet ihn mit halb offenem Mund. Sie betrachtet ihn – gierig. Ja, man kann es nicht anders ausdrücken. Gierig.
»Er ist sehr anziehend, nicht wahr?«, fragt sie mich, nachdem der junge Mann uns einen schönen Tag gewünscht hat.
»Ja, das ist er«, bestätige ich.
(Sie will leben. Sie will lieben.)
Sie ist jetzt von Unruhe erfasst, von der Hast einer Person, die allzu lange zum Stillsitzen und Ruhegeben und Nicht-Dasein verurteilt war. Sie zappelt auf ihrem Stuhl, spielt mit den Fingern, dreht ihr leeres Glas auf dem Tisch, als wolle sie ein mir unbekanntes Spiel beginnen, sieht mich herausfordernd an.
»Komm, worauf warten wir?«
Sie springt auf, eilt die Gracht entlang, ich vermag kaum zu folgen.
Atemlos hetze ich ihr hinterher. Da ist kein Plan in ihrem Kopf, scheint mir. Ihre anfängliche Lust, die schönen alten Häuser zu betrachten, die Menschen, die ihr entgegenkommen, scheint fürs Erste vergangen. Sie ist nur bei sich, nur um sich selbst bemüht. Sie läuft. Hat nichts weiter im Sinn, als ihre Beine zu bewegen, ihre Arme zu schleudern, ihren Kopf hin und her zu werfen, sodass das dunkle Haar fliegt. Ganz gleich, wo sie ist. Es könnte auch in einer finsteren Straßenschlucht in der Bronx sein oder auf einem öden Sandweg inmitten von dürren Kiefernwäldern.
Sie ist bei sich, endlich bei sich. Gesättigt zwar, aber noch sehr, sehr hungrig. Hungrig auf das, was kommen wird.
»Anne, warte!«, rufe ich zum wiederholten Mal. Sie dreht kurz den Kopf, ihr Schelmenlachen, auch das Vergnügen, mich außer Puste zu bringen, leicht für sie, die fast ein Jahrzehnt älter ist als ich, aber jung bewahrt gleichsam im Kälteschlaf, aus dem sie nun erstanden ist.
Jetzt scheint es mir, dass sie sogar fliegt. Eine Täuschung?
Und dann der große Moment, Entsetzen, Unglauben zunächst, Erstaunen ohne Grenzen.
Um uns herum klingeln die Fahrräder. Diese ganze Stadt wird beherrscht von Fahrrädern; Autos spielen kaum eine Rolle, die engen Straßen, auf einer Seite begrenzt vom Wasser, auf der anderen von den schmalschultrigen hohen Häusern mit ihren Eingängen über diverse Stufen, erlauben, wenn überhaupt, ohnehin nur im Schritt zu fahren, sich hindurchzuschlängeln durch die Pulks von Männern und Frauen auf Rädern. Es ist, als übernähmen sie die Rolle der Autofahrer in den anderen Städten Europas – selbstbewusst, anmaßend, unberechenbar.
Auch sie, Anne, ist ja mit ihren Freundinnen durch diese Stadt geradelt, bevor sie gefangen saß im Hinterhaus – sie allein, während die anderen, Hanneli und Jacque und wie sie hießen, längst verloren waren, mit ihrem Stern auf der Brust. Verloren und verkommen.
Heute also tänzelt und hüpft sie zwischen den Radfahrern hindurch; manchmal klingeln die und sie winkt ihnen zu, strahlend. Dass sie den Verkehr behindert, kommt ihr nicht in den Sinn.
Ich bin weiter hinter ihr.
Dann geschieht es.
Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Soll ich sagen, sie wird angefahren, überfahren, durchfahren …?
Jedenfalls, ein sehr schneller Radfahrer, behelmt, im Trikot, der rücksichtslos zwischen den anderen hindurch seinen Weg sucht, erfasst das tanzende, springende Mädchen, reißt es zu Boden, stürzt selbst mit seinem Bike, rappelt sich auf, fluchend, steht daneben, schwingt sich wieder in den Sattel, haut einfach ab, ohne sich um sein Opfer zu kümmern. Ringsum Kopfschütteln, abfällige Bemerkungen.
Aber gibt es denn ein Opfer? Das Mädchen, das da offenbar unter die Räder gekommen war, steht da, ein paar Wimpernschläge später, unversehrt, ohne eine Schramme oder einen Kratzer, geschweige denn eine blutende Verletzung, wie es scheint, auch unbeeindruckt.