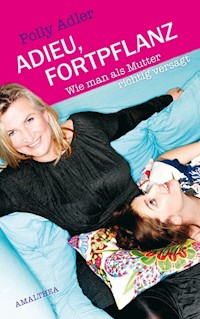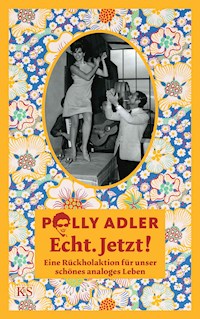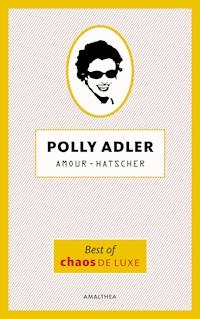Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es begann in Bad Vöslau Mimi Stein ist eine junge Schriftstellerin, die es mit dem Verfassen von TV-Schnulzen zu Erfolg gebracht hat. Sowohl ihr Beruf als auch ihre sich im Stillstand befindliche Ehe machen sie längst nicht mehr glücklich. Durch den Tod ihrer Lieblingstante Lou verschlägt es Mimi wieder an den Ort ihrer Kindheit - das Thermalbad Vöslau. In der ererbten Waldkabane beschließt sie, ihr Leben neu zu ordnen. Im Laufe des folgenden Sommers erlebt sie an diesem magischen Ort die seltsamsten Begegnungen. Und sie begibt sich auch auf eine Reise in die Vergangenheit, die sie am Ende ihre Gegenwart neu verstehen lässt. Und irgendwann entschlüsselt Mimi auch das Geheimnis jener mysteriösen blonden Frau, der sie immer wieder im dunklen Föhrenwald des Bades begegnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Polly Adler
WER JUNG
BLEIBEN WILL
MUSS FRÜH DAMIT ANFANGEN
Polly Adler
Roman
Bildnachweis:Alle Bilder am Buchende, nach Seite 210 © Vöslauer.Fotograf Peter Rigaud.
Danke an die Historikerin Dr. Silke Ebster, Leiterindes Vöslauer Stadtmuseums, für ihre Unterstützung.
Umwelthinweis:Dieses Buch und der Einband wurden auf chlorfreigebleichtem Papier gedruckt. Die Einschrumpffolie – zumSchutz vor Verschmutzung – ist aus umweltfreundlichemund recyclingfähigem PE-Material.
Besuchen Sie uns im Internet unterwww.amalthea.atwww.pollyadler.com
© 2012 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Martin BrunyUmschlaggestaltung, Layout und Grafik:Demner, Merlicek & BergmannUmschlagfoto: © Vöslauer,Fotografinnen: Maria Ziegelböck, Zena Holloway© Banderole: Manfred KlimekGesetzt aus der 12 auf 14 pt Adobe GaramondProduktion: CPI Moravia Books GmbHGedruckt in der EUISBN 978-3-85002-789-2eISBN: 978-3-902862-10-5
INHALT
1. Kapitel »DU WILLST ES DOCH AUCH SO SEHR«
2. Kapitel GANZ IN WEISS
3. Kapitel HOLLA, DIE WALDKÖNIGIN!
4. Kapitel WASSERFRAUEN
5. Kapitel »REICH MIR DIE HAND, MEIN LEBEN«
»Der Mensch verlangt überall Zerstreuungund gesellschaftlichen Verkehr.Er will doch nicht so vegetativ dahin-dämmern.«
Der Vöslauer Kurgast Wilhelm Geiger, 1898
1. KAPITEL
»DU WILLST ES DOCHAUCH SO SEHR«
Abenddämmerung, die sanft hügeligen Weingärten der Thermenregion, die Landschaft ist in ein nahezu surreales, roséfarbenes Licht getaucht.
Christine:
Diese Landschaft. Und jetzt du. Wir. Es ist wie ein Märchen!
Serge:
Märchen haben den großen Nachteil, dass man sie nicht angreifen kann. Komm’, küss mich …
Serge drückt Christine heftig an sich. Christine lässt das zögerlich mit sich geschehen. Sie scheint jedoch nicht ganz bei der Sache zu sein und wendet sich dann doch ab. Serge, ein Mann, der offensichtlich mit Zurückweisungen ganz schlecht umgehen kann, insistiert.
Serge:
Komm’, du willst es doch auch so sehr.
Christine:
Nein, Serge, nein. Solange ich den Grauschimmel auf meinen Weinstöcken nicht unter Kontrolle habe, fehlen mir die Nerven für andere Baustellen.
Serge:
Baustellen? Bin ich, nach all dem, was wir zusammen durchgemacht haben, nichts anderes als eine Baustelle für dich?
Christine:
Du musst mir Zeit geben …
Serge:
Es tut mir leid, Christine, aber ich habe keine Zeit mehr.
Sie wankt plötzlich, ihr wird schwarz vor den Augen, sie bricht zusammen.
Serge:
Um Gottes willen, Christine! Ist dir nicht gut? Was ist es? Schon wieder ein Anfall? Bleib’ jetzt bitte ganz ruhig liegen, ich lauf’ ins Dorf und hole Hilfe.
Die Kamera fährt über die Weingärten, dann zoomt sie noch einmal auf Christine und Serge. Serge beugt sich in der Großaufnahme verzweifelt über Christine, sie schlägt die Augen auf, nimmt seine Hand und flüstert unter sichtlicher Mühe.
Christine:
Du musst jetzt ganz stark sein, Serge. Es gibt da nämlich noch ein Geheimnis, ein dunkles Geheimnis, aber …
Sie schließt wieder die Augen, pathetische Streicherklänge ertönen, Serge schießt noch einmal sein ganzes emotionales Pulver in die letzte Großaufnahme, ehe der Abspann über den Monitor rollt.
»Christine – Irrwege ins Glück«
Es war stockdunkel im kleinen Vorführraum der Plan-C-Productions auf dem Rosenhügel-Studiogelände, alle Anwesenden schwiegen. Ob aus Betroffenheit über die Dramatik des Erlebten oder peinlicher Berührtheit, war aus der Stille nicht wirklich auszumachen.
Nur Mia, die Rezeptionistin der Produktionsfirma, schniefte leise vor sich hin. Mimi reichte ihr wortlos ein Taschentuch, in das sie lautstark hineinblies.
Als auf dem Monitor »Buch & Idee: Mimi Stein« zu lesen stand, blickte Mimi zu Boden. Dass sie aus purem Schamgefühl in diesem Moment niemandem in die Augen sehen konnte, wusste nur sie.
»Kind, was für ein grauenhafter Dienstmädchenschrott – ich hoffe, sie ersticken dich mit ›shitloads of money‹«, hätte Tante Lou angesichts dieser Irrwege des Geschmacks angemerkt und ihren Mund dabei so zugespitzt, als ob sie eben versehentlich in eine im Salat versteckte Nacktschnecke gebissen hätte.
Wenn Tante Lou fluchte, tat sie das immer in so einem richtig dekadenten Britisch. Denn auch beim Vulgärsein war ihrer Ansicht nach Stil unabkömmlich. Ach, Tante Lou! Höchste Zeit, sie endlich wieder einmal zu besuchen. Schon seit Wochen war sie nicht mehr zu ihr nach Baden hinausgefahren. Es war einfach keine Zeit gewesen. Die letzten Monate war sie ständig in ihrer Schreibkajüte auf dem Studiogelände eingepfercht gewesen. Und hatte täglich acht bis zehn Stunden Sätze wie »Du musst jetzt ganz stark sein«, »Lass uns unsere Träume leben!«, »Wer nie nach den Sternen greift, kann auch nie den Boden unter den Füßen verlieren« oder eben den absoluten Spitzenreiter aller Klischeephrasen »Du willst es doch auch so sehr« in die Tastatur ihres zenbuddhistisch-weißen Apple gehackt. Von all dem selbst gebackenen Kitsch hatte sie manchmal richtiggehend Sodbrennen bekommen, ein literarisches Sodbrennen eben. Aber die erwähnten »shitloads of money« erübrigten anhängige Sinnfragen.
Um ganz ehrlich zu sein, war das mit der Zeit eine Lüge, zumindest eine halbe Lüge. Sie hatte einfach Angst davor, Tante Lous Zustand nicht ertragen zu können. Aber nächste Woche, ganz sicher nächste Woche.
Zumindest Mia war der festen Überzeugung, dass Mimi ihren Blick zu Boden senkte, weil sie von ihrem eigenen Produkt so zu Tränen gerührt war. Sie drückte fest ihre Hand. Mimi bemühte sich, ihrem größten Fan einen dankbaren Blick zu schicken. Dann löste sie sich schnell wieder aus deren feuchtwarmer Umklammerung und seufzte.
»Was gibt’s denn bitte hier zu seufzen?«, knatterte Daniel jetzt in die Stille und sprang aus seinem ergonomischen Bürostuhl, um das Licht in dem fensterlosen Raum anzudrehen. Seit einem Bandscheibenvorfall, der ihn im vergangenen Frühjahr über Wochen außer Gefecht gesetzt hatte, benutzte er ständig diesen – erheblich an seiner Schnittigkeit kratzenden – Sessel, der noch dazu mit so einem kindergartenroten Leinenstoff überzogen war. Auch sein tiefergelegter italienischer Sportflitzer hatte einer bandscheibengerechteren bundesdeutschen Qualitätslimousine weichen müssen. Ja, ja, auch Gott hatte durchaus seine gerechten Tage. Der arme Daniel musste jetzt seine Vierzig-plus-Krise eben auf anderen Baustellen ausleben. Mimi hatte mit Süffisanz registriert, dass er vor Kurzem seine erdbeerblonden Wimpern schneewittchenschwarz färben hatte lassen. Und seine Hemden trug er neuerdings auch einen flotten Knopf weiter offen als früher.
»Das nenne ich einmal einen astreinen Cliffhanger. Die Taschentücher-Industrie kann uns schon jetzt einmal ein Dankesschreiben schicken«, trompetete Daniel und rieb sich die Hände, »da freut sich das Produzentenherz. Ein absoluter Bringer. Der Vorabend des österreichischen Farbfernsehens kann aufatmen. Gratulation an alle Beteiligten!«
Saskia Hellmann, die der tapferen Winzertochter Christine schon hundertsiebzig Folgen lang ihr ebenmäßiges Gesicht und ihre mäßige Schauspielkunst lieh, verschickte ihr obligates Natternlächeln und überkreuzte ihre meterlangen Rennpferd-Beine ausführlich. Sie wollte sichergehen, dass vor allem Daniel wieder einmal in aller Deutlichkeit an deren wohlgeformte Endlosigkeit erinnert wurde. Schließlich machte sich in ihr langsam die dunkle Ahnung breit, dass sie mit ihren einunddreißig Jahren in absehbarer Zeit auch für das Ein-Aschenputtel-kämpft-sich-nach-oben-Genre zu alt sein würde. Es galt also Vorkehrungen dafür zu treffen, diesen Moment so lange wie möglich hinauszuzögern. Außerdem wusste Saskia ganz genau, dass Mimi sie nicht wirklich leiden konnte. Und ihr Darstellungstalent für mehr als überschaubar hielt.
Saskias Intellekt beschränkte sich zwar auf die Lektüre des kommenden Dan-Brown-Romans, aber sie verfügte über eine gewisse Naturschläue und die entsprechenden Intuitionsantennen. Der Rauswurf von Charlie Sheen aus »Two and a half Men« vor ein paar Monaten hatte ihr doch ziemlich zugesetzt. Und Mimi hatte es durchaus genossen, bei den Drehbuchbesprechungen immer wieder ihrem Erstaunen Ausdruck zu verleihen, dass das »bisschen Verhaltensoriginalität« von Charlie Sheen seinen Sender dann doch zu einer so drastischen Maßnahme bewogen hatte und offensichtlich jeder, aber auch wirklich jeder ersetzbar wäre.
»Ich bin weder psychotisch, noch wohne ich mit zwei Porno-Darstellern in einer WG«, war Saskia einmal bei so einem Gespräch die Flucht nach vorne angetreten. Und Mimi, die an und für sich ein sanftes Gemüt besaß, aber angesichts von Menschen, die sie beim besten Willen nicht mochte, durchaus hinterfotzig werden konnte, hatte sie nur sehr lang angesehen und dann gesagt: »Keine Angst, Sassi! Noch habe ich überhaupt nicht eingeplant, dass Christine bei einem schnittigen Cabrio-Unfall am Wörthersee ihr turbulentes Leben lassen muss und durch eine Twentysomething-Nichte mit Rehblick aus Übersee ersetzt wird …«
»Was für eine Nichte?!«, hatte Saskia dann mit schreckensweiten Kuhaugen gefragt – sie war wie gesagt nicht durch einen übermäßig dreistelligen IQ belastet –, »es gibt doch in den Büchern weit und breit keine Nichte!«
»Nun ja«, hatte Mimi dann damals noch eines draufgesetzt, »Fantasie ist eben das, was sich die wenigsten Menschen vorstellen können. Aber nichts leichter als das: die Tochter eines aus dem Familienverband verstoßenen Bruders zum Beispiel, die nach einer Kampfausbildung auf einer Harvard-Business-School plötzlich auftaucht und als neue Chefin frischen Wind in das durch Schädlingsplagen und Verwandtschaftsfehden schwer gebeutelte Weingut bringt.«
Daniel hatte diesen Schlagabtausch nicht unamüsiert beobachtet, sich aber dann doch zu einem atmosphärischen UNO-Einsatz gezwungen: »So, Mädels, genug gescherzt. Wir haben weder die Zeit, noch die Energie für Zickenkriege, sondern in sechs Wochen Drehbeginn. Jetzt wird wieder gearbeitet.«
Daniel deutete Mia jetzt, die obligaten Sektgläser zu bringen. Dieses Ritual beschloss jedes Staffel-Screening. Er scheuchte alle in den Sitzungssaal, wo bereits organisch einwandfreies Fingerfood auf Tabletts arrangiert war.
»Champagner gibt’s erst dann, wenn wir es in den Hauptabend geschafft haben«, sagte Daniel, als Mia Prosecco servierte. Auch dieser Gag war nicht mehr taufrisch bei Plan-C-Productions.
Mimi sah auf ihr iPhone. 18 Uhr 38. Eigentlich hatte sie Anton versprochen, so gegen halb acht zu Hause zu sein. Er hatte ihr ein marokkanisches Zitronenhuhn in Aussicht gestellt.
Anton war kochbesessen. Im Gegensatz zu vielen anderen Männern, die sich in die Nahrungszubereitung nur insofern einbrachten, als dass sie sich bei angenehmen Temperaturen draußen um eine Feuerstelle scharten, um Fleischstücke auf den Rost zu legen und Bier trinkend deren Austrocknung abzuwarten, war ihr Anton da aus einem ganz anderen Zivilisationsholz geschnitzt. »Eine mit Leidenschaft zubereitete Mahlzeit ist die höchste Form von Zärtlichkeit, die ein Mann für eine Frau im Angebot haben kann.« – Erst unlängst hatte er ihr diese Weisheit an einem Samstagvormittag serviert, bevor er auf den Naschmarkt losstartete. Der Naschmarkt war für Anton das, was für den handelsüblichen Mann der Baumarkt verkörperte: eine Mischung aus Wunderland und Forschungszentrum. Dort pochte er mit der Konzentriertheit eines Sprengmeisters an Melonen, untersuchte die Beschaffenheit der Schuppen von Wolfsbarschen und focht im »Käseland« Glaubenskriege mit dem Chefverkäufer aus, ob die Aschenschicht auf dem Ziegenkäse aus der Auvergne den Eigengeschmack doch zu sehr übertünchte.
Wie Mimi erst später rausfinden sollte, hatte sich Anton den Mahlzeit-Zärtlichkeit-Spruch aus einem Interview von Jamie Oliver geklaut. Anton war ein kultivierter, gebildeter und unglaublich verlässlicher Mann, aber eben nicht rasend originell.
Vor ihrer Hochzeit vor vier Jahren hatte Mimi ohnehin mehr als ausreichend im Genre der rasend originellen Saxophonspieler gewütet. Wobei Saxophonspieler bloß symbolisch gemeint war. Unter diesen Herzensherren konnte kein Einziger ein solches Instrument bedienen. Sie besaßen nur die Psyche von Saxophonspielern: rastlos, in stetiger Panik vor allem, was nur im Entferntesten als Bürgerlichkeit apostrophiert werden könnte, sexy in ihrer Unmöglichkeit, sich auch nur irgendwie festzulegen, und voller Überraschungen. Irgendeine Katastrophe gab es in den Leben dieser Saxophonspieler immer: Wasserrohrbrüche, eingezogene Bankomatkarten, Alkoholexzesse inklusive Abstürze ins Bodenlose, oder irgendeine Ex, die aus Trauer über den unwiederbringlichen Verlust mit einer Rasierklinge an ihren Pulsadern spielte und um die man sich – wirklich nur noch dieses eine Mal – ganz dringend kümmern musste.
»Darling«, hatte Tante Lou sie immer wieder gewarnt, wenn Mimi wieder einmal in den Trümmern einer Saxophonspieler-Beziehung lag, »hol deinen Verstand endlich wieder einmal aus der Garderobe ab. Und versuch es doch einmal mit Männern, mit denen man Pferde stehlen kann, die aber diese Pferde abends auch wieder nach Hause bringen. Glaube mir, es tut auch gar nicht weh.«
Tante Lou war natürlich alles andere als eine befugte Auskunftsperson für Liebesgeschichten, die im rutschfesten Kompromiss-Gebiet zwischen Vernunft und Pragmatismus anzusiedeln waren. Wenn jemand in seinem Beziehungsleben dem Goethe-Spruch »Vor lau graut mir« gerecht zu werden versucht hatte, dann war das ihre Großtante gewesen.
Als Mimi ihr vor fünf Jahren Anton als ernst zu nehmenden Kandidaten vorgestellt hatte, raunte sie ihr zu: »Bravo, Darling! Endlich hast du jemanden gefunden, der dich mehr liebt als du ihn. Diese Art von emotionaler Schieflage ist für eine Frau enorm wichtig. Ich habe es jahrelang umgekehrt versucht, und es hat auf Dauer keinen so wahnsinnig guten Teint gemacht. Du musst die Königin sein!«
Und bei Anton war sie die Königin. Der Altersunterschied spielte da natürlich auch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Er war achtundvierzig und somit vierzehn Jahre älter. Kein Mitglied mehr im Club der Unvernünftigen, sondern grundsolide, in »seiner Mitte ruhend«, wie er das nannte. Eine Floskel, die Mimi wirklich auf die Palme bringen konnte.
Diese In-ihrer-Mitte-Ruher hatten doch auch so etwas Resignatives an sich. In seiner Mitte ruhte man doch nur dann, wenn man nichts mehr wollte vom Leben. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass das Leben mit Anton schon einen ziemlich exakten Vorgeschmack auf das Pensionisten-Dasein bot. Die Erotik hatte sich aus dem Schlafzimmer in die Küche verlagert, wo Anton in seiner blauweiß gestreiften Profi-Schürze stand und zu Friedrich Guldas Mozart-Interpretationen Lammkeulen in Salbei-Olivensalz-Honig-Marinaden einbettete oder Maischollenfilets mit Anchovis-Creme bestrich und akribisch zu Röllchen formte, die er mit neckischen Rosmarinzweigchen vertäute. Einen Herdtrieb von dieser Vehemenz hatte Mimi ansonsten nur bei ihren schwulen Freunden beobachtet.
Jedes Wochenende und an drei Abenden unter der Woche – außer Montag und Donnerstag – stand Anton in ihrer geräumigen »Gastroprofi«-Küche, deren Ausstattung mindestens die Kosten einer Weltreise auf Vier-Sterne-Niveau verschlungen hatte. Anton reiste nicht gerne. Reisen bargen für ihn immer die Gefahr von Unvorhergesehenem. Alles, was seine Flexibilität zu sehr herausfordern konnte, versuchte Anton großräumig zu vermeiden.
Dass Mimi zwei ess- und somit stressfreie Abende vergönnt waren, lag daran, dass Anton sich zwei Mal wöchentlich einer psychoanalytischen Supervision unterzog. Als Psychotherapeut, der seinen Beruf so ernst nahm wie die Zubereitung ihrer gemeinsamen Mahlzeiten, waren diese Sitzungen bei einer Fach-Kapazität namens Friedrich Kamolz, der mit seinem eisgrauen Schnauzer und den Nickelbrillen wie eine Karikatur aus einem Woody-Allen-Film aussah, für ihn »vom psychohygienischen Standpunkt überlebensnotwendig«.
Antons seelische Boxenstopps waren für Mimi durchaus nachvollziehbar. In einem Job, bei dem man täglich acht bis zehn Stunden lang mit den Dramen anderer Menschen zugemüllt wurde, musste man irgendwelche Strategien entwickeln, um dabei nicht selbst verrückt zu werden. Bei Doc Kamolz lernte Anton, wie er das nannte, »mich abzugrenzen, ohne dabei die Empathie für das Leid meiner Klienten zu verlieren«. Er nannte seine Kundschaft bewusst nicht Patienten, weil ihm das zu abwertend schien. Schließlich wären die meisten von denen nicht krank im pathologischen Sinn, sondern »Gefangene ihrer Kindheit und ihrer daraus entstandenen neurotischen Muster«.
Wenn Mimi an Anton dachte, war er in ihren Gedanken immer vollständig bekleidet. Ganz im Gegensatz zu den Saxophonspielern früher.
Der Serge-Darsteller Fritz Keller, der erst jetzt den Raum betreten hatte, klopfte ihr auf die Schulter. Ob aus Anerkennung oder Trost für das Gezeigte, war nicht wirklich herauszufinden. Fritz besaß im Vergleich zu den meisten Schauspielern eine ironische Distanz zu seinem Job. Er betrachtete die Rolle des Erben von Christines schärfstem Konkurrenten als eine drollige Art, sein Geld zu verdienen, um dann von Off-Off-Bühnen in Garagen oder stillgelegten Fabriken kapitalismuskritische Monologe – vorrangig ohne Oberbekleidung, und er konnte sich das wirklich leisten – ins Publikum brüllen zu können. Der Rest der »Irrwege ins Glück«-Truppe – allen voran Saskia Hellmann – war nicht mit einer derartig gesunden Einstellung gesegnet. Selbst Hermann Apelton, ein fünfundsechzigjähriger Schauspieler, der Serges gnadenlosen Vater spielte, war noch immer der felsenfesten Überzeugung, dass dieser Vorabend-Schrott ihn noch einmal ganz groß auf die Star-Rampe katapultieren würde und Kino-Angebote nicht mehr lange auf sich warten ließen. Schauspieler sind wie Kinder – überbordend voll von Optimismus und Egoismus.
Fritz reichte ihr das bislang unberührte Sektglas und sagte grinsend: »Komm’, du willst es doch auch so sehr.«
Mimi schickte ihm einen spöttischen Blick, nahm einen tiefen Schluck und registrierte, dass Daniel ihr deswegen einen tadelnden Blick schickte. Er hatte sichtlich angenommen, dass alle mit dem Trinken des nachlässig gekühlten Getränks warten würden, bis er seine Motivationsrede gehalten hatte.
Auch jetzt schweiften ihre Gedanken wieder zu Tante Lou. »Schätzchen, wenn sich hier wer schlecht benimmt, dann sind das noch immer wir«, pflegte sie zu kichern, wenn die Liegenachbarn bei ihren gemeinsamen Sommern im Vöslauer Bad wieder einmal gefunden hatten, dass sie beide bei ihren Debatten und Miniatur-Theaterinszenierungen zu lautstark agiert hätten. Seltsam, über Wochen hatte Mimi nicht an sie gedacht, und heute wollte Lou ihr aus unerfindlichen Gründen nicht aus dem Kopf gehen.
»Na, siehst du, geht ja«, murmelte Serge-Fritz.
»Wenn du frech bist, wirst du in Folge zweihundertachtundvierzig an einem noch nicht erforschten und deswegen leider unheilbaren Reblaus-Virus elend zugrunde gehen …«
»Sind bei diesem qualvollen Tod ein paar herzzerreißende Großaufnahmen drinnen?«
»Kennst du eigentlich den uralten Hollywood-Witz?«
»Welchen? Von denen gibt es Zillionen.«
»Wer ist das dümmste Mädchen auf der Hollywood-Party?«
»Nicht den blassesten Schimmer …«
»Die, die mit dem Drehbuchautor schläft.«
»Ok, alles klar.« Er kratzte sich verlegen die Haare. Er hatte wirklich viele davon. Ganz im Gegensatz zu Anton, der schon mit einem kleinen Kreis nackter Haut auf seinem Hinterkopf zu kämpfen hatte. Und ganz im Gegensatz zu Anton konnte sie sich Serge-Fritz durchaus nackt vorstellen. Das war kein besonders gutes Zeichen.
Es war außerdem sehr angenehm, von einem Mann einmal nicht bekocht, sondern beflirtet zu werden. Sie prostete Fritz zu. Ob Daniel das daneben fand oder nicht, war ihr in diesem Moment völlig egal.
»Für deine Closeups musst du mit dem da drüben verhandeln.« Sie deutete auf den Regisseur Erich Miesling, der – natürlich, wie denn auch anders – in Greifnähe von Daniel saß.
Würde es ein soziologisches Museum für Prototypen der verflossenen Dekaden geben, hätte Erich Miesling mit seinem dünnen Pferdeschwänzchen, den Cowboy-stiefeln aus dunkelgrünem oder wahlweise schwarzem Schlangenleder und den dunklen japanischen Designer-Jacketts mit den Mao-Stehkrägen dort einen Podestplatz im Schauraum der Achtziger eingenommen.
Daniel war Erichs Lebensversicherung. Nach Boomzeiten in der Werbung der frühen neunziger Jahre, wo nahezu kein Fruchtjoghurt und kein Energydrink nicht unter seiner Ägide in Szene gesetzt worden war, lief es in den letzten Jahren nicht mehr so tosend für ihn. An den Schaltstellen der Agenturen hatten inzwischen die smarten Anfangsdreißiger das kreative Ruder übernommen. Erich war für die mit seinen siebenundvierzig Jahren ein Repräsentant der »Jurassic Park«-Generation. Und deswegen musste er mehr als froh sein, den Absprung ins »Bügelprogramm« geschafft zu haben, wie Daniel die »Irrwege« bei fortgeschrittener Promillezahl gerne nannte. Natürlich mobilisierte Erich alle seine Kräfte, um seiner Umwelt zu signalisieren, dass er sich alles andere als über seine Auftragslage zu beklagen hätte und es sich eigentlich noch sehr gut aussuchen konnte.
Daniel ließ ihn geschehen. Er war zwar der Jüngere und wesentlich Erfolgreichere, aber Erich hatte ihm in der Zeit, als er noch Klinken putzen hatte müssen, ein paar Aufträge als Produktionsleiter zugeschanzt. Schließlich lebten und arbeiteten alle in Wien. Und irgendwie hatte diese Form von verschlagener Loyalität, die in dieser Stadt Usus war, auch etwas Sympathisches.
Daniel fand inzwischen, dass schon viel zu viel Zeit vergangen war, ohne dass die ungeteilte Aufmerksamkeit in diesem Zimmer sich ganz auf ihn konzentrierte. Er erhob sich und dann sein Glas.
Diese dunkel gefärbten Wimpern sahen wirklich verdammt affig aus, nahezu tuntig. Mimi fragte sich, was Daniels Frau, diese esoterische Yoga-Kostbarkeit, die Mimis Ansicht nach schon in einem kühlen, weißen Jil-Sander-Leinenkleid zur Welt gekommen sein musste, über diese Form der Midlifekrisen-Bewältigungsstrategie dachte. Wahrscheinlich waren die Litschis und Mangos, die bei den Fechters immer sorgfältig drapiert in einer Tropenholzschale in der klinisch sauberen Küche standen, vor Aufregung angesichts solcher vulgären Entgleisungen des Hausherrn regelrecht durcheinandergepurzelt.
»Also, meine Lieben, nach einer Staffel ist vor einer Staffel, deswegen nicht gleich übermütig werden, aber ich freue mich, dass wir ›Christine‹ wieder einmal nahezu reibungslos eingetütet haben. Jetzt einmal abgesehen von den kleinen Meinungsverschiedenheiten zwischen unserer geschätzten Hauptdarstellerin und unserer ebenso geschätzten Drehbuchautorin …«
Vitriolgeladenes Schmunzeln auf beiden Seiten, schließlich wollten weder Mimi noch die Hellmann als Spaßverderber gelten.
Daniel genoss es sichtlich, dass er gerade wieder einen Fuß in ein Tretminenfeld gesetzt hatte. Also setzte er noch nach: »Nur zur Erinnerung, Saskia. Du wirst nicht ernster genommen, wenn du an jedem zweiten Drehtag eine halbe Stunde zu spät kommst. Solche Attitüden haben selbst der großen Marilyn Monroe Schwarzpunkte ins Klassenbuch ihrer Produzenten eingebracht …«
Mimi musste lächeln. Sie dachte an Billy Wilder, den die Monroe am Set von »Manche mögen’s heiß« zur schieren Verzweiflung getrieben hatte. Als Wilder einmal von seinem Produzenten einen scharfen Verweis abkassiert hatte, dass er seine Hauptdarstellerin besser in den Griff kriegen sollte, hatte Wilder seinen obligaten Hut schief nach hinten geschoben, sich am Hinterkopf gekratzt und nur geseufzt: »Meine Tante Rita aus Ottakring war immer pünktlich. Nur die wollte keiner sehen.«
Nach einer Kunstpause knöpfte sich Daniel jetzt Mimi vor: »Und, Frau Stein, nur, dass du es dir jetzt auch einmal merkst: Wir machen hier den Stoff, aus dem die Träume sind. Also vergiss’ Aids, Migrations-Tragödien, Ausbeutungskonflikte der rumänischen Erntehelfer, und nein, es wird auch in der nächsten Staffel kein Asylanten-Drama in Form eines nigerianischen Feschaks aus dem Traiskirchner Flüchtlingslager geben. Unsere ›Irrwege ins Glück‹ beschränken sich auf Ernteschäden durch Unwetter, miese Intrigen der Konkurrenz oder ein dunkelhaariges Luder, das sich das ›love interest‹ unserer Hauptblondine krallen möchte. Unsere Zuschauerin will sich doch ihre wohlverdiente Flucht aus dem Alltag nicht durch eine Überdosis Realität verderben. Da bin ich einmal ausnahmsweise ganz Saskias Ansicht. Es ist doch eh alles so einfach, gell Mimilotta? Warum willst du es dir denn auch immer so kompliziert machen?«
Pflichtschuldiges Gelächter. Nur Serge-Fritz schickte ihr einen Durchhalteblick. Als nebenberuflicher Turbokapitalismus-Kritiker war er natürlich ganz auf ihrer Seite.
Mimi fand, dass sie sich jetzt nicht wie ein geprügelter Hund in Schweigen flüchten sollte, und sagte mit einem Tick zu zittriger Stimme: »Warum ich so kompliziert bin? Ganz einfach, Daniel: Weil ich an ein Leben vor dem Tod glaube! Und die Diktatur des Mittelmaßes für mich schon immer ein politisches System war, dem ich zutiefst misstraue.«
Mit so viel Kampfgeist hatte jetzt keiner gerechnet und Daniel versuchte, die kippende Stimmung rasch wieder zu seinen Gunsten zu wenden: »Du Jeanne d’Arc des Vorabends! Es gibt aber immerhin zwei Argumente, die einem diese Diktatur dann dennoch erträglich machen: Schmerzensgeld und, haha, Schmerzensgeld. Also, meine Lieben, einen schönen Sommer für uns alle. Schont eure Nervenkostüme, ihr werdet sie im August wieder brauchen. Und Santé! Vor allem dir, Mimi. Dein Sommer ist ja bekanntlich wesentlich kürzer als der vom Rest der Gang. In der Hoffnung, dass dir wieder schöne, tränenreiche Geschichten einfallen …«
Er erhob sein Glas und fixierte sie eindringlich. Das war ein Versöhnungsangebot, auf das Mimi mit einem Lächeln einging. Zum Teufel auch! Schließlich war sie freiwillig ein Rädchen dieser Verblödungsmaschinerie geworden. Es hatte sie ja keiner mit vorgehaltenem Revolver dazu gezwungen, Christine durch die Tsunamis eines Winzerkönigin-Schicksals zu manövrieren. Und wenn sie wollte, könnte sie ja einen Problemfilm schreiben, wo sie sich gegen Rassismus, Xenophobie, bisexuelle Liliputaner – Pardon: Kleinwüchsige – und die Diskriminierung von am Tourette-Syndrom erkrankten Teenagern einsetzte. Aber ein so dringliches Anliegen waren ihr diese gesellschaftspolitischen Themen offensichtlich auch nicht; sonst säße sie nicht hier und würde jetzt schon das dritte Glas bereits ekelig lauwarmen Proseccos in sich hineinschütten.
»Kommst du mit hinaus, eine rauchen?«, fragte Serge-Fritz.
»Ich rauche nicht mehr. Aber ich würde wahnsinnig gerne mit dir draußen eine nicht rauchen.«
Sie verließen die Truppe, die sich inzwischen wie eine Horde Haftentlassener auf das exzentrische Fingerfood stürzte, das mit seiner Zitronengras- und Thunfischtartar-Lastigkeit sicher die Idee von Daniels angetrauter Yoga-Kostbarkeit gewesen war.
Als sich Mimi und Fritz nach draußen stahlen, schickte Mia ihnen einen wehmütigen Blick hinterher. Sie hatte in den letzten Wochen nicht nur ein Mal geträumt, dass Christine während eines ihrer geheimnisvollen Anfälle überraschenderweise dann doch den Löffel abgab. Und Serge, der Romeo des Winzerdramas, nach einer Anstandstrauer irgendwann einsehen würde, dass Christine vor allem sein Glück gewollt hätte. Und er deswegen mit Mia an seiner Seite dem heruntergekommenen Weingut neuen Glanz und Glorie verleihen wollte.
»Serge«, seufzte Mia innerlich, »wenn ich dich schon nicht mit Haut und Haaren haben kann, dann pimp wenigstens my dreams.« Sie war ein Kind der MTV-Generation.
Als Mimi gegen halb eins mit einem Damenschwipschen und richtig fröhlich nach Hause kam, war es, bis auf das Licht der Esszimmer-Stehlampe, stockdunkel in der Wohnung. Wenn es je auf diesem Planeten ein totes, marokkanisches Zitronenhuhn geschafft hatte, sich in einen fleischgewordenen Vorwurf zu verwandeln, dann war es dieses. Anton hatte den Ton-Tagine nahezu unberührt auf der Mitte des gedeckten Tischs stehen lassen. Sein Gedeck war abgeräumt, das von Mimi war wie ein malerisches Mahnmal auf seinem Platz geblieben.
Mimi fühlte sich schlecht, aber nicht so schlecht, dass sie gleich zu Anton ins Bett kriechen und ihn für die Dreistigkeit ihres Fernbleibens um Verzeihung bitten wollte. Es musste doch bitte auch einmal drinnen sein, nicht zu funktionieren. Warum konnte Anton sie nicht atmen lassen, und wollte, dass sie ihm ständig über jede ihrer noch so kleinen Bewegungen Meldung machte.
Drei Mal hatte er sie mit »Wo bleibst du?« angesmst, und beim dritten Mal hatte sie nicht mehr geantwortet. Diese ständige als Fürsorge getarnte Überwachungsmanie konnte sie manchmal wirklich aggressiv machen.
Manchmal schämte sie sich auch dafür. War sie undankbar? Zu oft hatte sie sich die Litaneien ihrer Freundinnen anhören müssen, wie achtlos, desinteressiert, bindungsparanoid, egomanisch und lieblos ihre Lebensabschnittspartner doch mit ihnen umgingen. Und was Anton im Vergleich dazu nicht für ein Lottogewinn wäre! In der Tat: Im Gegensatz zu deren Männern, die sich doch immer wieder darüber erstaunt zeigten, dass so ein Geburtstag partout im Jahresrhythmus wiederkehrte, hatte Anton bereits Monate zuvor für sie ein Wochenende in Paris, Rom oder Venedig gebucht, Romantik inklusive – Champagner, Obstkörbe in den Suiten mit Aussichten, Besuche in versteckten kleinen Bistros und Osterien jenseits der touristischen Trampelpfade, Opernvorstellungen oder Konzerte, so wie letztes Jahr das Aznavour-Konzert im Pariser »Olympia«. Seine Abneigung gegen Reisen und Überraschungen bezwang er, indem er jeden Schritt auf diesen Städtetrips vorausplante. Nichts blieb da dem Zufall oder spontanen Entdeckungstrips überlassen. Rührend irgendwie, natürlich. Und dennoch hatte Mimi zunehmend das Gefühl, dass sie mit ihrem Onkel verreiste und nicht mit ihrem Ehemann und Liebhaber. Doch, doch, natürlich hatten sie noch ein Liebesleben. So lange waren sie schließlich auch noch nicht verheiratet. Aber auch in dieser Angelegenheit, da war sie inzwischen felsenfest davon überzeugt, überließ ihr Anton sicher nichts, aber auch gar nichts dem Zufall.
Wahrscheinlich hatte er den geplanten Liebesakt in einer speziellen Farbe, vielleicht ja in knalligem Pink, mit einem Leuchtmarker-Balken in seinem Wochenplaner vermerkt. Schließlich hatte auch jeder seiner »Klienten« eine eigene Marker-Farbe zugeteilt bekommen, sodass Antons Therapiestundenplan wie ein kunterbunter Streifenteppich aussah. Wenn sie an Anton dachte, sah sie ihn nahezu immer mit einer ausgeleierten Strickjacke, die über seinen cognacfarbenen Kordhosen baumelte. Ein richtiggehendes Onkel-Outfit. Passend zu den Gefühlen, die Anton in ihr auslöste: Sicherheit und Geborgenheit. Er hatte einen Schutzwall um sie errichtet, sie brauchte vor nichts und niemandem Angst zu haben. Aber wenn sie diesen Schutzwall visualisierte, sah sie nicht immer Geborgenheit, sondern auch bedrohliche Mauern, die sie fest umschlossen und die sie nicht verlassen durfte.
Drei Mal war sie heute mit dem SMS-Text »Wo bleibst du?« bombardiert worden; dabei war sie in den letzten Monaten ohnehin kaum ausgegangen. Sie war einfach zu erschöpft von ihrem täglichen Schnulzenmarathon gewesen. Und irgendwann hatten ihre Freunde auch die Lust verloren, sich schon wieder eine Abfuhr zu holen. War es das, was Anton eigentlich wollte? Die totale Symbiose, nur sie beide auf einer selbst gebastelten Zweisamkeits-Oase, die durch nichts und niemanden gestört wurde? Es war ihr nicht wirklich gut. Wie sollte einem bei diesen Gedanken auch nicht übel werden?
Sie brühte sich ein Tässchen »Magenfreund«, ein in diesem Fall besonders gelungener Teename, und stellte das kalte Zitronenhuhn in den Kühlschrank. Dann knallte sie sich auf die sandfarbene italienische Sitzlandschaft und zappte durch die TV-Sender. Fasziniert blieb sie bei einem Shopping-Kanal hängen, wo eine späte Blondine mit falschen Wimpern und mit drastisch orangefarben übermalten Lippen, die ihr Gesicht schaurig clownesk wirken ließen, kindergroße Porzellanpuppen an die Frau zu bringen versuchte. Die Visagen dieser Puppen wirkten mit ihren starren, ausdruckslosen und überdimensional großen Augen nicht weniger beklemmend als Frau Clown selbst. Ihre Stoppellockenfrisuren erinnerten Mimi fatal an jene von Bette Davis in dem Psycho-thriller »Wiegenlied für eine Leiche«. Welcher Mensch würde sich ein solch gespenstisches Spielzeug freiwillig ins Wohnzimmer stellen?
Offensichtlich liefen eine Menge von solchen potenziellen Konsumenten da draußen frei herum, denn jetzt wurde folgende Warnung eingeblendet: »Zauber-Marlies – Gliederpuppe aus handbemaltem Porzellan, eine Kostbarkeit aus Tübingen zum einmaligen Sonderpreis von 134,40 Euro. Achtung, wegen hoher Nachfrage nur mehr drei Stück auf Lager!« Aber ziemlich sicher schrieben die etwas Ähnliches bei jedem zweiten angepriesenen Teil, um der Konsumträgheit des Zuschauers auf die Sprünge zu helfen.
Und schon zog Madame Clown ihren nächsten Trumpf aus der Zaubertüte – einen Goldlamé-Strickpullover mit eingebautem Wonderbra, der jetzt nur auf einem Foto gezeigt wurde. »Das perfekte Oberteil für verheißungsvolle Stunden zu zweit«, säuselte sie und winkte einem Model, das die Wirkungskraft dieses Wirkwaren-Coups gleich vor Augen führen sollte. Fräulein Goldbusen drehte sich jetzt mit dem starren Lächeln eines Laufsteg-Mannequins der Wirtschaftswunderjahre ins Bild. Verglichen mit deren Gesichtsausdruck – man musste es leider zugeben – besaß Saskia Hellmann nahezu eine intelligenzgeladene Physiognomie und sah fast aus wie eine aussichtsreiche Kandidatin für den Friedensnobelpreis.