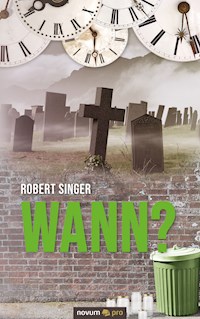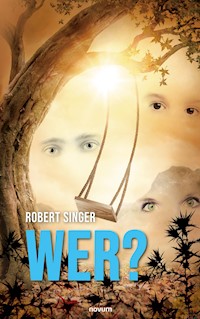
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Tamara auf Harald trifft, spürt sie instinktiv, dass sie auf ihrer lebenslangen Suche einen entscheidenden Schritt weitergekommen ist. Er ist wie sie – und doch anders. Albträume, Verzweiflung, Einsamkeit. Sie lernen andere kennen, andere wie sie. Lebensmüde und gefüllt mit Angst und Schreckensvisionen. Unfähig, Beziehungen einzugehen. Ohne Vertrauen in ein Gegenüber, das es gut meint. Was verbindet sie? Das Grauen? Das Dunkle? Das Aufkommen von Erinnerungen? Fetzen aus der Vergangenheit? Fragmente, die zusammenzusetzen sie nur gemeinsam schaffen. Die Frage stellt sich ihnen: Wer steht hinter dem Grauen? Dem Dunklen? Wer verhindert, dass sich die Teile zu einem Bild fügen, das ihnen Gewissheit gibt und Vertrauen in eine nie gekannte Zukunft schenkt? Gemeinsam beginnen sie die Suche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2023 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-823-1
ISBN e-book: 978-3-99131-824-8
Lektorat: Julianne Johannsen
Umschlagfotos: Elena Schweitzer, Andrey Pritula, Fallenangel, Rui Matos, Inga Nielsen, Anton Samsonov | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Prolog
Sie saßen da.
Saßen einfach da und warteten.
Oder warteten auch nicht.
Es war nicht zu erkennen. Das Licht im Raum war zu schwach. Hervorgerufen nur durch einen schmalen Spalt in der Tür.
Nur schemenhaft tauchten die bleichen Gesichter aus dem Dunkel auf.
Fünf.
Es waren fünf Gesichter und sie gehörten zu fünf Körpern. Vielleicht waren auch noch mehr im Raum. Das war nicht erkennbar. Es war zu dunkel.
Sie waren klein und ließen erahnen, dass es Kinder waren, die da saßen.
Kleine Kinder, die einfach nur dasaßen und im Dunkel des Nichts sich selbst überlassen waren.
Sie sprachen nicht. Keinen Laut gaben sie von sich.
Waren es Kinder? Waren es überhaupt menschliche Wesen?
Sie bewegten sich nicht.
Nicht die kleinste Regung war zu sehen. Weil es dunkel war und weil sie sich tatsächlich nicht bewegten.
Im Raum herrschte absolute Stille. Er war leer, wenn man von den dünnen Körpern absah. Und er war klein. Nicht so klein, als dass sie nicht ihre Notdurft in der entferntesten Ecke verrichten konnten. Instinktiv. Zu Beginn wenigstens. Später ging das nicht mehr. Später waren sie zu schwach, in eine andere Ecke oder auch sonst wohin zu kriechen.
Später saßen sie einfach nur da und warteten. Warteten darauf, dass sich die Tür öffnen würde. Dass etwas Licht gemacht werden würde. Oder dass wenigstens eine menschliche Stimme an ihr Ohr dränge.
Eine vertraute Stimme oder auch eine, die sie nicht kannten.
Einfach eine menschliche Stimme hören, darauf warteten sie. Natürlich wünschten sie sich eine Stimme, die sie kannten. Später war ihnen egal, von wem die Stimme kommen würde. Hauptsache, sie hörten eine Stimme. Wenn schon sie selbst nicht miteinander sprechen konnten. Aber dieser Wunsch versank genauso im Dunkel der ewigen Nacht wie der Schmerz, den das Heimweh auslöste.
Am Anfang wimmerten sie, weinten sich in den dumpfen Schlaf, den der Hunger mit sich brachte, der bald über allem stand.
Auch über dem Heimweh.
Und dann, später, saßen sie nur noch da und warteten nicht mehr. Sie saßen da und merkten, wie auch der Hungerschmerz abnahm. Langsam. Mehr und mehr. Sie waren erschöpft, obwohl sie dieses Wort nicht kannten.
Woher auch? Sie waren noch zu klein.
Dort wo sie vorher waren, war es ihnen problemlos möglich zu schlafen, wenn sie müde waren. Und wenn sie aufs Klo mussten, gab es einen Ort, wo sie hingehen konnten.
Und sie hörten Stimmen. Stimmen, die sie kannten.
Mama.
Papa.
Auch andere.
Es war vor allem die Erinnerung an die Stimmen ihrer Mamas und Papas, die in ihren Ohren tönten. Es waren diese vertrauten Stimmen, nach denen sie sich sehnten, lange. Es waren diese Stimmen, die zärtlich durch ihre Gehörgänge wisperten, kurz nachdem sich die schwere Tür hinter ihnen geschlossen hatte und alles beinahe schwarz werden ließ.
Dunkelheit.
Auch das war etwas, das man ihnen nicht zugemutet hatte. Damals. Zuhause in ihren Zimmern brannte ein kleines Licht. Manchmal ließ Papa die Tür offen, damit Licht ins Zimmer fiel und das Kind etwas hören konnte.
Stimmen.
Vertraute Stimmen.
Stimmen, die das Kind kannte und ihm zeigten, dass es zuhause war.
In Sicherheit.
Geborgen und geliebt.
Man sagt, dass sich Kinder rasch an eine neue Umgebung anpassen. Je jünger sie sind, desto weniger schwer fällt es ihnen, sich auf eine neue Umgebung einzustellen.
Sich anzupassen.
Die kleinen Körper, die regungslos an der Wand kauerten, waren der beste Beweis, wie gut sich die Anpassung vollzogen hatte. Dunkel und grau wie das Gemäuer waren ihre eingefallenen Gesichtchen. Sie hatten sich wahrhaftig auf ihre neue Umgebung eingestellt. Weinten nicht mehr.
Wimmerten nicht mehr und sprachen immer noch kein Wort miteinander. Sollten sie jedoch jemals die Möglichkeit erhalten, auf die Zeit in diesem dunklen Betonloch zurückzublicken, würden sie mit Sicherheit davon berichten, dass die Anpassung beileibe nicht das höchste Gut der menschlichen Natur ist. Wenn sie denn überhaupt darüber sprechen konnten. Auch das war nicht sicher.
Aber sie dachten nicht an die Zukunft. Sie dachten nicht daran, einmal zurückzublicken geschweige denn, vorwärts schauen zu können. Und sie dachten schon gar nicht an die Möglichkeit, sprechen zu können. Geschweige denn, jemanden zu haben, der ihnen zuhörte. Sie hatten keinen Zeitbegriff. Dafür waren sie noch zu wenig lang auf der Welt. Sie saßen da und erwarteten nichts. Nichts von der Zukunft und schon gar nichts von der Gegenwart. Und die Bilder der Vergangenheit glitten mehr und mehr von ihnen weg, rutschten ins Nichts des dunklen Raumes.
Dann, irgendwann in der Leere der Zeit hörten sie ein Geräusch. Unterschiedliche Geräusche. Einzelne Augenpaare richteten sich unmerklich Richtung Türe. Ohne Bewegung des Kopfes. Nur ein sachtes Drehen der Augäpfel seitwärts war zu erkennen.
Woher kamen die Geräusche? Waren dies Schritte?
Kam Papa?
Kam auch Mama?
Kamen sie alle beide?
Ein Kratzen und Knirschen. Metall auf Metall. Ein Poltern. Es hallte von weit her und drang dumpf in den kahlen Raum. So viele Geräusche, die auf einmal da waren.
Ungewohnt.
Beinahe war es für die kleinen Kinder ein Lärm. Nichts konnten sie bereits einmal Gehörtem zuordnen. Nichts, das sie an ihr Zuhause erinnerte. Nichts, das ihnen Mut gab oder Hoffnung weckte, bald von Mami im Arm gewiegt zu werden. Einem kleinen Mädchen, das nicht älter als fünf war, rann eine Träne über die Wange.
Lautlos.
Einfach nur eine einzelne Träne. Unklar, wofür sie stand. Ungewiss, was sie bedeutete. Aber es war eine Regung. Mehr, als sich in den letzten Tagen bewegt hatte. Eine kleine Träne der Unschuld, die sich wie von selbst gelöst hatte und dem Gesetz der Schwerkraft gehorchte. Eine leise Träne.
Und der Lärm.
Beides zur selben Zeit.
Ein metallenes Rasseln war zu hören und die schwere Tür öffnete sich. Langsam zuerst, dann mit einem schnellen Ruck. Im Lichtschein war ein Kind schwach zu sehen, das zu ihnen reingeschoben wurde.
Ein Kind, so wie sie.
Ihre Augen blickten den Neuankömmling an.
Regungslos.
Leer.
Und bevor sich die Tür wieder schloss, konnte man sehen, weshalb die Kinder nicht miteinander sprechen konnten. Ihre Münder waren verdeckt. Verdeckt mit einer metallenen Platte, ähnlich dem Mundstück eines Schnorchels. Und ähnlich dem Schnorchel war das Metallstück auch befestigt. Aber nicht mit einem Gummizug. Viel mehr mit einem helmartigen Gebilde aus Metall, das um ihren Kopf gelegt worden war.
Sprechen konnte man so nicht mehr. Aber Tränen konnten fließen. Auch jetzt. Das neue Kind weinte.
Weinte in seinem Metallgestell, weinte nach Mama und Papa, nach Gutenachtliedern und Geschichten im Bett, nach vertrauten Stimmen und Geräuschen.
Und die Hoffnung des Kindes war noch groß.
So groß, wie sie auch die anderen Kinder empfunden hatten.
Lange Zeit zuvor.
September – Oktober
1Barbara Robinson
Barbara Robinson war glücklich. Überaus glücklich und zufrieden. Die Septembersonne, die vor wenigen Augenblicken hinter einigen Wolken hervorgekommen war, strahlte mit ihr um die Wette. Barbara Robinson war sicher, dass sie diese Wette gewinnen würde. Heute würde sie diese mit Sicherheit gewinnen. Bald war der Tag zu Ende und die Wolken waren zu stark und wahrscheinlich würden sich diese auch noch entleeren.
Mit ihren achtundzwanzig Jahren war sie an einem Punkt ihres Lebens angelangt, wie er besser nicht sein könnte. Während sie sich ihre rotblonden Locken aus dem Gesicht strich, wartete sie auf den Bus. Obwohl der Wind wehte, war es nicht kalt. Trotzdem war sie froh um den beigen Blazer, den sie über einer hellblauen Bluse trug. Die schwarze, knöchellange Hose von Peter Hahn ließ ihre Figur toll zur Geltung kommen. Sie hatte sie heute Morgen bewusst angezogen.
Sie musste lächeln, wenn sie an das Gespräch mit ihrem Vorgesetzten zurückdachte. Die Hose hatte ihm wohl gefallen. Und auch alles andere. Alles war so gelaufen, wie sie es sich vorgestellt hatte. Mehr noch. Wie sie es sich gewünscht hatte. In Tat und Wahrheit würde sie im kommenden Jahr weniger arbeiten und trotzdem ein Drittel mehr verdienen. Und das nur deshalb, weil sie von einem Großraumbüro in ein privates Büro wechseln konnte. Notabene im obersten Stockwerk des Gebäudes, das hinter der Bushaltestelle in den Himmel ragte.
Kein Wolkenkratzer, nein. Aber doch hoch genug, dass man die Konturen der obersten Fenster nur noch als Weiterführung von Linien wahrnehmen konnte. Barbara Robinson lächelte erneut. Nein, es war kein Wolkenkratzer wie in ihrer Heimatstadt. Das nicht. Aber trotzdem war es das höchstgelegene Büro, das die Stadt zu bieten hatte. Okay. Auf derselben Etage befanden sich noch unzählige andere Büroräume, aber Barbara Robinson war davon überzeugt, das schönste zu erhalten. Das hellste und größte. Im neuen Jahr. Das stand ihr zu.
Dafür hatte sie all die Jahre gekämpft und geschuftet, unzählige Überstunden gemacht und immer wieder den richtigen Augenblick abgewartet, um eine weitere Stufe ihrer Karriereleiter zu erklimmen und Etage für Etage höher zu kommen. Bis zuoberst. Dafür hatte sie sich manchmal auch ganz hinten angestellt und sehr oft oder meist auch nach vorne gedrängt. Und dafür hatte sie sich heute Morgen für die schwarze Hose von Peter Hahn entschieden. All dies hatte ihr geholfen, in die obersten Gefilde des höchsten Gebäudes der Stadt zu kommen.
Bald. Im neuen Jahr.
Barbara Robinson war in der Tat ein Glückskind. Schon immer gewesen. Damals in der Schule, als niemand der Lehrer erkannte, dass ihre Antworten nur im Ansatz richtig waren und sich mehr von ihrem Äußeren beeindrucken ließen. Oder in den Bewerbungsgesprächen, in denen es niemandem aufzufallen schien, dass ihr wichtige Abschlüsse fehlten. Sie wurde eingestellt. Vielleicht lag es an ihrem rotblonden Haar, das ihr Gesicht schulterlang umrahmte und diesem eine Aura der Unnahbarkeit und gleichzeitigen Verführung verlieh. Diese Haut, die wie schimmerndes Porzellan Zerbrechlichkeit ausstrahlte und so gar nicht zu den grüngrauen Augen passen wollte, die alles ausstrahlten. Aber keine Zerbrechlichkeit.
Barbara Robinson brauchte niemanden, der sich um sie kümmerte und sich Sorgen um sie machte. Sie war stark genug. Immer schon gewesen. Sie blickte auf die Uhr. Bald würde sie zuhause sein und mit einem schönen Glas Wein ein Bad genießen.
Es war Freitag. Kurz vor 19.00 Uhr.
Wochenende. Sie hatte es verdient, auszuspannen, sich etwas Gutes zu tun. Eigentlich könnte sie übers Wochenende auch verreisen.
Der Bus kam. Sie hatte ihn schon von weitem gesehen. Pünktlichkeit. Auch etwas, das sie an diesem Land liebte. Pünktlichkeit und Sauberkeit. Und die Ruhe.
Danach sehnte sie sich.
Nachdem sich die Türen des Busses geöffnet hatten, stieg sie ein und setzte sich auf einen der wenigen freien Plätze. Auch das Busfahren würde bald zu ihrer Vergangenheit gehören. Mit dem neuen Jahr gab es nicht nur ein Büro im obersten Stockwerk, sondern auch einen Wagen mit Chauffeur. Sie blickte aus dem Fenster. Sie war wirklich ein Glückskind. Barbara war aber auch selbstbewusst genug zu wissen, dass dieses Glück auf ihrer jahrelangen Vorbereitung, ihrer Willenskraft und ihrem akribischen Streben nach Perfektion gegründet lag. Sie wusste, dass sich das Glück dieser Erde nicht auf der Straße befand und man ihm nachhelfen musste. Das hatte sie getan. Seit sie denken konnte.
Alles, was sie zur Verfügung gestellt bekam, hatte sie dazu genutzt, nach oben zu kommen. Stufe um Stufe.
Und heute hatte sie erreicht, wovon sie all die Jahre geträumt hatte. Unwillkürlich blickte sie den Hochhäusern auf der Seite entlang nach oben. Ein sanftes Lächeln umspielte ihren zartrosa geschminkten Mund. Ihr Büro lag höher. Viel höher.
Ja, sie war ein Glückskind.
2Barbara Robinson
Kurze Zeit später lag sie in ihrer Wanne und nippte an ihrem Glas. Sie wollte sich nicht betrinken und wenn, dann nicht zu schnell. Sie war ein Glückskind. In der Tat. Heute hatte sie das erreicht, wonach ihr der Sinn all die Jahre gestanden hatte, und das mit dem Effort, den aufgewendet zu haben sich nun auszahlen würde.
Sie blickte sich um. Es war ein großes Badezimmer. Achteckig und mit riesigen Spiegeln auf den je gegenüberliegenden weißen Wänden. Manchmal, wenn sie ein leichtes Makeup auflegte, musste sie sich ansehen und lächelte von allen Seiten zurück. Ja. Wenn Barbara Robinson in einen Spiegel in ihrem großen Badezimmer blickte, fühlte sie sich nicht einsam. Umgeben von diesen schönen Frauen mit der Porzellanhaut. Und jede lächelte. Genauso wie sie. Lächelnd und inmitten vieler Freundinnen.
Sie blickte unwillkürlich zu einem der Spiegel, lag aber zu tief, als dass sie sich hätte sehen können. Auch wenn die Wanne auf einer Erhöhung stand. Um sich sehen zu können, musste sie aufstehen und sich zu den Spiegeln drehen. Das tat sie aber nicht. Nicht jetzt. Sie wusste, dass sie makellos war. Ausgestattet mit einer Haut, um die sie alle im Fitnessstudio beneideten. Die alten, aber auch die Jungen. Sie spürte deren Blicke, wenn sie in die Umkleide trat. Manchmal glaubte sie sogar, sie darüber sprechen zu hören. Aber sicher war sie sich nicht. Vielleicht waren das auch die Stimmen in ihrem Kopf. Wunschstimmen. Sie wusste es nicht. Aber ob real oder nur in ihrem Kopf: Es waren wundervolle Dialoge, die sie zu hören bekam. Dialoge über sie und ihre Haut, die dafür verantwortlich war, dass sie sich nur wenig Makeup auftragen musste. Und dies auch nur deshalb, damit sie einige Minuten ungeniert in den Spiegel schauen konnte. Ein wundervolles Bild. Eine Freude, es zu betrachten. Immer und immer wieder. Die acht Spiegel im Badezimmer waren denn auch der Grund, dass sie sich nach der ersten Besichtigung keine andere Wohnung mehr angesehen hatte. Acht Spiegel! Mit goldfarbener Umrahmung. Golden wie die Armaturen der zwei großen Waschbecken aus weißem Marmor. Wo gab es denn sowas? Sie liebte weiß. Und sie liebte ihre Wohnung. Zugegeben. Immer hatte sie nicht so gewohnt. Bei weitem nicht. Ganz früher hatte sie sogar in dieser Stadt gewohnt, bevor sie nach Amerika gebracht worden war. Jetzt war sie wieder hier. In einer Wohnung, die ihr entsprach. Sie war immer davon überzeugt gewesen, dass ihr eine Wohnung wie diese zustand. Nicht mehr und nicht weniger. Oberstes Stockwerk. Mit Blick über die Stadt. Direkter Zugang von der Tiefgarage. Mit dem Lift war sie in wenigen Sekunden in ihrem Reich. Ihrem Rückzugsort. Ihrem Traum in Weiß.
Nur wenn sie auf der halbüberdeckten Terrasse stand und am viel zu niedrigen Geländer nach unten blickte, konnte sie einen Hauch von Stadt wahrnehmen. Weit unten ging eine Hauptstraße durch. Stark befahren. Sie war die Verbindung zum Flughafen, der etwa fünfundzwanzig Minuten außerhalb der Stadt lag und von dem sie nur an Nachmittagen auf der Terrasse etwas mitbekam, wenn sie zuhause war. Was aber nicht geschah, weil sie an den Nachmittagen arbeitete. Auf der Terrasse stand sie nur, um diesen vagen Geruch von Stadt aufzunehmen und in die Nacht zu lauschen, die Lichter der Autos und Bürogebäude zu sehen. Manchmal fragte sie sich ernsthaft, ab wie vielen Häusern man von Skyline sprechen durfte. Hier sicher nicht. Zu wenige Gebäude und zu wenig hoch. Trotzdem erinnerte es sie an die Bilder von Amerika, wenn sie alles, was sie sah, größer dachte. Manchmal blickte sie nach unten, sah den Lichtschein der Autos und drehte sich um mit der Gewissheit, dass sie diese Straße befahren würde. Irgendwann. Mit einem Fahrer.
Einem Fahrer, der sie direkt in die Tiefgarage fahren würde. Und dann dachte sie an den Lift, der sie nach oben in ihr Penthouse brachte. Von der Tiefgarage. Nicht vom Haupteingang her, in welchem Karl oder Kurt stand und ihr die Tür jeweils aufhielt. Das wäre dann nicht mehr von Bedeutung. Dann würde ihr Fahrer die Türe ihrer Limousine öffnen und ihr einen schönen Abend wünschen. Diskret und charmant. Und am andern Tag würde er wieder bereit sein, sie in ihr neues Büro im obersten Stockwerk des höchsten Gebäudes dieser Stadt zu bringen. Und sie würde ihren Fahrer beim Vornamen nennen. Vielleicht wäre es auch ein Karl oder Kurt. Sie wusste vieles, aber das noch nicht. Wer konnte das zum jetzigen Zeitpunkt schon wissen? Aber lange würde es nicht mehr dauern und dann würde sie sich von ihm die Wagentür öffnen lassen. Er hätte eine Sonnenbrille auf und würde von Zeit zu Zeit in den Rückspiegel sehen und ihr makelloses Gesicht betrachten.
Und vielleicht …
Sie streckte ihre Arme, stützte sich leicht ab und legte den Kopf nach hinten, darauf bedacht, den Wein nicht zu verschütten. Sie schloss die Augen und sah die Bilder ihrer Zukunft. Sie war am Ziel. Wenige Monate und sie würde dort sein, wo sie schon seit Ewigkeiten hingehörte. Ihre Geduld würde sich bezahlt machen. Und die guten Gene ihrer Mutter, die sie nie gekannt hatte. Wahrscheinlich waren es die Gene ihrer Mutter. Irgendwie konnte sie sich nicht vorstellen, die Reinheit ihres Äußeren von einem Mann vererbt bekommen zu haben. Auch ihren Vater hatte sie nicht gekannt.
Sie wusste sehr wenig von früher.
Es waren kleine Erinnerungsfetzen. Bilder, die manchmal kurz aufleuchteten, ähnlich einer Signallampe bei einer Baustelle. Ein kurzes Leuchten und weg war es wieder. Meist Farbflecken. Grün oder braun. Nie blau. Nie rot oder gelb. Grüne und braune Farbpigmente, die sich zu undefinierbaren Formen zusammenschoben und absolut keinen Sinn ergaben. Meist geschah dies in Träumen oder wenn sie in Gedanken versunken auf dem Laufband in ihrem Fitnessstudio Kilometer für Kilometer lief. Sie dachte sich jedoch nie wirklich etwas dabei. Farben bedeuteten ihr nur wenig und wenn ein Traum nicht klarer zu ihr sprach, sollte er bleiben, wo der Pfeffer wächst. So sagte man doch.
Barbara Robinson hatte schon früh gelernt, sich nicht um ihre Vergangenheit zu kümmern. Sie interessierte sie genauso wenig wie die grünen und braunen Punkte, die manchmal jäh aufblitzten.
Wozu sollte es gut sein, sich mit etwas abzugeben, das man nicht besaß?
Sie öffnete ihre Augen und blickte an die Decke, die beinahe wie einer der Spiegel schimmerte. Schwach konnte sie ihren Körper in der Wanne erkennen. Sie nahm nie Badeschaum. Stets war es ein Kokosöl, das sie ins Wasser träufelte. Wunderbar duftend. Es erinnerte sie an etwas. Aber nur vage. Die Erinnerung war zu schwach, um in ihr zu verweilen.
Vergangenheit!
Damit hatte sie abgeschlossen. Schon früh. Sie nutzte jeweils den Augenblick der Gegenwart und malte sich daraus ihre Zukunft. Stück um Stück. Strich um Strich. Mit allen Schattierungen und Farben. Mehr Farbe als Schatten. Vor allem weiß. Wie ein Licht. Licht hatte sie verdient.
So wie diese Wohnung.
So wie das Büro hoch oben.
Sie beugte ihren Arm und versuchte, einen Schluck des Weines zu nehmen. Ein Rinnsal lief ihr über den Mundwinkel den Hals hinunter. Vielleicht würde sie sich heute doch betrinken. Es wäre ein solcher Abend. Und morgen hatte sie frei. Auch am Nachmittag. Vielleicht würde sie morgen auf der Terrasse liegen und die Flugzeuge nicht hören, weil sie einen Kater ausschlief.
Sie hörte, wie Regen an die Fenster prasselte. Von draußen drang das frische Geräusch durch die Wohnung ins Innere des Badezimmers. Also würde sie wohl ihren Rausch nicht auf der Terrasse ausschlafen. Wenn sie denn in einen Rausch fiel heute Abend. Der Sinn stand ihr danach. Allerdings wusste sie nicht, ob dies allein Spaß machen würde. Sie setzte sich leicht auf, nahm einen weiteren Schluck und stellte das Glas vorsichtig auf den breiten Rand der Wanne.
Auf einem beigefarbenen, niedrigen Barhocker neben der Wanne lag ihr Smartphone. Sie nahm es, gab den Pin ein und scrollte durch ihre Kontakte. Ein Lächeln umspielte ihren Mund, als sie einen anwählte und eine Nachricht schrieb. Sie war kurz, aber klar. Sie legte das Gerät zurück, nahm das Glas, rutschte wieder nach hinten und nahm einen Schluck aus dem beinahe leeren Glas. Sie würde in der Wanne liegenbleiben, bis es an der Tür klopfte. Ja, das würde sie.
Draußen war immer noch der Regen zu hören. Sonst war es still in der Wohnung. Sie schloss erneut ihre Augen und genoss die Ruhe. Genoss sie und wusste, dass auch nachher alles ruhig sein würde.
Denn Stefan Seegartner hatte noch nie ein Wort gesprochen, seit sie ihn das erste Mal gesehen hatte. Ihre Kommunikation funktionierte trotzdem einwandfrei und das Wesentliche in ihrem Austausch würde auch heute Abend geschehen.
Sie setzte das Glas an ihre Lippen und spürte, dass sie feucht wurde.
Bereit für ihn, der nie sprach und alles für sie tat.
3Stefan Seegartner
Stefan Seegartner spannte den Schirm auf, nachdem er aus dem Taxi gestiegen war. Es waren nur wenige Meter zu Barbaras Haus, aber der Regen war so stark, dass auch ein paar Meter ausreichen würden, ihn klitschnass werden zu lassen. Was in Anbetracht dessen, was bald geschehen würde, keine große Rolle spielte. Trotzdem kam er lieber trocken in der Wohnung an.
Unwillkürlich blickte er nach oben und versuchte herauszufinden, hinter welchen Fenstern ganz oben Barbaras Wohnung war. Vergeblich. Er hatte es bis heute noch nie geschafft, diese zu lokalisieren. Zu verschachtelt war das Gebäude. Oder besser gesagt, die Gebäude. Beinahe schien es, als sei es ein Teil einer Anhäufung von Baustilen und Bauetappen, in denen die unterschiedlichsten Architekten ihre Träume zu verwirklichen versucht hatten. Was ihnen wohl nicht gelungen war. Beim Bauen war es vielleicht wie mit den Köchen. Zu viele …
Stefan Seegartner öffnete die schwere Tür am Eingang.
Kuno am Empfang kannte ihn und nickte ihm zu.
„Hey, Stefan, tut mir leid. Habe dich gar nicht kommen sehen. Hätte dir sonst aufgemacht.“
Stefan winkte ab. Auf dem Tisch stand ein großes Schild mit dem Namen des Türstehers. Kuno. Er verstand nicht, weshalb sich Barbara diesen Namen nicht merken konnte. Beinahe war er versucht zu denken, dass es an ihrem Willen lag. Er war ein Türsteher. Den Namen eines Türstehers musste man nicht kennen.
Seinen Namen hingegen kannte sie. Nicht nur seinen Namen. Auch seine Nummer und noch vieles mehr.
Er ging an Kuno vorbei und drückte auf den Knopf des Fahrstuhls. Gleichzeitig nahm er wahr, dass Kuno eine Nummer wählte und sein Kommen wohl ankündigte. Vielleicht auch nicht. Die Tür öffnete sich. Er trat ein und drehte sich um. Kurz bevor sich der Fahrstuhl schloss, sah er, wie Kuno den Daumen seiner rechten Hand in die Höhe streckte.
Ob sich der Türsteher bei anderen Besuchern diskreter verhielt? Er wünschte es ihm, denn nicht alle hatten es gern, wenn Leute der unteren Schichten sich als Freunde aufspielten. Für Stefan Seegartner war dies in Ordnung. Kuno war kein Freund. Auch kein Kumpel, mit dem man ein Bier trinken würde. Aber doch jemand, den er gut mochte. Wenn er es sich allerdings recht überlegte, musste er sich korrigieren. Ein Bier würde er mit ihm trinken, denn er stellte keine Fragen. Keine unnötigen Fragen.
Wie Barbara war er jemand, der ihn nicht danach fragte, wie es dazu gekommen war, dass er nicht mehr sprach. Er hasste diese Frage. Er hasste überhaupt die Gespräche, die sich um sein Sprechen drehten. Er konnte zuhören und nicken und den Kopf schütteln. Wenn das den Leuten um ihn herum nicht genügte, konnten sie noch andere Formen der Konversation anwenden. Aber dazu waren sie nicht geschaffen. Oder es fehlte ihnen der Wille, es wenigstens zu versuchen. Barbara vermochte dies und hatte auch den Willen. Deshalb hatte er vorhin keine Sekunde gezögert, einen aufrechten Daumen zu senden. Kein Herz. Er wusste, dass sie das hasste. Und es wäre auch unpassend, denn sie waren nicht zusammen.
Nicht so, wie andere zusammen waren.
Wenn sie zusammen waren, geschah dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Für ihn war das mehr als in Ordnung, denn er brauchte keine Öffentlichkeit. Er brauchte niemanden. Aber die Textnachrichten Barbaras liebte er. Manchmal sendete sie ihm auch eine Sprachnachricht. Wenn er sich dann in ein Taxi setzte, kam es vor, dass er sich diese wieder und wieder anhörte. Ihre Stimme war für ihn ein Elixier wie für andere der Schlussakkord eines Requiems oder das Kosten eines teuren Weines.
Es war Babaras Stimme gewesen, die ihn damals veranlasst hatte, sich nach ihr umzudrehen. Ihre Stimme und ihr Lachen. Es war in der Galerie, in welcher auch einige seiner Bilder ausgestellt waren. Nicht an jenem Abend, aber sonst. Er hörte diese warme Stimme und drehte sich instinktiv um. Rötliche Haare, beinahe kupferfarben. Locken und eine schneeweiße Haut.
Was ihm sofort auffiel, war, dass die Stimme kein Makeup in ihrem Gesicht hatte. Alles war rein. Er nahm sein Glas vom Mund und einen Augenblick glaubte er, dass sein Atem aussetzte. Die Frau drehte ihren Kopf zu ihm. Während sie weitersprach, trafen sich ihre Blicke und Stefan Seegartner realisierte, dass sie nur noch sprach, um die Geschichte fertig zu erzählen und die Zuhörer um sich herum nicht zu brüskieren.
Die Frau war Barbara. Aber das wusste er zu jenem Zeitpunkt noch nicht. Zwei Besucher stellten sich zwischen ihn und sie und er sah sie nicht mehr. Er konnte sie nur noch hören. Mit dieser Stimme, die nicht hoch und nicht tief war. Undefinierbar. Aber mit einer Wärme, die ihn erregte. Zutiefst erregte.
Die Stimme war doch irgendwie tief. Wie wenn sie aus dem tiefen Innern ihres Selbst kam und nicht direkt aus dem vordersten Teil der Kehle, begleitet vom nasalen Laut des Gesichts. Begleitet wurde der Stimmlaut von einem Hauch von Luft, der mitschwang. Nicht zu viel, dass man befürchten müsste, da litte jemand an Atemnot. Eine Stimme, die etwas versprach, ohne es in Worte zu fassen.
Die Stimme passte zum Äußeren. Rotblondes Haar, das zwischen den Zuhörenden hervorschaute. Nochmals ein kurzer Blick aus diesen grünblauen Augen, die ihn zu elektrisieren schienen. War es ein Klischee, dass rothaarige Frauen grüne Augen hatten? Eine Fantasie irgendwelcher Schreiberlinge? Etwas, das sich im kollektiven Bewusstsein festgesetzt hatte und nicht mehr zu demontieren war?
Für Stefan hatte das an jenem Abend keine Rolle gespielt. Für ihn waren es die verführerischsten Augen, die ihn je angeblickt hatten. Kurz. Dann wurden sie wieder verdeckt und später hatte er sie nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich war sie früher gegangen. Als er wenig später die Galerie verließ und draußen auf ein Taxi wartete, stand sie hinter ihm.
„Nimmst du mich mit?“
Er hatte genickt. Das Versprechen der Stimme manifestierte sich in Worten.
Natürlich nickte er, als er die Frage in seinem Ohr vernahm. Er musste nicht sprechen, nur nicken. Das genügte ihr. Und wenig später war er in ihrer Wohnung. Eine Wohnung wie ein Haus. Riesig und mit einem Badezimmer, das unzählige Spiegel besaß. Auch dies erregte ihn. Aber er spürte, dass sie die Spiegel noch viel lieber mochte als er. Nicht die Spiegel, aber das, was sie darin sah.
Es war ein guter Abschluss des Tages gewesen und später einigten sie sich darauf, auch andere Tage auf diese Weise abzuschließen. Stefan genoss es und Barbara schien es auch zu lieben, wenn sie dies auch nicht direkt aussprach. Sie sprach sowieso wenig. Aber auch das wies eine gewisse Logik auf. Wenn jemand des Sprechens nicht mächtig war, war auch das Gegenüber stiller. Zwangsläufig. Seit diesem Abend wartete er jeweils auf die Nachrichten von Barbara. Oder besser auf ihre Einladungen. Wie heute. Er wollte eigentlich an der Leinwand im Schlafzimmer weiterarbeiten. Aber die konnte warten.
Nur kurze Zeit nach Erhalt der Textnachricht trat er auf die Straße. Die Zeit, die er brauchte, ein Taxi zu rufen, die schwarzen Haare mit Gel nach hinten zu streichen und sich mit einem Hauch von Hugo Boss zu besprühen, den Mantel zu nehmen und die Wohnung hinter sich zuzusperren.
Und jetzt stand er im Lift wie schon so oft und dachte daran, wie er sie kennengelernt hatte. Er wusste allerdings nicht, ob dies das richtige Wort war, denn er kannte Barbara Robinson nicht wirklich. Er stellte keine Fragen und registrierte, dass sie dies auch nicht tat. Nur wenn sie miteinander im Bett lagen, sprach sie zu ihm. Erzählte ihm von ihrem Tag und ihren Begegnungen. Belanglosigkeiten, weil sie wusste, dass er ihre Stimme liebte und weil sie nichts über ihre Vergangenheit erzählen wollte. Ihre Vergangenheit war tot. Wie seine. Sie musste nicht erwähnt werden. Sie war schon zu lange totgeredet worden. Früher. Diese Zeit war vorbei.
Ist vorbei.
Die Türe des Liftes öffnete sich und er trat hinaus in einen kleinen Vorraum und klopfte an die Tür der Wohnung. Es dauerte nicht lange und sie öffnete sich. Barbara stand dahinter. Ihre Haarspitzen waren nass. Einige Strähnen klebten an ihrem rechten Schlüsselbein. Ein weißes Frottiertuch hatte sie sich um ihren schlanken Körper gewickelt. Ihr Gesicht hatte eine leicht rosa Färbung und ihr Mund umspielte die Andeutung eines Lächelns.
„Schön – du bist da. Komm rein.“
Diese Stimme war eine Offenbarung und Stefan war froh, dass er sich nicht hatte dazu hinreißen lassen, an seinem Bild weiterzuarbeiten. Er drückte sich an ihr vorbei und nahm den zarten Geruch von Kokos wahr. Er zog seinen Mantel aus und legte diesen über die Chaiselongue, die im Eingangsbereich stand. Dass diese so genannt wurde, wusste er, weil ihm dies Barbara erzählt hatte. Und auch, dass diese eine Erinnerung an früher war. Er fand sie schrecklich altmodisch, spürte aber, dass sie für Barbara von Bedeutung war. Und schließlich kam er nicht wegen Möbelstücken zu Besuch.
Im Bad brannte Licht und Stefan war sicher, dass Barbara ein Bad genommen hatte. Wahrscheinlich hatte sie auch Wein getrunken und war nun darauf aus, sich mit ihm zusammen zu betrinken. Im Bett.
„Ich bin gleich wieder bei dir.“ Sie stand an der Tür, wartete, dass er mit einem Nicken antwortete und verschwand im Schlafzimmer. Stefan setzte sich aufs Sofa und begann, sein schwarzes Hemd aufzuknöpfen. Er lächelte.
Dies würde ein guter Abschluss des Tages werden.
4Barbara Robinson
Am andern Morgen lag Barbara in ihrem großen Bett. Das seidene Laken umspielte ihren Körper und sie fühlte sich richtig gut. Sie hatte keinen Rausch gehabt und folglich jetzt auch keine Kopfschmerzen. Sie hörte Stefan in der Küche.
Kaffee.
Er würde ihr Kaffee ans Bett bringen. Das würde er tun. Sie war sicher. Er war im ähnlichen Alter und sie erinnerte sich noch gut, wie sie das überrascht hatte. Sie bevorzugte normalerweise wesentlich ältere Männer. Keine Jungen, die noch nicht wussten, was sie wollten. Stefan war nur wenig älter und trotzdem strahlte er etwas aus, das ihm eine Aura von Weisheit und Beständigkeit verlieh. Konnte man das so sagen? Sie fühlte sich bei ihm geborgen und in einer Art und Weise umsorgt, die sie nicht einengte. Ihr nicht den Atem zum Leben nahm. Keine Verpflichtungen. Keine gemeinsamen Zukunftspläne. Und trotzdem ein Gefühl der Sicherheit, dass es so, wie es ist, richtig ist. Sie waren nicht zusammen. Trotzdem war sie davon überzeugt, dass das Zusammensein mit ihm besser war als bei vielen andern. Nicht immer reden. Einfach nur zusammen sein. Still. Die Ruhe des Tages genießen. Keine Vergangenheit. Keine Pläne für die Zukunft. Sie hatte ihn nie gefragt, weshalb er nicht sprach. Weshalb er nicht sprechen konnte. Das heißt, sie wusste nicht einmal mit Sicherheit, dass er die Fähigkeit des Sprechens nicht beherrschte. Ob er ein Stummer war? Gab es überhaupt Stumme, die ohne Schwierigkeiten hören konnten? Tatsache war, dass Stefan nicht sprach. Weshalb auch immer.
Ihr war es recht, denn wenn er nicht sprach, stellte er auch keine Fragen. Sie hasste es, ausgefragt zu werden. Hasste es wie die Pest. Und so war es nur fair, dass sie auch ihn nicht ausfragte. Aber sie wusste, dass er es liebte, wenn sie sprach. Wenn sie ihm ins Ohr flüsterte, was sie mit ihm alles machen wollte oder auch Belanglosigkeiten über ihre Woche und was sie alles erledigt hatte. Manchmal reihte sie auch einfach unterschiedliche Wörter aneinander, die keinen Sinn ergaben. Das gefiel ihm. Das erregte ihn. Und das erregte auch sie. Sie waren wirklich ein perfektes Gespann.
Sie hörte die Kaffeemaschine. Also hatte sie sich nicht getäuscht. Wer war der schlanke, groß gewachsene, dunkelhaarige Mann in ihrer Küche? Wer war er wirklich? Manchmal war sie sehr neugierig und versucht, in seiner Tasche herumzuwühlen, die er manchmal bei sich hatte. Tat sie aber nie. Sie hätte damit eine Grenze überschritten und womöglich eine Wunde aufgerissen, die sie nur mit ihrer Stimme nicht wieder hätte schließen können. Aber von Zeit zu Zeit fragte sie sich ernsthaft, woher er kam. Was ihn umtrieb und ob sie seine einzige Bettpartnerin war oder ob er noch andere hatte. Auch seine Bilder ließen nichts erkennen, das Rückschlüsse auf seine Vergangenheit oder sein Wesen erlaubte. Sie gefielen ihr, gefielen ihr wirklich und vielleicht würde sie eines für ihr neues Büro erwerben. Das neuste, von dem er ihr schon lange geschrieben und das sie noch nie gesehen hatte. Es sei nur in einer Farbe gemalt. Ihrer Lieblingsfarbe, die gar keine Farbe war. Das hatte er ihr verraten. Mit Stift und Schreibblock. Wenige Sätze. Mehr nicht.
Dieses Bild. Ein Bild für sie. Ein Bild in Weiß. Vielleicht würde sie es zu Gesicht bekommen und dann kaufen.
Stefan trat ins Schlafzimmer. Er hatte sich seine Boxershorts angezogen. In der Hand trug er ein Servierbrett mit Kaffee, Scheiben von Toastbrot und Wasser. Barbara setzte sich auf und er legte das Brett in ihre Hände. Während sie es festhielt, schlüpfte er unter die Decke. Er lächelte, setzte sich gerade, nahm das Wasser und setzte das Glas an ihre Lippen.
Einen Moment lang verwischte das Glas ihren Blick auf Stefans Augen. Sie sah, dass er lächelte. Matt hinter dem Glas zu erkennen. Wie in einem Nebel war ihr Blickfeld für den Bruchteil einer Sekunde eingeschränkt. Es durchzuckte sie und beinahe glaubte sie, sich übergeben zu müssen. Sie schüttelte sich leicht und Stefan schaute sie fragend an.
„Es tut mir leid“, sagte sie und stellte das Brett ans Fußende. Sie schlug die Decke zurück, stand auf und verschränkte ihre Arme vor ihren Brüsten. „Für mich ist es gut, wenn du jetzt gehst. Bitte.“
Stefan hob die beiden Hände mit den Handflächen nach oben, wie um die Frage nach dem Warum anzudeuten. Er schüttelte den Kopf. Verstand nicht.
„Bitte, geh.“
Er stieg aus dem Bett, nahm seine beige Chino und zog sich an. Während er die Knöpfe seines Hemdes schloss, blieb Barbara Robinson regungslos stehen und schaute ihm zu. Wieso dauerte es bloß so lange, bis er sich angezogen hatte? Weshalb brauchte es so viel Zeit, bis sie wieder allein in ihrer Wohnung war? Nur kein Kuss. Bitte. Inständig hoffte sie, dass er einfach verschwand. Ohne sich umzublicken mit wer weiß was für Fragen im Blick. Wie angewurzelt blieb sie neben ihrem Bett stehen, nahm den Geruch des Kaffees wahr, der aus den beiden Tassen dampfte und auch jenen des Toastes. Stefan band seine Schuhe und trat auf sie zu. Sie wich unmerklich zurück.
„Bitte, geh einfach.“
Sie sah, wie er das Schlafzimmer verließ und dankte ihm, dass er sich nicht umdrehte. Sie hörte, wie er den Mantel nahm, seine Schlüssel und einen kurzen Augenblick später das leise Klicken der Tür, die sich hinter ihm schloss, nachdem es einen Moment leise gewesen war. So, als ob er überlegen würde, zurück ins Schlafzimmer zu kommen. Oder auch nur verwundert die Tür vor sich anblickte.
Dann war es still in der Wohnung. Vollkommen still. Langsam ließ Barbara ihre Arme hängen und setzte sich neben dem Tablett aufs Bett. Ohne hinzusehen, nahm sie sich eine Tasse, hielt sich diese an die Lippen und trank einen Schluck. Koffein. Das war es jetzt, was sie brauchte.
Denn sie hatte keine Ahnung, was geschehen war. Sie hatte nicht den Hauch eines Schimmers, was in sie gefahren war oder was ihr Verhalten ausgelöst hatte. Ein Verhalten, das sie so von sich nicht kannte und auch nicht entschuldbar war. Sie würde Stefan eine Textnachricht schicken müssen, denn der arme Kerl hatte wohl genauso wenig eine Ahnung, was in sie gefahren war, wie sie selbst. Vielleicht würde sie ihm eine Sprachnachricht schicken, denn das liebte er, das wusste sie. Aber jetzt noch nicht. Jetzt war sie noch nicht so weit. Jetzt würden es zusammenhangslose Phrasen sein, die sie sprach. Auch wenn ihm dies ebenfalls gefiel, einfach ihrer Stimme wegen. Heute hatte er etwas anderes verdient. Einen Zusammenhang. Eine Verbindung. Eine Logik. Etwas, das er einordnen konnte oder ihm zumindest dabei half.
Barbara Robinson brauchte Zeit, diese zu finden. Sie stellte den Kaffee aufs Tablett und trat ins Badezimmer. Sie blickte ins Spiegelbild und sah, dass sie Tränen in den Augen hatte. Etwas, das ihr seit vielen Jahren nicht mehr geschehen war. Sie löschte das Licht. Es machte ihr keine Freude, sich zu sehen. Nicht so. Nicht heute. Sie öffnete die Tür zur Terrasse und ging nach draußen. Sie lief die wenigen Meter bis zum Geländer. Von unten hörte sie den Verkehr. Sehen konnte sie ihn nicht. Nebel hing wie ein Schleier in der Luft. Machte die Farben farblos, verwischte die Konturen der Gebäude. Es regnete nicht mehr. Grau war alles, verschwommen. Wie der Blick durch das Wasserglas. Wieder durchzuckte sie ein Blitz durch den Körper.
Was passierte mit ihr?
Wurde sie verrückt?
Litt sie an einer Krankheit?
Wie niedrig das Geländer war. Für eine Terrasse in dieser Höhe. Unglaublich, wie die Bauleute hier nicht überlegt hatten. Oder zu viel. Auch das Geländer war grau, verschwommen vom Nebel, der, so schien es, auch durch die Terrassentür hinter ihr in die Wohnung kroch. Zäh und bläulich-weiß. Sie spürte das Metall des Geländers an ihrem nackten Unterschenkel. Kalt und nass. Sie drückte ihre Beine gegen das Geländer. Spürte das Metall. Und es tat ihr gut. Beinahe wünschte sie sich die Kühle auch auf ihrer Stirn.
Ihr Kopf pochte. Schmerzen.
Hatte sie doch zu viel Wein getrunken?
Wie niedrig das Geländer war!
Sie müsste sich nur leicht nach vorne kippen und dann würde sie die Straße von nahe sehen. Aber dann würde sie keine Flugzeuge mehr hören, die vielleicht bald über ihrer Terrasse hinwegflogen. Weg. An Orte, in denen es keinen Nebel gab. Kein Grau. Nichts, das verschwommen war.
Fliegen.
Einfach wegfliegen.
Nicht mehr denken. Nicht mehr fragen. Nicht mehr antworten.
Sie schloss die Augen, beugte sich leicht über das Geländer. Sie spürte das Metall. Immer noch nass, aber nicht mehr so kalt. Sie hatte sich daran gewöhnt. Man kann sich an Kälte gewöhnen. Auch an Nässe. Aber nicht ans Nichtwissen. Sie hob ihre Arme in die Höhe. Spürte die Feuchtigkeit des Nebels auf ihrem nackten Körper, beugte sich weiter nach vorne, spürte die Stange, wie sie in ihre Knie drückte. Öffnete die Augen. Alles grau. Alles war immer noch grau. Grau und verschwommen. Draußen und auch in ihrem Kopf. Es wurde nicht besser.
Weg war alles. Der Gedanke an ihr neues Büro. An Stefan. An die acht Spiegel wenige Meter hinter ihr. Einfach weg. Nur fliegen. Der Druck der Metallstange tat beinahe weh.
Da klingelte ihr Smartphone. Der Standardton. Sie hatte nichts an den Grundeinstellungen verändert. Wozu auch. Sie senkte die Arme, öffnete die Augen und trat ins Innere der Wohnung. Sie spürte, wie ruhig sie atmete. Wie in Trance ging sie zum Bett und setzte sich. Sie nahm das Gerät vom Nachttisch und blickte es an.
Alisha rief sie an.
Alisha rief sie an und verhinderte damit, dass sie hätte wegfliegen können. Sie strich über das Display.
„Hallo?“
5Suzy Chang
„Und seit wann haben Sie diese Träume?“
Der junge Mann saß vornüber gebeugt auf einem Stuhl, den Blick auf seine Hände gerichtet, die gefaltet auf seinem Schoß lagen. Beinahe regungslos hatte er in den letzten Minuten erzählt, was ihn am Schlafen hinderte. Dass es die Angst vor den Träumen war, die seinen Schlaf beeinflusste, war für Doktor Chang neu. Die Ärztin saß dem Mann gegenüber und beobachtete, wie er auf ihre Frage reagierte. Aber da war nichts.
„Wollen Sie mir von den Träumen erzählen?“
Keine Reaktion.
Unauffällig blickte Doktor Chang auf die Uhr hinter ihrem Patienten. Sie würde schweigen und keine weitere Frage mehr stellen. Es war seine Zeit, nicht ihre. Und wenn es ihm nicht ums Sprechen war, würden sie schweigen. Sie hatte schon oft erlebt, dass die Stille etwas auslösen konnte. Manchmal kam es vor, dass erst mit der Ruhe ein Durchbruch erzielt wurde.
Entgegen allen Studien, die besagten, mit den richtigen Fragen den Patienten an das Ende des Tunnels zu führen. Schweigen war in der Tat manchmal wertvoller als alles zu zerreden. Wie hatte schon Hemingway gesagt:
,Man braucht zwei Jahre, um sprechen zu lernen und fünfzig, um schweigen zu lernen.‘
Sie blickte aus dem Fenster und lächelte. Unmerklich, damit ihr Gegenüber nicht das Gefühl bekam, sie würde über ihn lachen.
Doktor Chang war es nie schwergefallen, nicht zu sprechen. Sie musste es nicht extra lernen. Sie stellte schon früh fest, dass es den Menschen im Allgemeinen schwerfiel, die Stille zu ertragen. Sie selbst brauchte keine fünfzig Jahre, um das Schweigen zu lernen. Sie beherrschte diese Kunst.
Hemingway und seine Geschichten, die sie schon als junge Frau verschlungen hatte – sie liebte sie. Hatte sie immer schon geliebt. Mit ihnen tauchte sie in andere Welten. Oft war Afrika der Schauplatz. In Afrika war sie noch nie, hatte eine Reise dorthin aber auf ihrer Liste. Irgendwann würde sie diesen Kontinent besuchen und mit eigenen Augen den Schnee auf dem Kilimandscharo sehen. Wer weiß? Vielleicht würde es sogar möglich sein, diesen imposanten Berg mit den ewigweißen Spitzen auf ihren eigenen Füßen zu erklimmen.
„Wieso lachen Sie? Lachen Sie über mich?“
Doktor Chang erschrak und schalt sich sofort ihrer mangelnden Professionalität. Sie brauchte Ferien. Dringend. Sie war sicher gewesen, dass sie nur in ihren Gedanken gelächelt hatte.
„Entschuldigen Sie, Herr Meyer. Wirklich. Es tut mir leid. Mein Schmunzeln galt nicht Ihnen.“
„Ach ja?“
Harald Meyer hatte die Hände geöffnet und auf seine Oberschenkel gelegt. Er rieb sie an seinen Hosen, wie wenn er sie trocknen müsste. Sein Blick war feindselig, wie auch seine Stimme.
„Möchten Sie mir jetzt etwas über Ihre Träume erzählen? Sie haben noch zehn Minuten.“
Er blickte sie mit seinen dunkelbraunen Augen an. Beinahe schwarz schienen sie. In ihnen waren die Pupillen fast nicht auszumachen. Dazu hätte sie ihm sehr nahekommen müssen. Aber dies wäre ebenfalls nicht professionell.
„Sagen Sie mir zuerst, worüber Sie gelacht haben, Doktor.“ Herausfordernd blickte er ihr direkt in die Augen.
Doktor Chang atmete hörbar ein. „Wissen Sie, es geht hier nicht um mich. Es ist Ihre Zeit. Es ist Ihr Leben, das Sie wieder in ruhigere Bahnen bringen wollen, nicht wahr, Herr Meyer? Und deshalb muss ich wissen, was Sie träumen. Wollen Sie mir davon erzählen?“
„Was? Was war so lustig?“ Meyers Blick blieb unverändert auf sie gerichtet. Suzy Chang hielt ihm stand. Auch das machte ihr keine Mühe. Wie das Schweigen.
Sie erinnerte sich, wie sie früher mit ihrer kleinen Schwester gespielt hatte. Sie blickten sich unverwandt in die Augen, abwartend, dass jemand aufgab und den Blick abwenden musste. Sie hatte meistens gewonnen und das lag nicht am großen Altersunterschied. Sie schaffte es auch mit ihrer Mutter und auch später mit ihren Freundinnen auf der Universität in Tianjin. Und noch später hier in dieser Stadt inmitten von Europa schaffte sie es stets, ihre Kollegen dazu zu bringen, ihren Blick zuerst abzuwenden.
Ja, das konnte sie.
Auch jetzt. Meyer strich seine Hände erneut über seine Oberschenkel, erhob sich, nahm seine Jacke, die er eine gute Stunde zuvor über den Stuhl gelegt hatte und drehte sich zur Tür.
„Dann lassen Sie’s.“
Doktor Chang spürte etwas, das sie im vergangenen halben Jahr bei diesem Patienten noch nie festgestellt hatte.
Emotion.
Harald Meyer war wütend. Richtig wütend. Sie musste erneut lächeln. Jetzt war sie aber sicher, dass er nichts davon mitbekam. Erstens hielt sie ihre Gesichtsmuskulatur entspannt und neutral und zweitens hatte er ihr den Rücken zugedreht und machte sich daran, den Raum zu verlassen.
„Herr Meyer. Sie sind wütend. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das ist ein Durchbruch.“
Er drehte sich zu ihr um. Aber da war keine Wut in seinem Gesicht zu erkennen. Kein Zorn. Suzy Chang sah vor sich einen verletzten, traurigen, jungen Mann, dessen blonde Haare beinahe nicht zum dunklen Blick passen wollten.
„Kommen Sie, Herr Meyer. Setzen Sie sich nochmals hin. Wir haben noch Zeit.“
Er schüttelte den Kopf. „Sie verstehen nicht, was? Überhaupt nichts.“
Doktor Chang erhob sich. „Aber …“
Und dann war Harald Meyer draußen. Suzy Chang senkte den Kopf. Das hatte sie nun gründlich an die Wand gefahren. Sie brauchte wirklich Ferien. Sie trat ans Fenster und blickte zur Straße runter. Es regnete. Wie schon die letzten Tage. War der September früher nicht ein trockener Monat gewesen? Sie wusste es nicht. Zuhause in China war es früher sonnig gewesen im September. Viel blauer Himmel und wenig Wolken. Meist gar keine. Der September war ein guter Monat gewesen, früher.
Wenigstens, was das Wetter betraf.
Als sie herausgefunden hatte, dass man politische Gefangene absichtlich falsch diagnostizierte und sie in psychiatrischen Krankenhäusern behandelte, obwohl sie geistig und körperlich gesund waren, setzte sich in ihr der Gedanke frei, ihre Heimat zu verlassen. Sie war zum Glück nie in einem Ankang, wie eine solche Klinik genannt wurde und von denen es offiziell über zwanzig gab. Die Behandlungen dort verdienten keinen medizinischen Fachausdruck, wenn die Leitung auch solche verwendete. Aber für Suzy Chang war schon in jungen Jahren klar, dass Elektroschocks, chemische Zwangsjacken, Insulinschocks und „Behandlung“ mit glühendem Eisen nur eines waren: grausame Folter. Nicht mehr und nicht weniger. Und sie kam jenen zuteil, die Kritik an den staatlichen Autoritäten übten oder überzeugte Anhänger einer Religion waren.
Ankang.
Suzy Chang schob die Gardine zur Seite und beobachtete, wie Harald Meyer zwei Stockwerke weiter unten das Gebäude verließ, den Kragen seiner Jacke hochschlug und trotz des Regens nur langsam über die Straße ging.
Ankang bedeutete in ihrer Sprache so etwa ‚Frieden und Gesundheit für Geisteskranke‘. Die Kliniken unterstanden der Sicherheitsbehörde und man musste aufpassen, was man sagte, um nicht von diesen in einen solchen Ankang gesteckt zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, diesen wieder verlassen zu können, war ziemlich klein.
Suzy Chang atmete tief ein. Es war gut, dass sie in dieses Land gekommen war. In diese Stadt. Mit der sauberen Luft. Alles war geordnet und klar und es gab keine Elektroschocks. Sie schüttelte den Kopf.
Hier gab es nur unfähige, ferienreife Psychiaterinnen. War sie mit ihren fünfundvierzig Jahren zu alt für diesen Beruf? Sie brauchte sich selbst diese Frage nicht zu beantworten. Dass sie es vermasselt hatte, lag nicht an ihrem Alter und auch nicht an ihrer Ausbildung. Es lag einfach und allein daran, dass sie bei sich war an Stelle des Ortes, an dem sich ihr Patient befand. Das war höchst unprofessionell und sie könnte sich dafür ohrfeigen.
Als Harald Meyer auf der anderen Straßenseite angekommen war, drehte er sich um und blickte hoch. Hoch zu ihr. Instinktiv ließ sie die Gardine zurückfallen. Sie war jedoch sicher, dass er sie gesehen hatte. Kurz. Aber doch lange genug, um mitbekommen zu haben, dass sie ihn beobachtet hatte.
Er blickte hoch zu ihr und trotz der Entfernung konnte sie durch den Vorhang seinen Blick sehen. Enttäuschung und Traurigkeit. Der Regen machte ihn klitschnass. Das schien ihn nicht zu kümmern. Es verstärkte den Eindruck, den sie von ihm gehabt hatte, kurz bevor er ihre Praxis verließ.
Harald Meyer war zutiefst verletzt.
Sie sah, wie er den Kopf leicht schüttelte und sich Richtung Hauptbahnhof in Bewegung setzte. Sie wusste, dass er am anderen Ende der Stadt wohnte. Ohne Mitbewohner. Kannte die Adresse, weil ihre Patienten diese angeben mussten, wenn sie das erste Mal zu ihr kamen. Leicht schob sie den Vorhang zur Seite und sah ihn im Meer von Menschen, Autos, Fahrrädern und Regenschirmen verschwinden.
Dann sah sie ihn nicht mehr.
Sie blickte auf ihre Uhr. Es war fünf Uhr nachmittags und sie hatte keine weiteren Patienten mehr. Gott sei Dank. Sie würde schließen, nach Hause gehen und einen Tee zubereiten. Grüntee. Ungesüßt. So liebte sie ihn. Sogar das Teetrinken war in China in gewissen Zeiten verpönt und sogar verboten gewesen und viele Teehäuser mussten geschlossen werden. Es war einfach nur gut, dass sie ihre Heimat verlassen hatte.
Sie würde heute Abend nach Hause gehen, nach alter Tradition einen Tee zubereiten und sich ein Bad einlaufen lassen. Ja, das würde sie tun.
Als sie kurze Zeit später ihre Praxis verließ, waren es zwei Gedanken, die sie beschäftigten. Weshalb fühlte sie sich schuldig, wenn sie an ihren letzten Patienten dachte und weshalb war sie mit ihren fünfundvierzig Jahren immer noch gezwungen, ihren Tee allein trinken zu müssen?
Er ist sicher, dass er richtig gehandelt hat.
Er ist davon überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Er hat die absolute Gewissheit, das einzig Richtige getan zu haben. Gleichzeitig weiß er aber auch, dass er wohl der einzige Mensch auf diesem Planeten ist, der sich diese Sicherheit zuschreibt.
Zuschreiben kann.
Zuschreiben darf.
Er weiß haargenau, dass andere sein Handeln aus einer völlig anderen Perspektive betrachten würden, wenn sie davon erführen. Sie würden es anders anschauen und nicht verstehen, was er getan hat. Aus innerer Überzeugung hat tun müssen.
Immer schon.
Schon damals, als er noch keinen Rasierapparat brauchte.
Heute braucht er ihn nur, wenn er sich dazu entscheidet, ohne Bart durch die Straßen zu ziehen. Oft lässt er ihn aber auch einfach wachsen. Oder klebt sich einen an, wenn es schnell gehen muss.
Er liebt es, verschiedene Gesichter zu haben und ist davon überzeugt, dass diese mithelfen, dass er bis jetzt der einzige Mensch ist, der von seinem Handeln Kenntnis hat.
Also er und die Kinder.
Die anderen Menschen haben eine komplett andere Wahrnehmung als er. Hatten sie schon immer. Das weiß er.
Seine ist um ein Vielfaches differenzierter, klarer.
Seine lässt das Dunkel des Tages erhellen.
Sie ist es, die ihn erst atmen lässt und ihm die Gewissheit seiner Existenzberechtigung schenkt.
Die, weiß Gott, nicht alle für sich in Anspruch nehmen dürfen. Die muss man sich verdienen und er hat sie sich verdient.
Weiß Gott, die hat er sich wahrhaftig verdient.
6Daniel Klipper
Auf dem Weg nach draußen nahm Daniel Klipper das Treppenhaus. Er nahm immer das Treppenhaus, nie den Fahrstuhl. Egal, wo er rauf oder runter musste, er entschied sich immer für die Treppe. Das lag nicht daran, dass er Angst hatte, dass die Stahlseile reißen könnten oder der Fahrstuhl durch ein Erdbeben die Leute schneller nach unten brachte, als diesen lieb war. Sein Entscheid gegen das Gefährt der verweichlichten Moderne hatte auch nichts damit zu tun, dass das Treppensteigen verhinderte, mehr Bauchumfang zu erhalten. Auch wenn dies ein guter Nebenaspekt war. Ein sehr guter Nebenaspekt. Er musste sich darüber jedoch keine Gedanken machen. Im Gegenteil. Er war schlank und trainiert und wusste, dass es sich auszahlt, regelmäßig zu laufen. Und eben auch die Treppe zu benutzen. Er hatte keine Angst vor Unglücken im Fahrstuhl oder Übergewicht.
Und trotzdem war da diese Angst.
Aber nicht davor.
Der Grund, dass er den Fahrstuhl nicht benutzte, lag einzig und allein daran, dass ihn in engen Räumen das Gefühl überkam zu ersticken. Enge und kleine Räume machten Daniel Klipper Angst.
Angst, die ihm in solchen Momenten beinahe verunmöglichte, den Sauerstoff aus der Luft zu nehmen und diesen seinen Lungen zuzuführen.
Er nahm die letzten beiden Stufen mit einem Satz, obwohl das überhaupt nicht zu seiner Stimmung passte. Er wusste auch nicht, weshalb er es tat. Wollte er das Polizeigebäude möglichst rasch verlassen? Allen beweisen, dass er guten Mutes war? Er ging durch die Halle und verlangsamte seinen Schritt, damit sich die automatische Drehtür in Bewegung setzte und er nach draußen gelangen konnte.
Er war enttäuscht.
Enttäuscht und auch ein wenig wütend. Obwohl er sich das Gefühl von Wut eigentlich nicht eingestehen wollte. Wut war für ihn ein Zeichen der Schwäche und des Versagens. Aber dass sie ihm nicht helfen konnten, enttäuschte ihn zutiefst. Und wenn er ganz ehrlich zu sich selbst war, dann musste er letztendlich zugeben, dass er zornig war. Er lächelte bitter. Zorn war aus seiner Sicht noch stärker als Wut. Sich einzugestehen, dass bei ihm der Übergang fließend gewesen war, machte ihm allerdings Mühe.
Aber so war es. Punkt.
Er hatte die richtigen Fragen gestellt. Alles so geschildert, wie er es in Erinnerung hatte und sie antworteten mit einem Lächeln, das ihm zeigte, dass sie überhaupt nicht verstanden, wovon er eigentlich sprach. Er wollte nicht mit einem Psychomenschen reden. Er wollte auch nicht eine Auszeit in einer Klinik. Er war nicht überarbeitet. Er fühlte sich überhaupt nicht überlastet. Er brauchte keine Ruhe, kein Yoga und mit Sicherheit auch nicht ein wenig Zeit für sich selbst.
Er wollte einzig und allein, dass ihn jemand anhörte und ernst nahm, wie unglaublich auch war, was er zu erzählen hatte. Obwohl er sich bewusst war, dass es gar nicht so viel war, das er erzählen konnte, weil er vieles nicht wusste und noch mehr nur aus Interpretationen und Erinnerungsfetzen aus der Vergangenheit bestand. Aber er war sicher gewesen, dass ihm die Polizisten wenigstens würden helfen können. Dass sie wissen würden, an wen er sich wenden sollte. Ja, davon war er überzeugt gewesen und nun bitter enttäuscht worden.
Was er ihnen erzählte, musste sich in ihren Ohren in Tat und Wahrheit wirklich wie die Geschichte eines Verrückten angehört haben. Er wusste, dass es unglaublich war, nicht vorstellbar. Wenigstens dann nicht, wenn man dem Mainstream folgen wollte. Seine Geschichte hatte jedoch nichts mit dem Mainstream zu tun.
Schon lange nicht mehr.
Er ging die Straße entlang und hatte keine Ahnung, was er mit dem Rest des Tages noch anfangen sollte. Es war warm und trotzdem konnte man nicht sicher sein, wann der Regen erneut einsetzen würde. Es war ein nasser Monat. Kein goldener Herbst. Kein September, wie er ihn von den letzten Jahren kannte. Vielleicht würde er als einer der niederschlagsreichsten September in die Geschichte eingehen. Wer konnte das wissen? Ihm war es egal. Wirklich egal.
Er wollte einzig und allein eine Lösung für sein Problem. Sein Problem, das zu formulieren ihm so unglaublich schwerfiel, weil er es nicht wirklich benennen konnte. Den Weg zurück zur Polizei konnte er sich sparen. Der Freund und Helfer hatte sich als das genaue Gegenteil entpuppt. Hätte er ihnen noch mehr Einzelheiten erzählt, hätten sie ihn mit Sicherheit weggebracht. An einen Ort, an welchem er zur Ruhe kommen sollte. In eine Institution, die ihm dabei helfen sollte, herunterzufahren. Die Batterien neu aufzuladen.
Er lächelte, obwohl ihn dies überhaupt nicht belustigte. Er war überzeugt, dass er das Gebäude nicht selbständig hätte verlassen können, wenn ihn seine Wut nicht dazu gebracht hätte, innezuhalten und den beiden Männern in Uniform zu versprechen, er würde zuhause seine Gedanken nochmals ordnen und wieder vorbeikommen. Bei jedem anderen hätte die Wut wohl einen Ausbruch hervorgerufen, der direkt in die Zwangsjacke geführt hätte. Er schien innerlich zu explodieren und spielte gegen außen das komplette Gegenteil. Ruhig und besonnen hatte er gewirkt. Gewillt, alles nochmals zu überdenken. Und dass er sich vielleicht in vielem geirrt hatte. Das Täuschungsmanöver hatte funktioniert. Das Spiel war ihm geglückt. Interessanterweise hatten sie seine Personalien nicht aufgenommen. Wussten sie von Anfang an, dass er bei ihnen an der falschen Adresse war?
So oder so: Zur Polizei konnte er nicht mehr gehen. Das konnte er abhaken. Zum jetzigen Zeitpunkt hatte er keine Ahnung, an wen er sich wenden sollte. Wenden konnte. Sie hatten recht, als sie sagten, er brauche Hilfe. Deshalb war er ja zu ihnen gekommen. Ihre Vorstellung dieser Hilfe entsprach jedoch überhaupt nicht seiner eigenen.
Er wusste, dass er Hilfe brauchte. Er wusste es, seit er das erste Mal einzelne Fragmente seiner Träume zusammensetzen konnte. Eigentlich waren es keine Träume. Vielmehr waren es Bilder, die jäh aufleuchteten. Blitzen gleich. Kurz und grell und sehr oft nicht erkennbar. Natürlich brauchte er Hilfe und es war ja nicht so, dass er bis jetzt keine in Anspruch genommen hatte. Im Gegenteil.
Aber das reichte nicht. Das reichte überhaupt nicht.
Das erste Mal, als Hanna dabei gewesen war, als diese grell aufleuchtenden Bilder einmal mehr auftauchten, lag etwa drei Monate zurück. Normalerweise übermannten ihn diese Bilder in dunklen Straßen, in Zimmern, in denen kein Licht brannte oder eben in engen Fahrstühlen.
Er war mit ihr im Verkehrshaus in Luzern, einem riesigen Museum auf einem riesigen Gelände mit mehreren Gebäuden und vielen Attraktionen auch unter freiem Himmel. Die ältesten und neusten Verkehrsmittel wurden ausgestellt. Von der Dampflokomotive bis zum Raumfahrzeug war alles zu sehen und Hanna hatte sich einen Besuch dieses Museums gewünscht.
„Es wird doch Zeit, dass wir mal etwas unternehmen. Findest du nicht? Du hast mir doch mal erzählt, dass du schon mal da gewesen bist.“ Hanna hängte sich bei ihm ein, während sie an der Seepromenade entlang spazierten.
Er war wirklich schon mal da gewesen. Er hatte ihr auch erzählt, dass er keine Erinnerung daran hatte, wann das gewesen war oder mit wem. Seine Pflegeltern waren nicht dabei gewesen, das wusste er. Sie hatte er gefragt. Er wusste nur, dass er schon da gewesen war und er wusste auch, dass sich Hanna freuen würde, dorthin zu gehen.
Natürlich sagte er ja und am nächsten Tag fuhren sie hin. Daniel freute sich darüber zu sehen, wie Hanna es genoss, die unterschiedlichsten Oldtimer per Wunsch und mit Knopfdruck auf eine Plattform schieben zu lassen und etwas über die Geschichte des Gefährts zu hören. Er sah die lange Reihe von Fahrzeugen, die alle an die Wand gehängt worden waren. Auf einzelnen Bühnen, die gedreht werden können, damit man sie von allen Seiten betrachten konnte. Daniel war mehr an der Mechanik interessiert, wie die bestellten Fahrzeuge in ihre Nähe gebracht wurden, als an den Informationen über die jeweilige Geschichte des herangefahrenen Oldtimers. Irgendwann musste ein Mensch diesen Parkierroboter programmiert haben. Unglaublich eindrucksvoll.
Daniel drehte sich leicht und sah hinter sich eine junge Familie vorbeigehen. Der Mann sichtlich interessierter an den Dingen, die sich an der Wand befanden, als die Frau. Ein Mädchen hielt eine Puppe in der Hand und unwillkürlich musste Daniel an die Klischees dieser Welt denken.
Hanna drückte erneut auf den Signalknopf. Sie wählte eine Postkutsche. Gebannt lauschte sie den Ausführungen, die aus einem Lautsprecher zu hören war.
Noch jemand schien zuzuhören. Weiter hinten stand ein Mann, der ihm auffiel, weil er mehr zu Hanna schaute als auf die Ausstellungsstücke an der Wand oder auf die gelbschwarze Kutsche.
Er war Mitte vierzig, trug eine Jeans, ein rotblau-kariertes Holzfällerhemd, das er nicht in die Hose geschoben hatte und einen ungepflegt wirkenden Bart. Die Brille, die ihm immer wieder von der Nase rutschte, schob er sie sich mehrere Male zurecht und auch wenn Daniel nicht starren wollte, lag seine Konzentration nun doch nicht mehr nur bei den Fahrzeugen hinter sich. Niemand sollte seine Hanna anstarren. Was wollte der Kerl?
Und dann war da noch etwas. Irgendetwas ließ ihn leicht erschauern. Der Mann erinnerte ihn an jemanden.
Oder an etwas.
Daniel konnte es nicht genau ausdrücken. Er spürte, wie sein Atem flacher wurde und undefinierbare Bilder vor seinem inneren Auge auftauchten. Bilder, die mehr aus Farbflächen bestanden, denn aus wirklichen Figuren. Die Art, wie sich der Mann die Brille auf die Nase schob – das hatte er schon mal gesehen. Sein Magen wurde flau und beinahe glaubte er, aufstoßen zu müssen. Dieses Gefühl überkam ihn meist nur in geschlossenen und engen Räumen. Aber nicht, wenn er einen anderen Menschen im Blickfeld hatte.
Schaute der Typ wirklich zu Hanna? Oder vielmehr zu ihm? Daniel konnte es nicht sagen und war nicht sicher, ob er Hanna auf den Mann aufmerksam machen sollte.
Hanna hatte sich nun ein Motorrad heranbringen lassen. Ob das noch fahren konnte? Daniel trat näher zu Hanna, welche ihn lächelnd anblickte. Dann drehte er seinen Kopf wieder zu dem Mann. Aber der war nicht mehr da.
Eine Schulklasse ging vorbei und Daniel staunte, wie leise sie waren.
Am Ende des Tages wollte Hanna noch ins Schokoladenmuseum, welches ins Verkehrshaus integriert war. Und dort geschah es – nicht zum ersten Mal. Aber in einer Heftigkeit, die ihm beinahe den Atem raubte. Es überfielen ihn Bilder und Geräusche, die ihn beinahe zu lähmen drohten, auch wenn er sie nicht das erste Mal sah. Aber es war das erste Mal, dass jemand dabei war, den er kannte und er war froh und dankbar, dass es seine Freundin war, die vor ihm stand und ihn ruhig anblickte.
Die Besucher wurden in einen Raum geführt, der kein gewöhnlicher Raum war. Vielmehr war es ein Lift. Daniel registrierte dies und schätzte die Größe. Ein großer Lift. Es sollte gehen. Und es befanden sich viele Touristen darin. Trotzdem spürte er, wie mit jedem Stockwerk nach unten sein Atem schneller ging und er zu schwitzen begann. Hanna hatte seine Hand genommen und er zog sie nicht zurück. Er brauchte sie. Das wusste er zu jenem Zeitpunkt mehr denn je.