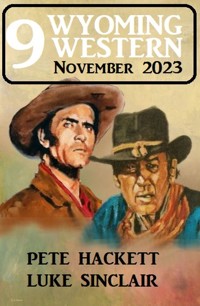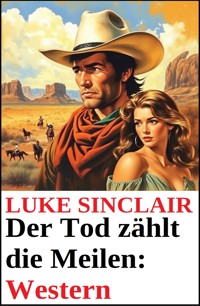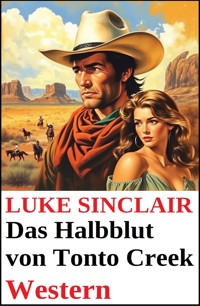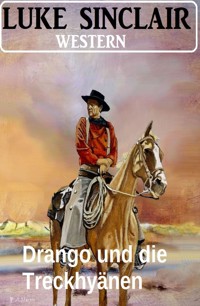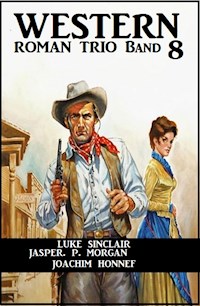
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Western Roman Trio Band 8 von Luke Sinclair, Joachim Honnef, Jasper P. Morgan Über diesen Band: Dieser Band enthält folgende Western: Joachim Honnef: Chavo und der Sklavenjäger Jasper P. Morgan: Showdown in der Rinderstadt Luke Sinclair: Ein Colt und tausend Feinde Der Saloon ist leer bis auf den Fremden, der allein an einem der Tische sitzt und eine kalte Atmosphäre von Tod verbreitet, die man fast körperlich spüren kann. Für Clay Shannon besteht kein Zweifel, dass es der Mann ist, dessen Gesicht er auf dem Steckbrief an der Wand des Sheriff's Office gesehen hat. Und Clay Shannon ist entschlossen, sich selbst und allen anderen etwas zu beweisen. Als er auf den Saloon zuschreitet, ahnt er nicht, dass er diesen Tag noch bitter bereuen wird, denn auf ihn wartet das triste Dasein eines Außenseiters, dessen einziger Freund der Colt ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Table of Contents
Titel
Copyright
Chaco und die Sklavenjäger
Showdown in der Rinderstadt
Ein Colt und tausend Feinde
Western Roman Trio Band 8
von Luke Sinclair, Joachim Honnef, Jasper P. Morgan
Über diesen Band:
Dieser Band enthält folgende Western:
Joachim Honnef: Chavo und der Sklavenjäger
Jasper P. Morgan: Showdown in der Rinderstadt
Luke Sinclair: Ein Colt und tausend Feinde
Der Saloon ist leer bis auf den Fremden, der allein an einem der Tische sitzt und eine kalte Atmosphäre von Tod verbreitet, die man fast körperlich spüren kann. Für Clay Shannon besteht kein Zweifel, dass es der Mann ist, dessen Gesicht er auf dem Steckbrief an der Wand des Sheriff’s Office gesehen hat. Und Clay Shannon ist entschlossen, sich selbst und allen anderen etwas zu beweisen. Als er auf den Saloon zuschreitet, ahnt er nicht, dass er diesen Tag noch bitter bereuen wird, denn auf ihn wartet das triste Dasein eines Außenseiters, dessen einziger Freund der Colt ist ...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER Firuz Askin
© dieser Ausgabe 2020 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Chaco und die Sklavenjäger
Chaco #49
Western von Joachim Honnef
Der Umfang dieses Buchs entspricht 125 Taschenbuchseiten.
Eigentlich soll Chaco eine reiche Familie aus dem Osten begleiten, die auf ihrer Urlaubsreise „Abenteuer“ erleben will. Als die Gruppe bei einer Poststation auf Tote trifft und von der Entführung der Söhne hört, wird aus dem harmlosen Trip blutiger Ernst. Statt sich weiter um die arroganten Besucher zu kümmern, will Chaco die entführten jungen Männer befreien. Aber dann wird auch die Familie überfallen und entführt, und die Zeit wird knapp.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© Cover: Stanley L. Wood mit Steve Mayer, 2018
© dieser Ausgabe 2018 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Die Hauptpersonen des Romans:
Chaco – Das Halbblut verspricht, die Söhne der alten Stationsfrau zu retten, und reitet mitten in ein Bleigewitter.
Pamela – Das hübsche Mädchen aus dem Osten sucht in Texas das Prickeln des Abenteuers.
Tony – Der schönste Mann von Luckenbach und Umgebung verliert seinen Galgenhumor nicht mal unter der Peitsche des Satans.
Freeman – Der Marshal hat Schlimmes hinter sich und ist verbittert. Doch das rechtfertigt nicht seinen üblen Plan.
Graciosa – Der mächtigste Mann von Coahuila soll einen Orden bekommen. Denn niemand weiß etwas von seinen ausgefallenen Hobbys.
1
Herb Greenville blickte durch das Fernrohr zu den Reitern hin, die sich im Galopp der kleinen Station näherten. Vier Männer, die in der rötlichen Staubwolke kaum mehr als dunkle Punkte waren.
Wie Ameisen, die über die verdorrte Erde galoppieren, dachte der alte Stationsmann, und er lächelte bei dem Gedanken daran, dass er noch keine Ameisen hatte galoppieren sehen.
„Kundschaft?“, fragte Pete, der aus dem Stall trat, mit einer Hand die Augen beschattete und zu der Staubwolke im Norden spähte.
„Ich hoffe es“, sagte Herb zu seinem Sohn. „Sag Ma Bescheid, sie soll schon mal Feuer im Herd anzünden. Vielleicht rasten die Jungs hier und bestellen was. Und sag Bobby, er soll nicht wieder den teuren Brandy ausschenken, sondern den Selbstgebrauten.“
Ein Grinsen huschte über Petes sommersprossiges Gesicht. „Zum doppelten Preis, wie?“
„So ist es“, brummte Greenville. „Schließlich haben wir nichts zu verschenken. In diesen Zeiten muss man sehen, wie man zurechtkommt.“
Pete ging in das kleine Stationsgebäude, in dem sich der Schankraum und die Wohnräume der Greenvilles befanden.
Herb Greenville hörte dann, wie Pete laut und aufgeregt seinen Bruder und die Mutter über das Nahen von Reitern informierte.
Es hatte Zeiten gegeben, da hätte keiner auf der Station viel Aufhebens wegen ein paar eventueller Gäste gemacht. Da hatte das Geschäft geblüht. Allein die regelmäßigen Postkutschen der Overland Mail hatten genug Kunden gebracht.
Mit Wehmut dachte Herb Greenville an diese Zeit zurück.
Damals hatte er noch zwei Stallburschen und eine Köchin beschäftigt. Heute reichte der Umsatz kaum aus, um die Familie zu ernähren.
Greenville hatte sich in das falsche Geschäft eingekauft. Er war auf einen „guten Freund“ hereingefallen, der angeblich aus gesundheitlichen Gründen die Station an ihn verkauft hatte.
„Eine wahre Goldgrube“, hatte er gesagt, der falsche Hund. Dabei hatte er genau gewusst, dass er ein sinkendes Schiff verließ. Der feine Freund hatte sich so gesundgestoßen, und Greenville war daran krank geworden. Denn genau drei Monate nach dem Kauf der Station war die Postkutschenlinie eingestellt worden, und selten verirrte sich mal ein Frachtwagen oder Reiter zu der einsamen Station im Niemandsland.
Blacky, der magere schwarze Bastardhund an Greenvilles Seite, begann zu bellen.
„Ruhig, Blacky“, sagte Greenville und kraulte dem Tier das Fell. Das Bellen ging in ein Winseln über, und der Hund rieb seine feuchte Schnauze an Greenvilles Handfläche.
Der Stationsmann schaute wieder durch das Fernrohr.
Jetzt konnte er die Reiter schon besser erkennen. Sie trieben ihre Pferde hart an. Einer der vier Männer trug den Stern eines U.S. Marshals.
„Bobby!“, rief Greenville zur Stationstür, die Pete halb offengelassen hatte.
Bobbys roter Haarschopf tauchte auf. „Ich weiß schon, Pa, nicht den guten Brandy, sondern ...“
„Quatsch“, sagte Greenville. „Den besten Whisky und den besten Brandy zum normalen Preis.“
Bobbys Augen wurden groß.
„Ein Marshal mit ’ner kleinen Posse“, fügte sein Vater erklärend hinzu und nickte zu den Reitern hin, die jetzt mit bloßem Auge zu erkennen waren.
„Das ist was anderes“, rief Bobby.
„Dann werde ich Ma sagen, dass sie größere Portionen serviert.“
Greenville nickte. Wenn es ihnen auch schlecht ging, mit einem Marshal würde er seinen letzten Kanten Brot und den letzten Rest Whisky teilen.Er war nämlich fünfzehn Jahrelang selbst für das Gesetz geritten, bis er erkannt hatte, dass er zu alt und zu langsam mit dem Colt geworden war, um noch im Kampf gegen die Kerle vom rauen Trail bestehen zu können.
Als die Reiter heran waren, erhob er sich von der Bank vor der Station und trat ihnen ein paar Schritte entgegen.
Die vier Männer zügelten ihre staubbedeckten Pferde, deren Fell dunkle Flecken aufwies.
Raue Burschen, registrierte Greenville, als er die harten Gesichter der vier sah, die kalt blickenden Augen, die Waffen in den tief geschnallten Holstern.
Einer der vier trug zwei Remington-Revolver in bodenlosen Holstern. Seine Rechte klatschte auf die Griffe der Waffen, und er zog mit einer Schnelligkeit, die Greenville Respekt abnötigte.
Der Mann mit dem Stern warf dem Zweihandschützen einen missbilligenden Blick zu und schüttelte leicht den Kopf. Er schob den Hut aus der Stirn, stemmte die Hände aufs Sattelhorn und musterte Greenville mit stechendem Blick.
„Du bist der Stationer“, sagte er mit rauem Panhandle-Slang. Es klang ziemlich herablassend.
Der Tonfall gefiel Greenville nicht. Und es gefiel ihm ebenso wenig, dass der Zweihandschütze grinsend seine Revolver auf ihn richtete.
„Und wer bist du?“, fragte er den Mann mit dem Stern im gleichen herablassenden Tonfall.
„Marshal White“, lautete die knappe Antwort.
„Okay, White, dann sagen Sie Ihrem Mann dort, er soll seine Eisen wegstecken. Ich hab solche Spielchen nicht so gern.“ Er legte die Rechte auf seinen Peacemaker, den er schon als Marshal getragen hatte.
White warf dem Zweihandschützen einen Blick zu Der Bursche zuckte leicht mit den Schultern, ließ die Revolver am Abzugsbügel um die Finger rotieren und schob sie dann ins Leder. Er grinste selbstgefällig, als habe er Beifall für diese kleine Einlage erhalten.
„Wir suchen einen Mann“, sagte der Mann mit dem Stern.
„Hier ist keiner“, antwortete Greenville, ein bisschen enttäuscht, weil die Reiter keine Anstalten trafen, abzusitzen. Die wollten offenbar keine Rast einlegen, obwohl ihre Pferde erschöpft waren.
„Das sehen wir, Opachen“, sagte einer des Quartetts und spuckte in den Staub. Dicht vor Greenvilles Stiefelspitzen.
Er fing sich einen tadelnden Blick von White ein.
Greenville schoss bei der spöttischen Bemerkung Zornesröte ins Gesicht.
„Wir müssen die Station durchsuchen“, sagte der Mann mit dem Stern.
„Aber ich sagte doch“, begann Greenville zu protestieren.
„Rufen Sie Ihre Leute heraus“, unterbrach ihn White mit einer scharfen Stimme, die keinen Widerspruch duldete.
Das ist ein eisenharter Bursche, dachte Greenville. Er selbst war kein Mann, der so leicht kuschte. Andererseits erinnerte er sich an seine Zeit als Marshal. Er war zwar höflicher gewesen, aber auch er hatte sich schon mal im Ton vergriffen, wenn er auf Jagd nach einem Verbrecher gewesen war und die Leute sich quergelegt hatten, wenn er Nachforschungen angestellt hatte. Da musste man Verständnis haben.
„Sie wollen doch nicht das Gesetz behindern?“, fragte der Mann mit dem Stern, und es klang drohend.
Greenville lächelte leicht. „Bestimmt nicht.“
Er wandte sich um und rief seine Söhne.
Die Reiter saßen ab. Einer blieb bei den Pferden. Die anderen drei schritten steifbeinig zur Station.
„Noch jemand im Haus?“, fragte White, nachdem er Pete und Bobby kurz gemustert hatte, die fragend zu ihrem Vater blickten.
Greenville schüttelte den Kopf. „Nur meine Frau.“
Der Mann mit dem Stern betrat das Stationshaus. Die anderen beiden blieben links und rechts von Greenvilles Söhnen stehen, als gelte es, sie zu bewachen. Ihre Hände lagen auf den Griffen ihrer Colts. Das waren misstrauische, vorsichtige Burschen.
„Wollt ihr nicht hier rasten?“, fragte Greenville.
Alle drei Männer schüttelten nur stumm den Kopf.
„Aber wenigstens die Pferde wechseln?“, setzte Greenville ein bisschen enttäuscht nach, weil er das erhoffte kleine Geschäft vergessen konnte. „Ich habe ...“
Er verstummte abrupt.
Barbara, seine Frau, schrie gellend.
Trotz der glühenden Sonne an diesem drückend heißen Tag lief Greenville ein eisiger Schauer über den Rücken. Die Köpfe seiner Söhne ruckten herum.
Herb Greenville reagierte wie in alten Tagen, instinktiv, ohne zu überlegen, wie immer, wenn er in einer gefährlichen Situation gewesen war.
Seine Rechte stieß zum Peacemaker hinab. Er war immer noch schnell, trotz der Gicht in seinen Händen. Doch für diese hartgesottenen Kerle war er nicht schnell genug. Bevor er die Waffe aus dem Leder hatte, hielten alle drei ihre Revolver in den Fäusten und spannten bereits die Colthähne.
„Lass fallen!“, sagte der Zweihandschütze kalt und drohend.
„Und ihr nehmt die Pfoten hoch!“, befahl einer der Männer neben Bobby und Pete.
Benommen gehorchten sie.
Herb Greenville war noch zu überrascht, um reagieren zu können. Sein Gefühl warnte ihn, doch er hielt alles noch für ein Missverständnis. Wie betäubt sah er den Mann mit dem Stern in der Tür der Station auftauchen. Der Mann zerrte Barbara hinter sich her. Er riss sie am Handgelenk herum, dass sie schmerzerfüllt aufschrie, schlang einen Arm um sie und drückte ihr seinen Revolver an die Schläfe.
„Waffe weg!“, sagte er mit scharfer Stimme. „Oder deine Alte bekommt Luftzug im Gehirn!“
„Das ist kein Marshal!“, durchfuhr es Herb Greenville. So spricht kein Gesetzesmann, und so handelt erst recht keiner.
In diesem Augenblick sprang Blacky knurrend und zähnefletschend auf den Mann mit dem Stern zu, der seine Herrin umklammert hielt und bedrohte.
Ein Schuss krachte.
Der Hund überschlug sich im Sprung, und sein Bellen ging in ein gepeinigtes Winseln über, das Greenville ins Herz stach.
Blacky war noch nicht in den Staub geprallt, als der Zweihandschütze zum zweiten Mal feuerte. Die Kugel traf den Hund und wirbelte das Tier herum. Es fiel fast vor Barbaras Füße.
Barbara schrie.
Bobby und Pete starrten entsetzt, unfähig zu begreifen, was da geschehen war. Und Herb Greenville war zu geschockt, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Sie hatten seinen geliebten Blacky einfach abgeknallt. Und sie bedrohten Barbara!
Der Zweihandschütze lachte.
In diesem Augenblick verlor Herb Greenville die Kontrolle über sich.
„Ihr verdammten Verbrecher!“, schrie er mit sich überschlagender Stimme, riss den Hammer des Peacemaker zurück und feuerte.
Drei Revolver krachten gleichzeitig.
Und drei Kugeln trafen den alten Stationsmann und ehemaligen Marshal. Er spürte noch die harten Schläge gegen seinen Körper, hörte Barbara schreien und die Fensterscheibe klirren, in die seine Kugel geschlagen war, und dann wurde es dunkel und still um ihn. Er spürte nicht mehr, wie er in den Staub stürzte.
„Alter Narr“, sagte der Zweihandschütze kalt.
Barbara starrte in namenlosem Entsetzen auf die Leiche ihres Mannes. Dann schrie sie wie von Sinnen. Die kleine grauhaarige Frau wollte sich losreißen. Der Mann mit dem Stern schlug sie nieder.
Sie fiel neben Blacky. Sie war nicht bewusstlos. Ihr tränenfeuchter Blick erfasste ihren Mann. In einer Woche hätten sie den 25. Hochzeitstag gefeiert.
„Herbie – mein Herbie – was ist mein Gott ...“
Bobby und Pete, die zwanzig und zweiundzwanzigjährigen Söhne, starrten fassungslos auf ihre Mutter, die auf allen Vieren durch den Staub auf ihren toten Vater zu kroch, und das Grauen spiegelte sich in ihren Augen.
Pete löste sich als erster aus der Erstarrung.
„Ihr dreckigen ...“
Er trug keinen Revolver. Mit bloßen Händen wollte er auf den Banditen losgehen, der links neben ihm stand. Für einen Moment sah er in die Waffenmündung und glaubte schon, es aufblitzen zu sehen und den Kugeleinschlag zu spüren.
Doch der Verbrecher schoss nicht.
Er wich katzenhaft geschickt aus und schlug den heranschnellenden Pete mit dem Revolver nieder.
Gleichzeitig schlug der Bandit neben Bobby zu.
Beide jungen Greenvilles stürzten in den Sand.
Barbara Greenville hatte ihren Mann erreicht. Schluchzend warf sie sich über ihn und betastete sein Gesicht, rüttelte an seinen Schultern, als wolle sie ihn aufwecken.
„Herbie – Herbie ...“
„Fesseln!“, sagte der Mann mit dem Stern und nickte zu den Bewusstlosen hin. Er war kein Marshal, und er hieß auch nicht White. Er hieß Ed Corwin und war ein vielfacher Mörder. Der Mann, der den Stern zu Recht getragen hatte, war vor ein paar Monaten an Corwins Kugel gestorben.
„Die Alte auch?“, fragte der Zweihandschütze beinahe gelangweilt.
Corwin schüttelte den Kopf. „Sie ist zu alt, um ...“
Er verstummte, und seine Augen verengten sich, als er die Staubwolke im Norden sah. Der Mann bei den Pferden zog ein Fernrohr aus der Satteltasche und blickte hindurch.
„’ne Postkutsche!“, meldete er.
Corwin fluchte. „Ich dachte, die Linie existiert nicht mehr!“
Er blickte zu den beiden Banditen, die Pete und Bobby inzwischen mit Lederriemen gefesselt hatten.
„Okay, beeilt euch. Wir müssen hier weg. Hank, hol frische Pferde aus dem Stall.“ Er blickte wieder zu der Staubwolke. Die Kutsche war noch meilenweit entfernt, ein dunkler Punkt in der hitzeflimmernden, verdorrten Ebene, die sich am fernen Horizont in einem perlgrauen Dunstschleier verlor.
Barbara Greenville stand zu sehr unter dem Schock der Ereignisse, um begreifen zu können, dass ihr Mann tot war.
„Herbie – warum sagst du nichts? Herbie...“
Corwin hob die Hand mit dem Colt und zielte auf die Frau.
Ihre geschluchzten Worte gingen im Krachen des Schusses unter.
Sie fiel vornüber und blieb reglos auf der Leiche ihres Mannes liegen.
„Boss, musste das sein?“, fragte der Bandit bei den Pferden.
Corwin maß ihn mit einem eisigen Blick.
„Wir können uns keine Zeugen erlauben, Mac“, sagte er kalt. Und mit einem Achselzucken fügte er hinzu: „Ihr Pech, dass sie zu alt für uns ist.“
Steifbeinig schritt er auf die beiden alten Leute zu, die dort reglos im Staub lagen, vereint nach einem langen, harten Leben auf dieser Erde. Ja, es sah fast so aus, als umarmten sie sich im Tode.
Corwin starrte auf sie hinab. Kalt, gefühllos. Dann zog er ein Messer aus der Lederscheide am Gurt. Es hatte ein Hirschhornheft und eine zweischneidige, rasiermesserscharfe Klinge, die vorne spitz zulief.
Er bückte sich hinab, fasste in die Haare der Frau und schnitt die grauen Locken ab. Er stopfte sie in seine Hosentasche. Dann ging er zu den Pferden, die einer der Banditen aus dem Stall geholt hatte.
Zwei Minuten später ritten die Verbrecher mit zwei Gefangenen nach Süden davon.
Bald verschwanden sie jenseits eines Hügels, und das weite Land nahm sie auf, als hätte es sie nie gegeben.
2
„Ich bestehe darauf, endlich zu baden!“, sagte Edwina Wilson schrill zu ihrem Mann Thomas, der ihr gegenüber in der Kutsche saß.
„Ich habe Hunger“, maulte Pamela, die achtzehnjährige blonde Tochter.
„Und ich Durst“, fügte Dany hinzu. Er war dreiundzwanzig, doch der Altersunterschied zwischen Schwester und Bruder hätte genau umgekehrt sein können. Pamela wirkte entwickelter. Dany rückte seine Nickelbrille zurecht und vertiefte sich wieder in die Zeitung, in der er gelesen hatte.
„Aber wir haben doch erst vor drei Stunden gerastet!“
Thomas Abraham Wilson zog ein blütenweißes Taschentuch aus der Tasche seines Nadelstreifenanzugs und tupfte sich den Schweiß von seinem geröteten Gesicht.
„Ich bestehe darauf, endlich zu baden!“, wiederholte Edwina noch etwas schriller als zuvor. Sie war klein, zierlich und hatte hellblonde Locken. Das war nicht ihre Naturfarbe, wie einige dunkle Strähnen verrieten, die unter dem Blond hervorschimmerten. Sie färbte sich die Haare jede Woche mit einem speziellen Mittel aus dem Osten, das ihr ein Barbier verkauft hatte, der so teuer und vornehm war, dass er seinen Laden nicht mehr Barbershop, sondern Kosmetiksalon nannte.
Auch die anderen wiederholten sich. Pamela hatte Hunger, Dany hatte Durst.
Thomas A. Wilson wurde von allem gleichzeitig geplagt. Er schwitzte in seinem eleganten Anzug und sehnte sich nach einem Bad. Das flaue Gefühl im Magen konnte auch vom Schlingern der Kutsche herrühren, denn sie hatten ausgiebig gefrühstückt. Doch seit einiger Zeit hatte Wilson fast ständig Hunger. Er führte das auf die Strapazen der Reise und auf die Luftveränderung zurück. Seine Kehle war schon wieder wie ausgedörrt. Wie gerne hätte er einen Schluck aus der Whiskyflasche getrunken, die er in seiner Reisetasche versteckt hatte. Bei jeder Rast trank er heimlich, denn Edwina wachte argwöhnisch darüber, dass er sich an den Rat seines Arztes hielt und keinen Tropfen Alkohol trank.
Wilson hatte schon mehrfach seinen Entschluss bereut, diese Reise durch Texas und nach Mexiko zu unternehmen. Vergnügungsreise, ha! Die reinste Tortur war das. Hitze, Staub und mangelnder Komfort in diesem verdammten Westen. Noch dazu die ständig nörgelnde Familie. Und die Überwachung von Edwina!
Er hätte sie niemals geheiratet, wenn er vor der Hochzeit gewusst hätte, dass sie sich in wenigen Jahren von einem sanften Mäuschen in einen schrillen Drachen verwandeln würde.
Wie schön hätte er in Baltimore den Urlaub verbringen können bei seiner Geliebten Evelyn, wie jedes Jahr, wenn er die Familie allein in einem Badeort in Florida geschickt hatte, weil ihm angeblich die Geschäfte keine Zeit für einen gemeinsamen Urlaub gelassen hatten. Ha, wie herrlich hatte er sich bei Evelyn entspannt, in dem kleinen Haus am Stadtrand, für das er seit drei Jahren die Miete zahlte, ihr Liebesnest, das er immer aufsuchte, wenn er sich davonstehlen konnte, ohne Edwinas Argwohn zu wecken.
Die beiden Frauen waren so verschieden wie Tag und Nacht. Wie ein strahlender Frühlingstag und eine Gewitternacht im November. Und das lag nicht nur am Altersunterschied. Evelyn hatte eine weiche, sanfte Stimme, Edwina eine harte, schrille. Was an Evelyn rund und knackig war, war an Edwina flach und schlaff. Edwina war nie eine Schönheit gewesen, und er hatte in seinem jugendlichen Leichtsinn auf ihre inneren Werte, auf ihr liebes Wesen gesetzt.
So konnte man sich irren.
Oh, vor der Hochzeit war sie auch noch ganz anders gewesen; zärtlich, liebevoll, eine gute Köchin und ja, tatsächlich voller Leidenschaft. Die Glut war schnell erloschen. Irgendwann nach den ersten Ermüdungserscheinungen in ihrer Ehe hatte sie ihm bekannt, dass sie sich daraus nicht viel mache, aber Pflicht sei eben Pflicht. Und seit drei Jahren erlaubte sie ihm nur noch einmal im Monat, seine Pflicht als Ehemann zu absolvieren.
Da hatte er sich Evelyn zugewandt. Bei ihr konnte er seine Pflicht erführen, so oft er wollte und dazu in der Lage war.
Er seufzte bei diesem Gedanken und warf einen verstohlenen Blick zu Edwina.
„Weshalb seufzt du?“, fragte sie und blickte ihn an, als hätte sie seine Gedanken erraten. Teufel, er musste vorsichtig sein, stets aufpassen, dass er nicht in eine ihrer Fallen tappte. Das kostete ihn mehr Kraft als die Stunden mit Evelyn.
Edwina war entsetzlich eifersüchtig. Wenn die ihm auf die Schliche kam, konnte er sich auf etwas gefasst machen. Schlimmstenfalls konnte es ihm passieren, dass sie sich von ihm trennte. Das hätte er ja gerne ertragen, doch dann hätte sie auch ihr Kapital aus seinen Fabriken gezogen, was seinen Ruin bedeutet hätte. Und es war fraglich, ob Evelyn ihm als bankrottem Unternehmer mit einem Haufen Verbindlichkeiten dann noch die Stange halten würde!
Sie war in jeder Beziehung sehr anspruchsvoll.
Er musste verdammt vorsichtig sein.
Was hatte ihm Edwina eine Szene gemacht, als sie das Haar auf seinem Anzug entdeckt hatte! Es war ihm auf die Schnelle keine andere Ausrede eingefallen, als zu behaupten, es sei ein Hundehaar. Er habe mit dem Köter eines Prokuristen herumgetollt.
„Ein rothaariger Hund mit so langen Haaren?“, hatte Edwina spitz gefragt.
Einen Tag später hatte sie herausgefunden, dass besagter Prokurist nur einen pechschwarzen Kurzhaardackel hatte. Wochenlang hatte Edwina ihn deswegen mit ihrer Schrillstimme angekeift, und er hatte die rothaarige Evelyn erst wieder besuchen können, als sich die Wogen etwas geglättet hatten.
In dieser angespannten Phase hatte Thomas sich dazu hinreißen lassen, der Familie einen gemeinsamen Urlaub zu versprechen. Etwas ganz Besonderes. Eine Reise in den Westen. Mit allem Drum und Dran. Mit wilden Indianern und abenteuerlichen Revolvermännern. Prickeln und Sensation auf jeder Meile.
Sie hatten weder skalplüsterne Indianer noch wild durch die Gegend schießende Cowboys gesehen, wie sie im Osten in der Westernshow auftraten.
Pamela fand die ganze Reise stinklangweilig. Und Edwina und Dany jammerten dauernd über den mangelnden Komfort.
Hätte er sich doch niemals zu dieser Wahnsinnsidee hinreißen lassen! Aber es ließ sich nicht mehr rückgängig machen.
Er hatte die Bagage am Hals.
Und wenn nicht bald etwas Aufregendes passierte, dann würde ihm die Familie auch noch vorwerfen, eine Schnapsidee gehabt zu haben.
Er seufzte von Neuem.
„Was seufzt du andauernd herum?“, fragte Edwina, und er hatte das Gefühl, dass es lauernd klang.
„Verdammt!“, sagte er und tupfte sich über das gerötete Gesicht. „Darf man nicht mal seufzen? Zur Hölle, ich kann doch auch nichts dafür, dass wir bis zum Abend durchfahren müssen! Ihr habt doch selbst gehört, was dieser Chaco gesagt hat!“
„Du fluchst schon wie diese primitiven Leute, die wir bisher getroffen haben“, sagte Edwina tadelnd.
„Wenigstens etwas Westernatmosphäre“, sagte Pamela spöttisch und blickte gelangweilt aus dem Fenster. „Ich glaube, ich werde noch gemütskrank in dieser Einöde.“
„Dahinten kommen schon die Berge“, sagte Dany und blickte von der Zeitung auf. „Bis Del Rio müsste rein theoretisch das Terrain etwas variabler werden als auf den vegetationsarmen letzten fünfzig Meilen.“
Wilson bedachte seinen Sohn mit einem finsteren Blick.
Rein theoretisch ... variabler... vegetationsarm!, dachte Thomas Wilson. Zum Kotzen, dieses hochtrabende Gelaber!
Manchmal bedauerte er, den Bengel aufs College geschickt zu haben.
Dort hatte er anscheinend verlernt, normal zu reden.
„Du solltest ein Machtwort sprechen“, sagte Edwina. „Du lässt dich viel zu sehr von diesem blöden Mischling bevormunden – du Weichling!“
„Aber Ma …“.sagte Pamela, und es war nicht ganz klar, ob sie gegen den „blöden Mischling“ oder gegen den „Weichling“ protestierte.
„Ist doch wahr“, sagte Edwina mit schriller Stimme. „Ständig macht der Mann uns Vorschriften! Ich frage mich, weshalb wir ihn überhaupt bezahlen.“
„Damit er aufpasst, dass uns nichts passiert“, erwiderte Wilson.
„Mir wäre lieber, es würde mal was passieren“, sagte Pamela schnippisch. Dann nahmen ihre himmelblauen Augen einen schwärmerischen Ausdruck an. „Ich möchte diesen großen, starken Mann mal in Aktion sehen.“
„Er gefällt dir wohl?“, fragte Dany hämisch und rückte seine Nickelbrille zurecht. „Schwesterherz, rein theoretisch gesehen ist er kein reinrassiger ...“
„Ach, du mit deiner ewigen Theorie!“ Pamela funkelte ihren Bruder an. „Praxis ist mir lieber. Und ob er ein halber Indianer ist oder nicht – wen juckt das?“
„Dich“, bemerkte Dany grinsend.
„Ich finde ihn irre aufregend“, bekannte Pamela.
„Pamela!“, sagte Edwina empört.
In diesem Augenblick fluchte der Kutscher. Die Kutsche wurde langsamer, rollte aus und blieb mit einem Ruck stehen. Staub wehte am Fenster vorbei. Eines der Gespannpferde wieherte.
„Was ist los, Gregory?“, rief Wilson und blickte aus dem Fenster. „He, ist da etwa doch eine Station?“
„Jawohl, Sir. wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Dachte, wir müssten bis Del Rio durchfahren.“
„Na und?“, rief Edwina. „Weshalb fahren Sie dann nicht weiter? Ich will endlich baden!“
„Darauf werden Sie wohl noch etwas warten müssen, Ma’am“, erwiderte der Kutscher. „Chaco hat mir signalisiert, nicht weiterzufahren. Er reitet zur Station voraus und erkundet die Lage.“
„Chaco, Chaco!“, schrillte Edwinas Stimme. „Der will sich bestimmt nur wichtig machen. Ich verlange ...“
„Das glaube ich nicht, Ma’am“, unterbrach sie der Kutscher. „Es sieht aus, als sei die Station überfallen worden.“
„Ein Überfall?“, rief Dany erschrocken und rückte nervös seine Brille zurecht.
„Von richtigen Indianern?“, fragte Pamela, und es klang fast hoffnungsvoll.
„Das werden wir erfahren, wenn Chaco zurückkommt.“
Eine Weile herrschte Stille. Dann ertönte wieder Edwinas Stimme. Sie drängte ihren Mann, etwas zu unternehmen. Gregory verzog das Gesicht, als er das hörte.
Wilson öffnete die Tür und stieg aus der Kutsche. In seinem eleganten Nadelstreifenanzug, der roten Weste, der grauen Samtschleife, und den flachen schwarzen Schuhen wirkte er in dieser staubigen Einöde so fehl am Platz wie ein Pinguin in der Wüste.
Pamela trug als einzige der Familie legere Kleidung, eine Levishose, eine graublau karierte Baumwollbluse, Texasstiefel und einen flachkronigen schwarzen Hut. Man konnte sie von Weitem für eine Farmers- oder Rancherstochter halten. Ihre Eltern und auch Dany hatten die Nase gerümpft, als sie sich diese Sachen gekauft hatte. Sie sehe aus wie ein Zirkusmädchen, hatten sie gemeint.
„Der Westen soll ja auch ein einziger Zirkus sein“, hatte Pamela daraufhin erklärt. „Hoffentlich fängt die Schau bald an.“
Ihr Vater hatte sich dann doch noch einen – wie er meinte – zünftigen Cowboyhut zugestanden. Es war ein schneeweißer Hut mit rotem Samtband, den ihm der Verkäufer für einen Wucherpreis aufgeschwatzt hatte, weil er Wilson gleich als eitles und zahlungskräftiges Greenhorn eingeschätzt hatte. Der Hut stammte aus dem Osten, und jeder normale Cowboy hätte sich geweigert, so was zu tragen. Gleich bei der ersten Rast hatte ein Vogel etwas drauf fallen lassen. Der Fleck war nicht ganz abgegangen, und seither genierte Wilson sich, den Hut zu tragen.
Er beschattete die Augen mit einer Hand und spähte zur Station hin, die noch etwa eine Meile entfernt war. Er sah Chaco vor der Station. Chaco war vom Pferd gestiegen und gab mit hoch erhobener Hand ein Zeichen.
„Er winkt“, sagte Wilson. „Die Gefahr ist vorüber.“
Er stieg wieder in die Kutsche und tupfte sich mit dem Taschentuch übers Gesicht. „Ist das da draußen eine Affenhitze“, stöhnte er.
Gregory trieb das Gespann an.
„Na endlich!“, sagte Edwina, als die Kutsche dann vor der Station hielt. Sie wollte aussteigen, doch Chaco trat an den Schlag. Seine Miene war hart und verschlossen.
„Sie bleiben bitte in der Kutsche, Ma’am“, sagte er.
„Aber warum?“, begehrte Edwina auf. „Wenn Sie meinen, Sie könnten uns herumkommandieren ...“
„Es ist besser für Sie“, unterbrach Chaco sie kühl. „Bleiben Sie alle in der Kutsche. Gregory, komm und hilf mir.“
„Ja“, erwiderte Gregory mit seltsam gepresster Stimme und stieg vom Wagenbock.
„Ich verstehe nicht, weshalb du dir das bieten lässt“, keifte Edwina ihren Mann an. „Ich verlange, dass du ihn zurechtweist! Unerhört, wie er ...“
Chaco hörte nicht mehr hin. Er wandte sich ab. Er fing Gregorys Blick auf. Das sonst so lustig wirkende Gesicht des stämmigen Kutschers war ernst, und seine grauen Augen verengten sich, als er wieder zu den beiden reglosen Gestalten im Sand hinsah.
Der Schlag der Kutsche flog auf. Thomas Wilson hatte sich von seiner Frau offenbar aufhetzen lassen. Mit hochrotem Kopf und grimmiger Miene stieg er aus, gefolgt von Edwina, Dany und Pamela.
Chaco unterdrückte ein Seufzen. Er verwünschte den Tag, an dem er sich bereit erklärt hatte, für seinen Freund Tony, den Detektiv, den Job als Leibwächter zu übernehmen und die Wilsons quer durch Texas nach Del Rio zu begleiten. Sie zahlten gut, aber das war auch das einzig Erfreuliche. Die hysterische Edwina konnte einem den letzten Nerv töten. Nicht viel angenehmer fand Chaco den arroganten Wilson, der glaubte, mit Geld alles kaufen zu können. Und der Fatzke von Dany mit seinem hochtrabenden Gerede ging ihm ebenso auf die Nerven wie Pamela mit ihrem koketten Getue.
Sie hatten sich allesamt beklagt, dass er nicht für genug Aufregung sorge, dass die Reise eine langweilige Tortur Er hatte ihnen erklärt, dass er nicht als Clown engagiert worden war, sondern für ihre Sicherheit zu sorgen habe.
Jetzt hatte er ihnen gesagt, dass sie in der Kutsche bleiben sollten. Sie wollten nicht hören. Nun konnten sie ihre Schau haben. Die Sensation, nach der sie am der ganzen Reise gegiert hatten. Er traute ihnen sogar zu, dass sie den Anblick genossen. Sie widerten ihn an.
Sie genossen den Anblick nicht. Das, was sie sahen, war kein Nervenkitzel wie im Zirkus. Keine Nummer aus einer Westernschau im Osteel, das war brutale Wirklichkeit.
„Ich verlange ...“, begann Edwina und rauschte an ihrem Mann vorbei. Dann verstummte sie abrupt und blieb stehen, als sei sie gegen eine unsichtbare Mauer geprallt. Ihre Augen weiteten sich jäh vor Entsetzen. Sie presste eine Hand auf den Mund, stieß einen seufzenden Laut aus und sank zu Boden.
Sie konnte kein Blut sehen.
Wilson blickte ebenso entsetzt auf die beiden reglosen Menschengestalten und auf den toten Hund, über dessen blutiges Fell Fliegen krochen.
Dany wurde kreidebleich und schluckte, als müsste er sich übergeben.
Auch aus Pamelas Gesicht wich die Farbe. „Chaco …“, hauchte sie, dann fiel sie etwas eleganter als ihre Mutter in Ohnmacht.
Chaco ignorierte sie. Als er sich abwandte, sah er noch aus den Augenwinkeln, wie Pamela blinzelnd nach ihm Ausschau hielt, ob er sich nicht um sie kümmern wollte.
Chaco ging zu Gregory, der neben der Frau kniete. Sie lebte, wie Chaco erkannt hatte, bevor er die Kutsche herangewinkt hatte, weil er Gregorys Hilfe brauchte.
„Wir bringen sie ins Haus“, sagte Chaco. „Vorsichtig.“
Gregory nickte. Sein Bruder war Doc, und er selbst verstand etwas von Verletzungen. Er war ein verlässlicher, sympathischer Mann, mit dem Chaco sich gut verstand.
„Die Kugel steckt“, murmelte Gregory, nachdem er die Frau kurz untersucht hatte. „Mein Gott, wie sieht ihr Haar aus! Als ob jemand ihren Skalp …“
„Indianer?“, fragte Wilson, der das gehört hatte, und seine Stimme klang fast so schrill wie sonst die von Edwina. Furchtsam schaute er sich um.
Chaco schüttelte den Kopf. Die Fuß und Hufspuren vor der Station hatten ihm etwas anderes erzählt.
„Sie können unbesorgt sein“, sagte er zu Wilson. „Kümmern Sie sich um Ihre Frau und Tochter.“
Wilson hastete zur Kutsche. Er holte die Whiskyflasche aus seiner Reisetasche, entkorkte sie und trank gierig. Dann lief er mit der Flasche ein paar Schritte auf seine Frau zu, überlegte es sich aber anders und eilte zur Kutsche zurück, wo er die Flasche wieder versteckte.
Chaco wusste, dass Wilson heimlich Whisky schluckte. Er hatte ihn schon mehrfach dabei beobachtet, aber nichts gesagt. Sein Problem war das nicht.
Während er mit Gregory die Frau ins Haus trug, sah er mit einem kurzen Blick zurück, wie Pamela blitzschnell zu sich kam und wie Wilson neben seiner Frau kniete und ihre Wangen tätschelte, ziemlich heftig, so dass es fast schon Ohrfeigen waren.
„Chaco“, rief Pamela. „Bleib bei mir. Ich habe solche Angst ...“
Chaco gab ihr keine Antwort.
Es gab jetzt Wichtigeres zu tun, als ein verzogenes gefallsüchtiges Mädchen zu beruhigen.
3
„Glaubst du, sie wird es überstehen?“ Chaco blickte zu Barbara Greenville, die wieder das Bewusstsein verloren hatte.
Gregory zuckte mit den Schultern. „Die Kugel ist raus. Mehr konnte ich nicht tun. Aber nach allem, was ich meinem Bruder, dem Doc, abgeguckt habe, meine ich, sie müsste schnellstens zu einem Arzt.“
„Ist sie transportfähig?“
„Ich denke schon. Auf keinen Fall darf sie allein sein, wenn sie zu sich kommt. Den Schock würde sie nicht verkraften. Ein Dutzend Meilen von hier ist die Harding-Farm. Der Farmer war mal Doc, bevor er sich zur Ruhe setzte. Es wäre zwar ein Umweg, aber ich schlage vor, wir bringen die Frau dorthin.“
„Gute Idee“, stimmte Chaco zu.
Er dachte an die wenigen Worte, die die Stationsfrau gesagt hatte, als sie zu sich gekommen war. Einiges ergab für Chaco keinen Sinn und war sicher auf den Schock zurückzuführen, unter dem Barbara Greenville stand. Sie hatte zum Beispiel von einem Marshal geredet und ihrem Hochzeitstag. Aber die Tatsachen hatte Chaco im Großen und Ganzen schon aus den Spuren vor der Station ersehen. Banditen hatten ihren Mann ermordet, sie niedergeschossen und die beiden Söhne entführt. Die Fährte führte nach Süden und war noch frisch. Die Verbrecher konnten allenfalls einen Vorsprung von anderthalb bis zwei Stunden haben. Chaco erinnerte sich, durch sein Fernglas einen kleinen Reitertrupp gesehen zu haben, als er und die Kutsche noch Meilen von der Station entfernt gewesen waren.
Das mussten die Verbrecher gewesen sein.
Chaco hatte der verletzten Frau ohne zu zögern versprochen, ihre beiden Söhne zurückzuholen. Das hielt er für eine menschliche Pflicht.
Hoffentlich dachten die Wilsons ebenso darüber.
Er verließ den Wohnraum, in dem sie die Frau auf das Sofa gebettet hatten, und ging in die kleine Schenke.
Die Wilsons saßen an einem der drei Tische, aßen Schinken, den sie in der Küche gefunden hatten, und tranken Kaffee, den Pamela zubereitet hatte.
Sie blickten ihn erwartungsvoll an.
Pamela schenkte Kaffee in einen Becher, ging zu Chaco und hielt ihn ihm hin. Er nahm den Becher und nippte an dem Kaffee.
„Wie sieht’s aus?“, fragte Wilson und tupfte sich mit seinem Taschentuch übers Gesicht.
Chaco berichtete.
„... und deshalb werde ich die Verfolgung der Verbrecher aufnehmen und versuchen, die beiden jungen Männer zu befreien“, endete er.
Sie blickten ihn verdutzt an.
„Sie wollen uns allein lassen?“, fragte Edwina dann entrüstet.
„So ist es, Ma’am“, erwiderte Chaco kühl. „Gregory bringt die verletzte Frau zu einer Farm und fährt Sie dann nach Del Rio. Dort erwartet Sie ohnehin Mr. Tony Burgess, um Sie auf der weiteren Reise durch Mexiko zu begleiten.“
„Wir sollen diese Person mitnehmen?“ Edwina schaute ihren Mann an.
„Sie muss zu einem Arzt“, erklärte Chaco.
Edwina wollte etwas sagen, doch Thomas Wilson ließ sie nicht zu Wort kommen.
„In Ordnung, ich bin bereit, sie mitzunehmen.“ Es klang, als kostete ihn der Entschluss Überwindung. Dann wurde sein Tonfall schärfer. „Aber ich bin nicht bereit, hinzunehmen, dass Sie uns einfach im Stich lassen.“
„Das ist eine Unverschämtheit!“, bekräftigte Edwina.
„Rein theoretisch betrachtet ein Vertragsbruch“, warf Dany ein, rückte seine Nickelbrille zurecht und starrte Chaco mit leichtem Silberblick vorwurfsvoll an.
Pamela sagte nichts. Ihre Miene zeigte Enttäuschung.
„Jawohl“, griff Wilson das Stichwort auf, das ihm sein Sohn gegeben hatte. „Sie haben einen Vertrag. Sie haben sich verpflichtet, uns bis Del Rio zu beschützen.“
„Es sind nur noch rund vierzig Meilen bis dorthin“, erwiderte Chaco, „und die Gegend ist sicher.“
„Sicher, ha!“ Wilson hieb mit der Faust auf den Tisch. „Das haben wir ja gesehen. Menschen werden hier abgeknallt, Leute entführt! Wer sagt uns, dass diese Bande nicht überall hier herumreitet? Ich bestehe darauf, dass Sie Ihre Pflicht erfüllen. Andernfalls ...“
„Andernfalls?“, unterbrach Chaco ihn gelassen.
„Andernfalls wird das Konsequenzen haben. Ich habe bis Del Rio bezahlt und ...“
Jetzt platzte Chaco der Kragen. „Bezahlt, bezahlt! Sie denken immer nur an Geld! Da drinnen liegt eine schwerverletzte Frau, deren Mann ermordet wurde, deren Söhne entführt wurden, aus welchem Grunde auch immer. Die Fährte ist noch frisch. Noch besteht die Aussicht, diese Verbrecher zu schnappen, bevor sie untertauchen, und die Gefangenen zu befreien. Hier steht nicht, wie vielleicht bei Ihnen im Osten, an jeder Ecke ein Polizist, den man alarmieren könnte. Hier muss man sich und anderen oftmals noch selbst helfen. Sie sprechen von Pflicht! Es ist meine verdammte Pflicht, mich um die Greenvilles zu kümmern, anstatt für Sie den Babysitter zu spielen. Mr. Burgess wird Ihnen das Geld für die letzten vierzig Meilen schon zurückzahlen.“
Die Ader an Wilsons Stirn schwoll an. Er brauchte keinen Ansporn seiner Frau mehr.
„Blasen Sie sich nicht so auf, Mann! Sie haben den Job von Anfang an nicht richtig erfüllt. Wenn ich gewusst hätte, dass uns Mr. Burgess so jemand schickt, hätte ich ihm niemals den Auftrag gegeben. Sie sind ein ...“
„Sagen Sie’s besser nicht!“, unterbrach Chaco ihn hart. Er zuckte mit den Schultern. „Ich kann nichts dafür, dass Sie mehr erwartet haben, als Texas für Ihre Ansprüche zu bieten hat. Wenn Sie statt ständig herumzunörgeln mal die Augen aufgemacht hätten, dann hätten Sie vielleicht bemerkt, wie schön dieses Land ist, wie herrlich die unberührte weite Natur, die Tiere, der Sonnenuntergang, der Duft der Wildblumen, der Rauch des Lagerfeuers unter dem Sternenhimmel. Sie haben kleine Städte gesehen, Wild in freier Natur, Cowboys bei der Arbeit, Farmen und Ranches. Für Rummel konnte ich nicht sorgen. Wenn Sie den suchen, wären Sie besser in Baltimore geblieben. Und was meinen Job anbetrifft, so habe ich ihn hundertprozentig erfüllt – schließlich ist Ihnen nichts passiert, oder?“
Er konnte sich nicht verkneifen, hinzuzufügen: „Abgesehen vielleicht davon, dass Mylady mal auf ein heißes Bad verzichten musste und dass Sie das irre Prickeln vermissen mussten, von skalp- und sonstigen lüsternen Rothäuten überfallen zu werden.“
Pamela wusste, dass mit Letzterem sie gemeint war. Sie senkte den Kopf und zog einen Schmollmund.
Edwinas Stimme klang schrill wie nie: „Thomas, willst du dir das bieten lassen? Von einem primitiven Mischling?“
Sie spuckte das Wort förmlich aus. Thomas Wilson reckte zornig das Kinn vor. „Ich werde Sie verklagen!“, brüllte er.
„Tun Sie das“, sagte Chaco gelassen. Er tippte an seine Hutkrempe. „Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte.“ Er wandte sich grußlos um und verließ die Station.
„Verdammter Indianerbastard!“, hörte er Wilson hinter sich sagen.
Da war es wieder, das Vorurteil, das sie von Anfang an gegen ihn gehabt hatten. Er erinnerte sich daran, wie er sie in Tonys Auftrag in New Orleans in Empfang genommen hatte. An die versteckten Anspielungen auf seine Abstammung. Nur Pamela hatte das „irre prickelnd“ gefunden und sich dafür interessiert, ob es stimme, dass alle Krieger eines Stammes über eine weiße Frau herfielen. Er hatte ihr kühl erklärt, dass das schon aus Platzmangel kaum möglich sei, weil die Tipis zu klein seien und so, und er hatte das Gefühl gehabt, dass seine Antwort sie nicht ganz befriedigt hatte. Er wusste, wie die manchmal in der Tat grausame Realität im Westen in den großen Städten des Ostens noch schaurig übertrieben wurde. Er konnte sich denken, was Pamela so alles gehört und gelesen hatte. Ihr nahm er es noch am Wenigsten übel. Sie war noch jung und musste sich erst ein eigenes Bild von der Welt machen, wie sie wirklich war.
Und manchmal war die Wirklichkeit schlimm. Wie die Ereignisse auf dieser Station gezeigt hatten. Doch das rechtfertigte nicht die Sensationslust gewisser Leute, die in der schlimmsten Ausnahme die Regel suchten und enttäuscht waren, wenn nichts passierte – wofür jeder normal denkende Mensch im Westen dem Schöpfer dankte.
Ja, die Wilsons waren sensationsgeile Leute aus dem Osten, voller Vorurteile und Arroganz – was ja meistens Hand in Hand geht.
Später, auf dem langen Weg von New Orleans durch Louisiana bis hinauf nach Dallas, dann nach San Antonio, und schließlich nach Westen über Uvalde auf die mexikanische Grenze zu, hatte er gedacht, sie hätten nach und nach einige Vorurteile abgebaut und mehr Verständnis für den Westen und seine Menschen gefunden.
Das war wohl ein Trugschluss gewesen.
Gregory trat zu ihm, als er aufsaß. Er reichte Chaco mit einem Lächeln die Hand.
„Viel Glück, Chaco“, sagte er. Und mit einer kleinen Grimasse fügte er hinzu: „Ich muss sie ja leider noch ein bisschen länger ertragen.“
Chaco drückte die Hand. Sie verstanden sich. Gregory Farrell war ein gebürtiger Texaner, ein Mann des Westens. Auch ihm waren die Wilsons oft genug auf die Nerven gegangen. Aber er brauchte das Geld. Er hatte die Kutsche auf Pump gekauft und mit einem Partner eine Linie aufbauen wollen. Gegen die Großen in diesem Geschäft hatte er nichts ausrichten können, sein Partner war ausgestiegen, und er hatte mit seinen Schulden dagesessen. Da war er auf die Idee gekommen, Reisegruppen zu kutschieren. Tony hatte ihm den Auftrag vermittelt.
„Mach’s gut, Greg“, sagte Chaco. „Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Möglich, dass ich in Del Rio bin, bevor ihr von dort aus weiterfahrt.“
Chaco trieb den Morgan-Hengst mit leichtem Zügeldruck an.
Als er nach Süden davonritt, trat Pamela aus der Station, und aus den Augenwinkeln heraus sah er noch, dass sie die Hand hob, wie um zu winken.
Er blickte nicht zurück.
4
Die Sonne senkte sich wie eine blutrote Scheibe über die Hügel im Westen, als Chaco die Verbrecher sah.
Sie hatten sich nicht bemüht, ihre Fährte zu verwischen. Von der Station aus waren sie nur knapp zwei Meilen nach Süden geritten, waren dann einige Zeit einem Arroyo gefolgt und hatten das ausgetrocknete Bachbett dann verlassen, um nach Westen zu reiten.
Chaco beobachtete aus der Deckung einer Gruppe von Pappeln heraus durch das Fernrohr. Die Banditen schlugen in einer Mulde am Fuße eines bewaldeten Hügels ihr Camp auf. Einer hängte gerade einen Wasserkessel über ein Feuer.
Chaco konnte fünf Männer sehen. Sie hatten zwei Gefangene bei sich , also mussten es drei Banditen sein. Aber nach den Fuß- und Hufspuren vor der Station hatte er angenommen, es mit vier Banditen zu tun zu haben. Er schwenkte das Fernrohr in die Runde, konnte aber keinen weiteren entdecken. Möglich, dass einer von ihnen voraus geritten war, um vielleicht ihre Ankunft zu melden oder den Weg zur Grenze zu erkunden. Chaco vermutete, dass sie nach Mexiko wollten, denn meilenweit hatte die Fährte schnurgerade nach Westen geführt.
Er bedauerte, dass Barbara Greenville nicht in der Lage gewesen war, ihm Fragen zu beantworten. Er hatte wissen wollen, wie viele Banditen es waren, was sie gesagt hatten, aus welchem Grund sie die beiden Söhne entführt haben konnten, doch alles, was Barbara Greenville gesagt hatte, hatte sie von sich aus gesagt; seine Fragen hatte sie wohl gar nicht verstanden.
Warum dieser brutale Mord und Mordversuch und die Entführung? Warum das abgeschnittene Haar der alten Frau?
Das waren Punkte, die Chaco Rätsel aufgaben.
Ob die Verbrecher Beute gesucht hatten? Möglich, wenn auch nichts darauf hinwies, dass die Zimmer durchwühlt worden waren, und die Einrichtung und anderes darauf schließen ließ, dass bei den Greenvilles nicht viel zu holen war. Chaco hatte aber auch schon erlebt, dass Leute, die man für die ärmsten Schlucker hielt, Reichtümer aus Gold oder Geld versteckt hatten. Möglich, dass die Verbrecher sich die Beute zielbewusst unter den Nagel gerissen hatten. Ebenso konnte es sein, dass die Banditen auf der Flucht vor dem Gesetz waren und sich nur frische Pferde hatten besorgen wollen, und dass sie geschossen hatten, weil Greenville sich widersetzt hatte.
Aber wozu dann die Entführung?
Damit sie Geiseln hatten, wenn das Gesetz auftauchte?
Chaco wusste noch keine Antwort auf all die Fragen.
Er hoffte, sie bald zu erhalten.
Er wartete auf die Dunkelheit. Dann konnte er die Kerle in ihrem Camp überraschen, wenn sie so lange dort rasteten.
Chaco saß ab und führte den Hengst tiefer zwischen die Bäume ins Halbdunkel. Dann legte er sich zwischen die Büsche am Rande des Trails und wartete. Vielleicht noch eine knappe Stunde. Er drehte sich eine Zigarette und hing seinen Gedanken nach. Er musste an die Wilsons denken, und die Zigarette schmeckte ihm nicht mehr so gut. Leicht bitter.
Er war froh, diese Leute nicht mehr zu sehen. Er traute Wilson zu, dass er Tony noch Schwierigkeiten bereitete, aber Tony würde schon mit ihnen fertig werden. Das war kein dummer Junge, der sich ins Bockshorn jagen ließ.
Die Schatten der Dämmerung krochen schließlich über das Land. Die Sonne war hinter den Hügeln verschwunden, und nur der Himmel war noch in einen rötlichen Schimmer getaucht, der ein einziges weißes Wölkchen an den Rändern rosa färbte.
Ein leichter Nordwestwind trieb den Duft von Wacholder und Blumen herüber und brachte etwas Kühlung nach der Hitze des Tages.
Chaco beobachtete eine Eidechse, die seitlich von ihm davonhuschte, als er den Hufschlag hörte.
Ein Reiter näherte sich im Galopp auf dem Trail, auf seiner Fährte. Er musste jetzt in der Senke unterhalb des Waldstücks sein. Die Sicht auf ihn war verdeckt.
Chaco zog seinen Army-Colt und überprüfte ihn. Er hatte nicht vor, zu schießen, denn ein Schuss würde von den Banditen gehört werden. Er hatte auch nicht vor, sich dem Reiter zu zeigen, es sei denn, es wäre ein Sheriff oder Marshal, der auf der Fährte der Banditen ritt. Jeder andere konnte eine Gefahr sein, unter Umständen ein Kumpan der Banditen, der die Gegend erkundete. Schließlich kannte er sie nicht und hatte nicht mal eine Beschreibung von ihnen.
Das Beste war also, unsichtbar zu bleiben und abzuwarten, wie sich die Dinge entwickelten.
Chaco spähte zum Trail hin. Dann tauchte der Reiter an der Wegbiegung auf.
Und Chaco glaubte seinen Augen nicht trauen zu können.
Es war Pamela.
5
Sie erschrak, als er zwischen den Büschen aufsprang. Sie war keine gute Reiterin. Das hatte er bemerkt, als er sie mal auf dem Morgan Hengst hatte reiten lassen. Sie hielt sich anscheinend jedoch für eine meisterhafte Reiterin. Schließlich bezahlte ihr Vater die wöchentliche Reitstunde in der Halle des noblen Reitklubs in Baltimore.
Sie stieß einen Laut des Erschreckens aus und zügelte das völlig erschöpfte Pferd so heftig und falsch, dass es auf die Hinterhand stieg. Ihre Füße rutschten aus den Steigbügeln. Sie versuchte noch, sich an der Mähne festzuklammern, doch es gelang ihr nicht. Sie rutschte nach hinten aus dem Sattel und setzte sich wenig elegant auf den Hintern.
Chaco war mit ein paar langen Sätzen bei dem Pferd, das wieder mit der Vorderhand aufsetzte, vor ihm scheute und sich drehte, wohl um in die entgegengesetzte Richtung zu fliehen.
Chaco konnte gerade noch die schleifenden Zügel packen. Er brachte das Tier schnell unter Kontrolle und redete beruhigend auf es ein. Das Fell des Pferdes war schweißnass, und seine Flanken zitterten. Pamela hatte es hart gefordert.
Sie saß wie ein Häufchen Elend im Staub, der sich träge senkte, sah zu ihm auf und lächelte zaghaft.
Es war ihr offenbar nicht viel passiert.
Chaco führte erst das Pferd in Deckung und band es an. Mit einem schnellen Blick vergewisserte er sich, dass die Reiterin vom Banditencamp aus nicht gesehen worden sein konnte. Auch den Hufschlag hatten sie dort nicht hören können.
Er ging zu Pamela.
„Was ist passiert?“, fragte er, denn er dachte, dass irgend etwas auf der Station passiert sein musste, was Gregory oder die Wilsons veranlasst haben könnte, ihm Pamela nachzuschicken.
Doch Pamela dachte offenbar nur an sich.
„Ich hab’ nur einen furchtbaren Schreck bekommen.“
Sie streckte die Arme aus.
Er half ihr auf.
Im nächsten Augenblick warf sie sich an seine Brust und schlang die Arme um seinen Nacken.
„Chaco, ich – ich musste dich einfach wiedersehen.“
Sie duzte ihn zum ersten Mal, und sie presste sich an ihn wie eine leidenschaftliche Geliebte. Er spürte, wie sich ihr Busen unter einem heftigen, fast seufzenden Atemzug hob und senkte, und er roch ihren Duft eine Mischung aus Parfüm, Schweiß und Pferdegeruch.
Sie war nur einen halben Kopf kleiner als er, schlank, langbeinig und wohlproportioniert. Sie blickte aus leicht verschleierten blauen Augen zu ihm auf.
„Küss mich, Chaco.“
Sie schloss die Augen und bot ihm die Lippen dar.
„Bist du mir deshalb nachgeritten?“, fragte er, und er glaubte die Antwort schon zu wissen.
„Ja. Ich – ohne dich konnte ich es nicht aushalten. Ich hatte gedacht, dass bis Del Rio noch etwas passiert – zwischen uns, meine ich. Außerdem haben wir da drei volle Tage Aufenthalt. Drei Tage und drei Nächte. Da hättest du schon deine Zurückhaltung aufgegeben. Aber als Vater dich fortschickte wie einen ...“
Er löste sich von ihr und schob sie von sich. Nicht so sanft, wie er beabsichtigt hatte.
„Dein Vater hat mich nicht fortgeschickt“, stellte er richtig. „Weiß er von deiner Dummheit, allein hier durch die Wildnis zu reiten?“
Ihre Miene spiegelte die Enttäuschung wider.
Sie hatte ein schönes Gesicht und einen schönen Körper, und sie war sicherlich die Beste der Wilsons, doch Chaco hatte sie auf dem langen Weg zu oft dummes Zeug plappern hören. Er hatte gespürt, dass sie ihm gefallen wollte, dass sie ein Abenteuer suchte. Aber er bezweifelte, dass es um seiner selbst Willen geschah, sondern einfach nur, weil er anders war als die geschniegelten Burschen in Baltimore, mal etwas Besonderes für ein verwöhntes Mädchen, das sich bestätigt sehen wollte. Er glaubte sie schon bei ihren Freundinnen reden zu hören, über Abenteuer, die sie auf dieser Reise nie erlebt hatte, über all das, was sie sich wohl erträumt hatte und was ihr Vater für sein Geld zu kaufen geglaubt hatte.
„... und dann war da noch ein wildes Halbblut, fast so’n richtiger Indianer, unser Leibwächter. Gleich in der ersten Nacht ist er in unserem Camp mitten in der Prärie über mich hergefallen. Und dazu haben die Kojoten geheult, und aus der Ferne klang der Trommelwirbel von Comanchen, denen wir gerade noch entkommen waren. Ach – es war einfach himmlisch. Ihr solltet auch mal in den Westen fahren. Da ist mehr los als bei euren Kaffeekränzchen ...“
So oder ähnlich konnte er sich Pamelas Bericht gut vorstellen. Es war praktisch eine Zusammenfassung all ihrer bisherigen Äußerungen.
Das ging Chaco in Sekundenschnelle durch den Kopf.
Pamela strich sich eine Strähne ihres hellblonden Haars aus der Stirn. „Nein“, antwortete sie.
„Sie werden sich sorgen.“
„Die doch nicht. Ich bin kein kleines Kind mehr. Du bist nicht der erste Mann für mich. Aber der erste, dem ich nachgeritten bin.“ Sie lächelte ihn an.
Er sagte nichts.
„Zehn Minuten nachdem du weg warst, habe ich mir ein Pferd von der Station genommen und mich davongemacht. Ich habe ihnen eine Nachricht hinterlassen, dass sie nach Del Rio fahren und dort auf uns beide warten sollen. Vater kam aus der Station gerannt, als er den Hufschlag hörte und brüllte hinter mir her: Dann reite doch zum Teufel!“ Sie lachte. „Und da bin ich. Mensch, bist du schnell geritten.“ Ihr Blick forschte in seinem Gesicht. „Warum schaust du mich denn so grimmig an? Bist du böse?“
„Ja“, erwiderte er, und es erinnerte an ein Knurren. „Ich bin böse.“
Ihr Lächeln erstarb. Sie senkte den Kopf. Ihre Wangen röteten sich.
„Das musst du doch verstehen“, sagte er etwas milder. „Ich reite hier nicht zum Vergnügen herum. Da vorne sind Mörder und Banditen.“ Er nickte in die Richtung. „Mit den Gefangenen. Da kann ich nicht noch auf ein vergnügungssüchtiges Mädchen aufpassen.“
„Hast du sie tatsächlich gefunden?“ Ihre Neugier war so groß, dass sie seine Worte offenbar nicht übelnahm. Sie spähte durch die Dämmerung. „Ich kann nichts erkennen. Das heißt, doch – da ist ein rötlicher Punkt. Ein Feuer?“
Er nickte und nahm das Fernrohr.
Im Camp hatte sich nichts verändert.
„Darf ich auch mal sehen?“
Er reichte ihr das Glas.
Sie schaute hindurch. „Das sind also die Verbrecher.“ Sie schüttelte sich. „Und die armen Gefangenen! Wie willst du sie befreien?“ Sie ließ das Fernrohr sinken und schaute ihn gespannt an.
„Nicht wie in ’ner Zirkusshow“, erwiderte er, immer noch wütend, weil sie sich mit ihrer Dummheit nicht nur in Gefahr begeben hatte, sondern ihn jetzt auch noch belastete.