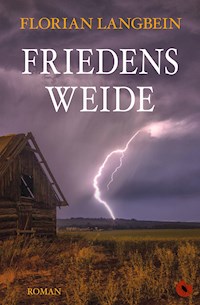7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Periplaneta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Periplaneta
- Sprache: Deutsch
Es braucht nur einen winzigen Funken, der das, was in uns schlummert, in ein gleißendes Inferno verwandelt, einen winzigen Funken, der uns die Grenzen unseres Lebens sprengen und uns in den Wahnsinn abgleiten lässt. Der menschliche Geist ist wie ein mit Benzin übergossener Haufen alter Autoreifen. Er kann sein eigener Scheiterhaufen werden. Wir müssen nur so mutig – oder so dumm sein, das Streichholz anzuzünden. Ein Mann sitzt ineinem Zug in der Zukunft und erinnert sich an ein Damals, das unser Heute sein könnte. In diesem Damals begleiten wir Menschen, die ihre fragilen Leben in Flammen aufgehen lassen. Eine atemberaubende Geschichte über die Zerbrechlichkeit von Empathie, über die Dynamiken innerhalb einer Gruppe und die Trivialiät hinter dem Gespenst des Terrorismus. (Coverfoto: fusssergei; Archivfotos, lizenzfreie Bilder, Grafiken, Vektoren, stock.adobe.com)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
FLORIAN LANGBEIN: „Wetterleuchten“ Roman 1. Auflage, November 2018, Periplaneta Berlin
© 2018 Periplaneta - Verlag und Mediengruppe Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin www.periplaneta.com
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig.
Lektorat: Swantje Niemann Coverfoto: fusssergei https://stock.adobe.com Satz & Layout: Thomas Manegold
print ISBN: 978-3-95996-121-9 epub ISBN: 978-3-95996-122-6
Florian Langbein
Wetter
LeuchteN
Roman
periplaneta
Vorwort des Herausgebers
Man sagte über den Mann nie etwas. Er war einfach da, lebte viele Jahre vor sich hin in der alten Villa in xx, einem kleinen Dorf im Hinterland von Maruggio, an der südlichen Spitze des Stiefels von Italien. Es war und ist eine vergessene Region: Vergessen vom Regen genauso wie von Europa, lebten in diesem Dorf nur ein paar alte Menschen, die genauso sonnenverbrannt und zerfallen waren wie ihre Häuser. Zwischen zerklüfteten Hügelchen, verbrannten Gräsern und staubtrockenem Boden vegetierten sie vor sich hin. Keine Polizei scherte sich um dieses Eck von Italien, kein Einzelhändler wagte sich in dieses Wespennest aus Katholizismus und Rückständigkeit. Die Alten versorgten sich größtenteils selbst und konnten nur überleben, weil sie mit zunehmendem Alter weniger und weniger zum Leben brauchten. Mit jedem Jahr wurden die Erträge auf den Feldern magerer, und sie ließen keine Gelegenheit aus, darüber zu klagen. Meine Großeltern lebten in xx, und so war ich jedes Jahr für einige Wochen zu Besuch, wie auch einige andere Jungs, die ihre Großeltern in diesem riesigen Sandkasten besuchten.
Wenn wir Jungen fragten, ob das Haus da draußen leer sei und ob wir zum Spielen da hin dürften, bekamen wir immer dieselbe Antwort: Da wohnt il Teutonico, der Deutsche. Bleib weg von da. Er lebte schon sehr lange da. Selbst als meine Eltern Kinder waren, haben sie meinen Großeltern dieselben Fragen gestellt. Und es war immer il Teutonico. Er verjagte Kinder von seinem Grundstück und verließ es selbst so gut wie nie, aber er arbeitete viel im Garten.
Nur einmal war er weg, für drei Wochen im Sommer des Jahres 2064. Alle dachten, er sei gestorben. Und doch machte sich niemand die Mühe, zu schauen, ob er nicht vielleicht tot in seiner Wohnung lag. Es wäre ein Leichtes gewesen: Die Menschen hier schlossen ihre Häuser nicht ab. Aber dann kam er wieder.
In einem so kleinen Dorf verursacht so etwas einige Aufregung: Schließlich hatte der Mann sein Grundstück in über 30, 35 Jahren nie verlassen. Täglich war er als ferner Punkt in seinem offenen Garten zu sehen gewesen, und dann war er für drei Wochen verschwunden. Die Alten munkelten, wie sie es immer taten. Sie munkelten, und verboten uns, Fragen zu stellen.
Jedenfalls ist von entscheidender Bedeutung, dass er wieder kam, wenn auch nur für kurze Zeit. Plötzlich sah man seine Silhouette wieder im Garten, und genauso plötzlich war er wieder verschwunden. Doch diesmal kam er nicht zurück. Die Alten munkelten wieder, aber bereits ein halbes Jahr, nachdem der alte Teutone wieder verschwunden war, sprach niemand mehr von ihm, so als hätte er nie existiert.
Doch uns Jungen interessierte er immer noch. Oder besser gesagt, die alte Villa, die er bewohnte: Sie hatte die Form eines Hufeisens, und ein Seitenflügel war eingestürzt. Zehnjährige Jungen werden von solchen Ruinen geradezu magisch angezogen. Eines Tages nahmen wir all unseren Mut zusammen und gingen hin. Auf den verwitterten Steinen herumzuklettern, erschien uns, jetzt, da wir es taten, längst nicht mehr so interessant, wie es in unserer Vorstellung gewesen war. Wir hatten es unsere gesamte Kindheit lang ersehnt, und jetzt war es nur ein Geröllhaufen wie viele andere auch.
Nach einer halben Stunde Kletterei entdeckte einer, ich glaube, es war Jacopo, dass hinter dem Haus ein Fenster offen stand, so als wollte uns der Teutone einladen. Wir kletterten hinein. Alles war noch da: Teller, Besteck, Tassen, Kleidung, Bettlaken ...
Wie Jungs in diesem Alter eben sind, vergnügten wir uns damit, ein paar Teller zu Boden zu werfen, wir waren schließlich sicher, dass der alte Teutone niemals wiederkommen würde. Warum wir da so sicher waren, wussten wir nicht. Ich hatte kurz vorher zu Hause reichlich gegessen und getrunken und wollte deswegen bald erkunden, ob die Toiletten des Hauses noch funktionierten. Wenn nicht, halb so wild. Der Teutone hatte schließlich schon einige Teller weniger, also würden ihn Urinspuren in seiner Toilette auch nicht weiter stören.
Jedenfalls fand ich unter der Treppe einen Stapel loser, computergeschriebener Blätter. Er zog meine Aufmerksamkeit auf sich, weil er als einziger Gegenstand in dem ganzen Haus nicht alt und verstaubt war. So als hätte der alte Deutsche sie nach seiner Rückkehr hier hingelegt, nur damit ich sie fand. Die Blätter waren gelocht und mit einem Schnürsenkel zusammengebunden. Ich konnte sie nicht lesen – natürlich nicht, sie waren auf Deutsch. Ich nahm sie an mich, steckte sie unter mein T-Shirt und kehrte zurück zu meinen Freunden. Ich sagte ihnen, ich fühle mich nicht wohl, und rannte mit dem Manuskript des Deutschen nach Hause. Dort legte ich es unter mein Bett, dorthin, wo meine Großmutter niemals hinschaute, weil sie wusste, dass ich da unten immer ihre Geburtstagsgeschenke versteckte.
Viele Jahre später, während meines Studiums in Bologna – ich hatte den Süden so schnell wie möglich nach meinem Schulabschluss verlassen, da er, während Europa unaufhaltsam in die Zukunft stürmte, immer tiefer in der Vergangenheit versank –, hatte ich die Gelegenheit, ein paar erste Brocken des Manuskripts zu lesen. Ich lernte Deutsch, um es vollständig zu verstehen, ich las es, ich studierte ein Semester in Hamburg, ich las es wieder, und jetzt lebe ich in Stuttgart als Übersetzer aus dem Italienischen ins Deutsche und umgekehrt.
Man könnte also sagen, dass der Fund dieses Manuskripts meinem Leben eine Richtung gegeben hat. Das Manuskript und die Entscheidung, Süditalien zu verlassen, das nach der Ankunft der Flüchtlinge am Anfang des Jahrhunderts vergessen worden war, verarmte und langsam weiter zurück in das letzte Jahrtausend rutschte.
Jedenfalls erscheint es mir jetzt, im reifen Alter, richtig, das Manuskript herauszugeben, das ich so oft gelesen habe.
Ich wünschte, ich könnte in dieser Ausgabe verifizieren, dass das, was der alte Teutone berichtet, sich auch wirklich so zugetragen hat, aber das ist leider unmöglich. Ich bin viel gereist in meinem Leben, ich habe die Orte besucht, von denen der Teutone spricht, ich habe in Bibliotheken und Archiven von Zeitungen versucht, eine Bestätigung für seine Geschichte zu finden.
Aber es war unmöglich. Es ist, als habe der alte Mann nie existiert – vielleicht hat er es auch nie, zumindest nicht als die Person, als die sich der Ich-Erzähler in diesem Manuskript ausgibt. Aber ob es sich um einen Tatsachenbericht oder um eine Geschichte handelt, das ist nicht das Problem des Herausgebers
Im Zug, natürlich
Ich sitze im Zug. Natürlich, wie passend. Die Geschichte, die ich nun zu schreiben beginne, hat sich vor 49 Jahren zugetragen. Und sie begann ebenfalls in einem Zug.
Mein Name ist Thorsten Lagerstätt und ich schwitze in meiner Kleidung, obwohl ich meine Strickjacke schon abgelegt habe. Diese schwüle deutsche Luft bekommt mir nicht nach vielen Jahren im Süden. Ich bin 76 Jahre alt, ehemaliger evangelischer Pfarrer. Nachdem ich ausgebrannt, depressiv und erfolglos ein Leben als professioneller Trinker aufgegeben hatte, um nach dem Studium ein Kind ernähren zu können, war ich zum Pfarramt gekommen wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind (als evangelischer Pfarrer darf man so etwas sogar sagen), weil mir dieser Job arbeitsarm und zukunftssicher erschien. Ich habe geheiratet und meine Tochter Linda genannt. Seitdem betrieb ich das Trinken nur noch semiprofessionell, sozusagen eher als Berufung statt als Beruf.
Da sich die Geschichte, die ich erzählen werde, vor 49 Jahren zugetragen hat, möchte ich in die Vergangenheit reisen, in das Jahr 2015. Es ist keine weite Reise, da sich seitdem kaum etwas verändert hat. Ja, die ICEs fahren heute etwas schneller, die Verbindungen sind auch besser, aber die leicht nach Kuhstall muffelnde Dame, die soeben zugestiegen ist, könnte genauso auch im Jahr 2015 zugestiegen sein: Sie ist dick und trägt weite Kleidung. Schwitzend und glubschäugig stiert sie im Inneren des Zuges umher. Wahrscheinlich ist das die erste Fahrt, die sie weiter als drei Dörfer von ihrem Bauernhof wegbringt.
Sie grinst obszön und kramt aus ihrer Reisetasche ein Wurstbrot hervor, das fast nur aus Wurst besteht. Das hätte Linda gefallen, als sie noch klein war! Sie sieht mich kauend und grinsend an – ein widerlicher Anblick. Ich ziehe einen Flachmann aus der Brusttasche meines Hemds, genehmige mir einen Schluck, und sie sieht verschämt weg. Manche Dinge ändern sich nie: Seit 49 Jahren sitzen in jedem Fernverkehrszug ein Bauerntrampel und ein alter Mann mit Alkoholischem.
Und auch die Welt im Jahr 2015 war so ziemlich dieselbe wie die heutige: Finanzkrisen kommen und gehen, und immer scheint gerade genug Geld da zu sein, um das eine fiskalische Loch zu stopfen, während sich deswegen woanders ein neues auftut. So hält sich die Welt einigermaßen im Gleichgewicht.
Kriege gibt es auch noch, aber weil sie nicht mehr Kriege genannt werden und immer da stattfinden, wo wir nicht sind, interessieren sie niemanden groß. Wir waren nicht fauler und nicht fleißiger im Jahr 2015, wir waren genauso medial und digital abhängig. Wir verstanden damals und verstehen heute etwas von Politik, aber wir wussten und wissen, dass sie auch ohne uns sehr gut zurechtkommt. Ob wir sie verstehen oder nicht, ob wir sie beeinflussen oder nicht, sie passiert. Die Welt braucht uns nicht, damals wie heute. Aber wir brauchen sie.
Wenn man jung ist, weiß man das noch nicht. Man fühlt sich wichtig, fühlt sich groß und benötigt. Wenn man erwachsener (ich sage hier bewusst ‚erwachsener‘, denn von meinem Ich im Jahr 2015 wird niemand sagen können, es sei erwachsen) wird, lässt das langsam nach, aber dafür gibt es Alkohol. Viel Alkohol wird in meiner Geschichte fließen, aber ich will den Ereignissen nicht vorgreifen. Wer rebellisch sein will, wer weiterhin in der Illusion leben möchte, von der Welt benötigt zu werden und wichtig zu sein, der trinkt. Das ist eine der elementaren Wahrheiten des Lebens.
Man verstehe mich nicht falsch, ich war nie das, was man einen Alkoholiker nennt. Ich bin nie frühmorgens zu Tankstellen gepilgert, um billigen Korn zu kaufen, war seit über 30 Jahren nicht mehr bewusstlos und habe mich und meine Ausscheidungsorgane auch sonst ganz gut im Griff. Die lustige und auch beschämende Wahrheit ist: Ich bin einfach unheimlich gerne betrunken. Man könnte es als Hobby bezeichnen.
Doch das Alter lässt mich nicht mehr trinken. Früher habe ich bis zu einer Woche andauernde Sauftouren unternommen und bin am achten Tag arbeiten gegangen. Heute befindet sich in meinem Flachmann Wasser mit ein paar Tropfen Single Malt. Kein Whisky Soda, eher umgekehrt. Soda Whisky. Gerade genug, um mich nicht schämen zu müssen, wenn ich der Dorftrulla den bemitleidenswerten Süchtigen vorspiele, damit sie mich nicht mehr aus ihren dummen Triefaugen anstarrt.
Zurück zum Jahr 2015. Wir dachten damals, die Welt sei kurz vor ihrem Untergang, und denken es noch heute. Mittlerweile glaube ich, dass die Welt kurz vor dem Untergang steht, seit es sie gibt. Oder anders gesagt: Seit es die Menschen gibt, denken sie, die Welt ginge unter. Sie ging unter, als Julius Cäsar das Jahrhunderte alte System der römischen Republik ausgehebelt hatte, und kurz darauf ging sie wieder unter, weil sich die Menschen an den Gedanken gewöhnt hatten, ohne Cäsar ginge die Welt unter. Sie ging zum Wechsel des Jahrtausends unter, sie ging unter, als der französische Pöbel einem König den Kopf abgeschlagen hatte. Sie ging sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg unter, und alle wussten es. Als sich in der Schweinebucht sowjetische und amerikanische Kriegsschiffe gegenüberstanden, fast in Sichtweite, fassten sich die Menschen an den Händen in der Gewissheit, dass am nächsten Tag die Welt, die sie kannten, nicht mehr existieren würde. Muss ich noch mehr sagen?
Jahrtausende des Weltuntergangs haben uns abgestumpft. Wir wissen, sie geht unter, aber irgendwann hat es aufgehört, uns zu kümmern. Gerade zur zweiten Jahrtausendwende schien sich die Welt eine Pause von ihrer Untergangspanik zu gönnen. Die Medien berichteten viel über die Eurokrise in Griechenland, aber so richtig besorgte das niemanden. Es war nur Geld, und es war vor allem nicht unseres ... Es war Steuergeld, und deshalb war es egal, ob es für griechische Banken, Bildung oder Brunnen in Afrika verwendet wurde. Der deutsche Steuerzahler wusste, dass jede Staatsausgabe Verschwendung war, und meinte, das Geld sei genau da am besten aufgehoben, wo es gerade nicht hin investiert wurde. Wären die Milliarden statt in griechische Banken in neue Schulen investiert worden, hätte man sich an Stammtischen darüber beschwert, dass die Bälger doch keine rückenschonenden Stühle bräuchten.
Gelegentlich hörte man von ertrunkenen Flüchtlingen, die an der Küste Italiens angespült wurden, aber auch das quittierte die deutsche Öffentlichkeit mit einem Schulterzucken. Die Afrikaner starben doch sowieso, wie alle Menschen. Ob sie das jetzt in Afrika taten oder im Mittelmeer, war Europa egal. Natürlich gab es im Sommer 2015 schon Neonazis. Aber die hatte es schon immer gegeben, also musste man auch keine kostbare Sendezeit auf sie verschwenden.
Es war der Sommer vor der großen Hysterie, die Monate, bevor die Grenzen geöffnet und dann noch dichter geschlossen wurden, bevor alle Menschen zuerst mit Refugees-Welcome-Plakaten zu den Bahnhöfen rannten und sich dann wieder in ihre Löcher zurückzogen, um zu nörgeln. Es war, bevor zwei Flüchtlingsheime pro Woche brannten, bevor Rechtspopulismus eine ernstzunehmende politische Kraft wurde, bevor alle anderen Parteien sich zuerst geradezu hysterisch für Flüchtlinge einsetzten, um dann wieder in Teilnahmslosigkeit und Apathie zu versinken. Es war ein Sommer voller Weltuntergangsfantasien, deren Stand-By-Taste gedrückt war. Und nur in so einem Sommer konnte auch meine Geschichte passieren.
Sie nahm ihren Lauf, als nüchterner Egozentrismus der Welt eine Verschnaufpause vom Untergang gewährte. Aber wir waren weder nüchtern noch egozentrisch. Im Gegenteil: Wir soffen, um nicht egozentrisch zu werden. Alkohol verlieh uns die Fähigkeit, den desolaten Zustand der Welt zu erkennen, die metaphorische Klippe, auf die unsere Erdenkugel unaufhörlich zuzurollen schien, und zugleich flüsterte er uns ein, dass wir sie vorher auffangen und wieder ins Gleichgewicht hieven konnten. Dass diese großartigen Erkenntnisse des Rausches am nächsten Morgen vergessen waren, versteht sich von selbst. Aber dagegen half nur eines: Weitertrinken.
Selbst als Anfang des Jahres eine gewisse Gruppe namens ‚Hadones‘ auftauchte, die, ähnlich der RAF, Brandbomben in Kaufhäuser warf, Autos anzündete und Unordnung stiftete, verursachte das nur müdes Schulterzucken. Das kollektive Gewissen des leidgeprüften und abgestumpften Deutschen hatte schließlich schon Schlimmeres erlebt, die RAF zum Beispiel. Oder den NSU. Solange keine Politiker exekutiert wurden, konnte man damit leben, dass eine vermutlich linke Terrorzelle ein paar Autos in die Luft sprengte.
Wahrscheinlich nur gelangweilte Punks, man würde ihnen schon bald das Handwerk legen, sagte man und wandte sich dem nächsten Thema zu. Ich hatte keine Ahnung, ob der Name ‚Hadones‘ für irgendetwas stand, doch in meinen Ohren klang er annähernd wie Altgriechisch. Ich will und kann nicht so tun, als sei ich klassisch gebildet, aber ich hatte während meines Theologiestudiums ein paar Semester Altgriechisch belegen müssen. Zumindest konnte ich Sokrates in dieser Sprache buchstabieren und den Anfang des Gedichtes „Wanderer, kommst du nach Sparta ...“ von Semonides aufsagen. Oh xein angellein ... „ Wanderer, kommst du nach ...“ könnte der Titel meiner Erzählung sein.
Nachdem die Brücke in das Jahr 2015 nun geschlagen ist, will ich die Geschichte erzählen, wie ich sie damals erlebt habe, völlig frei von den lästigen und moralisierenden Zwischenkommentaren eines alten Mannes. An dieser Stelle betritt nun der 27-jährige Thorsten Lagerstätt die Bühne, naiv und dumm. Er ist überfordert mit einer Ehefrau und einer Tochter. Trotzdem schaut er zuversichtlich in eine Zukunft, die so schlecht nicht sein kann. Schließlich kann er sich gelegentlich noch betrinken. Er hat gerade seine erste Stelle im Vikariat angetreten, nachdem er sein Studium genauso unwillig beendet wie begonnen hat.
Seine Geschichte beginnt, wie bereits erwähnt, in einem Zug.
INFERNO
Erster Tag
Ankunft
Ich saß in einem Zug. Es war Juli und ich schwitzte, obwohl nur ein achselfreies Shirt meinen blassen, dürren Oberkörper bedeckte. „Natürlich, ich melde mich. Ich verbringe eine Woche mit meinen Freunden, das heißt nicht, dass ich wie vom Erdboden verschluckt sein werde. Keine Sorge, ich rufe an“, sagte ich ins Telefon, obwohl meine Frau genau wie ich wusste, dass ich nicht anrufen würde.
„Sauf nicht so viel“, mahnte sie und meinte es so.
„Ja“, antwortete ich unaufrichtig.
Ich hatte eine zweijährige Tochter, Linda. Schlimm genug, dass ich meine Woche Urlaub nicht bei ihr verbrachte, aber ich nahm mir fest vor, nach dieser Woche wieder mehr für sie da zu sein. Irgendwann, sagte ich mir, muss ein Mann seinen Hedonismus für Höheres aufgeben.
Ich hatte Theologie studiert, während ich daran scheiterte, Schriftsteller zu werden – oder nachdem es mir geglückt war, Trinker zu werden. Ich hatte zwar gelegentlich einmal eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht in einer Anthologie unterbringen können, jedoch war die Bezahlung immer gerade gut genug, um mir für den nächsten Monat Zigaretten leisten zu können, für die Miete hat es nie gereicht. Ich bin rückblickend sehr froh, das früh erkannt zu haben, so dass ich nun im Vikariat das Kleingeld hatte, eine Tochter zu ernähren. Ich habe zeit meines Lebens nie an Gott geglaubt, aber wenn es ihn doch geben sollte, hätte er so viel zu verzeihen, dass er auch dieses bisschen Heuchelei vergeben konnte.
Maria, meine Ehefrau, hatte in Südamerika in einem Waisenhaus gearbeitet, wurde aber auf offener Straße von einem Unbekannten angeschossen und kam auf einem Auge blind nach Deutschland zurück, wo sie, bevor sie schwanger wurde, als Sprechstundenhilfe gearbeitet hatte. Nein, es war keine Liebe. Den Glauben daran hatte ich vor langer Zeit aufgegeben. Aber wir kamen gut miteinander aus und gaben einander Halt.
Vor einem knappen Monat hatte ich einen Anruf erhalten, von David, meinem besten Freund. Sein Anruf überraschte mich, da das Letzte, was ich von ihm gehört hatte, war, dass er auf einem Fischkutter einer NGO afrikanische Flüchtlinge beziehungsweise deren Leichen aus dem Mittelmeer fischte und gelegentlich Farbbomben oder Paintballmunition auf die Schiffe von Frontex warf, wenn diese an ihm vorbeifuhren. Er war immer der Radikalste von uns gewesen.
„Hey, lange nichts mehr von dir gehört“, meldete er sich. „Wie ist das Leben zu dir?“
Er klang heiser, etwas geschwächt, aber darüber machte ich mir keine Sorgen, David war praktisch immer verkatert.
„Es fließt vor sich hin. Meine Tochter hält mich auf Trab, sonst passiert nicht viel. Schön, dass du anrufst. Bist du etwa wieder in Deutschland?“ antwortete ich.
„Aber sicher. Wie sieht’s aus, mal wieder Lust auf einen Raubzug?“
Noch bevor er seinen Satz beendet hatte, sagte ich: „Klar. Wann?“
Ich wäre sofort losgefahren. Tatsache ist, dass wir immer alle sofort losgefahren sind, wenn David anrief.
„Ja. Pass auf, in der letzten Juliwoche wären die Pfadfinderhütten im Kressbacher Forst frei. Eine Woche, nur wir?“
Ich schmunzelte. Wir ... Es war nicht nötig, mehr zu sagen. Wir, das waren David, ich, Christian, Karl, Nick, Stephan, Sophie und Larissa.
„Weißt du, das könnte etwas schwierig werden, ich kann in dieser Zeit meine Schäfchen kaum allein lassen. Ich habe ja jetzt Hirtenpflichten. Ich wollte Anfang August Urlaub nehmen, damit Maria und ich uns auf die Suche nach einem Haus machen können. Die Wohnung wird einfach zu klein, wenn Linda größer wird. Irgendwann braucht sie ein eigenes Zimmer.“
Am anderen Ende herrschte kurz Stille. „Bitte“, sagte David leise. „Bitte komm. Alle anderen sind auch da. Es ist wichtig, ich habe etwas mit euch vor.“
Das konnte alles bedeuten, von „gemeinsam trinken“ bis hin zu „einen dritten Weltkrieg anzetteln“.
„Ich ... ich rede mal mit Maria und melde mich wieder“, sagte ich.
David lachte. „Ach Thorsten, du hast dich doch längst entschieden. Samstagabend, am vorletzten Juliwochenende bei den Pfadfinderhütten. Stell dich notfalls krank, wie immer. Bis dann.“
Er hatte recht, ich hatte mich entschieden.
Nach drei Streitereien mit meinem Chef und vier mit meiner Ehefrau innerhalb eines Monats (die ersten drei kreisten darum, meinen Urlaub zu verschieben, die letzten vier darum, dass ich meiner Frau von der Verschiebung des Urlaubs nichts gesagt hatte und überdies die Woche nicht daheim verbringen würde), saß ich nun im Zug, einen Rucksack, eine Isomatte und einen Schlafsack im Gepäck. Mehr würde ich wohl kaum benötigen.
Ich freute mich. Ich erwartete nichts und alles. Ich und David waren unzertrennlich, seit wir gemeinsam laufen gelernt hatten. Wir waren zusammen im Kindergarten und zusammen in der Grundschule gewesen und hatten dann gemeinsam unser Abi gemacht. Nach und nach kamen die anderen sechs dazu, aber in der siebten Klasse waren wir vollzählig, bis auf Larissa, die erst etwas später zu uns stieß. Seitdem existierten wir nur noch gemeinsam.
Das heißt, hauptsächlich feierten wir gemeinsam. Es hatte mit heimlichen Zigaretten auf dem Lehrerparkplatz und einigen Sixpacks Mischbier an Bushaltestellen begonnen und wurde immer opulenter. Feiern und Drogen waren nichts, das wir als Ausgleich zu unserem sonstigen Leben taten, nein, es war unser Leben, unsere Bestimmung, unser einziges Hobby. Und wir waren richtig gut darin.
Und darüber schwebte immer die Musik. Wir mochten die richtig alten Sachen: Musiker, die so gelebt hatten wie wir, aber in einer Zeit, in der man wegen Alkohol und Drogen noch nicht in Klatschblättern zerrissen wurde: Johnny Cash, die Rockbands der 70er und vor allem Joe Cocker. Seine Musik hatte alles, was wir brauchten: Leidenschaft, Gefühl, Härte. Man hörte jedes Glas Whisky und jede Zigarette. Seine Stimme war das akustische Ebenbild unseres Lebens.
Wir hatten auch geschafft, was sehr wenige Cliquen schafften: Wir sahen uns regelmäßig, nachdem wir uns nach dem Abi in alle Windrichtungen verstreut hatten, zunächst sogar fast jedes Wochenende. Das ließ natürlich nach, als wir so langsam unsere Plätze im Leben fanden. Ich war verheiratet und hatte ein Kind, David setzte sich nach Süditalien ab, um für „Human Rights Watch“ oder so zu arbeiten, Christian hatte eine feste Freundin und eine Adoptivtochter in Dänemark, und Sophie jettete sowieso immer um die Welt, um das Geld ihres Vaters zu verprassen. Aber von Zeit zu Zeit kamen wir trotzdem immer wieder alle zusammen. Meist zu Geburtstagen, sonstigen Festen, oder einfach nur dann, wenn jemand mal wieder jemanden zum Reden brauchte oder sich einfach nur betrinken wollte.
Wir betranken uns gerne bis fast zur Bewusstlosigkeit, aber irgendwie klappte das immer nur miteinander. Zu Hause bei meiner Frau rührte ich fast gar keinen Alkohol mehr an, und selbst als ich noch studierte, habe ich mich kaum jemals mit meinen Kommilitonen betrunken. Es gab immer nur uns und den Alkohol. Und jetzt freute ich mich auf eine Woche mit meinen ältesten und besten Freunden, die wir wie Caligula verbringen würden. Was auch immer David mit uns vorhatte, es konnte nur großartig werden.
Die Sonne hatte ihren Zenit bereits überschritten, als ich am Bahnhof der Kleinstadt ausstieg, die ich gleichzeitig liebte und hasste. Wie immer fiel mir als Erstes die heruntergebrannte Fabrikruine direkt gegenüber dem Bahnhof ins Auge. Sie war schon lange, bevor ich zur Welt kam, eine Ruine, und ebenso lange ein Treffpunkt von Straßenkötern jeder Art. Ich lief zu ihr hin, setzte mich auf die Stufen vor der schiefen, verkohlten Eingangstür und zündete mir eine Zigarette an. Von drinnen hörte ich das Klappern von Bierflaschen und Stimmen im Stimmbruch. Manche Dinge verändern sich nie.
Ich überlegte, ob ich mir ein Taxi rufen sollte, während auf der anderen Straßenseite ein alter Mann in Jogginghosen im Mülleimer wühlte und eine Plastiktüte auf der Straße vorbeiwehte. Nein, dachte ich, ich würde laufen. Ich war wie der alte Mann in den Jogginghosen ein Kind dieser toten Stadt, ein Straßenköter, und mich verband mehr mit ihm als mit meinen Arbeitskollegen in meiner Gemeinde. Der alte Mann sammelte Pfandflaschen, um sich ein Abendessen leisten zu können, also würde ich es auch schaffen, die knapp sechs Kilometer zu den Pfadfinderhütten zu laufen.
Schon kurz nachdem ich das Ortsschild passiert hatte, war ich schweißüberströmt und fluchte leise in meinen Bart hinein. Selbst dieser war mir zu warm, ich hasste es, wie Schweißtropfen in ihn hineinrannen und mich kitzelten. Vor mir breiteten sich Felder und Dörfer aus. Wenn man ein Postkartenmotiv von der Mitte Deutschlands benötigte, hier war es. Aber das war mir, mit Verlaub, scheißegal. Ich saß den ganzen Tag am Schreibtisch, rauchte, und die einzige Bewegung, die ich bekam, war, gelegentlich am Sonntag durch das Kirchenschiff zur Kanzel zu schreiten, um von dort aus weltfremden Unsinn in mein Publikum zu werfen. Und genau das bekam ich nun bitter zu spüren, als mir in den klobigen Wanderstiefeln die Füße kochten und der Rucksack auf den Schultern festklebte. Für das Wetter wären leichtere Schuhe, eigentlich Badeschlappen, angemessen, aber ich für sieben Tage in einer Pfadfinderhütte hatte ich mich lieber mit festerem Schuhwerk ausgestattet.
Ich lief am Rand der sanft ansteigenden Landstraße entlang und wusste, dass mir noch Schlimmeres bevorstand: Die letzten 500 Meter meines Weges waren so steil, dass selbst ein Auto im zweiten Gang Mühe hatte, diesen Hügel zu erklimmen. Als ich an der steilsten Stelle um die Kurve bog, fuhr ein Mercedes-SUV hupend an mir vorbei. In diesem überteuerten Monster saßen Karl und Christian und winkten lachend. Diese faulen Arschlöcher!
Dass Karl mittlerweile ein solch übertriebenes Auto fuhr, sah ihm ähnlich. Er war Anwalt irgendwo im Ruhrpott. Aber für uns würde er wohl immer der kleine Junge bleiben, dem man im Stundentakt das Maul verbieten musste. Wahrscheinlich war er deshalb so erfolgreich, weil keiner seiner Gegner vor Gericht die Chance hatte, seinen Redefluss zu unterbrechen.
Neben ihm saß Christian, der nach Dänemark zu seiner Lebensgefährtin gezogen war. Er war Handwerker, und zwar einer von der Sorte, die zu gut für jeden Betrieb war. Wer Gitarrensoli von Jimmy Hendrix nachspielen und gleichzeitig schreinern konnte, der baute Gitarren. Genauer gesagt, Gitarrenhälse, aus irgendeinem ganz bestimmten Holz, das nur in Dänemark wuchs. Sündhaft teuer, alles Einzelanfertigungen. Ich kenne mich nicht mit Gitarren aus, aber wer mit 26 Jahren einen Gitarrenhals an ein ehemaliges Mitglied von Pink Floyd verkauft hat, dem konnte man durchaus einen gewissen Erfolg bescheinigen. Wie besagter Musiker auf einen kleinen Ein-Mann-Betrieb in einer winzigen Kleinstadt in Dänemark aufmerksam geworden war, blieb ein Mysterium, genauso wie die Frage, wie Christian an eine dänische Freundin gekommen war, ohne Dänisch zu können. Ich hatte sie nie kennengelernt.
Keuchend stolperte ich die letzten Meter zu dem silbernen, protzigen Monster, vor dem die beiden lachend standen. Sie waren auf eine Waldlichtung abgebogen und hinter ihnen erkannte ich die Hütte, die für die nächsten Tage unser Quartier sein würde. Neben ihnen waren Schlafsäcke, Isomatten und Taschen verteilt. „Du hast schon mal besser ausgesehen, Thorsten“, begrüßte mich Karl.
Ich antwortete mit einem herzlichen „Halt’s Maul, Karl!“ und umarmte den etwas kleineren Mann mit der Glatze und dem kurzärmeligen Hemd.
Christian rief: „Fass mich bloß nicht an, du bist ja klatschnass.“
Trotzdem umarmte ich auch ihn und bekam dabei eine volle Ladung langer, muffiger Dreadlocks ins Gesicht. Meine Augen waren ungefähr da, wo seine Zotteln endeten, knapp über seiner Brust, und ich war beileibe nicht klein. Christian grinste so selbstzufrieden wie Bud Spencer und Terence Hill, die auf sein T-Shirt gedruckt waren.
„Hat David euch gesagt, warum er uns herbestellt hat?“, fragte ich, während Karl gleichzeitig begann: „Wie geht’s deiner Tochter?“
Christian fiel nichts Geistreicheres ein als: „Ich könnt’ ein Bier vertragen.“ Wir mussten alle drei lachen.
„Also der Reihe nach: Wisst ihr, was David mit uns vorhat?“, begann ich von neuem.
Karl schüttelte den Kopf. Christian warf schulterzuckend ein: „Der Herr wird mal wieder Durst haben, nehme ich an.“
Wieder lachten wir, denn das war plausibel.
„Und jetzt erzähl mir, wie geht’s deiner Tochter?“ Karl war letztes Jahr zu Besuch bei mir gewesen und hatte einen richtigen Narren an Linda gefressen.
„Der geht’s gut. Sie legt mittlerweile schon ganz schöne Strecken zu Fuß zurück. Du warst ein schlechter Einfluss auf sie. Sie redet und redet, aber niemand weiß so recht, was sie sagen will. Vor allem das Abendessen ist meist etwas kompliziert mit ihr.“
„Wieso das?“, fragte Christian.
„Sie hat herausgefunden, dass Wurstbrote sich ziemlich gut werfen lassen. Das ist beim Mittagessen nicht so gut möglich. Zumindest nicht, wenn es Suppe gibt.“
„Die wird wie ihr Vater. Du musst ja so stolz auf das Gör sein“, grinste Christian.
Zu unserem Gelächter gesellten sich noch zwei weitere Stimmen. Stürmisch umarmte ich Larissa, während Stephan Christian so hart auf die Schulter klopfte, dass dessen Haare fast an Stephans Zigarette Feuer fingen.
Stephan war in etwa so groß wie ich, aber er hatte breitere Schultern. Die Haare trug er kurz rasiert und unter seinem T-Shirt zeichnete sich ein dicker Bauch ab, das unvermeidliche Resultat von Bier und vom unvergleichlichen Essen seiner Eltern. Larissa war die Kleinste von uns. Sie trug ihr Haar ebenfalls kurz und war stämmig, aber nicht unansehnlich gebaut. Nachdem die Begrüßungsrunde erledigt war, setzte sich Stephan gemütlich auf den Waldboden und zog eine Tüte mit Knackwürsten sowie drei Dosen Bier aus der Tasche.
„Ihr habt Glück“, sagte er in dieser langsamen, bedächtigen Art, die man sich nur in den allerkleinsten Dörfern aneignet. „Ich war vorhin bei meinen Alten, die haben die Würste gerade frisch aus der Räucherkammer gezogen.“
Er verteilte sie. Sein Vater besaß einen Bauernhof mit Hofschlachtung und hauseigener Metzgerei. Stephan selbst hatte es bis ins Kulturamt des benachbarten Landkreises gebracht. Seine Freundin, Larissa, war das jüngste Mitglied unseres Clans, aber mit ihren 26 Jahren nur ein halbes Jahr jünger als wir.
„Ich wollte eigentlich vegetarisch leben“, grummelte sie und biss herzhaft in ihre Wurst, trank einen Schluck Bier, rülpste und fuhr fort: „Gut für die schlanke Linie, außerdem ist das eklig, was in Großschlachtereien mit den Tieren passiert. Aber Stephans Alter stopft mich ja voll mit sämtlichen Sorten Fleisch.“
Das war Larissa. Sie trug ihr Herz auf der Zunge und war so herrlich paradox. Ohne diese Eigenschaften hätte sie sich wohl nie so schnell bei uns eingelebt. Stephan war völlig vernarrt in sie. Und sie liebte ihn auch, das sah man den beiden an.
Wir saßen in der Sonne, ließen das warme Dosenbier kreisen, das mit jedem Schluck widerlicher wurde, und schwiegen. Es gibt Momente, die zu schön für Worte sind. Das war einer davon. Wir waren wieder zu Hause, bei uns, wo wir hingehörten.
Stephan warf gerade die leere Dose hinter sich in den Wald, als ein Quietschen ertönte, so hoch, dass es menschliche Ohren gerade noch wahrnehmen konnten. Christian grinste mich an und sprang auf. Das Quietschen stammte natürlich von Sophie, die gerade auf uns zustürmte. Nur sie konnte solche Töne erzeugen.
Wieder fühlte ich mich erschlagen von ihrer Präsenz. Mit ihren 1,85 m hätte sie als Model arbeiten können. Obwohl sie sehr schlank war, hatte sie ein pausbäckiges Gesicht, eingerahmt von einem rotgefärbten Wasserfall aus Haaren.
„Da sind ja meine Scheißer!“, quietschte sie und warf sich in Christians Arme. Obwohl sie von den Pfadfinderhütten gewusst hatte, trug sie hochhackige Schuhe, eine weiße Hose und eine durchsichtige, sicher sündhaft teure Bluse, unter der man ihren BH mehr als nur erahnen konnte. Wie immer begann mein Herz, schneller zu schlagen. Eigentlich absurd, ich war schließlich kein Teenager mehr, aber seine erste Liebe wird man wohl nie mit denselben Augen ansehen können wie andere Menschen.
Als wir noch zur Schule gegangen waren, hatte Sophie immer von allem das Beste und Teuerste gehabt. Ihr Vater hatte es ihr ermöglicht, zu reisen und Dinge zu tun, die für andere Sechzehnjährige vollkommen unerschwinglich waren. Eines Tages hatte sie mich in der Pause gefragt, ob ich mit ihr nach München fahren würde, sie hätte zwei Tickets für ein Konzert der Rolling Stones bekommen.
Völlig perplex hatte ich gefragt, wieso sie das Ticket gerade mir geben wollte, doch sie hatte nur gesagt: „Du magst doch die Stones, nicht wahr? So viele gibt es da ja nicht in unserem Alter.“
Auf diesem Konzert hatte ich sie das erste Mal tanzen sehen. Ich war so gebannt von ihren ruckartigen, aber dennoch grazilen Bewegungen gewesen, dass ich kaum mitbekommen hatte, was eigentlich auf der Bühne geschah. Für mich hatten Sophies Bewegungen die von Mick Jagger weit in den Schatten gestellt. Als im Jahr darauf Eric Clapton einige Deutschlandshows gegeben hatte, waren wir wieder gemeinsam dort gewesen. So kam es, dass wir über die Jahre sämtliche Größen gesehen hatten, Joe Cocker und Meat Loaf, AC/DC und Aretha Franklin, sowie eine unüberschaubare Menge an kleineren Garagen- und Clubkonzerten von Bands, an deren Namen ich mich kaum noch erinnere. Und immer wieder hatte ich gehofft, dass Sophie mich nicht nur gefragt hatte, dass wir die gleiche Musik mochten, sondern weil ihr etwas an mir lag. Irgendwann hatten wir dann auch gemeinsam getanzt, als ich nicht mehr wie benommen neben ihr stand und sie bewunderte. Da war sie aber schon längst ein fester Teil unseres Clans geworden. Ich hatte nie herausgefunden, warum sie mich damals gefragt hatte.
Sie umarmte nun auch mich und flüsterte gerührt: „Ihr habt mir alle so gefehlt.“
Ich wusste nicht, ob ihre Worte mir oder der gesamten Gruppe galten. Stephan hielt ihr das Dosenbier hin. Sie trank einen großen Schluck und setzte sich ungeachtet ihrer weißen Hose auf den Boden.
Wir verfielen wieder für kurze Zeit in glückstrunkenes Schweigen, bis Karl es brach: „Sag mal, Nick und David, wo bleiben die? Haben die sich verlaufen?“
„Du kennst sie doch“, antwortete Stephan gähnend. „Entweder die haben sich im Wochentag geirrt oder im Kalenderjahr, oder sie hocken im ‚Hellraiser‘ und saufen.“
„Hast wohl recht“, stimmte ich zu, „bei denen weiß man nie. Vielleicht haben sie sich unterwegs geprügelt und liegen bewusstlos im Straßengraben.“
Sophie lachte. „Dann warten wir hier sicher noch Stunden, denn erst einmal müssen sie wieder heulend kuscheln und sich versichern, wie leid es ihnen doch tut.“
„Die tauchen schon noch auf. Kein Stress“ war Stephans abschließender, gemächlicher Kommentar.
Wir verfielen wieder in Schweigen und hörten daher das Brummen der Harley schon, als die Maschine noch weit entfernt war.
„Nick kommt, so brummt nur seine Maschine“, sagte Larissa. „Komm, den Arsch lassen wir ein bisschen zappeln. Wir verstecken uns.“
Wir lachten.
„Wie alt sind wir noch mal?“, fragte Christian, doch er war schon in Bewegung zu dem Dickicht, hinter das Larissa bereits gesprungen war.
Binnen weniger Sekunden saßen wir, kichernd wie kleine Kinder, hinter dem Busch. „Mach schneller, Stephan“, zischte Sophie, als dieser langsam über die Lichtung trottete und gerade in dem Moment hinter dem Busch verschwand, als die protzige Harley um die Ecke bog.
Nick saß breitbeinig darauf, wie immer ohne Helm und im T-Shirt. Nun stieg er ab und schaute sich um. Er war noch breiter geworden. Irgendwann würde er die Kleider von Arnold Schwarzenegger sprengen. Seine Muskeln wollten allerdings kein bisschen zu seinen semmelblonden Haaren passen, die er zu einer ziemlich lächerlichen Tolle frisiert hatte. Larissa und Sophie kicherten, und Karl stieß sie beide in die Rippen. Nick sah sich auf der leeren Lichtung um, lehnte sich an seine Harley und begann, umständlich in seinen Hosentaschen zu kramen. Ich musste mir ein Lachen verkneifen: Dieser Typ baute sich doch tatsächlich einen Joint!
Christian sah mich an und sprang aus dem Gebüsch hervor. „Hey, du Arsch! Lass uns mitrauchen!“
Nick zuckte zusammen und ließ vor Schreck das Zigarettenpapierchen mit dem Gras darauf fallen. Wir alle rannten zu ihm und warfen uns auf ihn, um ihn zu drücken, doch er war alles andere als begeistert. „Ihr Kindsköpfe!“, rief er, musste dabei aber lachen. „Jetzt liegt das Gras im Wald! Das war schon ganz fein gemahlen, das kriegen wir nie wieder zusammen.“
„Spielt doch keine Rolle, ob wir ein bisschen Waldboden mitrauchen“, antwortete ich.
Ich kiffte zwar gerne, aber würde den Geschmack von Gras sicher nicht von dem des Waldbodens unterscheiden können.
Sophie saß bereits lachend auf dem Waldboden und krümelte Erde, trockenes Laub und Gras auf das Zigarettenpapier. „Bitte sehr“, sagte sie und hielt Nick das Zigarettenpapierchen wieder hin. „Ein Joint, Waldbodenaroma spezial.“
Wir prusteten los.
„Verdammt schön, euch zu sehen“, sagte Nick.
„Verdammt schön, dich zu sehen“, antwortete ich.
Wir setzten uns wieder. Nick leckte den Klebestreifen des Papiers ab und drehte den Joint zusammen. „Mal schauen, wie viele Tollkirschen und Knollenblätterpilze ihr da aufgesammelt habt“, sagte er und zündete den Waldbodenjoint an. Hustend und lachend pustete er den Rauch aus und reichte die Tüte an mich weiter. „Der ist superwürzig!“
Ich zog daran. Tatsächlich schmeckte der Joint zwar nach Gras, aber längst nicht so beißend wie Nicks übliche Joints. Man bemerkte wirklich einen warmen, leicht muffigen, würzigen Geruch von Waldboden. Oder Geschmack, wie auch immer. Es werden wohl nur Raucher verstehen, wie sich der Rauchgeschmack irgendwo zwischen Geruchs- und Geschmackssinn im Mund manifestiert. Ich reichte den Joint an Sophie weiter, die mich wieder mit einem sonderbar eindringlichen Blick bedachte. Wie ein unartiger Schuljunge schaute ich zu Boden und sagte hastig: „Wo David wohl bleibt?“
„Sitzt ihr schon lange hier?“, fragte Nick.
„Knappe Stunde“, kam es von Larissa, während Karl, der wieder nervös zappelte, ergänzte: „Langsam kann der Sack echt mal auftauchen.“
Damit hatte er recht. Prinzipiell schien David längst nicht so sehr von Uhren beherrscht wie andere Menschen, aber diese Verspätung war selbst für ihn untypisch. Es hätte besser zu ihm gepasst, uns mit einem Bier in der Hand neben einem rauchenden Grill zu erwarten.
„Hör auf zu zappeln und rauch den Waldboden“, schnauzte Stephan Karl an.
Wir anderen grinsten. Die beiden führten Krieg miteinander, seit sie sich kennengelernt hatten. Glücklich lächelnd lehnte ich mich zurück. Ich sah in die sechs vertrauten Gesichter. Genau hier gehörte ich hin. Ich liebte sie alle.
Nach einer weiteren Stunde war die Sonne schon fast bei den Baumwipfeln angelangt, und Christian und Karl liefen zum dritten Mal zur Hütte und rüttelten an der verschlossenen Tür. Diesmal umrundeten sie die Hütte sogar und zogen erfolglos an den Fensterläden. Stephan und Larissa lagen im Gras. Sie hatte ihren Kopf auf seinen Bauch gelegt und streichelte seine Seite. Er schien zu dösen. Wir alle hatten mittlerweile dank unseres Waldbodenjoints riesigen Durst, die Bierdosen waren schon lange leer, und Sophie trank gerade die letzten Schlucke des warmen Wassers, das ich noch von der Zugfahrt im Rucksack hatte. Nick war kurz weg, um seine geliebte Harley ein paar Meter tiefer im Wald im Schatten abzustellen. Sophie und ich saßen uns gegenüber und starrten auf den Fußboden vor uns. Ich begann, wütend zu werden.
„Was David wohl mit uns vorhat?“, fragte sie zum vierten Mal. Ich zuckte die Schultern. Wir hatten vorhin halbherzig und wegen des Waldbodenjoints dümmlich grinsend eine Runde „Wer bin ich?“ gespielt, aber keiner war so recht bei der Sache gewesen. Wir alle waren gespannt, wann David endlich kommen würde, und so gaben wir das Spiel auf und warteten.
Wir wussten alle, dass etwas Großes kommen musste. David war schon immer unser Motor gewesen. Wenn es Partys zu organisieren galt, kamen von ihm immer die besten Ideen, und letztlich steckte er immer die meiste Arbeit hinein, um uns eine unvergessliche Zeit zu bereiten. Wenn wir Konzertkarten hatten, war immer David derjenige, der sich darum kümmerte, einen Kleinbus zu mieten, einen Kasten Bier zu besorgen und die Fahrt zu planen. Ich zündete mir eine Zigarette an. Die siebte, seit ich hier oben angekommen war. Normalerweise rauchte ich nicht so viel, aber ich war nervös.
„Darf ich auch eine haben?“, fragte Sophie, und ich gab ihr eine und zündete sie ihr an.
Stephan gab mir mit einem Grunzen und einer ausgestreckten Hand zu verstehen, dass er auch eine wollte. Larissa steckte sie ihm zwischen die Lippen und gab ihm Feuer, damit er nicht aufstehen musste. Die beiden waren immer noch verliebt wie am ersten Tag. Da mittlerweile auch Christian, Karl und Nick bei uns saßen, wanderte die Zigarettenschachtel einmal im Kreis und kam leer zu mir zurück. Ich brummte und warf sie zerknüllt auf den Boden. „Hey Karl, bevor du fahruntauglich bist, fährst du noch mal mit mir zur Tanke zum Kippen kaufen?“, fragte ich.
Seine Antwort ging im Motorengeräusch unter, als der alte Cadillac von Davids Vater den Anfahrtsweg hochgerumpelt kam. Das Auto war der ganze Stolz des alten Herrn, dessen Gesicht ich auch hinter der Windschutzscheibe ausmachen konnte. Aber was hatte er hier zu schaffen? Ich wusste, dass David vor Jahren den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen hatte. Auch wir waren nie gut mit ihnen ausgekommen.
Er wendete, grüßte knapp aus dem Auto und fuhr sofort wieder los, nachdem die Beifahrertür zugeschlagen worden und jemand auf die Lichtung getreten war.
Offenbarung
Wir erkannten den Mann, der aus dem Auto gestiegen war, erst auf den zweiten Blick als David. Er war nicht der David, den wir kannten. Wir alle sprangen auf, um zu ihm zu laufen. Wir waren zwar noch zu weit entfernt, um Details zu erkennen, aber dass etwas mit ihm nicht stimmte, war uns allen klar. Ich kam als Erster vor ihm zum Stehen.
David war ein paar Zentimeter kleiner als ich, aber dafür viel kräftiger gebaut gewesen. Doch davon war nichts mehr zu sehen. Seine Arme und Beine waren skelettartig dünn, sein ehemals mächtiger Brustkorb hob und senkte sich hektisch. Man könnte jede einzelne seiner Rippen sehen, wenn er sein T-Shirt auszöge. Er stand zusammengesunken vor uns. Dass er abgenommen hatte, war noch nicht das Schlimmste. Er hatte kein einziges Haar mehr auf den Kopf, keine Augenbrauen und keinen Bart mehr. Ein Flechtwerk blauer Adern schimmerte durch seine pergamentdünne, ungesund gelbliche Haut hindurch. Auch im Weiß seiner Augen sah man gelbe Flecken. Fassungslos starrte ich ihn an.
Er brachte ein leichtes Lächeln zustande und schloss mich in die Arme.
„Was ...?“, brachte ich nur hervor. Die anderen blickten ebenso entgeistert. Jetzt wusste ich, warum er sich am Telefon vor einem Monat so schwach angehört hatte.
„Bevor ihr mich mit Fragen bestürmt – wartet. Ich werde sie euch alle beantworten. Aber lasst mich bitte ankommen“, sagte er in seinem tiefen, beruhigenden Bariton, der alle Menschen zuverlässig zum Schweigen brachte, und lief auf die Hütte zu.
Ich konnte Tränen in Larissas Augen erkennen. David war früher eine beeindruckende Gestalt gewesen: Gedrungen und bullig, mit langen, dunklen Haaren und einem wilden, fast zehn Zentimeter langen Vollbart. Er hatte gewirkt, als könnte er mit einer Hand einem Bären das Genick brechen. David war einer dieser seltenen Menschen gewesen, deren Energie jeden in ihren Bann zog. Er konnte Frauen verzaubern, und auch Männer waren Wachs in seinen Händen. Egal wo, es stand immer außer Frage, dass er das Alpha-Tier war.
Wortlos ging er auf die Hütte zu und zog den Schlüssel aus einer Tasche seiner Hose, die sackartig um seine dürren Beine schlabberte. Es hatte Zeiten gegeben, in denen seine diese Hosen beinahe gesprengt hätten. David schloss die Tür der Pfadfinderhütte auf, und was wir dahinter fanden, machte die Situation irgendwie realer, denn da war alles, was wir erwartet hatten: zwei übermannshohe Stapel Bierkästen, ein leise vor sich hin summender Kühlschrank. Ein Kamin mit einem Stapel Feuerholz daneben und ein großer Tisch in der Mitte des Raumes, zehn Stühle fein säuberlich davor aufgereiht. Der Tisch brach unter der Last von Konservendosen, Schnapsflaschen, Würsten, Schinken, Käse, Brot und Süßigkeiten fast zusammen. Ich lächelte. Hier war David, wie ich ihn kannte: Mein ältester und bester Freund hatte für uns den Traum unserer zahllosen, betrunkenen Spinnereien wahr gemacht.