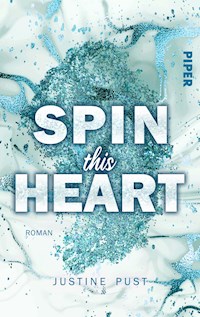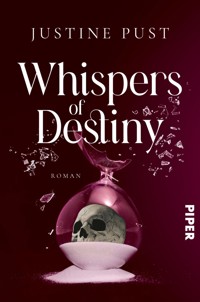
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Tod eröffnet ein Callcenter – und die Mitarbeitenden entscheiden, wer lebt und wer stirbt! 2096: Die Welt ist überbevölkert, Ressourcen und Jobs sind rar. Der Tod gründet die Firma Death Call, die über den Todeszeitpunkt aller Menschen entscheidet. Kurz nachdem die 21-jährige Blue erfährt, dass ihre Lebenszeit beinahe abgelaufen ist, trifft sie auf einer Party den geheimnisvollen Creek, einen Mitarbeiter von Death Call. Blue geht mit ihm einen Deal ein: Um dreißig weitere Jahre leben zu dürfen, nimmt sie einen Job bei der Firma des Todes an. Doch über Leben und Tod zu entscheiden, hat seinen Preis …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Whispers of Destiny« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Emily Bähr, www.emilybaehr.de
Coverabbildung: Bilder unter Lizenzierung von Freepik und Shutterstock.com und genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Inhaltswarnung
Widmung
Motto
Prolog
Auszug aus »Daily News to Go«
1. Kapitel
Fünfzehn Jahre später
2. Kapitel
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Auszug aus der Broschüre »Jetzt tödlich durchstarten«
6. Kapitel
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
7. Kapitel
8. Kapitel
Auszug aus »Daily worst of the World«
9. Kapitel
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
10. Kapitel
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Auszug aus dem Rundschreiben der Death-Call-Gewerkschaft
14. Kapitel
Auszug aus einem Flyer der Magenta Moms
15. Kapitel
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
16. Kapitel
Auszug aus einem Rundschreiben der Death-Call-Gewerkschaft
17. Kapitel
18. Kapitel
Auszug aus »Magenta Moms 4 Life«
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Auszug aus dem Rundschreiben der Death-Call-Gewerkschaft
28. Kapitel
Auszug aus der Broschüre »Tödlich durchstarten«
29. Kapitel
30. Kapitel
Auszug aus dem Artikel »Hungrig? Dann schau diese Serie«
31. Kapitel
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
32. Kapitel
Auszug aus dem Rundschreiben der Death-Call-Gewerkschaft
33. Kapitel
Auszug aus dem Börsenbericht
34. Kapitel
35. Kapitel
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
36. Kapitel
37. Kapitel
Auszug aus dem Rundschreiben der Death-Call-Gewerkschaft
38. Kapitel
Auszug aus »Glossar des Todes«
39. Kapitel
40. Kapitel
Auszug aus dem Rundschreiben der Death-Call-Gewerkschaft
41. Kapitel
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
Auszug aus einem Artikel der »Porträt«
45. Kapitel
Zitat aus der »Vanity Pearl«
46. Kapitel
47. Kapitel
Auszug aus dem Flugblatt »Wo sind die Moms?«
48. Kapitel
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
49. Kapitel
50. Kapitel
Creek
Auszug aus »Daily News to Go«
51. Kapitel
Blue
Zwei Stunden zuvor
Auszug aus einer Eilmeldung
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
Auszug aus einer Eilmeldung
56. Kapitel
Eine Woche später
Auszug aus Emeralds Tagebuch
Inhaltswarnung
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Inhaltswarnung
»Whispers of Destiny« enthält Themen, die belasten können. Deshalb findest du am Ende dieses Buchs eine Inhaltswarnung[1]. Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Widmung
Für alle, die schon einmal das Pech hatten, in einem Callcenter arbeiten zu müssen.
Und für meine Testleser*innen:
Viola, Sophie, Jana K, Dorina, Christine, Karina, Christin, Aylin, Sasi und Basma.
Motto
… vor Death Call sind alle Menschen gleich. Unabhängig von ihren Stufen.
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
Prolog
Wir werden sterben.
Ich sitze auf dem Rücksitz unseres alten Autos, eingeklemmt zwischen Kisten und Müllsäcken voller Dinge, die wir versuchen zu retten.
Der Geruch von nassem Stoff und Angst liegt in der Luft.
Wir sind zu spät.
Zu spät, um noch aus der Stadt rauszukommen.
Zu spät für einen Rettungstransporter.
Unser Auto ist eines von Hunderten, das nicht vom Fleck kommt. Die endlose Schlange aus Wagen und panischen Menschen, während der salzige Regen unentwegt auf diese Stadt fällt. Blitze zucken am Himmel.
»Mama?«
Sie beugt sich vom Beifahrersitz zu mir, drückt meine kleinen Hände und schafft es, irgendwie zu lächeln. »Alles wird gut.«
Alles wird gut.
Ich werde diese Worte nie vergessen.
Und ich werde nie vergessen, dass sie gelogen sind. Denn immer wenn Menschen sagen, dass alles gut wird, bedeutet es nur, dass sie das Ende nicht mehr aufhalten können.
Das Auto ruckelt vorwärts.
Doch gleich darauf bleiben wir wieder stehen, während sich die Straßen langsam in kleine Flüsse verwandeln. Eltern, die ihre Kinder im Arm halten und sich durch das kniehohe Wasser schieben. Menschen in Anzügen, die ihre Koffer über den Kopf halten. Das Dröhnen der Alarmsirenen wird zu einer Musik, die jede Faser meines Körpers in Angst versetzt. Ein Mann im dunklen Anzug steht auf den obersten Stufen einer Treppe. Das Pappschild in seinen Händen ist wellig und die Schrift kaum noch zu erkennen.
Aber er brüllt die Worte immer wieder: »Das Ende ist da.«
Das Ende.
Das Ende von allem, dieser Stadt oder nur von uns?
Schnell wende ich den Blick ab, während das Wasser immer höher steigt. Es ist, als würden wir dabei zusehen, wie das Leben, das wir kannten, langsam aber sicher ertrinkt.
Und wir können nichts tun, nur zuschauen. Sind gefangen zwischen den Mauern der Stadt.
Papa trommelt auf dem Lenkrad herum. »Wir müssen zu Fuß weiter«, murmelt er und versucht, die Tür aufzudrücken.
Eine Welle schwappt ins Innere, und ich schreie auf, weil die eisige Kälte des Ozeans sich anfühlt, als würde der Tod selbst nach mir greifen.
Doch das ist nicht das Schlimmste.
Mit weit aufgerissenen Augen starre ich in den Rückspiegel. »Mama?«
»Alles ist gut, Schätzchen.«
»Mama!«
Und dann sieht sie es auch.
Die riesige Welle, die auf uns zurollt.
Papa dreht sich um.
Im Gegensatz zu mir erstarrt er nicht.
Er steigt aus. Meine Mama ebenfalls, während ich nicht weiß, was das alles zu bedeuten hat. Papa packt mich, drückt mich an sich und rennt los. Ich hänge auf seinem Arm, den Kopf weiter der Welle zugewandt. Dem Monster, das endgültig gekommen ist, um uns zu verschlucken. Aber Papa läuft weiter. Er sagt nicht, dass alles gut wird, und auch Mama sagt nichts mehr, sondern umklammert seine Hand.
Aus den Autos strömen Hunderte Menschen, stolpern und fallen übereinander. Hauptsache weg.
Plötzlich höre ich ein lautes Krachen, und die Autos werden von einer kleineren Welle erfasst. Ein Vorbote dessen, was mit uns passieren wird.
Papa versucht, mit uns zu den Stufen der hohen Gebäude zu gelangen, doch es ist zu spät.
Das Monster hat uns eingeholt.
»Halt dich fest, Blue!«, ruft er.
Und ich werde mich auch an diesen Satz für immer erinnern, denn zwischen diesen Worten höre ich all die Angst, die sich in meiner Brust sammelt, als das Wasser über uns hereinbricht.
Die Kälte lässt die Zeit stillstehen.
Ich sehe, wie Mama und Papa versuchen, sich aneinander festzuhalten, die Kontrolle zu behalten und sich nicht der mitreißenden Strömung hinzugeben.
Aber das Monster ist zu stark.
Das kalte Wasser umschlingt mich, und ich kann die Schreie meiner Eltern nicht mehr hören. Alles ist laut und gleichzeitig zu still.
Jemand stößt gegen uns.
Sorgt dafür, dass Mama den Halt verliert.
Ich will nach ihr rufen, aber das Wasser blockiert jeden Schrei. Und dann ist sie weg.
Eingesaugt in die blaugraue Dunkelheit.
Papa und ich durchstoßen die Oberfläche. Ich schnappe nach Luft, aber schon im gleichen Moment werden wir wieder nach unten gezogen. Das Wasser drängt uns in eine Richtung, ohne dass wir die Chance haben, uns dagegen zu wehren.
Ich suche nach Mama.
Aber ich sehe nur andere Menschen.
Körper und Autos.
Schwerelos.
Getrieben.
Verzweifelt.
Und auch mein Körper schreit innerlich.
Nach Luft. Nach Hilfe. Nach Hoffnung.
Aber da ist nichts.
Papas schwere Hand findet meinen Mund, hält ihn zu, als wollte er so verhindern, dass ich nach Luft schnappe und den eisigen Ozean in mich aufnehme.
Und dann prallen wir gegen irgendetwas.
Es dauert einen Moment, bis ich verstehe, dass unsere Körper von der Strömung gegen ein Gebäude gepresst werden. Gegen Fenster, hinter denen früher einmal Leben war und jetzt nichts mehr. Kein Leben. Nur schwebende Körper.
Papas Griff erschlafft. So plötzlich, dass ich keine Chance mehr habe, mich an ihm festzuhalten, das Wasser zerrt mich weiter.
Ich schwimme, so gut ich kann, und kämpfe gegen die Strömung an. Will wieder zu ihm, wieder zurück. Zu seiner ausgestreckten Hand.
Doch ich schaffe es nicht.
Das schwere Blaugrau verschluckt ihn, genau wie Mama.
Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich brauche Luft.
Ich will nicht sterben.
Und auch wenn ich nicht weiß, wie, schaffe ich es zur Oberfläche. Das Wasser zieht mich mit sich, aber ich halte meinen Kopf starr nach oben. Ich schreie um Hilfe.
Da ist niemand, der mich retten wird.
Manchen Monstern wird man nie entkommen.
Auszug aus »Daily News to Go«
Der Tod eröffnet ein Callcenter: Death Call
Ein neuer Blick auf das Jenseits, mit dem wohl niemand gerechnet hat. Kurz nachdem der Tod sich der Welt offenbart hat, folgt der nächste Schock: Er bleibt nicht im Hintergrund, sondern eröffnet ein Callcenter namens »Death Call«.
Dies soll nicht nur für seine Kundschaft, sondern auch für die gesamte Gesellschaft eine neue Perspektive auf das Leben und das Jenseits bieten. Weltweit breitet sich die Firma des Todes aus.
Der Tod will sich ein neues Image verschaffen. Doch der Gegenwind gerade aus den politischen Kreisen bleibt stark. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt wollte er den Menschen die Möglichkeit geben, über ihre Ängste und Fragen zum Thema Sterben und das, was danach kommt oder nicht, zu sprechen. Und: aktiv dabei mitzuwirken.
Derzeit sind mehrere Stellenanzeigen geschaltet, die neue Callagents suchen.
Ob Death Call sich durchsetzen kann?
Die ersten Demonstrationen sind geplant.
Und mal ehrlich: Wer will schon für den Tod arbeiten?
Auszug aus »Daily News to Go«
1. Kapitel
Fünfzehn Jahre später
Die schlimmsten Momente sind immer die, in denen man noch glaubt, man stünde am Abgrund – aber eigentlich ist man schon dabei, zu fallen. Ich falle und falle, und niemand fängt mich auf. Der Boden rast auf mich zu, doch ich kann nichts tun. Nur darauf warten, dass der Aufprall kommt und alles zerschmettert, was ich mal war. Alles, was hätte sein können.
»Es tut mir sehr leid, Blue. Sie haben das, was die meisten umgangssprachlich eine Erbse nennen.«
»Was?« Meine Stimme klingt nicht nach mir, klingt fremd und kalt.
Die Ärztin vor mir räuspert sich unbehaglich. Auf ihrem Namensschild steht: Dr. Pastell. Pronomen: sie/ihr. Ich frage mich, wie sie es geschafft hat, an einen Doktortitel zu kommen. Offenbar ist sie nicht in einer der unteren Stufen geboren worden. Nur ergibt das wenig Sinn, wenn sie trotzdem hier ist und Menschen wie mir Nachrichten überbringt, die ihnen zeigen, wie abgefuckt ihr Leben wirklich ist.
Vielleicht ist sie einer dieser Versuchsgutmenschen, die ab und an aus den privilegierten Stufen hierherkommen und so tun, als würde es sie jucken, dass wir sterben wie die Fliegen. Aber vielleicht verurteile ich auch nur schnell Menschen. Gut möglich. Ich bin keiner der netten Menschen, und ich bin keiner von denen, die noch an das Gute glauben oder anderen einen Vertrauensbonus geben. Dazu habe ich schon zu lange überlebt. Na ja, bis jetzt zumindest.
Die Ärztin blinzelt, ohne den Blick von mir zu nehmen.
»Blue, ich meine damit, dass ich dir die Freigabe für Stufe 4 nicht geben kann, weil du bereits betroffen bist«, sagt sie langsam. Vorsichtig, als hätte sie Angst davor, was diese Nachricht mit mir macht. In ihren Augen glänzt etwas, das vielleicht Mitgefühl sein könnte. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Vielleicht ist auch das Belüftungssystem schuld.
»Ich … werde sterben? An einer Erbse?«, stoße ich hervor, weil mein Gehirn die Nachricht erst jetzt richtig verarbeiten konnte.
»Leider, ja.«
»Aber ich habe die Vitamine immer genommen. Ich habe jeden verdammten Tag diese widerlichen Pillen geschluckt, damit genau dieser Mist nicht passiert.«
Sie rutscht auf ihrem Stuhl hin und her. »Die Prävention ist nicht immer erfolgreich, aber …«
»Offensichtlich«, unterbreche ich sie, harscher als beabsichtigt. Mein Blick verschwimmt. »Wann?«
Dr. Pastell schluckt und klickt auf ihrem Computer herum. »Die ersten Symptome sind bereits da, Kopfschmerzen, Übelkeit, Gleichgewichtsstörungen …«
»Das sind keine Symptome«, bricht es aus mir hervor. »Ich habe Kopfschmerzen vom ganzen Smog, mir ist schlecht, weil ich kaum mehr als eine Mahlzeit am Tag essen kann und …«
Das Letzte ist schwerer zu entkräften, und diese Tatsache schlägt mir auf den Magen wie eine Abrissbirne und reißt jeden Funken Hoffnung weiter in die Tiefe.
Ich falle. Falle. Falle.
»Ich werde sterben«, kommt es mir tonlos über die Lippen.
Was gibt es schon zu sagen, wenn man sterben wird?
Willkommen in meinem Leben.
Oder dem, was noch davon übrig ist.
Meine Sicht wird wieder klarer, irgendetwas in meinem Inneren ist plötzlich schrecklich kalt. Der Geruch des Krankenhauses kitzelt in meiner Nase, als wollte mich mein Körper warnen. Der Tod ist allgegenwärtig, und trotzdem war ich nicht darauf vorbereitet. Nicht jetzt. Ich bin gerade mal einundzwanzig Jahre alt.
Wieso hat es ausgerechnet mich getroffen? Wieso jetzt? Warum nicht erst in ein paar Jahren?
Sachte beugt sich die Ärztin vor. Für einen kurzen Moment glaube ich fast, dass sie nach meiner Hand greifen und mich trösten will – aber das tut sie nicht. Trost ist etwas, das sich diese Welt nicht mehr leisten kann. »Du hast trotzdem eine Reihe von Möglichkeiten, die nicht nur dir, sondern auch dem Fortbestand aller Menschen dienen können. Ich gebe dir eine Broschüre mit …«
»Eine Broschüre?«
Freundliches Nicken gegen meine Fassungslosigkeit – obwohl ich es hätte wissen müssen. Die Ärztin versucht es erneut mit einem Lächeln und zieht die Broschüre aus der Schublade. Wahrscheinlich hat sie nur auf den richtigen Moment gewartet, um sie mir zu zeigen. »Death Call bietet eine umfangreiche Beratung für Menschen in deiner Situation.«
Menschen in meiner Situation?
Mit einem verdammten erbsenförmigen Tumor?
Irgendwo aus meinem Inneren kommt ein Lachen, das mir eine Gänsehaut verursacht. »Ich will keine verdammte Broschüre von Death Call, ich will nicht sterben.«
Ratlos sieht sie mich an. »Okay, dann …«
Dieses Mal halte ich mich allerdings nicht zurück. Warum auch? Der Traum auf Stufe 4 ist geplatzt.
Und die Ärztin, in die ich all meine Hoffnungen gesetzt habe, damit ich ein besseres Leben führen kann, drückt mir eine Selbstmordbroschüre in die Hand. Sie hat mir nicht einmal falsche Hoffnung zu bieten. Nicht einmal für den Bruchteil einer Sekunde.
Lässt dein Körper dich im Stich, wirst du ausgemustert wie alte Kleidung.
So funktioniert diese Welt.
Vielleicht hat sie so schon immer funktioniert, und die Hoffnung war nur der Köder, damit wir in diesem System mitspielen.
Tränen treten mir in die Augen, während ich den Kopf schüttle. »Ich werde mich ganz sicher nicht opfern, nur damit diese Stadt ein paar Lebensmittelrationen spart.« Meine Stimme bricht, ganz plötzlich. All meine Gefühle spielen Pingpong. »Ich habe das alles nur gemacht, um die Freigabe für Schmerzmittel und eine Extraration Essen zu bekommen.«
Seufzend lehnt sich Dr. Pastell auf ihrem Stuhl zurück. Wie oft sie wohl Gespräche wie dieses führen muss? Wie oft rät sie Leuten wie mir dazu, bei Death Call anzurufen?
»Es tut mir leid.«
Leere Worte.
Niemandem tut es leid.
Meine Stufe-3-Freigabe wird dafür sorgen, dass ein anderer Mensch meine Essensration und meine Arbeitserlaubnis bekommt. Niemand wird mich bedauern, na ja, fast niemand. Obwohl ich fairerweise sagen muss, dass ich mich selbst gerade schon genug bedauere.
Ich stehe auf, greife nach meiner Handtasche, deren zerschlissenes Kunstleder sich bereits abpellt. Sobald ich aus dem Raum heraus bin, lehne ich mich gegen die Tür. Nehme mir zehn Sekunden mit geschlossenen Augen.
Zehn Sekunden.
Der Krankenhausflur ist so gut wie leer, und diese Leere fühlt sich an wie ein Teil von mir selbst. Eine verfluchte Erbse sitzt in meinem Schädel. Eine Zeitbombe.
Von all den Dingen, die mich hätten töten können, habe ich das nicht kommen sehen. Die nächste Flut, das nächste Erdbeben oder die nächste Dürre? Sicher. Aber eine Erbse? Die alles, was mich ausmacht, zerstört, bis ich nichts weiter bin als eine Hülle? Von all den Möglichkeiten, wie mein Leben hätte zu Ende gehen können, ist das hier so ziemlich das Schlimmste.
Und obwohl ich weiß, dass es keinen Sinn ergibt, versuche ich, mich an etwas festzuhalten. An einer Hoffnung.
In früheren Zeiten hätte es Ärzte gegeben, die mir geholfen hätten. Medikamente, Operationen, irgendetwas. Man hätte versucht, mich zu retten, weil das Leben an sich einen Wert hatte. Nur gehört diese Welt der Vergangenheit an. Die Medizin stellt nur noch fest, und die Sensen von Death Call geben uns die Wahl, ob wir auf den Tod warten oder ihn mit offenen Armen empfangen wollen.
Sosehr ich mir auch einen Ausweg wünsche, es gibt keinen. Ich habe gesehen, was die Erbsen mit den Menschen machen. Sie saugen einem alles Leben aus und hinterlassen einen hungrigen Körper, der alles tut, um weiterzuleben. Das ist nicht das Ende, das ich mir gewünscht habe. Allerdings habe ich bisher auch nicht an mein Ende gedacht.
An das Ende dieser Welt? Ja.
An das Ende der Menschheit? Oh, ja.
Aber nicht daran, dass mein Leben wirklich endet.
»Blue!«
Ich reiße die Augen wieder auf.
Iris kommt auf mich zu. Tränen haben Spuren auf ihren Wangen hinterlassen.
Sofort beginnt mein Herz, wie wild zu schlagen. Noch schlimmer als mein eigenes baldiges Ableben ist der Gedanke, dass ihr etwas passiert ist. »Was ist los?«
Meine beste Freundin streicht sich den schwarzen Pony aus der Stirn. In dem grellen, leblosen Weiß des Krankenhausflures strahlt ihre dunkelbraune Haut so warm wie die Sonne, die wir nie sehen. »Mein Antrag wurde abgelehnt«, sagt sie und versucht sich an einem Lächeln.
»Fuck. Das tut mir leid, Iris.«
Sie nickt kurz, zwingt sich, weiterzulächeln. »Schon okay, ich komm klar«, sagt sie leiser. »Was ist mir dir?«
Für einen Moment hatte ich vergessen, was uns überhaupt hierhergeführt hat. Welche Träume wir hatten.
Als ich mich abwenden will, damit sie mir nicht von der Nasenspitze ablesen kann, wie es mir wirklich geht, fällt mein Blick auf eines der vergilbten Plakate.
Aufsteigen leicht gemacht!
Träumen Sie sich auch oft in höheren Stufen?
Glauben Sie, Sie haben das Potenzial für mehr?
Dann nutzen Sie unseren neuen Upgrade-Service!
Für nur 10 000 Creditpoints checken wir für Sie Ihre Aufstiegschancen! Jeden Monat beginnen so 47 Menschen in einer neuen Stufe ein neues Leben. Verpassen Sie nicht Ihre Chance!
Grollend mache ich einen Schritt nach vorn. Ich kann den Blick meiner besten Freundin im Nacken spüren, als ich nach dem Poster greife und es abreiße.
»Äh, Blue?«
Das Papier segelt zu Boden.
»Mein Antrag ist auch abgelehnt«, sage ich monoton.
Skeptisch hebt Iris eine Augenbraue, sagt jedoch nichts weiter, sondern hakt sich bei mir unter und zieht mich mit sich, weg aus dem Flur, raus aus dem Krankenhaus und auf die vollen Straßen. Der Geruch des Desinfektionsmittels liegt hinter uns, dafür weht uns nun der salzige Wind um die Nase.
Zeitgleich ziehen wir die breiten Kapuzen tief in unsere Gesichter und die Masken über Mund und Nase, bevor wir die schmale Treppe hinunterschreiten.
Die Schlange, in der wir bis vor wenigen Stunden auch gestanden haben, ist inzwischen lang genug, dass sich die Menschen bis zur Straße drängen. So viele Menschen, die ihre Hoffnung und ihr Erspartes daraufsetzen, eine Stufe mehr zu erreichen. Mehr Essen, mehr Wohnraum, mehr Möglichkeiten, in dieser Welt zu überleben.
Tränen brennen in meinen Augen, doch mir bleibt keine Zeit, um mein eigenes Ableben zu trauern. Alles, was jetzt noch zählt, ist Iris.
Sie deutet meinen fragenden Blick richtig und zuckt mit den Schultern. »Wie es aussieht, kann ich mich nicht reproduzieren.«
Unvermittelt bleibe ich stehen, sehe Iris an, deren schwarzes Haar im Wind hin und her wiegt. Hinter ihr ragen die grauen Klötze aus Beton und Metall auf. Überbleibsel einer Zeit. Wohnungen mit Blick auf ein Meer, das uns zu verschlingen droht. Mit jedem Sturm etwas mehr.
»Was?«
Iris verengt die Augen. Sie atmet einmal tief durch, als würde sie glauben, dass ihre Worte die Realität nur noch realer machen würden. »Darum wurde mein Antrag abgelehnt. Meine Reproduktionsorgane sind nicht funktionstüchtig.«
Mir ist klar, dass sie meinen offenen Mund unter der Maske nicht sehen kann – aber für einen Moment bin ich wie erstarrt. »Du kannst keine Kinder bekommen?«
Kurze Stille in einer zu lauten Welt um uns herum.
»Nein«, sagt sie leise. Ihr prüfender Blick gleitet zu einem Mann, dem man Stufe 2 deutlich ansieht. Er fragt andere nach ein paar Creditpoints oder Essensmarken. Doch die meisten ignorieren ihn einfach, schieben sich achtlos an ihm vorbei.
»Das tut mir unfassbar leid«, höre ich mich selbst sagen, obwohl es nicht wirklich das ist, was ich sagen will.
Ja, es tut mir leid. Aber diese Floskel bedeutet gar nichts. Und ich weiß, dass Iris damit nicht nur die Chance auf eine eigene Familie verloren hat, sondern so viel mehr.
»Immerhin laufe ich jetzt nicht mehr Gefahr, eine der Magenta Moms zu werden«, sagt sie mit einem halben Grinsen, das ihren Schmerz nicht wirklich verstecken kann, und deutet auf eines der Hologramme.
Eine KI-generierte Frau in einem magentafarbenen Hosenanzug deutet auf ihren Babybauch und sagt: »Sie wollen für den Fortbestand der Menschheit sorgen? Dann kommen sie ins Magenta Camp! Dem Ort für die Familien von morgen.«
Ich schüttle mich, als eine Sequenz gezeigt wird, in der die KI-Frau ein Baby an Menschen aus höheren Stufen gibt und sich mit einem breiten Grinsen und nach oben gereckten Daumen zu uns umdreht.
Die Vorstellung, dass uns das auch in Stufe 4 hätte passieren können, beruhigt mich zumindest ein bisschen. Denn die Gerüchte auf der Straße klingen sehr viel realistischer als der angeblich so schöne Ort, an dem die Magenta Moms ein Kind nach dem anderen bekommen, um es dann an kinderlose Menschen der höchsten Stufen abzugeben.
Iris zieht mich weiter, und ich bin dankbar dafür, denn irgendwie schafft sie es immer, mich zumindest für einen Augenblick abzulenken. Nur weiß ich in dem Moment, als ihr Blick auf mir liegt, dass sie mir keine weitere Gnadenfrist mehr geben wird.
»Willst du mir sagen, warum sie dich abgelehnt haben?«
Ich will es. Aber ich kann nicht.
Die Worte wollen einfach nicht aus meinem Mund kommen. Es ist das eine, dass ich mein Leben verliere, aber etwas ganz anderes, dass meine beste Freundin ihre Hoffnung auf eine Familie verloren hat. Ich will nicht, dass sie sich jetzt Sorgen um mich macht, wenn es eigentlich um sie gehen sollte.
»Nicht so wichtig, wie geht’s dir … damit?«
Iris zuckt mit den Schultern. »Hab ich noch nicht entschieden«, gibt sie mit einem düsteren Lächeln zurück.
Die Menschen drängen sich weiter, stoßen gegeneinander und gegen uns, weil wir im Weg stehen. Der Bezirk der Arbeitenden ist einer der wenigen, in denen viele Stufen zusammenkommen. Auch wenn es uns in der Theorie nicht verboten ist, in eine der anderen Stufen bis Stufe 6 zu gehen, bleiben die meisten doch eher in ihrem eigenen Umkreis. Das ist sicherer. Und es macht vieles einfacher.
Der Mann aus Stufe 2 ist noch immer dabei, die Menschen um sich herum nach ein paar Credits zu fragen.
Mein Blick gleitet auf meine dreckigen Turnschuhe. »Lass uns bitte einfach nach Hause gehen.«
»Das klingt nicht gut«, murmelt Iris nachdenklich.
»Alles, was ich will, ist mein Bett und einen deiner Tees.«
Nickend lässt sich Iris auf mein Schweigen ein.
Im inneren Halbkreis von 2-0-5 ist es hell, obwohl dieser Teil der Stadt nie das Tageslicht sieht. Der Schleier aus Smog ist zu dicht und raubt selbst der Sonne ihren Glanz. Aber die flimmernden Lichter der Werbetafeln erhellen alles. Zu jeder Zeit, an jedem Tag. Die Dunkelheit der Nacht ist zu einem Luxus außerhalb des Bezirks geworden, den sich nur noch Menschen der Stufe 7 und höher leisten können.
Je weiter wir in die pyramidenartig angeordneten Wohnzonen vordringen, desto voller wird es auf den Straßen. Iris und ich werden zusammengeschoben, halten uns fest, während wir uns durch die Massen schieben, immer auf der Hut vor Menschen, die husten oder unsere Taschen stehlen wollen, weil der Hunger sie überkommt.
Neonlichter zaubern Farbe in das ewige Grau. Der Stadtkern besteht aus einer Kreuzung, die in früheren Zeiten mal für den Verkehr gedacht war. An den Fassaden der Häuser hängen gigantische Werbetafeln, die abwechselnd für verschiedene Produkte, die Teilnahme an Showformaten und für Death Call werben. Immer wieder dieses verdammte Death Call.
»… nutze jetzt unseren exklusiven Service für dein Ableben!«, verkündet eine aufgesetzt fröhliche Frauenstimme. Die Mitarbeiterin sitzt an ihrem PC, das Headset in den blonden Haaren und ein Lächeln auf den Lippen. »Willkommen bei Death Call, was können wir für dein Ableben tun?«
Angewidert verziehe ich das Gesicht und bin froh, als wir endlich aus dem Ballungsgebiet heraus sind. Die Straßen hier sind noch schlechter. Schlagloch an Schlagloch, aber immerhin kein Gedränge mehr. Die Häuser bestehen nicht mehr aus Beton, sondern altem Technikmüll, zusammengepresst zu unebenen Wänden, aus denen Kabel herausschauen und in denen zersplitterte Handydisplays schimmern. Ein schmutziges Straßenschild begrüßt uns mit den Worten: »Hier beginnt das Wohngebiet der Stufe 3.«
Na dann, willkommen zu Hause.
2. Kapitel
»Was ist los?«
Iris verschließt die Tür unserer winzigen Wohnung, ehe sie ihre Jacke auf unseren Jackensessel zu den anderen legt. Sie hat die Hände in die Hüften gestützt, was mir eindeutig signalisiert, dass sie mich nicht so einfach vom Haken lässt.
Aber ich kann es ihr nicht sagen, nicht jetzt.
Wir haben wochenlang in der Hoffnung auf ein besseres Leben geschuftet, jeden Coin zurückgelegt und nun … tja. Nun werde ich sterben, und Iris bekommt keine Chance auf eine Stufe-4-Freigabe.
Bye, bye, Hoffnung. War eine kurze, aber schöne Zeit mit dir.
»Blue!«
Ich zucke zusammen, räuspere mich und streiche mir eine meiner blauen Strähnen aus dem Gesicht. »Um ehrlich zu sein, bin ich noch nicht bereit, darüber zu reden«, murmle ich und kratze an meinem Handgelenk herum, bis rote Striemen auf meiner weißen Haut zu erkennen sind.
Iris verengt die Augen. Ich kann der Falte auf ihrer Stirn deutlich ansehen, dass sie darüber nachgrübelt, ob sie mir das durchgehen lässt. Ihr Mund öffnet sich gerade, als sie von einem Geräusch unterbrochen wird. »Nicht schon wieder«, stöhnt sie auf. Der schrille Weckton eines entsorgten Handys dröhnt aus der Wand.
Sie macht auf dem Absatz kehrt, läuft durch unsere winzige Kochnische und schlägt einmal gegen die Wand. Doch der Wecker klingelt weiter. Noch ein Schlag. Dieses Mal so stark, dass etwas von dem dunkelgrauen Plastik zu Boden rieselt. Das Klingeln bricht ab.
»Dir ist schon klar, dass es nichts bringt, gegen die Wände zu boxen, oder?«, frage ich mit einem halben Grinsen.
Sie wirft ihre Haare nach hinten. »Mir hilft es sehr wohl«, behauptet sie. »Morgen ruf ich noch mal bei der Stadtverwaltung an. Irgendwann muss sich das verdammte Ding doch endlich entladen haben.«
Darauf sage ich nichts, weil wir beide wissen, dass es die Stadtverwaltung herzlich wenig interessiert, dass die Wände unserer Wohnung klingeln. Laut denen können wir froh sein, eine der Sozialwohnungen aus dem gepressten Abfall der letzten Generationen erhalten zu haben.
»Dir ist schon klar, dass ich mich nicht ablenken lasse?«, fragt Iris nach ein paar Herzschlägen und mustert mich streng.
Ich hätte es wissen müssen.
»Nicht mehr heute«, sage ich langsam. »Bitte, ich muss erst selbst verstehen, was das bedeutet.«
Sie macht einen Schritt auf mich zu. »Das klingt nicht gut.«
»Iris, ich will ja. Aber ich kann nicht.«
Sie denkt einen Moment darüber nach. Dann nickt sie. »Okay, das akzeptiere ich. Fürs Erste.«
Erleichtert atme ich auf. »Gut, ich bin in meinem Zimmer.« Mit schweren Gliedern drehe ich mich um und greife nach dem Türknauf, doch bevor ich mich verkriechen kann, höre ich die Stimme meiner besten Freundin noch einmal.
»Blue?«
Ich schlucke. »Ja?«
»Stufe 3 ist nicht so übel«, meint sie mit einem halben Lächeln. »Wir sind bisher gut zurechtgekommen und werden es auch weiterhin.«
»Ich weiß«, murmle ich. »Du kommst mit allem zurecht.«
»Und du auch.«
Nickend blinzle ich die Tränen weg. Dann schließe ich mich in meinem winzigen Zimmer ein, in dem ein schmales Bett gerade so Platz gefunden hat. Eine einfache Pritsche mit drei kleinen Kissen. Aber mein Bett ist nicht mein Ziel, sondern das Fensterbrett. Ich reiße das Fenster auf, schwinge meine Beine über die Brüstung und lehne den Rücken an den Rahmen.
Wie oft habe ich hier schon gesessen?
Die Beine im Nichts baumelnd und den Kopf voller Dunkelheit. Doch das, was ich nun fühle, ist viel schlimmer als alles, was ich bisher gekannt habe.
Schlimmer als der Kampf ums Überleben und die Suche nach den kleinen Momenten des Glücks, damit es doch noch ein Leben sein kann.
Das hier ist das Ende. Mein Ende.
»Eine verfluchte Erbse«, murmle ich in den Nachtwind.
Mein Spiegelbild im schmutzigen Glas zeigt mir mein Gesicht. Blass und müde, aber nicht anders als sonst.
Könnte sich die Ärztin geirrt haben? Ist das alles vielleicht nur ein Fehler?
Wie oft haben Iris und ich uns ausgemalt, wie wir uns hocharbeiten? Raus aus Stufe 2, aus Stufe 3 bis hin zu Stufe 5. Zu mehr Lebensmitteln, einer freien Jobwahl und dem Zugang zu Büchern. Kein Leben im Luxus, aber eines mit Perspektive. Und bis heute habe ich daran geglaubt, dass wir es schaffen können. Wir beide.
Was bleibt von einem Leben übrig, wenn es keine Möglichkeiten für ein Mehr gibt?
Zur Antwort beginnt die Sirene zu dröhnen. Fluchend schwinge ich die Beine wieder ins Innere, aber ich bin einen Tick zu langsam, als der erste ätzende Tropfen auf meiner Hose landet.
»Scheiße«, schreie ich auf. Das Zischen kann ich hören, noch ehe ich den Schmerz spüre.
Schnell verschließe ich das Fenster. Dann erst beginne ich damit, an meiner Hose zu zerren. Doch die mutierte Salpetersäure ist zu schnell. Ich schreie, als sie sich durch meine Haut frisst.
»Blue!«
Irgendwie schaffe ich es, mich aus meiner Hose zu befreien.
Der Schmerz blendet alles andere aus.
Ich glaube, ich schreie noch immer.
Aber ich bin mir nicht sicher.
Meine Sicht verschwimmt.
Plötzlich packt Iris mein Bein und schüttet so schnell ihren lauwarmen Kamillentee darüber, dass ich weder Zeit habe, mich zu wehren, noch verstehe, was sie da tut. Aber der scharfe Schmerz hört auf und wird zu einem dumpfen Pochen.
»Verdammt«, schnaubt Iris und stellt die nun leere Teetasse ab. »Das war der letzte Beutel Kamillentee, den ich hatte.« Dass sie nicht wirklich wütend auf mich ist, merke ich daran, dass sie sich vor mich hinhockt und die Wunde an meinem Schienbein inspiziert. »Sie hat sich noch nicht bis zum Knochen durchgefressen.«
Ihre kühlen Fingerspitzen in der Nähe der Wunde sorgen dafür, dass ich scharf die Luft einsauge. »Sehr beruhigend.«
Iris hilft mir aufzustehen, während der Wolkenbruch gegen mein Fenster hämmert, als wollte er mich herauslocken, damit er noch mehr von mir bekommt.
Den nassen Fleck auf meinem Bett ignoriere ich. Er wird ganz sicher auch später noch da sein, um mich daran zu erinnern, dass ich maximal unvorsichtig war.
Wahrscheinlich wäre es das Klügste, ins Dispo zu gehen und mir ein Kamillenbad zu gönnen, um auch die letzten Reste des Säureregens aus meinem Körper zu bekommen – auf der anderen Seite lohnt sich der Aufwand jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
Stöhnend humple ich ins Wohnzimmer.
So viel dazu. Dann darf ich eben nicht am Fenster sitzen und mich selbst bedauern, von mir aus.
»Ich hab dir doch gesagt, dass es noch regnen soll«, schimpft sie und holt den staubigen Verbandskasten aus der kleinen Kochnische.
»Ich konnte ja nicht ahnen, dass es genau jetzt anfängt«, wehre ich mich und unterdrücke einen zischenden Schmerzenslaut, als Iris mir ein Pflaster auf die verätzte Stelle klebt.
»Deine Beine sollten gar nicht aus dem Fenster baumeln, nicht in der Regenzeit.«
»Lektion gelernt.«
»Als ob«, erwidert sie mit einem lauten Schnauben und marschiert wieder in die Küche.
Der Geruch ihres Kamillentees hängt noch in der Luft und befeuert mein schlechtes Gewissen. Kamillentee ist teuer. Und ich weiß nicht, ob ich noch genug Zeit habe, um ihr einen neuen zu besorgen.
Iris hat es sich auf unserem schäbigen Zweisitzer bequem gemacht. Der in die Wand eingelassene Fernseher läuft. Sie zappt durch die Programme.
»Wie wär’s? Lust auf schreckliche Sendungen mit permanenter Werbeunterbrechung?«, fragt sie und deutet auf die Kanne Tee, die sie gekocht hat.
Ich ziehe die Ärmel meines Pullis über meine Hände und schlurfe zu ihr, lege mein Bein halb auf unseren kleinen Tisch und breite die Decke über uns beide aus. »Was läuft?«
»Next Step und Royal Games«, erwidert sie.
Ich versuche, nicht direkt mit den Augen zu rollen. »Als ob das echt ist.«
»Es geht nicht darum, ob es echt ist, nur dass es echt sein könnte. Und ich würde mich nicht beschweren, durch angebliche Liebe plötzlich drei Stufen aufzusteigen«, flötet Iris.
»Toxischer Müll.«
»Und großartige Unterhaltung.«
Mein Mund öffnet sich schon, um die immer gleiche Diskussion mit ihr zu führen – aber ich schließe ihn wieder. Seit wir uns im Waisenhaus gefunden haben, träumt Iris davon, es irgendwie nach oben zu schaffen. Und auch wenn ich es niemals laut zugeben würde, träume ich mit. Wir haben es gemeinsam aus Stufe 2 geschafft, unsere Arbeitserlaubnis bekommen und so etwas Ähnliches wie ein Fundament gelegt. Für ein paar Momente hat es sich so angefühlt, als hätten wir tatsächlich eine Chance. Das hat uns geholfen weiterzumachen.
Anders als Iris bin ich nicht in Stufe 2 oder 3 aufgewachsen. Meine Eltern kamen aus Stufe 6. Ich konnte schon etwas schreiben und lesen, als ich ins Waisenhaus gekommen bin. Ich wusste, was es heißt, ein eigenes Zimmer zu haben. Anders als die meisten Kinder um mich herum. Anders als Iris.
Und ich habe mir die ganze Zeit nichts mehr gewünscht, als ihr irgendwann ein besseres Leben zu bieten als das, was wir beide gerade haben.
Aber ich habe versagt. Oder mein Körper. Wie man es nimmt.
»Würdest du die Chance ausschlagen, eine heiße Person zu daten und ein paar Stufen aufzusteigen? Ich glaube nicht«, reißt Iris mich wieder aus meinen Gedanken.
Ich kann nicht mehr antworten, denn offenbar hat sich heute einfach alles gegen mich verschworen. Das Bild des flackernden Hologramms kündigt die nächste Werbung an.
»Willkommen bei Death Call …«
Innerlich fluchend, greife ich nach einer der Tassen auf dem Tisch und verschütte dabei etwas Tee. Grimmig wische ich die paar Tropfen mit meinem Ärmel weg, was Iris nur mit einem missbilligenden Blick kommentiert.
»… dein Ableben kann helfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen …«
Mit der heißen Tasse lehne ich mich wieder zurück.
»… wir bieten dir einen möglichst angenehmen Übergang, in was auch immer danach kommt!«, verkündet die Frau im Fernsehen mit einem breiten Lächeln. »Lass dich jetzt beraten, und profitiere von unseren einzigartigen Angeboten.«
»Oh, ist ja wirklich sehr profitabel, tot zu sein«, zische ich.
Iris hebt eine der sorgfältig gezupften Augenbrauen. »Stimmt was nicht?«
»Alles bestens«, murmle ich und verschütte erneut heißen Tee. Ich zucke zusammen und fluche vor mich hin.
»Der Regen hat dich kaum erwischt, es ist alles gut«, versucht Iris es erneut.
Nur ahnt sie nicht, dass es nicht nur darum geht. Die Stelle an meinem Bein brennt, aber nicht genug, um zu erklären, warum ich plötzlich weine.
»Verdammt, was ist los?«, will Iris wissen.
Ich spüre ihre warmen Arme, die sich um mich schließen. Bereit, mich zu beschützen und alles Schlechte dieser Welt von mir fernzuhalten.
»Willst du nicht auch an einen Ort ohne Schmerzen oder Qual?«, fragt die verdammte Death-Call-Mitarbeiterin. »Nie wieder Hunger, nie wieder Angst. Nur das friedlichste Dasein, was ein Mensch bekommen kann. Wähle jetzt unseren exklusiven Afterlife-Service, und erfahre, was vielleicht oder vielleicht auch nicht nach deinem Ableben geschieht.«
»Halt die Klappe«, brülle ich die Frau an, doch sie lächelt nur.
»Bis bald, bei Death Call. Der Service für dein Ableben.«
Iris schaltet den Fernseher aus. Ganz langsam steht sie vom Sofa auf und sieht mich an. Nicht wütend, nicht verwirrt – nur unendlich traurig. »Was ist es?«
Eilig wische ich mir die Tränen aus dem Gesicht. »Was ist was?«
»Was wird dich töten?«
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
Es gibt jene, die zu Death Call gehen, und diejenigen, die vom Tod selbst berufen werden.
Auszug aus »Das Handbuch des Todes«
3. Kapitel
Eigentlich trage ich keine Kleider. Nicht weil ich sie nicht mag, sondern weil sie unpraktisch sind. Sie zeigen Haut. Haut, die schnell verletzt werden kann, wenn der Regen kommt. Haut, die schutzlos ist, wenn man überfallen wird.
Mit Kleidern ist die Chance, irgendwo hängen zu bleiben, wenn man weglaufen muss, ziemlich groß, und sie wickeln sich, wenn man Pech hat, um die eigenen Beine, wenn eine plötzliche Flut kommt und einen mitreißt.
Ich verdränge den Gedanken an meine Eltern und alles, was damit zusammenhängt. Es nützt nichts, aus einem Albtraum aufwachen zu wollen, der das eigene Leben ist.
Doch nun mustere ich das schwarze Kleid im Spiegel, dessen Schlitz meinen kurvigen Oberschenkel zeigt.
»Du siehst klasse aus«, murmelt Iris und lässt meine blau-grünen Haare über meine Schulter fallen.
Ich mag meine Haare. Sie sind eines der wenigen Dinge, über die ich in dieser Welt selbst entscheiden kann. Der eine Funke Luxus, den ich mir zu meiner Volljährigkeit geschenkt habe. Haare, die immer blau sind. Ein bunter Tupfer in meinem grauen Leben.
Unbehaglich drehe ich mich vor dem Spiegel hin und her, kann mich nicht entscheiden, ob ich meinen Anblick wirklich mag. Ich sehe aus wie ich, aber irgendwie auch nicht, weil ich mich nicht in meinem Hoodie verstecke.
»Meinst du wirklich, eine Party löst mein Todesproblem?«, murmle ich resigniert.
»Nein, aber es kann auch nicht schaden, oder?«
»Wahrscheinlich nicht.«
»Und bis du weißt, was du tun willst, da …«
»Mein Problem ist, dass ich nichts tun kann«, unterbreche ich sie. Nicht wütend, nur ehrlich. Irgendwie habe ich es in das Stadium der Akzeptanz geschafft.
Glaube ich jedenfalls.
Ich bin es durchgegangen. Ganz logisch. Ein paar gute Tage kann ich noch haben, vielleicht sogar Wochen. Und danach … Tja, sobald sich meine Augen verfärben und ich vergesse, wer ich bin, werde ich die Reißleine ziehen.
Nicht mit Death Call, sondern allein.
In der Nacht.
»Tut mir leid«, murmelt Iris und zupft an ihrem schillernden Oberteil. »Ich wollte nicht taktlos sein.«
»Als ob du jemals nicht taktlos bist«, gebe ich halb lächelnd zurück.
»Stimmt, aber soweit ich weiß, magst du das an mir.«
»Womöglich, weil ich auch nicht gut darin bin, den Takt zu halten, weshalb ich auch nicht verstehe, warum wir zu einer Party gehen«, antworte ich gelassen und schnappe mir meine Jacke.
»Weil es die letzte Party im Bunker ist – das nächste Unwetter wird dafür sorgen, dass er zusammenbricht«, erklärt Iris und trägt Lippenstift auf.
»Na wie passend. Die letzte große Party.«
»Ich wusste, dass dir das gefällt.«
Wir greifen nach unseren Taschen, verriegeln die Türen und lassen unsere kleine Wohnung hinter uns.
Die Nacht in 2-0-5 ist nicht viel anders als der Tag, aber die Menschen tragen auffälligere Kleidung. Unter den Masken wird gekichert, gelacht, und ab und an werden sie heimlich nach oben geschoben, um etwas selbst gebrannten Schnaps zu trinken.
Iris hat auch eine Weile selbst gebraut, doch irgendwann waren die Rohstoffe zu teuer und ihre Kundinnen zu pleite, als dass es sich noch gelohnt hätte. Je voller die Stadt wird, desto weniger reicht das bisschen Leben aus, das wir noch haben.
Dieses Mal nehmen wir die U-Bahn. Noch etwas, das wir eigentlich nie tun. Im dichten Gedränge ist es kaum möglich, zu sehen, an welcher Station man sich befindet. Ständig schiebt einer der Aufseher die Menschen dichter zusammen in die Waggons, bis man kaum noch Luft bekommt.
Ich stolpere, stoße gegen jemanden hinter mir und unterdrücke das leichte Schwindelgefühl, als wir endlich losfahren.
»Pfoten weg«, höre ich hinter mir eine helle Stimme.
Ich drehe den Kopf leicht, nur um zwischen den vielen Menschen zu sehen, wie ein Typ sich gegen eine junge Frau in einem knappen Kleid drängt.
»Komm schon, Baby – das Teil, das du trägst, ist doch ’ne Einladung«, sagt er süffisant und schiebt sich die Haare nach hinten, als würde er so weniger ekelhaft wirken.
»Komm mir noch mal nahe, und ich taser dich«, zischt sie.
»Uh, ich mag Ladys, die ihre Krallen ausfahren, aber das solltest du lieber lassen«, schnurrt er fast schon und deutet auf seinen Gürtel.
Ich kann die glänzende Marke nicht ganz erkennen, aber es reicht aus. Egal, ob er ein Bulle oder von der inneren Sicherheit ist – es macht keinen Unterschied. Denn damit ist er in Stufe 5, was bedeutet, dass alle in den unteren Stufen herzlich wenig gegen ihn ausrichten können.
»Hey, Arschloch«, ruft Iris, während sie sich an einer der hängenden Griffe festhält. »Lass deine dreckigen Pfoten von ihr.«
Der Kerl, den Iris mit ihren Augen fixiert, weicht ein bisschen vor der jungen Frau zurück, die er eben noch bedrängt hat. Sie nickt uns knapp zu, als stilles Zeichen dafür, dass es ihr gut geht.
»Du sollst dich nicht immer in so was einmischen«, wispere ich Iris zu. »Wenn wir noch mal festgenommen werden, war’s das mit Stufe 3.«
Iris verdreht nur die Augen. »Jemand muss doch was sagen.«
Sorgenvoll schüttle ich den Kopf. »Aber nicht du. Nicht wir.«
»Wir wissen beide, dass die es nicht tun werden«, gibt Iris zurück und deutet auf die kleinen schwarzen Kameras in den Ecken der U-Bahn.
Angeblich sind die ganzen Kameras, Gesichtsscanner und ID-Scans nur für unsere Sicherheit. Das sagen zumindest die PolitikerInnen im Fernsehen. Doch bisher habe ich nie gesehen, dass all dieses Zeug Menschen wie uns schützt – es kommt immer nur dann zum Einsatz, wenn wir die Grenzen der Gesetze ausgereizt haben, weil wir keine andere Wahl hatten.
Ich bin froh, als wir endlich wieder draußen sind, selbst wenn der beißende Geruch nach Gülle mir die Fähigkeit nimmt, tief einzuatmen.
Wir sind im äußersten Kreis der Stadt. Früher gab es hier so etwas wie Strände, doch die Fluten haben sich längst zurückgeholt, was die Menschen sich früher genommen haben. Und die Stadt dankt es der Welt, indem sie ihren Müll hier lagert. Über kurz oder lang finden die Berge an Plastik und Metall ohnehin ihren Weg in den Ozean, und wahrscheinlich hat sich die Stadtverwaltung gedacht, dass wir den Punkt überschritten haben, das zu vertuschen.
Ich zupfe mein Kleid zurecht und blicke nach oben. Aus der Entfernung kann man sie nur vermuten. Die Hochhäuser, die den ersten Fluten standgehalten haben und aus dem schwarz glänzenden Wasser emporragen – eine ständige Erinnerung an bessere Zeiten. Manchmal ziehen sich die Wassermassen ein wenig zurück, doch wir wissen alle, dass es nicht lange anhält. Nur bis zur nächsten Flut. Bis zur nächsten Welle, die wieder ein Stück mehr aus dieser Stadt mit sich reißen wird.
Und alle, die gezwungen sind, in diesem Bezirk zu leben.
Müll türmt sich an den Ecken der zerschlissenen Häuser. Die Wellen haben das Plastik an den Rand der Zäune geschwemmt, die jene abhalten sollen, die aus der Stadt verstoßen wurden.
Ein Schild warnt uns, dass hier Stufe 1 beginnt.
Trotzdem schieben wir uns durch das Tor zu dem einzigen Pfad, den es gibt. Keine andere Stufe ist durch einen Zaun abgegrenzt – nur diese. Denn hinter dem Maschendraht gibt es keine Regeln mehr. Keine Polizei und keine Staatsmacht, die sich einmischt. Nur der Müll und die Ausgestoßenen.
Der Pfad wird vom Maschendraht flankiert. Iris holt ihren schmalen Flachmann hervor und reicht ihn mir. Das Alkoholverbot ist aufgehoben. Von Kameras an den Zäunen fehlt jede Spur. Wer hier draußen ist, ist es auf eigene Gefahr. Der Smog ist hier kaum noch vorhanden, denn wo kaum Leben herrscht, wird auch kein giftiger Dreck aufgewirbelt. Zumindest gerade nicht.
Trotzdem lassen wir die Masken auf, wohl wissend, dass sie unserem eigenen Schutz dienen und den Gestank nach Fäkalien und Verwesung zumindest zum Teil abhalten.
Eine Gänsehaut breitet sich auf meinem Körper aus.
Still frage ich mich, wieso ich mich von Iris dazu habe überreden lassen, hierherzukommen. Um mich mache ich mir keine Sorgen, aber um sie.
Der Weg zum Bunker wird von blutroten Fackeln erleuchtet, deren künstliches Licht über die Pailletten von Iris’ Top flackert. Links und rechts vom Weg sind Zäune, verstärkt mit Stacheldraht, an dem Fetzen von Kleidung und Fleisch hängen. In der Dunkelheit dahinter kann man kaum mehr erkennen als Schatten, die hin und her springen.
Nein, korrigiere ich mich in Gedanken. Keine Schatten. Menschen.
Unvermittelt bleibe ich stehen, starre durch den Maschendraht in das Schwarz dahinter. Iris folgt meinem Blick, aber sie hält mich nicht auf, als ich näher an die Maschen herantrete. Fast bin ich versucht, meine Hand auszustrecken, aber ich weiß, wie viel Volt durch die kleinen metallischen Drähte fließen – und ich weiß, was diese Ladung mit einem Menschen macht.
Blutunterlaufene Augen starren mich an. So plötzlich, dass ein erstickter Schrei aus meinem Mund kommt.
Ein Mann. Geronnenes Blut verklebt seine Nase.
Sein Blick taxiert mich, als könnte er erkennen, dass wir uns ähnlich sind. Dass wir das gleiche Schicksal in uns tragen, beide zerfressen werden von etwas, das wir nur Erbsen nennen. Sein Mund öffnet sich, doch es sind keine Worte, die seinen Lippen entweichen, nur Laute. Erschütternde Laute, voller Leid und Hunger und dem Unverständnis, was mit ihm passiert.
Er wirft sich auf den Boden, wirbelt Dreck und Staub auf, während die roten Fackeln die Deformierungen seines Kopfes offenbaren. Aus der Erbse sind mehr geworden. Dutzende von Tumoren, die sich aus seinem Kopf drücken.
Ich sollte Angst haben.
Doch stattdessen fühle ich nur Mitleid.
Die Schmerzen, die er haben muss, die Angst …
»Du bist nicht wie sie«, höre ich Iris hinter mir sagen.
Ich starre ihn weiter an, das Abbild meiner Zukunft. »Noch nicht.«
»Wir werden nicht zulassen, dass es so weit kommt«, erwidert sie entschieden und zieht mich vom Zaun weg.
Als ob ich nicht auch so wüsste, was mich erwartet.
Nur dass wir uns nicht hier rausgewagt haben, damit die dunklen Wolken in meinem Kopf die Oberhand gewinnen. Wir sind hier für die letzte Party meines Lebens.
Die Schlange vor dem Bunker ist kurz. Wir treten durch den Scanner, warten, bis das Signal von Rot auf Grün wechselt, und nehmen unsere Masken ab, ehe wir durch den schwarzen Vorhang treten. Hinter uns höre ich, wie der Scanner das Störgeräusch von sich gibt. Offenbar hat jemand versucht, eine Waffe mit in den Bunker zu nehmen, und wird nun wieder nach draußen geschickt. Ich wende meinen Blick wieder nach vorn.
Die Luft ist besser als jene außerhalb der dicken Mauern, aber noch immer stickig.
Wir sind hier nicht unter der Erde, aber verborgen vor den Blicken der Welt. Was der Bunker früher war, weiß kaum noch jemand, aber es wird vermutet, dass Menschen darin gelebt haben. Menschen, die nicht geahnt haben, dass der Blick auf das Meer irgendwann ein Todesurteil sein könnte. Und nun, da das Gebäude weiter absackt, tiefer in den Grund sinkt und bald selbst zum Teil des Meeres werden wird, hat es keine Ähnlichkeit mit dem, was es einmal war.
Nun erstrahlt das Grau des Betons im kalten neonfarbenen Schein. Die schwere Eisentür knarrt und öffnet sich langsam, der Einlass in eine andere Welt, fernab von allem. Ein enges Labyrinth aus Gängen, die mit flackernden Lichtern gesäumt sind, breitet sich vor uns aus.
Die Wände erzählen Geschichten vergangener Tage, während die Beats der Musik meine Sinne betäuben. Wir schlängeln uns durch enge Gänge, bis wir in einen Raum gelangen, der an einen Tempel erinnert.
An den Wänden leuchten psychedelische Farben, wie ein Rausch. Die Tanzfläche ist ein Meer aus sich bewegenden Schatten, verschmolzen mit den Klängen, die aus den Boxen dröhnen. Die meisten Menschen sind völlig in Ekstase versunken, tanzen und feiern, als wären sie nicht am Abgrund der Welt, sondern in ihren Anfängen.
Harte Beats lassen den Boden unter meinen Füßen vibrieren. Tausende Lichter schimmern in der Dunkelheit.
Iris lacht und zieht mich mit sich. Ihre Euphorie steckt mich an, weckt den Drang danach, noch einmal richtig zu leben. Ich schwinge mich hin und her, lasse mir von ihr einen Drink in die Hand drücken und nippe an der Flüssigkeit, die meine Zunge zu verbrennen scheint. Aber es ist mir egal.
Weil alles egal ist.
Nur wir sind wichtig, wir und die Musik.
Die Tanzfläche füllt sich langsam, aber sicher. Die letzte Party im Bunker, das große Finale. Dabei ist der Name des Bunkers eigentlich irreführend. Das Gebäude ist ein Hochhaus, das letzte, das man in dieser Zone noch betreten kann. Alle anderen sind bereits zerstört, und in einer Woche wird auch dieses Hochhaus in sich zusammenfallen. Das Wasser ist schon jetzt nicht mehr allzu weit entfernt.
Ich wische mir den Schweiß von der Stirn und blicke Iris an. Wie sie lacht. Ihr Strahlen ist der Grund, warum ich so lange durchgehalten habe – warum ich immer an ein »Besser« glauben konnte. Sie hat mich gerettet, öfter, als ich zählen kann. Lächelnd nehme ich noch einen Schluck des Gebräus, das dafür sorgt, dass ich weniger nachdenke.
Trotzdem kann ich nicht mehr tanzen. Denn plötzlich zieht sich eine Gänsehaut über meinen gesamten Körper. Instinktiv sehe ich mich um, bis mein Blick auf einen jungen Mann am anderen Ende des Raums fällt. Ich kann sein Alter in dem flackernden bunten Licht nicht einschätzen, aber seine Augen starren mich an.
Es ist wie bei dem Mann in der verriegelten Zone. Er erkennt es. Diese Gewissheit trifft mich so schwer, dass ich ein paar Schritte zurücktaumle. Der Schwindel ist wieder da, sorgt dafür, dass ich mich kurz an Iris festhalten muss.
Mein Körper fühlt sich fremd an. Als wüsste er längst, dass es zu spät ist.
»Alles okay?«, ruft sie gegen die dröhnende Musik.
Ich blinzle, bis ich das Gefühl habe, die Kontrolle über meinem Körper wieder zurückgewonnen zu haben. »Ja, ich besorg uns mal einen neuen Drink.«
Sie nickt begeistert und wendet sich wieder einer hübschen Rothaarigen zu, die gerade auf sie zugetanzt kommt. Ich drehe ihr und dem unheimlichen Beobachter den Rücken zu.
Die Bar liegt neben den Aufzügen. Ein paar Dutzend Menschen drängen sich an den kleinen Tresen, in der Hoffnung, noch etwas Alkohol zu bekommen, ehe auch der letzte Tropfen aus ist.
Gerade überlege ich, ob ich auch versuchen soll, wie versprochen, einen neuen Drink zu besorgen, als plötzlich die Fahrstuhltüren aufgehen.
Ein bulliger Mann kommt heraus, beladen mit zwei schweren Fässern, die er unter dem Jubel der Menschen zur Bar bringt. Aber ich habe keine Augen für ihn, nur für den Aufzug.
Erst als mich jemand anrempelt, löse ich mich aus meiner Starre. Ich blicke über meine Schulter. Iris tanzt noch immer. Und der seltsame Kerl schaut noch immer in meine Richtung.
Ehe mir so richtig klar wird, was ich eigentlich tue, bewege ich mich in Richtung Aufzug. Niemand hält mich auf. Ich drücke auf den obersten Knopf und könnte schwören, dass der seltsame Beobachter den Kopf schüttelt, als sich die Türen vor mir schließen.
Die plötzliche Stille ist seltsam beruhigend. Hier bin ich mit dem Klang meines klopfenden Herzens allein. Sobald sich der Fahrstuhl bewegt, fühlt es sich an, als würde ich fallen und fliegen zugleich. Der Druck auf meinen Ohren nimmt zu, als er immer höher und höher schießt.
Und dann, ganz plötzlich, bin ich oben.
Unschlüssig stehe ich da, umhüllt von Metall. Erst das Piepen des Aufzugs reißt mich wieder in die Realität zurück. Das oberste Stockwerk.
Es ist dunkel, als ich auf den Flur trete. Nur die Beleuchtung des Notausgangs spendet Licht, aber die Treppe nach unten ist nicht mein Ziel. Stattdessen schlage ich den Weg nach oben ein.
Das Dach.
Vielleicht wird mir erst jetzt wirklich klar, was ich vorhabe. Der kalte Wind peitscht mir ins Gesicht. Die Luft hier oben fühlt sich klarer an, aber vielleicht ist das auch nur Einbildung.
Langsam gehe ich weiter auf das Dach hinaus, lasse die Tür achtlos hinter mir zufallen, denn ich habe nicht vor, wieder nach unten zu gehen.
Schritt für Schritt gehe ich auf die Kante des Daches zu, nur um einen Fuß breit vor dem Abgrund stehen zu bleiben. Die Kälte lässt mich zittern. Unter mir liegt die Stadt. Auf der einen Seite die Dunkelheit des Meeres, auf der anderen neonfarbene Lichter in der Ferne. Ich kann den Weg erkennen, den Iris und ich genommen haben. Vereinzelte Menschen, die sich diese letzte Party nicht entgehen lassen wollen – und die Umrisse der Ruinen hinter den Zäunen. Hunderte leere Häuser.
Verfallen.
Verlassen.
Verloren.
Wie die Menschen, die gezwungen sind, in ihnen zu leben.
Wird man krank, hat man nur zwei Möglichkeiten: sterben oder ausgestoßen werden.
Menschen der Stufe 1 leben jenseits der Zäune, falls man das überhaupt leben nennen kann. Kein Essen, kein sauberes Wasser. Nichts. Noch schlimmer als der Tod ist es, ausgestoßen zu werden vom Leben.
Ich schlucke, denn mir wird klar, dass ich mich längst entschieden habe. Mit geschlossenen Augen atme ich noch einmal tief ein.
Also dann, wollen wir doch mal sehen, ob es ein Danach gibt.
»Das solltest du nicht tun.«
Ich zucke so heftig zusammen, dass ich fast das Gleichgewicht verliere. Taumelnd weiche ich vor dem Abgrund zurück, wirble herum und blicke in zwei grüne Augen.
»Fuck«, stoße ich aus. »Zur Hölle, was soll das?«
»Ich wollte nicht, dass du springst«, erwidert der Mann vor mir ungerührt und fährt sich durch das dunkle Haar.
Irgendetwas in meinem Inneren stockt. Wie ein alter Film, auf dem sich ein Fehler in die Daten gebrannt hat.
Ich starre mein Gegenüber an. Er ist zu groß, zu gut aussehend und zu fremd für meinen Geschmack.
Unwillkürlich schlinge ich die Arme um meinen Körper, denn offenbar ist mein Beobachter mir auf dieses Dach gefolgt – und so etwas endet niemals gut.
»Wüsste nicht, was dich das angeht«, gebe ich schnaubend zurück, trete aber noch etwas weiter vom Abgrund zurück. Wenn ich falle, dann weil ich es will – nicht, weil eine Windböe mich erfasst hat oder ich wieder einmal unter Beweis stelle, dass ich nicht sonderlich geschickt bin.
»Tut es nicht.«
Wütend starre ich ihn an. »Großartig, da wir uns einig sind, kannst du ja wieder verschwinden.«
Meine Worte scheinen allerdings wenig Eindruck auf ihn zu machen. »Bevor du springst, solltest du dir vielleicht anhören, was ich zu sagen habe«, meint er ruhig, als hätte er solche Gespräche schon hundertmal geführt.
Irgendwie ärgert es mich, weil ich nicht nur eine von vielen sein will. Und das ärgert mich noch mehr, weil ich gar nicht erst so denken sollte, nur weil ein gut aussehender Typ mich davon abgehalten hat, mich von einem Dach zu stürzen.
»Du kannst es mir sagen, wenn ich unten angekommen bin.«
Er lacht.
Der Klang irritiert mich für einen Moment so sehr, dass ich mich frage, ob ich den Moment verpasst habe, in dem mein Leben zu einer seltsamen Dokusoap geworden ist.
In seinen Wangen zeigen sich kleine Grübchen, während er sein Lachen hinter einer Hand verbirgt. »Tut mir leid«, schiebt er hinterher und greift in die Taschen seiner Lederjacke. »Du bist witzig, das wird ihm gefallen.«
Skeptisch musterte ich ihn. Stufe 6. Mindestens. Kein Zeichen von Mangelernährung, saubere Kleidung, die fast neu aussieht, und wenn der Wind mir keinen Streich spielt, kann ich sogar Aftershave riechen.
»Das wird wem gefallen?«
Der Fremde lächelt. »Dem Tod.«
Ich wusste, er sieht zu gut aus.
Blinzelnd starre ich ihn an, während er mir eine Visitenkarte entgegenhält. Das schwarze Logo der gekreuzten Sensen auf dem elfenbeinfarbenen Papier hätte ich überall wiedererkannt.
»Das ist doch ein verfluchter Scherz«, stoße ich aus, ohne mich zu rühren. »Ist das ein neues krankes Spiel von Death Call?«
»Kein Scherz, Blueberry«, antwortet er. Noch immer ruhig, noch immer viel zu gelassen. Und dass er seine Haare so lässig nach hinten streicht, als wären wir in einem Werbespot für HoloHair, hilft auch nicht gerade.
»Woher weißt du, wer ich bin?«, will ich etwas leiser wissen und verschränke die Arme vor der Brust. Plötzlich bin ich mir nicht mehr so sicher, ob die Kälte der Grund für mein Zittern ist.
Es ist schon gruselig, wenn man bis auf ein Dach verfolgt wird und eine Visitenkarte von Death Call vor die Nase gehalten bekommt, aber meinen vollen Namen habe ich seit Jahren nicht mehr aus dem Mund eines anderen gehört.
»Vom Tod«, erklärt er nüchtern. »Und ich bin Creek. Er/ihn-Pronomen, danke der Nachfrage.«
»Es interessiert mich nicht, wer du bist«, erwidere ich mit einem lauten Schnauben und spüre, wie die vertraute Wut in mir aufsteigt. »Und es interessiert mich nicht, was Death Call von mir will.«
»Woher willst du das wissen, wenn du dir nicht angehört hast, was sie dir anzubieten haben?«, will Creek wissen. Sein Tonfall ist noch immer locker, leicht, als würden wir nicht auf einem Hochhaus stehen, als würde diese Welt nicht langsam, aber sicher verfallen, als würde er nicht für den verfluchten Tod persönlich arbeiten.
»Vielleicht hab ich kein Interesse am Afterlife und vielleicht auch nicht an diesem ganzen Bullshit«, gebe ich wütend zurück.
Creek zuckt mit den breiten Schultern. »Dann ist es ja gut, dass das nicht Teil des Angebots ist.«
Ich verenge die Augen, suche in seinem Gesicht nach etwas, das mir verrät, ob das alles hier nur ein fieser Scherz ist. Aber da ist nichts. Kein Anzeichen, das mir Aufschluss darüber geben könnte.
»Und was willst du mir anbieten?«, frage ich schließlich in herausforderndem Ton.
Creek legt den Kopf schief. »Einen Job.«
Für den Bruchteil einer Sekunde klappt mein Mund auf. Dann schüttle ich den Kopf. »Oh, tut mir leid. Ich bin leider verhindert, denn ich werde …«
»Sterben«, beendet Creek meinen Satz. »Ja, das ist der Grund, warum sie mich geschickt haben.«
Ich beiße mir auf die Lippe. Wenn es etwas gibt, das ich nicht mag, dann, unterbrochen zu werden. »Der Tod hat dich geschickt, um mich davon abzuhalten, mich zu töten, damit ich bei Death Call arbeite?«
Creek betrachtet mich einen Moment.
Und mir entgeht nicht, dass seine Augen einen Bruchteil zu lang auf dem langen Schlitz in meinem Kleid liegen oder, besser gesagt, auf meinen Beinen darunter. Er schüttelt langsam den Kopf. »Ja, das heißt, na ja – ich wusste nicht, dass du versuchen würdest, dich von einem Hochhaus zu stürzen, aber grundsätzlich … ja.«
Angriffslustig hebe ich das Kinn. »Warum?«
»Keine Ahnung.«
Creek hält meinem Blick stand, bis ich diejenige bin, die es nicht mehr aushält und an ihm vorbeistürmt. »Gut, dann richte ihm doch bitte aus, dass ich kein Interesse habe.«
»Dann stirbst du.«
Abrupt bleibe ich stehen, nur um ihm den giftigsten Blick zuzuwerfen, den ich aufbringen kann. »Ist mir bewusst.«
Doch auch davon scheint Creek nicht beeindruckt zu sein. Sachte macht er einen Schritt auf mich zu. »Wenn du für Death Call arbeitest, bist du für die Laufzeit deines Vertrags immun.«
Schluckend unterdrücke ich einen Fluch. »Gegen den Tod?«
»Sicher, gegen jede Form des Ablebens. Der Mister sucht sich ja nicht Menschen aus, die er dann direkt ins Jenseits schickt«, erklärt er sachlich und hält mir wieder die Karte entgegen.
»Ich glaub das einfach nicht.«
»Mich hat es auch verwirrt, dass er Mister genannt werden will«, gibt er zu.
Ungläubig starre ich Creek an. »Nicht das.«
Zum ersten Mal runzelt er die Stirn, als würde es ihm schwerfallen, mir zu folgen. »Oh, und was dann?«
»Dass du hier auftauchst, mich störst beim …« Ich schaffe es nicht, den Satz zu Ende zu bringen. »Und mich jetzt dazu bringen willst, für diese verdammte Firma zu arbeiten, die reihenweise Menschen umbringt.«
Er legt nachdenklich den Kopf schief. »Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung von ungeheuer komplexen Zusammenhängen.«
Ich werfe die Hände in die Luft. »Ach ja?«
»Absolut.«
»Und wie ist deine Darstellung?«, schieße ich zurück.