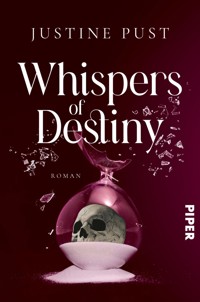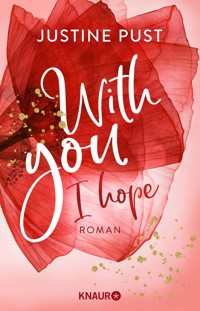
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Belmont Bay
- Sprache: Deutsch
Manchmal musst du erst etwas verlieren, um die Liebe zu finden »With you I hope« ist der 2. Band der ebenso dramatischen wie hoffnungsvollen New-Adult-Reihe »Belmont Bay« aus dem wild-romantischen Idaho. Obwohl Megan ihre Familie und vor allem ihre Adoptivschwester Mia liebt, wünscht sie sich nichts sehnlicher, als endlich ihre leiblichen Eltern ausfindig zu machen. Deren letzte Spur hat Megan vor einigen Jahren nach Belmont Bay geführt, und sie hat sich in die idyllische kleine Stadt verliebt – auch, weil sie sich ihren Wurzeln dort näher fühlt. Als Leo in Belmont Bay auftaucht, ist er für Megan zunächst vor allem eines: eine neue Chance, das Geheimnis um ihre Eltern doch noch zu lüften. Ihre Nachforschungen stellen Leo und Megan jedoch vor ungeahnte Konflikte, und schon bald sind sie hin- und hergerissen zwischen Liebe und Verrat. Der 2. Band der »Belmont Bay«-Reihe von Justine Pust erzählt eine bewegende Romeo-&-Julia-Geschichte. Im 1. Band der New-Adult-Reihe, »With you I dream«, muss Megans Schwester Mia ein Trauma überwinden und einen Neuanfang wagen, im Leben wie in der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Justine Pust
With you I hope
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Obwohl Megan ihre Familie und vor allem ihre Adoptivschwester Mia liebt, wünscht sie sich nichts sehnlicher, als endlich ihre leiblichen Eltern ausfindig zu machen. Deren letzte Spur hat Megan vor einigen Jahren nach Belmont Bay geführt, und sie hat sich in die idyllische kleine Stadt verliebt – auch, weil sie sich ihren Wurzeln dort näher fühlt.
Als der attraktive Leo in Belmont Bay auftaucht, ist er für Megan zunächst vor allem eines: eine neue Chance, das Geheimnis um ihre Eltern doch noch zu lüften. Ihre Nachforschungen stellen Leo und Megan jedoch vor ungeahnte Konflikte, und schon bald sind sie hin- und hergerissen zwischen Liebe und Verrat.
Inhaltsübersicht
Triggerwarnung – Hinweis
Widmung
Playlist
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Epilog
Nachwort
Danksagung
Quellenverzeichnis
Triggerwarnung
Triggerwarnung – Hinweis
Liebe Leser*innen,
bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen euch gute Unterhaltung mit With you I hope.
Justine und der Knaur Verlag
Dieses Buch ist für dich.
Wir sind alle auf der Suche, verlier dich nicht auf deinem Weg.
Playlist
Thirty Seconds To Mars – Rescue Me
NIN – Every Day is Exactly the Same
blink-182 – First Date
Tom Odell – Numb
The Veronicas – Untouched
Lady Antebellum – Just A Kiss
Rag’n’Bone Man & P!nk – Anywhere Away From Here
Miley Cyrus – Midnight Sky
plxntkid – Rose Quartz
Zoe Wees – Control
New York Dolls – Trash
Daughtry – It’s Not Over
The Fray – You Found Me
Lady Gaga – Million Reasons
Céline Dion – Ashes
Billie Eilish – Everything I Wanted
OneRepublic – Counting Stars
Tom Grennan – Little Bit of Love
1
Erinnerungen sind ebenso wertvoll wie zerbrechlich. Wir müssen sie erhalten, bewachen wie Schätze und dafür sorgen, dass sie nicht durch ein Feuer in der Gegenwart zu einem Häufchen Asche ohne Bedeutung verglühen. Jeder Mensch hat seine eigene Art, Erinnerungen zu bewahren. Für mich sind es Fotoalben. Nicht diese schrecklich lieblosen Versionen, die man online mit ein paar Klicks erstellt. Sondern oldschool. Eingeklebte Bilder der glücklichsten Momente, ganz ohne Filter und Bearbeitung. Schnappschüsse in Licht, das nicht optimal ist, unterbrochen von Eintrittskarten, getrockneten Blüten und Geschenkband. Der Versuch, diese kostbaren Augenblicke zwischen den Seiten für immer zu versiegeln.
Immerhin können die Andenken nicht verblassen, wenn sie auf den schwarzen Blättern eines Albums dokumentiert sind. Meine Fingerspitzen sind klebrig von den Resten des Leimstifts, mit dessen Hilfe ich die Fotos des letzten Jahres in einem neuen Buch untergebracht habe.
Um mich herum liegen Stifte, Glitter, Washi-Tape und Fotos in unterschiedlichen Größen, die mich, meine Schwester und all die Menschen um uns herum zeigen, die langsam zu einer zweiten Familie geworden sind. Ich hebe eins davon hoch, betrachte Mia und mich, wie wir unserer Mom einen Kuss auf die Wange drücken. Ich erinnere mich so gut an diesen Moment. Wir drei haben mein neuestes Rouge ausprobiert, und während es auf meinen Wangen eher aussah, als hätte ich mir einen Strich aufgemalt, verlieh es der dunkelbraunen Haut meiner Mom einen so schönen Schimmer, dass sie es noch immer benutzt. Mit einem Finger streiche ich über das Bild.
Und obwohl ich dieses Foto liebe, den Moment liebe, in dem es entstanden ist, und meine Familie liebe, tut es weh. Denn es zeigt mir nicht nur, welches Glück ich habe, sondern auch, was ich nicht habe. Nach einigem Zögern ziehe ich das neue Fotoalbum näher an mich heran, positioniere das Bild in der Mitte der ersten Seite und betrachte noch einmal den Spruch, den ich mir auf Pinterest herausgesucht habe.
Glück wird aus Mut gemacht.
Ekelhaft kitschig, aber ziemlich passend für Mia und mich und diese Stadt, in der wir gelandet sind. Selbst wenn die Gründe dafür nicht unterschiedlicher hätten sein können. Mia ist geflohen, ich habe nach der Familie gesucht, die mich nicht haben wollte.
Nachdem ich den Satz in meiner schönsten Schrift und mit einem roségoldenen Metallicstift auf das schwarze Papier geschrieben habe, klebe ich das Foto mit dem passenden Washi-Tape fest und nicke. Es ist das perfekte Geschenk für einen Abschied, der zugleich ein Neubeginn ist – wenn auch nicht für mich.
Seufzend klappe ich das Fotoalbum wieder zu und verstaue es in der Kiste vor mir. Inzwischen habe ich mich so daran gewöhnt, dass meine kleine Schwester auf meinem Sofa schläft, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass dieser Raum wieder mir allein gehören soll. Die Wohnung kommt mir plötzlich unglaublich groß vor. Natürlich kann ich den Gedanken niemals laut aussprechen, aber mich beschleicht ein Gefühl, das ich lieber verdrängen würde: Einsamkeit.
Ich suche kein fehlendes Puzzlestück, keine Heilung meiner Wunden und niemanden, der den Schmerz in mir teilen will. Es ist verdammt noch mal mein Schmerz, und ich will ihn nur für mich. Doch jetzt, in diesen Moment, der so angefüllt ist von schönen Erinnerungen, kann ich trotzdem nicht anders. Fröstelnd streiche ich mir über die nackten Arme, als würde mein Körper sich nach einer Umarmung sehnen. Mia scheint diesen Gedanken gehört zu haben, denn sie steht im Türrahmen und sieht mich an. »Was machst du da, Megan?«
»Etwas furchtbar Kitschiges, das ich niemals zugeben werde«, entgegne ich und grinse meine kleine Schwester an. Für mich hat es nie eine Rolle gespielt, dass wir adoptiert sind. Mia ist meine Schwester, nicht nur, weil wir das Glück hatten, dass unsere Mutter uns beide aufgenommen hat, sondern auch, weil unsere Seelen unwiderruflich verbunden sind.
Ich reiche ihr das Fotoalbum, das ich für sie gemacht habe. Meine Schwester lächelt, drückt das Buch an ihre Brust, kennt mich jedoch gut genug, um es nicht sofort zu öffnen. Sie trägt eines ihrer Sommerkleider, die bei jeder Bewegung sachte mitschwingen. Ihr schwarzes, glattes Haar liegt schwer über ihren Schultern.
Mia schüttelt den Kopf über mich. »Wolltest du mir nicht beim Packen helfen, statt in den Fotos zu blättern und zu basteln?«
»Wollte ich, aber es waren ein paar wirklich krasse Monate. Wer hätte gedacht, dass wir uns beide in Belmont Bay verlieben?«
Mia zuckt mit den Schultern. »Ich bin sicher, es liegt an den Milchshakes im Joey’s.«
»Eine Verschwörung? Sie machen ahnungslose Besucher abhängig mit den Spezialmischungen und sorgen so dafür, dass die Einwohnerzahl steigt?«, will ich skeptisch wissen, muss bei dem Gedanken jedoch lächeln. Es würde auf absurde Art zu Tanja und Joey, den Besitzern des örtlichen Diners, passen.
Wir schauen einander kurz an und seufzen zeitgleich. Es erscheint so unwirklich, Mia jetzt gehen zu lassen. Mir ist klar, dass ihr Auszug längst überfällig ist. Eigentlich kam sie nur noch in unsere, besser in meine Wohnung, wenn ihre Wäsche zur Neige ging. Da sie für ihr Studium die meiste Zeit in der nächsten großen Stadt verbringt und nur an den Wochenenden und in den Semesterferien in Belmont Bay ist, ist es auch nur logisch, dass sie ihre Freizeit mit ihrem Freund verbringen will und nicht mit mir.
»Du ziehst wirklich aus«, sage ich und spüre wieder diesen kalten Stich. Für einen Herzschlag schließe ich die Augen. Ich sehe Mia wieder vor mir, wie sie letzten Sommer aus dem Bus gestiegen ist. Den gesamten Körper übersät mit Prellungen und einer blutenden Seele. Damals hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass sie am gleichen Ort ihren Frieden findet wie ich. Meine Lider heben sich wieder, finden in die Realität und das Jetzt zurück.
»Mit dem Rad sind es nur ein paar Minuten«, wehrt Mia ab, lässt sich aber trotzdem neben mir auf den Boden sinken. »Du wirst gar nicht merken, dass niemand auf deinem Sofa schläft.«
Da irrt sie sich, doch das werde ich ihr nicht sagen. In den letzten Wochen war mir ihre Abwesenheit viel zu bewusst. Die Angst des Verlassenwerdens war viel zu greifbar.
»Es fühlt sich nur komisch an.«
»Ja, für mich auch«, gesteht sie und lächelt. »Aber jetzt streiten wir uns auch nicht mehr um den Abwasch.«
»Definitiv ein Pluspunkt.«
Ich würde gern etwas sagen, das meine verwirrten Gefühle zumindest ein wenig in Worte fassen kann – aber in solchen Dingen war meine kleine Schwester immer viel besser als ich. Wenn ich emotional werde, mache ich schlechte Witze und versuche mir nichts anmerken zu lassen. Sie hingegen ist eine Meisterin darin, ihre Gefühle in poetische Worte zu kleiden. Oder in Shakespeare-Zitate. Oder beides.
Ein Hupen erklingt, noch bevor ich es geschafft habe, ihr zu sagen, was ich denke.
»Komm, Conner wartet sicher schon«, meint Mia.
Ich bin froh, dass Conner und meine Schwester ein Paar sind. Von all den Menschen in dieser Stadt gehört er zu jenen, denen ich am meisten vertraue, auch wenn er auf den ersten Blick wie ein Bad Boy wirkt. Zu lange Haare, mehr Tattoos als freie Haut und seine Einsilbigkeit lenken davon ab, dass er die besten Milchshakes der Welt macht und seine Seifen selbst herstellt. Er ist einer von den guten Jungs, und meine kleine Schwester verdient nach allem, was sie erlebt hat, genau das.
Mia steht auf, ehe sie mich auf die Füße zieht. Zusammen bringen wir die letzten Kisten mit ihren Sachen nach unten, verstauen alles im Wagen und witzeln darüber, dass Conners neueste Lavendelseifenmischung ihn riechen lässt wie unsere Granny.
Er ist unsere Sticheleien inzwischen gewöhnt und tut sie nur noch mit einem Schulterzucken ab, bevor er sich die lange Mähne zu einem Knoten bindet. »War das alles?«, will Conner wissen und erwischt mich damit eiskalt. Kein flapsiger Spruch will mehr über meine Lippen kommen. Dennoch schaffe ich es, irgendwie zu nicken.
»Falls ich noch etwas finde, bring ich es rüber«, murmle ich stockend, versuche, das Gefühl zu verdrängen, dass meine kleine Schwester mich verlässt.
»Ab heute wohnen wir hochoffiziell zusammen«, verkündet Mia. Sie schlingt glücklich die Arme um Conners Hals, und er beugt sich zu ihr, um ihr einen zärtlichen Kuss auf die Lippen zu hauchen.
»Könntet ihr bitte nicht direkt vor mir mit eurem romantischen Abend beginnen?«, merke ich an und verschränke die Arme vor der Brust. Ich gönne ihnen ihr Glück. Wirklich. Nachdem Mia in ihrer letzten Beziehung durch eine Hölle aus Gewalt und Kontrolle gehen musste, soll sie jetzt einfach nur glücklich sein.
Allerdings hinterlässt es trotzdem diesen Stich in meiner Brust, zu wissen, dass sie nun nicht mehr auf meinem Sofa schläft. Dass es keine Abende mehr geben wird, in denen wir zu viel Pizza und Eiscreme essen und in den alten Fotoalben blättern. Okay, ich merke selbst, dass ich melodramatisch werde. Natürlich wird es diese Abende noch geben – aber eben nicht mehr so oft.
Conners Haus mag nur einen Marsch durch den Wald von meiner Wohnung entfernt liegen, aber es ist dennoch nicht das Gleiche. Auch wenn es nicht immer einfach war, war es doch schön, ein Stück meiner Familie um mich herum zu haben. Mias Lächeln hat die Gedanken verscheucht, die sich nun wieder aus ihren Löchern wagen und mir all die Fragen entgegenwerfen, auf die ich einfach keine Antworten finde.
Mia scheint den Schatten zu spüren, der in meinen Augen flackert. »Treffen wir uns Donnerstag im Diner?«
Ich nicke stumm, denn ich will nicht anfangen, noch emotionaler zu werden, und wenn ich jetzt den Mund öffne, könnte das durchaus passieren. Mia umarmt mich zum Abschied, steigt in den Wagen. Für einen Moment stehe ich einfach nur am Rand der Straße, blicke ihnen nach.
Und dann bin ich wieder allein.
Die Treppen bis zu meiner Wohnung kommen mir plötzlich schrecklich steil vor. Hinter mir fällt die Tür ins Schloss, bevor ich in die Küche gehe. Im Kühlschrank steht noch eine Flasche Weißwein, die ich nun ohne Rücksicht auf Verluste öffnen werde. Mit dem vollen Glas setze ich mich auf das Fensterbrett. Am Himmel zeigt sich bereits der Mond, obwohl die Sonne erst dabei ist, unterzugehen. Die Äste der Bäume zeigen die prachtvollen Knospen und hellgrünen Blätter. In all dieser Ruhe höre ich das Gefühl der Einsamkeit in mir seufzen. Der Ausblick wäre schön, wenn nicht ein großes Spinnennetz inklusive des haarigen Bewohners die Sicht versperren würde. Spinnen machen mir keine Angst, doch sie verursachen diese Gänsehaut, die einem instinktiv sagt, man solle sich fernhalten. Einen Moment zögere ich, dann laufe ich ins Wohnzimmer und hole meine Kamera. Aus meinem einstigen Hobby, das ich auf Instagram teile, ist inzwischen mein Job geworden – was dafür sorgt, dass ich manchmal das Gefühl habe, die Welt nur noch hinter einer Kameralinse hervor zu betrachten. Wie ein Schutzschild zwischen mir und der Realität.
Ein paarmal drücke ich auf den Auslöser, doch die Stimmung des Lichts will sich nicht so einfangen lassen, wie ich es gern hätte. Frustriert lege ich die Spiegelreflex wieder weg. Fotos kann man löschen. Erinnerungen meist nicht. Und vor manchen kann man nicht einmal davonlaufen. Als ich nach Belmont Bay kam, war ich auf der Suche nach der Familie, die mich nicht wollte – und fand stattdessen ein Zuhause, nach dem ich gar nicht gesucht hatte. Unglaublich, wie die Zeit vergeht, wie schnell aus Tagen Wochen werden, die sich in Monate erstrecken und zu Jahren reifen. Zwei Jahre nenne ich diese Wohnung schon mein Zuhause, doch erst meine Schwester hat es wirklich dazu gemacht. Zu Hause. Und nun, da sie fort ist, wieder ihr eigenes Leben führt, fühlt sich meins an, als sei ich wieder auf der Suche.
Auf der Suche nach meiner leiblichen Familie. Nach der Mutter, die mich allein auf einem Busbahnhof mitten in New York gelassen hat, und dem Vater, von dem ich nicht einmal weiß, ob er je versucht hat, mich zu finden. Nach Antworten, die mir niemand geben kann, außer diese zwei Personen, die ich nicht einmal kenne.
Die Spuren meiner Mutter haben mich in diese Stadt gebracht, haben mir gezeigt, dass ich nicht immer rastlos sein muss, sondern auch mal stehen bleiben darf. Nur was, wenn ich inzwischen zu lange auf einer Stelle stehen geblieben bin? Belmont Bay sollte nie der Ort sein, an dem ich bleibe – doch nun weiß ich nicht mehr, ob ich wirklich wieder gehen möchte.
Vielleicht läuft es genauso im Leben: Man bekommt nicht das, von dem man dachte, es zu wollen, sondern das, was man tatsächlich braucht. Offenbar beginnt der Wein zu wirken, denn solch schwülstige Gedanken überfallen mich nicht gerade oft. Trotzdem blicke ich weiterhin gedankenverloren aus meinem Fenster, vor dem die Glühwürmchen im Mondlicht tanzen.
2
Jeder Tag ist gleich. Es fühlt sich fast an, als könnte ich in die Zukunft sehen. Nur ohne irgendeine Spannung, obwohl ich in einem immerwährenden Drama feststecke, das nicht mein eigenes ist.
Meine Großmutter hat gesagt, dass uns im Laufe des Lebens die Liebe zweimal begegnet: eine, mit der wir für immer zusammenleben, und eine, die wir für immer verlieren werden.
Scheiße – wenn das stimmt, bin ich am Arsch, denn ich habe nicht nur meine bereits verloren, sondern sorge auch dafür, dass andere es tun. In meinem Job mache ich praktisch kaum etwas anderes, als ohnehin schon fragile Beziehungen endgültig über eine Klippe zu stoßen. Aber zu meiner Verteidigung: Es gibt in Idaho wenig Bedarf an Privatermittlern – und im Gegensatz zu meinem Vater bin ich nicht gut darin, Betriebskriminalität aufzudecken. Meine Kunden sind in 95 Prozent der Fälle Menschen, die ihren Partnerinnen und Partnern misstrauen. Und zu meinem eigenen Leidwesen haben sie meist recht. So wie Mrs Stuart recht hat.
Jedes Mal, wenn ich einer Ehe den Grund liefere, geschieden zu werden, fühlt es sich an, als würde ich meine eigenen Wunden noch mehr aufreißen, damit sie nie ganz verheilen. Dabei ist meine eigene Erfahrung damit, der Betrogene zu sein, schon lange her.
Meine Hand zuckt zu meinem Telefon, öffnet das Bild, das ich längst hätte löschen sollen. Kelly strahlt mich von dem Foto an. Sie hat ihre Hände um meinen Hals geschlungen, schmiegt sich an mich und gibt mir das Gefühl, dass wir ein Happy End verdient haben. Aber so weit kam es nie. Stattdessen sitze ich in diesem Auto, mache einen Job, den ich nicht mag, und frage mich, ob ich die Liebe noch einmal finden kann, ohne dass mir erneut das Herz gebrochen wird.
Ohne das Foto zu löschen, stecke ich mein Handy weg und konzentriere mich wieder auf den Fall von Mrs Stuart. Ihr Mann kommt gerade aus einem schmuddeligen Hotel, gibt seiner Geliebten einen Abschiedskuss und geht seines Wegs, als sei alles normal. Für ihn ist es das wahrscheinlich sogar.
Nach den letzten vier Wochen kenne ich Mr Stuart besser als meinen eigenen Vater. Ich weiß, was er zu Mittag isst, welche Bücher er gern liest, auf welchen Datingseiten er sich rumtreibt, und zu allem Überfluss leider auch, wie seine Genitalien aussehen. Gelangweilt lege ich die Spiegelreflexkamera zur Seite. Durch das übergroße Teleobjektiv bekommt man zwar gestochen scharfe Bilder, doch meine Arme werden schwer. Außerdem ist die Arbeit getan.
Ich habe sämtliche Beweise für die Untreue von Mr Stuart gesammelt und dokumentiert und, sobald ich die Fotos ausgedruckt habe, in der Akte abgelegt.
Und damit erfülle ich das perfekte negative Klischee eines Privatermittlers in den USA. Ich gehe nicht so weit, dass ich mich selbst strafbar mache, aber ich schlängle mich an der Grauzone entlang, die das Privatleben schützt.
Es ist also nicht so, dass ich einfach in ein Hotelzimmer stürmen kann, in dem jemand gerade Ehebruch begeht, um dann Fotos zu schießen.
Aber je nach Bundesstaat kann es den Ausgang einer Scheidung maßgeblich beeinflussen, besonders wenn ich haarklein dokumentiert habe, wann und wie oft der Betrug erfolgt. Doch was hier so technisch klingt, zeigt nicht, welche Wunden es aufreißt.
Jetzt kommt der nächste Teil meines Jobs, den ich nicht leiden kann. »Scheiße.«
Das Schlimme an der Liebe ist, dass wir den Schmerz auch mit rationalem Denken nicht ausblenden können. Und meine Aufgabe ist es, jemandem die Gewissheit zu geben, dass der Schmerz nicht nur real, sondern die Trennung, die daraus folgt, meist endgültig ist.
Für heute kann ich allerdings nichts mehr tun. Ich starte den Wagen und folge der Hauptstraße. Vor mir liegt die Skyline von Boise mit den Bergen in der Ferne. Die schönste Stadt im Südwesten von Idaho, zumindest, wenn man die Touristenblogs fragt. Ein paar Graureiher schweben in der Luft, als würden sie dem Sonnenuntergang entgegenfliegen. Bevor ich mich jedoch über diesen Anblick freuen kann, muss ich scharf abbremsen, um einem verirrten Radfahrer auszuweichen. Fluchend wische ich mir über das Gesicht. Wahrscheinlich ein Tourist, der den Weg zum Boise Greenbelt, einem langen Rad- und Fußgängerweg, sucht, der verschiedene Parks und Naturgebiete entlang des örtlichen Flusses verbindet. Die Graureiher sind verschwunden, doch meine Sehnsucht nach den Bergen nicht. Von Hügel zu Hügel schweift mein Blick über die unendliche Fläche aus felsigen Formationen, die im Licht der Abendsonne golden funkeln. Seufzend fahre ich mir durch die schwarzen Haare. Aktuell wäre mir die Einsamkeit der Natur wesentlich lieber, als einmal quer durch die Stadt zu gondeln. Besonders, da am Ende nichts auf mich wartet, das diesen Tag noch retten könnte.
»Du bist spät dran«, begrüßt mich mein Vater, als ich die Kanzlei betrete. Das Daddarios liegt inmitten der Innenstadt von Boise. Die raue Fassade passt gut zu dem minimalistisch kühlen Stil der Inneneinrichtung. Mein Dad nennt es modern, doch für mich fühlt es sich einfach nur kalt an.
Die meisten anderen Privatermittelnden sind bereits im Feierabend oder haben noch eine Observation. Die im Raum verteilten Schreibtische sind leer, und die Berge aus Papieren schimmern im Licht der Abendsonne, die durch die großen Fenster dringt.
»Ich hab den Fall fast abgeschlossen«, erkläre ich, um dieses Gespräch zumindest etwas versöhnlicher zu gestalten.
»Gut, denn ich habe einen neuen Auftrag für dich.« Die Stimme meines Vaters klingt kühl, nach einem Geschäftsmann. Sein Spezialgebiet hat herzlich wenig mit meiner Arbeit zu tun. Während ich das negative Klischee unserer Branche verkörpere, ist er der erste Mann in Boise, den Firmen anrufen, wenn sie vermuten, jemand in ihrem Konzern würde sich etwas in die eigenen Taschen stecken. Selbst mit der Polizei hat er schon zusammengearbeitet, korrupte Politiker überführt und Menschen geholfen, die sich unverschuldet in Schwierigkeiten gebracht haben. Lange Zeit war er mein Held, bis er diesem Bild nicht mehr gerecht werden konnte, denn auch Helden haben Geheimnisse. Und seine zeigen eine Seite von ihm, die ich lieber nie gesehen hätte.
Die Zeitungsausschnitte der Fälle, in denen er sogar der Polizei geholfen hat, hängen in goldenen Rahmen an der Wand hinter seinem Schreibtisch. Er ist der Held, und ich mache die Arbeit, die sonst niemand tun will.
Nur knapp gelingt es mir, ein Stöhnen zu unterdrücken. Ich werde nie verstehen, wie wir uns äußerlich so ähnlich sein können und doch so grundverschieden sind. »Dieses Mal kein potenzieller Fremdgänger?« Ganz leise keimt in mir die Hoffnung auf, dass er mir mal etwas mehr zutraut als wieder einen potenziellen Fremdgänger, doch sein Blick reicht, um diese Hoffnung gleich wieder zu ersticken.
Mein Vater mustert mich einen Moment streng. Mir ist klar, dass er es nicht gern hört, wenn ich schlecht über meinen Job rede. Unseren Job. Das Familiengeschäft.
Seit zwei Generationen sind die Daddarios Privatermittler. Wir alle landen über kurz oder lang hier. Nachdem mein Großvater verstarb, übernahm mein Vater das Geschäft und baute es aus, und inzwischen sind wir führend in dieser Stadt, vielleicht sogar die Besten im Bundesstaat. Und das, obwohl wir nur aus einem Fünferteam bestehen. Sie alle machen einen besseren Job als ich, dem das alles doch im Blut liegen müsste.
»Nach dem, was im Mini-Markt passiert ist, wirst du wohl verstehen, warum ich dir erst mal die kleineren Sachen gebe«, brummt er.
Meine Zähne pressen sich zusammen. Diese Sache wird er mir noch ewig vorhalten. Ich sollte eine unehrliche Kassiererin überführen. Bei den Testeinkäufen musste ich feststellen, dass sie nicht alles richtig boniert und sich so etwas Extrageld verschafft hat. Allerdings wurde mir auch schnell klar, dass sie dies nur tat, um die Behandlung ihres krebskranken Mannes zu finanzieren. Also warnte ich sie vor, damit sie nicht in die von mir gestellte Falle lief. Zugegeben, es war nicht richtig von ihr – aber was hätte ich getan, wenn es um den Menschen gegangen wäre, den ich am meisten auf der Welt liebe? Wahrscheinlich etwas Ähnliches. Weil die Liebe uns manchmal eben dazu bringt, Dinge zu tun, die nicht immer nur gut sind. Ich räuspere mich. »Die Frau war keine Schwerverbrecherin.«
»Nein, aber sie hat gegen das Gesetz verstoßen, und es war deine Aufgabe, das zu beweisen.«
Grimmig kneife ich die Augen zusammen. »Du bist wohl kaum der Richtige für ein moralisches Urteil, Dad.«
Sein Gesichtsausdruck verfinstert sich. Wir reden nicht viel über die Dinge, die ich aus seinem Leben weiß, aber nicht wissen sollte. Genau genommen reden wir insgesamt nicht viel. Mein Dad ist nicht mehr mein Held, sondern nur noch ein Mann, in dessen Vergangenheit es viele dunkle Flecken auf der augenscheinlich weißen Weste gibt.
Grollend wischt mein Vater sich über die Nase.
»Und du bist offensichtlich nicht der Richtige für diesen Teil unseres Berufs.«
Autsch. Das hat gesessen.
Mein Dad liebt alles an diesem Job. Das Spurensuchen, das Beobachten, das Puzzeln. Manchmal glaube ich, dass es mich auch glücklich machen, mich erfüllen könnte. Doch dann stecke ich wieder mitten in dieser Spirale der immer gleichen Momente, Gespräche und Augenblicke.
Für einen Wimpernschlag warte ich darauf, dass er mir eine Standpauke hält, doch es ist spät, und wir sind beide müde. Das erkenne ich bei ihm schon daran, dass die Ärmel seines Hemds nach oben geschlagen sind und die Kaffeemaschine bereits aus der Steckdose gezogen wurde. Er hat die absurde Angst, dass irgendetwas Feuer fängt, wenn es noch am Strom angeschlossen ist.
»Dieser Fall könnte dir gefallen, Junge. Der Ort klingt, als würdest du ihn mögen.«
Ich fahre mir erneut durch die Haare und lege den Kopf schief, während ich Dad betrachte. Obwohl er bereits auf die sechzig zugeht, sind seine Haare noch immer so voll wie meine. Nur hat sich das tiefe Schwarz inzwischen in ein Grau verwandelt. »Schieß los.«
»Es ist ein Außeneinsatz.«
So klingt es, als wäre ich ein Geheimagent, der die Welt retten muss. »Und wo geht’s hin? Middelton? Kuna? Blacks Creek?«
»Nein.« Alexander Daddario schnaubt und wischt sich erneut über die Nase, ehe er sich auf seinen Schreibtischstuhl sinken lässt. Er tippt ein paarmal auf der Tastatur herum, ehe der Drucker anspringt.
Wortlos ziehe ich ein Blatt Papier mit einer Routenplanung hervor. Ich lege die Stirn in Falten. »Wo zum Teufel liegt Belmont Bay?«
3
Ich mag keine Menschen, die sich mehr darüber aufregen, dass man ihre Lügen aufgedeckt hat, als darüber, dass sie gelogen haben.
»Du glaubst diesem Kerl doch nicht!«
Mr Stuarts Kopf hat einen dunklen Purpurton angenommen. Er fuchtelt wild mit den Armen und lockert immer wieder seine Krawatte, als würde er zu wenig Luft bekommen. Seine Noch-Ehefrau sitzt seelenruhig neben mir auf dem Samtsofa und nippt an ihrer Tasse Tee.
»Möchtest du dir die Fotos ansehen, Schatz?«, will sie gelassen wissen, wobei sie mir einen entschuldigenden Blick zuwirft. Eigentlich vermeide ich es, ins Kreuzfeuer zu geraten, doch Mr Stuart hat zum ersten Mal gegen seinen Zeitplan verstoßen und damit meinen eigenen durcheinandergebracht. Nun sitze ich mitten in diesem Schlamassel.
»Ich …«
Mr Stuart hört auf zu fuchteln und zu leugnen. Er taumelt einen Schritt zurück, als würde ihm erst jetzt klar werden, dass er seine Ehe für ein paar vergnügliche Stunden in einem Hotel an die Wand gefahren hat. Sein Hilfe suchender Blick trifft meinen, doch mein Mitleid hält sich in Grenzen. Was er getan hat, hatte System. Das war weder ein Ausrutscher noch eine einmalige Sache, er hat sich selbst in diese Situation gebracht. Ich bin nur die arme Socke, die sie aufgedeckt hat. Die Einzige in diesem Raum, die mein Mitgefühl hat, ist Mrs Stuart.
Betrogene Seelen heilen nicht wie gebrochene Knochen. Wenn jemand das weiß, dann ich. Und noch besser weiß ich, dass Betrug viele Formen haben kann, denn ich trage zwei Narben davon auf meiner Seele.
»Pack deine Sachen, James. Du kannst in das Hotel fahren, aus dem du gerade kommst«, sagt sie und steht auf, bevor sie sich an mich wendet. Ihr Gesicht ist völlig ruhig, aber in ihren Augen spiegelt sich ein Schmerz, den ich nur zu gut kenne. »Ich bringe Sie noch zur Tür.«
Nickend stehe ich ebenfalls auf. Wir gehen an dem untreuen Ehemann vorbei, der es sich nicht verkneifen kann, mir zuzuzischen: »Ich hoffe, Sie sind glücklich darüber, dass Sie meine Ehe zerstört haben.«
Für einen kleinen Moment bleibe ich stehen, sehe ihn an und frage mich nicht zum ersten Mal in meinem Leben, wie verblendet Menschen sein können. »Es war nicht meine Entscheidung, meine Ehefrau zu betrügen.«
Dann wende ich mich ab, bedanke mich bei Mrs Stuart und gebe ihr die Karte eines Scheidungsanwalts. Als sich die Tür hinter mir schließt, weiß ich, dass der Krieg zwischen den beiden einstmals Liebenden erst beginnt. So ist es meistens, und vielleicht muss es auch so sein. Nachdenklich blicke ich die Tür an. Das ist immer der schlimmste Moment in meinem Job, wenn ich nichts hinterlasse als Scherben und Trauer um eine Liebe, die gestorben ist, ohne dass jemand es bemerkt hat.
Mit langsamen Schritten gehe ich zu meinem Auto zurück. Auf der Rückbank liegen bereits die zwei Reisetaschen für meinen nächsten Auftrag, prall gefüllt mit dem technischen Kram, den man eben braucht, wenn man herumschnüffeln will. Unschlüssig sitze ich da, ohne den Wagen zu starten. Hinter der Haustür ist nichts zu hören, und die dicken roten Vorhänge versperren den Blick auf das Drama im Inneren. Dennoch sind meine Gedanken noch immer bei Mrs Stuart. Ich hoffe, dass sie das alles verkraftet.
Und ich wünsche mir, dass auch ich endlich mit meinen eigenen Wunden abschließen kann. Wieder ziehe ich das Handy aus der Hosentasche. Wieder öffne ich das Foto. Mein Finger schwebt einen Moment über dem kleinen Mülleimersymbol, aber ich schaffe es einfach nicht.
Vielleicht weil ich Angst davor habe, was passiert, wenn ich diese letzte Verbindung zur Liebe einfach trenne. Seufzend klemme ich das Handy in die Halterung am Armaturenbrett. Ein letztes Mal blicke ich zu dem Haus, in dem Mrs Stuart gerade ihren Mann verlässt, dann starte ich den Wagen, drehe die Musik auf, damit sie meine Überlegungen endlich übertönt, und fahre meinem neuen Ziel entgegen. So ist das mit dem Leben in diesem Job. Man steht auf und macht weiter. Tag für Tag. Egal, wie viel Kraft es kostet oder wohin der Weg einen führt. Und ich kenne es nicht anders, obwohl ich es mir wünsche.
Die Wahrheit habe ich gesucht und gefunden, nicht nur für Mrs Stuart, sondern auch für mich. Und genau wie ihr hat mir nicht gefallen, was ich gesehen habe.
Die Erinnerung an den eigenen Betrug keimt in mir auf. Kellys Gesicht vor mir. Ihr Lächeln. Die Art, wie ihre Haare sich im Wind wiegen, oder sich Laub darin verfängt, wenn wir durch den Park streifen. Strichen, verbessere ich mich. Denn so sehr die Erinnerung auch die Sehnsucht weckt, so tief sitzt auch der Schmerz, den diese erste große Liebe in mir hinterlassen hat.
Die geheimen Nachrichten, die großen und kleinen Lügen, die Hoffnung, dass alles nur ein großes Missverständnis ist, dass es keinen anderen gibt als mich. Aber es gab ihn. Und er hat meinen Platz eingenommen, während mir das Herz gebrochen wurde.
Ich fahre an den Seitenstreifen. Mein Herz klopft, als wüsste es bereits, was mein Kopf sich noch weigert zu verstehen. Mit einem Finger tippe ich auf das Display, öffne das Foto erneut. Ich brauche einen Abschluss, wenn ich wirklich wieder Liebe finden möchte. Das kleine Papierkorbsymbol scheint mich anzustarren. Und dann drücke ich drauf.
Möchten Sie das Foto endgültig löschen?
Ja. Ich denke schon. Also bestätige ich den Befehl und atme aus. Irgendwo zwischen Erleichterung und Unglauben, dass ich das gerade wirklich getan habe.
Ich lenke den Wagen wieder auf die Straße zurück. Die Musik dröhnt weiter aus den Lautsprechern. Thirty Seconds To Mars mit Rescue Me läuft gerade, als würde das Schicksal mir etwas damit sagen wollen. So ungern ich es auch zugebe, ich würde mir jemanden wünschen, der mich rettet. Jemanden, der mir die immer wiederkehrenden Gedanken, die Angst und den Schmerz nimmt und mich an einen Ort bringt, an dem es all das nicht gibt.
Eine naive, romantische Vorstellung von der alles heilenden Liebe, die der Realität nicht standhalten kann. Das weiß ich, doch irgendwie hoffe ich dennoch darauf, dass es jemanden gibt, der mir zumindest dabei helfen kann, mich selbst zu retten.
Mein Blick schweift über das Gebirge. Zum ersten Mal seit Monaten lasse ich meine Heimatstadt hinter mir und fahre ins Ungewisse. Doch es macht mir keine Angst, dafür breitet sich Vorfreude in mir aus.
Dieser Job sorgt dafür, dass mir langsam, aber sicher die Energie ausgesaugt wird. Ich bin nicht wie mein Vater und auch nicht wie mein Cousin Maxx. In den Leben anderer herumzustochern wie in Hackbraten ist das Letzte, was ich mir von meiner Zukunft wünsche.
Alles, was ich will, ist ein schönes Haus im Grünen und eine Arbeit, die mir Spaß macht. Kein Schnüffeln, kein Drama, nichts davon. Nur Ruhe und die Berge. Vielleicht einen Hund.
Dieses Bild, so undeutlich es auch ist, sorgt dafür, dass ich freier atmen kann. Vielleicht weiß ich noch nicht, was ich statt dieses Jobs tun sollte, aber zumindest weiß ich, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Die Stimme meines Vaters kommt wieder in mein Bewusstsein, und die Art, wie er meine Arbeit als minderwertig und schlecht empfindet. Und vielleicht ist das der Grund, weshalb sich irgendwo in meinem Inneren ein Schalter umlegt, der schon seit Wochen kurz davor war zu kippen. Was ich brauche, ist ein Neubeginn. Ein neues Kapitel, in dem ich zuerst mit mir selbst beginne und nicht mit den Erwartungen, die Dad oder meine Familie an mich stellen. Ich werde meinen Auftrag in Belmont Bay nutzen, um mir zu überlegen, was ich eigentlich will und wie mein Leben aussehen soll, wenn ich nicht mehr in der Kanzlei meines Vaters arbeite.
Je mehr meine Gedanken darum kreisen, desto mehr breitet sich ein Lächeln auf meinem Gesicht aus. Die Sonne geht langsam unter und taucht die leerer werdende Straße in ein dunkles Orange. Obwohl ich seit mehr als einer Stunde fahre, fühle ich mich noch immer ungeahnt motiviert. Meine Finger trommeln auf dem Lenkrad im Takt der Musik mit.
Ja, ein Neuanfang. Das ist es, was ich will. Und eine Zeit außerhalb meines sonstigen Dunstkreises wird sicher dabei helfen.
Mein Weg führt mich weg von den geradlinigen Straßen und näher zu den endlosen Wäldern, deren Farbspiel im Licht der Abendsonne zu schimmern scheint. Der Snake River begleitet mich auf der einen Seite, schlängelt sich durch die Klippen, Felder und Wälder.
Abseits der Straße und fernab der Städte steckt Idaho voller Wunder. Ich kann mir keinen besseren Ort in den USA vorstellen, um zur Ruhe zu kommen, sich zu entspannen und sich der urwüchsigen Lebensart hinzugeben.
Hier findet man nicht nur Juwelen der Natur, sondern auch echte Edelsteine. Was meiner Heimat den Beinamen »Edelsteinstaat« eingebracht hat – doch auf der Suche nach Schätzen bin ich nicht.
Die von Flüssen, Seen, Bergen und einem kristallklaren Nachthimmel geprägte Landschaft ist es, die dafür sorgt, dass ich niemals woanders leben möchte. Nur mit Boise kann ich mich nicht anfreunden: zu viel Lärm, zu viele Menschen.
Am östlichen Rand ziehen die Rocky Mountains an mir vorbei, ohne je ganz zu verschwinden.
Die Stimme des Navis schickt mich nach links.
Willkommen in Belmont Bay.
Meine Boots geben ein schlürfendes Geräusch von sich, während ich über die verlassenen Straßen von Belmont Bay schlendere, den Kopf in den Nacken gelegt, um die Sterne zu betrachten. Es gibt viele Dinge, die ich aus meiner Zeit in New York City vermisse. Aber der Nachthimmel von Idaho entschädigt mich für alles. Wie schimmernde Diamanten auf einem dunkelblauen Samttuch breiten sich die Sterne am Himmelszelt aus. Ein glitzerndes Chaos, das doch so voller Ordnung scheint.
»Du kannst nicht den Rest deines Lebens jobben.«
Ich verdrehe die Augen, obwohl mir natürlich bewusst ist, dass meine Mutter es nicht sehen kann. Mit dem Handy zwischen Schulter und Ohr geklemmt gehe ich weiter, während ich in meiner Handtasche krame. »Das sagst du immer.«
»Ja, und ich habe recht. Dann war das Jurastudium eben das Falsche für dich, aber du kannst doch andere Kurse besuchen«, sagt sie ernst.
Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie sie sich auf den Holztisch in meinem Elternhaus beugt und mürrisch mit den Fingern trommelt.
»Wozu, ich mache doch schon das, was ich tun möchte«, gebe ich zurück, nur um mir gleich darauf auf die Zunge zu beißen. Niemand hat mir gesagt, dass man auch mit über zwanzig Jahren noch immer die Erwartungen seiner Eltern diskutieren muss.
»Etwas, von dem du nicht leben kannst.«
»Noch nicht leben kann«, korrigiere ich. »Mein letztes Bild hat die Miete für mehrere Monate gezahlt.« Das ist zwar eine Lüge, aber nur eine kleine. Es war knapp über einer Monatsmiete. Das ist doch schon mal was.
»Ich mache mir nur Sorgen. Deine Nebenjobs sind immer so …« Ihre Pause zieht sich in die Länge, als würde sie darauf warten, ein Wort zu finden, das den Zwiespalt ihrer Befürchtungen optimal beschreibt. Was sie eigentlich sagen möchte, ist: schmuddelig.
»Es ist eine Bar, Mom. Und nicht einmal eine coole mit Bikern oder geheimen Mafiatreffen. Nur die einzige Bar in der Stadt, und du kennst die Gegend doch. Glaub mir, viel sicherer wäre ich auf keinem Campus der Welt.«
»Das überzeugt mich nicht.«
»Weil nichts dich überzeugen kann, wenn du gar nicht überzeugt werden willst«, sage ich und unterdrücke dieses Mal kein genervtes Stöhnen.
Ich liebe meine Mutter, aber sie hat diese Art, die mich an die Decke gehen lässt, wenn ich nicht aufpasse. Manchmal kommt es mir vor, als würde ihr Kopf ganz anders ticken als meiner. Selbst durch das Telefon kann ich hören, wie sie schmunzelt. »Da kann ich dir nicht widersprechen.«
Vor den Türen der Bar bleibe ich stehen. Das rote Neonlicht spiegelt sich in der Pfütze vor meinen Füßen, und die stumme Melodie der Nacht wird von der gedämpften Musik unterbrochen. »Ich bin jetzt da, Mom.«
Obwohl es am anderen Ende der Leitung kurz still ist, bin ich sicher, dass sie nickt. »Megan?«
»Ja?«
Ihre Stimme wird leiser. »Ich hab dich lieb.«
Nun bin ich es, die grinsen muss. »Ich dich auch, aber jetzt muss ich arbeiten und dem Mafioso der Stadt sein Bier geben.«
»Sehr witzig.«
»Ich weiß, das hab ich von dir. Bye!«
Im Licht der Nacht liegt die Bar vor mir. Aus den schmutzigen Buntglasfenstern dringt schummriges Licht, das kaum reicht, um den Asphalt unter meinen Boots zu beleuchten. Neben der großen roten Holztür, von der der Lack langsam abpellt, finden sich einige Plakate zu kommenden Veranstaltungen und wenige Meldungen über verschwundene Katzen, die allesamt der örtlichen Floristin, Stella, gehören. Schnell lasse ich das Handy in meine Tasche fallen und betrete das Red Lady.
Sofort schlägt mir der eigentümliche Geruch von schalem Bier und abgebrannten Kerzen entgegen. »Du bist spät dran«, begrüßt mich Dennis, der hinter dem dunklen Tresen steht und mich mit einem versucht strengen Blick betrachtet. Der Vinylboden unter mir quietscht schrill, während ich auf meinen Boss zugehe. Das Innere der Bar wird erleuchtet durch einige Industrielampen, die von den großen Deckenbalken hängen, und Kerzen auf den einzelnen Tischen. Durch die Neonschilder, die teilweise noch aus den Fünfzigerjahren stammen und die dringend mal wieder entstaubt werden müssten, bekomme ich jedes Mal das Gefühl, ich würde eine Zeitreise antreten.
Es sitzt nur ein Gast am hintersten Tisch der Bar, direkt neben der Dartscheibe. Der alte Bennett kommt fast jeden Abend, trinkt ein Tonic Water und spielt ein paar Runden. Wenn er einen Plaudertag hat, also mehr als drei Silben spricht, spiele ich manchmal mit. Zwischen uns hat sich so etwas wie eine Freundschaft entwickelt, seit ich vor zwei Jahren in diese Stadt gezogen bin. Was zum großen Teil auch an der simplen Tatsache liegt, dass er meine Schwester beschützt hat, als ich selbst nicht anwesend war. Und an seinem Hund. Zur Begrüßung nicke ich ihm kurz zu, ehe ich mich meinem grimmigen Boss zuwende. »Ich würde ja sagen, feuer mich, aber das wäre schlecht für uns beide«, gebe ich zurück und verstaue meine Handtasche hinter der Bar unter der Kasse.
Dennis verzieht das Gesicht. Obwohl er die fünfzig bereits überschritten hat, sieht er noch immer aus, als könnte er das Cover einer Zeitschrift zieren. Vorzugsweise eine, die sich um die Pflege von Bärten dreht, denn sein roter Bart ist ein wahres Kunstwerk. Der Schnauzer ringelt sich nach oben, und in den langen Kinnbart sind sogar Perlen eingeflochten.
Er schüttelt den Kopf, und wäre die Musik nicht so laut, hätte ich die Perlen klimpern hören können. »Trotzdem zieh ich dir ’ne Viertelstunde ab.«
»Kein Problem, die bleib ich einfach länger.«
Er gibt ein Brummen von sich, das mich jedoch nur zum Lachen bringt. »Kommst du allein klar?«
»Der Ansturm kommt erst in ein paar Stunden, oder siehst du hier schon jemanden?«, frage ich und drehe mich einmal um mich selbst. »Ja.«
Ich kenne Dennis nun seit einigen Monaten, doch erst in den letzten Wochen sind mir die tiefen Schatten unter seinen Augen und der schmerzverzerrte Zug um seinen Mund wirklich aufgefallen. Besonders wenn das Red Lady einen der guten Tage hat, werden seine Bewegungen im Laufe des Abends immer steifer, langsamer und, so ungern ich es auch zugebe, gequälter. Die meisten Gäste bekommen nicht mit, wie er das Tablett mit beiden Händen trägt oder es vermeidet, die Spirituosen aus dem obersten Regal zu nehmen. Aber all diese kleinen Dinge sind es, die mir sagen, dass heute keiner seiner guten Tage ist.
Manchmal vergesse ich, dass er krank ist, und erwische mich selbst dabei, wie ich denke, dass er für diese Art Leid doch noch viel zu jung ist. Wobei mir klar ist, dass ich damit eines der klassischen Klischees bediene, gegen die ich sonst immer so lautstark anbrülle. Nur ist mir das erst durch ihn wirklich bewusst geworden: dass man nicht alle Krankheiten sehen kann. Bevor ich ihn kannte, war mir nie bewusst, was für ein Glück ich habe, in einem gesunden Körper zu stecken. Und welches Privileg es ist, ohne dauerhafte Schmerzen durch das Leben zu gehen. »Geh dich ausruhen, ich komme klar.«
»Hast du deinen Schlüssel?«
Zum Beweis ziehe ich den Schlüssel mit dem kleinen funkelnden roten Ball als Anhänger hervor. »Ich komme klar. Du kannst nach oben gehen, wenn’s zu viel wird, hol ich dich. Du hast schon die letzten zwölf Stunden hinter der Theke gestanden.«
Dennis überlegt, will den Bierkasten vor sich verschieben und macht dabei eine unbedachte Bewegung. Sein Torso zieht sich zusammen, und eine Hand greift nach dem Rücken, als würde er versuchen, die Qual nur durch eine Berührung zu lindern. Nur sein Gesicht beleibt ausdruckslos, als sei der Schmerz längst zu einem Teil von ihm geworden.
Das, was ihn plagt, hat den wenig klangvollen Namen Morbus Bechterew – eine besondere Form entzündlichen Rheumas, das in seinem Fall schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Er hat versucht, es mir zu erklären, doch viel mehr als Schmerzen und Versteifung der Wirbelsäule konnte ich nicht behalten. Eigentlich macht es auch keinen Unterschied, denn allein ihn so zu sehen, bricht mir fast das Herz.
Ich bleibe reglos stehen. Inzwischen ist mir dieser Anblick nur allzu vertraut, doch das ändert nichts daran, dass es scheiße bleibt. Dennis’ Blick wird etwas düsterer. Langsam richtet er sich wieder auf. »Bist du sicher?«
Sachte schiebe ich meinen Chef in Richtung Tür neben der Bar, hinter der sich eine Treppe in das obere Stockwerk verbirgt. »Ja, jetzt geh schon.«
»Wenn du mich brauchst, dann …«
»Werd ich nicht«, unterbreche ich schnell und grinse ihn frech an. »Verschwinde und lass mich meine Arbeit machen.«
Er nickt knapp, bewegt sich aber noch immer nicht. »Ich hab ein paar Interessenten. Für die alte Lady. Also die Bar«, murmelt er und blickt über die Schulter, als hätte er Angst, wir würden belauscht werden.
Meine Gesichtsmuskeln verkrampfen sich, als ich sie dazu zwinge, mein Lächeln aufrechtzuerhalten. »Das ist doch toll.«
Wieder nickt Dennis. »Ich wollte nur, dass du es weißt. Unser Plan zu gehen ist nicht mehr nur ein Plan.«
»Mach dir um mich mal keine Sorgen.«
Einen Moment steht er noch zögernd da, dann geht er und lässt mich allein. Endlich Zeit zum Durchatmen.
Ich meinte es vollkommen ernst. Dennis muss sich um mich keine Gedanken machen – wie eine Katze lande ich immer auf den Füßen, manchmal breche ich mir dabei den Knöchel, aber im Großen und Ganzen komme ich gut davon.
Dennoch wird mir die Bar fehlen. Die Jobauswahl in dieser Stadt ist begrenzt, was dazu führt, dass mir danach nur eines der kleinen Restaurants bleibt oder ich mich außerhalb der Kleinstadt umschauen muss. Aber das sind Probleme, mit denen Zukunfts-Megan schon zurechtkommen wird. Ganz sicher. Hoffentlich.
»Ich hätte gern noch eins.«
»Wow, gibt’s was zu feiern?«, frage ich und bringe dem alten Bennett ein neues Tonic Water. Sein von der Sonne zerfurchtes Gesicht verzieht sich etwas.
»Wohl eher das Ende einer Ära.«
Ich seufze, sehe mich in der Bar um, als würde ich sie zum ersten Mal sehen. Die dunklen Balken, der Tresen aus Kirschholz und die kitschigen Neonschilder. Mein persönliches Highlight ist die Musikbox, die nur noch zwei Songs abspielt, dem ganzen Raum aber durch ihre bloße Anwesenheit eine Präsenz verschafft wie in einem Klassiker der Hollywoodfilme. »Wie lange steht die Bar schon?«
Bennett sieht zu mir auf. »Sie ist älter als ich, und das will schon was heißen.«
»Wirklich schade«, stimme ich zu und blicke mich noch einmal um. »Aber gut für Dennis. Ein Neuanfang in wärmerem Klima, wo sein Rheuma vielleicht besser wird.«
»Nicht zu vergessen ein finanzielles Polster. Die Rechnungen seiner Medikamente will ich mir nicht einmal vorstellen.«
Ich verziehe das Gesicht. Alles, was in Richtung Finanzen geht, versuche ich möglichst weit von mir wegzuschieben. Egal, ob es meine eigenen sind oder die von Freunden.
»Gut für ihn«, wiederhole ich also.
»Gut für ihn, schlecht für uns.«
»Darauf trink ich.«
Wir stoßen mit Tonic an, und ich setze mich neben ihn. Unter der Woche ist außerhalb unserer Aktionstage wie dem Karaoke-Dienstag nicht viel Andrang, die meisten Besucher kommen erst am Donnerstag oder am Wochenende.
Doch um ehrlich zu sein, ist es auch dann selten über meiner Schmerzgrenze, was den Ansturm angeht. Früher in New York hatte ich in jedem Café mehr zu tun als hier. Außerdem sind die Menschen in Belmont Bay netter. Meistens zumindest.
Ich bin mir sicher, jemand wird das Potenzial der alten Lady noch erkennen, und es wundert mich, wieso es nicht schon längst von einem neureichen Hipster-Pärchen gekauft wurde.
»Ich werde diesen Job wirklich vermissen«, murmle ich mehr zu mir selbst als zu dem grimmigen Mann neben mir.
Er fährt sich über die Glatze, ehe er den Kopf schüttelt. »Verständlich, du wirst fürs Rumsitzen bezahlt.«
Ich lache auf. »Das ist nur einer der wirklich vielen Gründe.«
»Nenn mir den zweiten.«
»Unsere unfassbar netten Gespräche zum Beispiel.«
Bennett schüttelt den Kopf. »Du bist eine schreckliche Lügnerin, Megan.«
Damit hat er recht, denn wenn es etwas gibt, das ich nicht mag, dann sind es Lügen. Nichts wird besser, indem man die Wahrheit verdreht.
Bevor ich aufstehe, drücke ich seine Schulter. Auch wenn er mir nicht glaubt, habe ich diese kurzen Unterhaltungen tatsächlich immer genossen. Gerade würde ich die Welt gern noch eine Weile anhalten, sodass alles bleibt, wie es in den letzten Monaten war. Manchmal halte ich mich so sehr an den Erinnerungen fest, damit mir nicht schwindelig von den vielen Veränderungen in meinem Leben wird. Doch so spielt das Leben eben, oder?
Alles verändert sich, auch wenn man selbst am liebsten stehen bleiben würde, und dafür bleiben genau die Dinge unbeweglich, von denen man sich wünscht, sie würden sich verändern.
Ein paar Stunden später jongliere ich mit zwei Tabletts zwischen den aufgeregten Gästen, während ich versuche, weder jemanden anzurempeln noch etwas von dem kostbaren Bier zu verschütten. Die Touristensaison ist da – und mit ihr eine ganze Ladung Menschen, die diese Kleinstadt ordentlich aufmischen. Besonders, wenn auch noch ein Footballspiel auf dem pixeligen alten Großbildfernseher an der Wand übertragen wird.
Der Sommer hat die Touristen angezogen, der Sport einige Einheimische, und meine Idee, den Freibier-Vize-Freitag einzuführen, sorgt für regen Zulauf. Ohne Zusammenstöße schaffe ich es an den Tisch von Mia und Conner.
Meine Schwester sieht mich grinsend an. »So mag ich Barbesuche«, meint sie mit einem Hauch von Triumph in der Stimme.
»Du meinst, wenn du nichts bezahlen musst?«
»Einer der vielen Vorteile, dich als Schwester zu haben.«
»Lass das nicht Mom hören, Zuckerstern.«
»Warum bekommt Mia ihr zweites Bier umsonst, und ich muss meins bezahlen?«, brummt Conner, bevor er an seinem Glas nippt. Die unzähligen Tattoos auf seinen Armen, Händen und dem Hals wirken in dem schummrigen Licht, als würden die vielen Muster und Linien sich bewegen.
Ich stemme eine Hand in die Hüfte. »Du bist nicht meine Schwester.«
»Aber ich könnte dein Schwager werden.«
»Untersteh dich, wir sind viel zu jung für so was«, zische ich schnell, bevor er noch auf unkluge Ideen kommt.
Mia fängt an zu kichern, denn ihr scheint der Gedanke an eine Ehe mit Conner keine gruselige Gänsehaut zu bereiten. Damit ich mir das liebevolle Geturtel nicht weiter mit ansehen muss, mache ich mit der Arbeit weiter.
Jeder Gast bekommt ein Freibier. Das sorgt nicht nur für ausgelassene Stimmung, sondern auch dafür, dass ich mein Work-out heute ausfallen lassen kann. Aber ich will mich nicht beschweren, ich mag es, wenn die Red Lady voller Leben ist. Ich winke noch einmal meiner Schwester zu, danach bleibt mir keine Zeit mehr, mir Gedanken um meinen Job zu machen oder mich über den Kitsch zwischen Mia und Conner zu amüsieren.
Eine Bar allein zu leiten ist nicht so einfach, wie es klingt. Selbst wenn sie so klein ist wie in dieser Stadt. Ich komme ganz schön ins Straucheln, überlege kurzzeitig sogar, ob ich Dennis um Hilfe bitten soll. Doch irgendwie schaffe ich es bis zu der magischen Grenze, an der sich der Trubel langsam lichtet.
Die meisten Einheimischen sind bereits gegangen, nur einige Touristen besetzen weiterhin die Tische. Mia gewinnt gerade das kleine Dartturnier gegen Bennett und Conner, als ein neuer Gast die Bar betritt.
Schwarzes Haar, breite Schultern und diese Augen … verdammt.
Er bleibt an der Tür stehen, sieht mich an, wie ich ihn ansehe. Die dunklen Augen scheinen Funken zu sprühen, die sämtliche Hormone meines Körpers durcheinanderbringen. Für einige Herzschläge kann ich ihn nur anstarren. Seine nahezu schwarzen Augenbrauen ziehen sich nachdenklich zusammen, bevor er vorsichtig einen Schritt nach dem nächsten ins Innere der Red Lady macht. Verdammt.
Ich bin Realistin. Durch und durch.
Von Dingen wie Liebe auf den ersten Blick halte ich genauso wenig wie vom streng monogamen Konzept der Ehe. Aber in dem Moment, als sich unsere Augen begegnen, zuckt etwas in mir zusammen. Mein Körper reagiert auf ihn wie der Mond auf die Erde – und umgekehrt.
Zumindest deute ich es so, dass wir beide in unserer Bewegung verharren und einander ansehen, als gäbe es nichts anderes mehr. Aber dann ist der Moment vorbei.
Ich schütte mir Bier über die Hand und unterdrücke einen leisen Fluch. Offenbar bin ich doch schon einen Tick zu lange Single, und Belmont Bay ist nicht gerade eine Stadt, in der man sich für zwanglose Affären treffen kann. Geschweige denn, dass ich hier große Auswahl hätte. Dennoch kann ich meinen Blick nicht von ihm lösen, während er auf den Tresen zugeht.
»Hey, Fremder, was darf’s sein?«
Selbst für mich ist das ein ziemlich flacher Spruch, aber es ist spät, meine Füße tun weh, und ich trage eins der schulterfreien Shirts, die ganz hinten in meinem Kleiderschrank versteckt waren, weil sie eigentlich nicht mehr in dieses Jahrzehnt gehören.
»Auf dem Schild draußen stand etwas von Freibier«, sagt er und schenkt mir ein Lächeln, das fast schon schüchtern wirkt. Die schwarzen Haare hängen ihm in die Stirn, ehe er sie lässig nach hinten schiebt.
»Neu in der Stadt?«
»Sieht man mir das so sehr an?«
Lächelnd zucke ich mit den Schultern. »Die Stadt ist zu klein, um neue Gesichter nicht zu erkennen. Urlaub oder Arbeit?« Immerhin kann ich es mir verkneifen, ihm ein Kompliment für sein unglaublich dichtes Haar zu machen. Um ihn nicht die ganze Zeit anzuschauen und womöglich in die Verlegenheit zu kommen, in dem warmen Braunton seiner Augen zu versinken, betrachte ich die Gäste. Bereit, jederzeit zu den Tischen zu sprinten, falls jemand noch etwas bestellen möchte.
»Eine Mischung aus beidem, würde ich sagen.«
Ich nicke und stelle das Bier vor ihm ab, obwohl es schon kurz nach zwölf Uhr ist und er damit eigentlich kein Freibier mehr bekommen dürfte. »Und was für ein Job führt dich her?«
»Ich bin wegen des Festivals hier.«
»Ein Journalist also.« Noch während ich das sage, betrachte ich ihn genauer. Die braune Lederjacke hat ihre besten Tage schon lange hinter sich. Die Ellenbogen sind abgewetzt und rissig, doch sie schmiegt sich trotzdem an seine breiten Schultern. Das helle Shirt betont seine von der Sonne gebräunte Haut und das dunkle Haar. Verdammt, ich gebe es wirklich nicht gern zu, aber aus der Nähe ist er noch attraktiver, und zu meiner Schande kann ich diesen Eindruck nicht auf den Alkohol schieben, denn im Dienst trinke ich nie.
Das fein geschnittene Gesicht wirkt durch die Andeutung eines Dreitagebarts rauer, die gerade Nase lässt ihn fast schon aristokratisch wirken, und der Zug um seine Lippen bringt mich dazu, meine eigenen aufeinanderzupressen. Er mustert mich mit diesem schüchternen Lächeln, bei dem sich etwas in mir zusammenzieht.
»Ja, ich hab viel Gutes über das Theater hier gehört«, murmelt er.
»Wenn du Shakespeare-Fan bist, solltest du auf deine Kosten kommen«, meine ich möglichst diplomatisch. An einem der hinteren Tische macht man sich bereit zu gehen und gibt mir mit einem Handzeichen zu verstehen, dass ich die Rechnung fertig machen kann.
»Bist du keiner?«
Die Gäste zahlen, das Trinkgeld ist mickrig, aber ich will mich nicht beschweren. Bevor ich das Geld in der Kasse verstaue, sehe ich meinen Fremden wieder an. »Was?«
»Shakespeare-Fan.«
Unwillkürlich beginne ich zu lachen. »Scheiße, nein.«
Die Überraschung in seinem Gesicht zaubert ein Grübchen auf seiner linken Wange hervor. »Warum nicht?«
»Ich steh nicht auf diesen ganzen Kitsch und die tragischen Enden. Außerdem fliegen mir nicht genug Dinge in die Luft.«
Er verschluckt sich fast an seinem Bier. »Wie bitte?«
Vielleicht liegt es an der Uhrzeit oder seinen tiefbraunen Augen, die mich mehr anziehen, als sie sollten, aber ich lehne mich auf die Unterarme. »Ich mag Action, weniger Intrigen und unnötiges Gerede. Dann doch lieber explodierende Autos, Kugelhagel und rohe Gewalt.«
Während er sich über den Mund wischt, bleibt mein Blick an seinen Lippen hängen. »Ich weiß ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll, aber es verstört mich, dass du mich an meinen Vater erinnerst«, murmelt er.
Natürlich kann ich ihm nicht sagen, dass ich auch keine Ahnung habe, was ich noch sagen soll oder was das hier wird, aber es ist nicht die klügste Entscheidung, die ich heute getroffen habe, jetzt mit ihm zu flirten. »Dann steht dein Vater wohl auf gute Filme«, versuche ich das Knistern zwischen uns zu entschärfen.
Da habe ich die Rechnung allerdings ohne den Fremden gemacht. »Jedes Weihnachten werde ich dazu gezwungen, mir sämtliche Stirb langsam-Filme anzusehen. Zweimal.«
Mein Grinsen wird breiter. »Das klingt nach dem perfekten Fest.«
»Dann würdest du dich bei uns sicher sehr wohlfühlen.« Er lacht. »Ich bin Leo«, stellt er sich vor und reicht mir die Hand. Kurz zögere ich. Dann ergreife ich sie.
4
Megan.«
Ein Name. Nur ein Name.
Doch alles, was er in mir auslöst, lässt Hitze durch meine Adern rauschen. Ich blicke in ihre braunen Augen, deren goldene Sprenkel im schummrigen Licht zu funkeln scheinen. Ich bin kaum eine Stunde in dieser Stadt, und schon wurde ich überrascht. Zweimal.
Erst mit Freibier, dann mit Megan.
Und jetzt von meinem eigenen Verhalten, denn ich halte ihre Hand noch immer fest, als könnte ich den Gedanken, sie wieder loszulassen, nicht ertragen. Verdammt, ich benehme mich unheimlich. Schnell ziehe ich meine Hand zurück und umfasse stattdessen mein Bier.
Meine Barkeeperin lässt mich allein am Tresen sitzen und geht zu einer kleinen Gruppe. Ein Mann, der aussieht wie ein gealterter Actionfilmstar, ein Kerl mit Dutzenden Tattoos auf seinem ganzen Körper und eine junge Frau. Ihre Gesichtszüge und ihr schwarzes, spiegelglattes Haar lassen mich vermuten, dass sie Wurzeln irgendwo in Ostasien oder Fernasien hat. Doch es ist ihr Lachen, das mich unwillkürlich auch zum Lächeln bringt. Megan umarmt sie lang, doch ich verstehe nicht, was sie ihr ins Ohr flüstert. Dafür ist jedoch sehr gut zu erkennen, wie die Schwarzhaarige knallrot wird.
Als sie an mir vorbei zum Ausgang geht, wirft sie mir einen Blick zu, den ich nicht deuten kann. Die kleine Gruppe verschwindet, und Megan kommt wieder hinter den Tresen der Bar.
»Freunde von dir?«, frage ich so beiläufig wie möglich.
»Meine Schwester, ihr Freund und der alte Bennett.«
Stirnrunzelnd sehe ich sie an. »Der alte Bennett?« Mir ist selbst nicht ganz klar, warum mich genau diese Information am meisten überrascht. Allerdings wäre es auch unhöflich gewesen, nach ihrem Familienstammbaum zu fragen – auch wenn ich die Neugier nicht leugnen kann.
Sie nickt, schnappt sich ein Tablett mit benutzten Gläsern und spült sie aus, während sie redet. »So nennen ihn alle, ich bin mir nicht einmal sicher, ob das nicht sogar sein Vorname ist. Alter. Bennett.«
Ich muss lachen.
»Gewöhn dich lieber dran, diese Stadt ist schräg«, erklärt Megan und macht eine ausladende Geste.
Diesen Eindruck hatte ich bisher nicht, allerdings ist eine Kleinstadt im Dämmerlicht des Sommers auch nichts Ungewöhnliches in Idaho. »Ach wirklich?«
»Auf jeden Fall.«
»Könntest du das näher ausführen?«, frage ich grinsend. Ihr rotes Haar schwingt in großen Locken hin und her, während sie sich hinter der Bar bewegt. »Du meinst für deinen Artikel über das Festival?«
Ich gerate kurz ins Stocken. »Genau.«
Megan schnappt sich einen Lappen und beginnt damit, die bereits freien Tische von Krümeln und klebrigen Getränkerückständen zu befreien. Erst jetzt fällt mir auf, dass wir nahezu allein sind. Nur ein Tisch ist noch besetzt, offenbar ebenso Touristen, denn sie studieren eine Karte und sprechen davon, die Berge zu erkunden.
»Na ja, die ganze Stadt ist süchtig nach Shakespeare, was schon seltsam ist, wenn man bedenkt, dass es ansonsten nur Wald, Kartoffeln und Berge in Idaho gibt.«
»Also ohne den Patrioten raushängen zu lassen, aber Idaho hat mehr zu bieten«, werfe ich ein. In meinem Kopf mache ich mir eine Notiz, dass Megan offenbar nicht von hier kommt.
Herausfordernd sieht sie mich an. »Ach ja?«
»Den Snake River, die Seven Stars Alpaca Ranch und natürlich die Crystal Gold Mine, und …«
»… und nichts davon hat auch nur ein bisschen Bezug zu Shakespeare«, beendet Megan meinen Satz.
Da ich dieses Argument nicht untergraben kann, fahre ich mir nervös durch die Haare. »Stimmt.«
»Und es ist nicht nur die Shakespeare-Sache«, fährt sie fort und geht zum nächsten Tisch. »Diese Stadt ist wie eine Mischung aus der Serie Virgin River und sämtlichen Büchern von Stephen King, mit einem Hauch Die Frauen von Stepford.«
»Das waren eine Menge Film- und Fernsehreferenzen.«
Sie wirft den Lappen nach mir. Da ich darauf nicht gefasst war, erwischt sie mich eiskalt. Der klamme Stoff trifft mich im Gesicht, und ich stolpere zurück. Ihr Grinsen entschädigt mich jedoch für diesen Angriff.
»King ist eine Buchreferenz, nur fürs Protokoll«, sagt sie amüsiert und hebt den Lappen vor meinen Füßen wieder auf. Dabei rutscht ihr Shirt etwas nach oben und entblößt die Ranken eines Tattoos, doch ehe ich mehr erkennen kann, ist sie schon auf dem Weg zum Tresen.
»Bist du ein Fan von ihm?«
»King? Würde ich nicht sagen. Seine Enden sind schrecklich. Aber irgendwie ist er zum Kulturgut geworden«, erklärt sie.
»Du bist also nicht von hier?«, frage ich weiter.
»Nein. Ich bin in New York City geboren und aufgewachsen.«
New York … Ja, das passt zu ihr. Die zerrissene Jeans, die selbstverständliche Coolness, mit der sie ein Shirt trägt, das bei einer falschen Bewegung vielleicht zu viel zeigen könnte, und ihre Art, einfach so durch mich hindurchzusehen. Ich hätte eher darauf kommen können, dass sie aus einer Großstadt kommt. »Und was hat dich hierhergebracht?«
Ihre Gesichtszüge werden kurz hart. Es ist nur der Bruchteil einer Sekunde, doch ihre lässige Art ist wie verschwunden. Stattdessen schweift ihr Blick ab. »Ich war auf der Suche nach etwas.«
»Und hast du es gefunden?«
»Nein.«
»Aber du bist noch hier.«
»Ja, weil ich etwas noch Besseres gefunden habe.«
»Und was?«
»Ein Zuhause, in dem niemandem auffällt, dass ich schräg bin, weil alle anderen es auch sind.«
Nun muss ich lachen. Sie ist schräg. Und das liegt nicht an ihren knallroten Haaren. Ich kann es nicht genau benennen, kann sie nicht einordnen – und das sorgt dafür, dass ich den Blick kaum von ihr lösen kann.
»Klingt, als würde diese Stadt mir gefallen.«