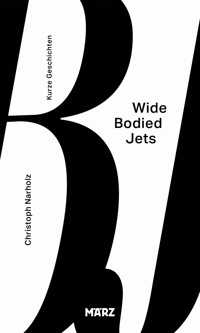
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MÄRZ Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Zittern der Luft. Die Queen of Soul umarmt John Lennon in einer Bar in Memphis. Ein Tankstellen-Café im Salzkammergut, jetzt zugesperrt. Susan Sontag lebt noch, sie arbeitet und sieht fern in Berlin. Blut für Öl, Flüstern im Bett. Trump beim Tauziehen. Die Keller Europas. Das Reich des Todes in New York. Warum und auf welche Weise rastete Therese von Lisieux aus? Ein langer Mittag neben dem Typ am Straßenrandtisch in einem Münchener Restaurant. Meine unglaublichen Tränen, auch deine, woher? In scharfen Miniaturen erzählt Christoph Narholz von Epiphanien der Moderne, Dystopien, Streunereien, der Arbeit, von Pandemie und Krieg. Sechsundsiebzig Geschichten sollen es sein, sagt er, so viele, wie die Lufthansa Wide Bodied Jets in der Pandemie stillgelegt hat. Gerahmt werden sie von Selbstgesprächen des Erzählers, oder besser: Fremdgesprächen des Autors mit sich selbst. Sie fragen agil und lästig in tausend Richtungen nach. Wie lebt man im reichen Westen, was für eine unerhörte Existenzweise ist das, welche Moral hält oder fordert sie?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WIDE BODIED JETS
Christoph Narholz
WIDE BODIED JETS
Kurze Geschichten
MÄRZ
Hello darkness my old friend
Wer hat euch erlaubt, so gut zu leben?
Russischer Soldat vor Kiew im März 2022, nach Jonathan Littell
I
PROVESENDE
Man erzählte mir folgende Geschichte: In einem Dorf in den Weinbergen über dem Douro in Portugal, zwischen den regenreichen Niederungen am Atlantik und der heißen und trockenen Ebene an der Grenze zu Spanien, hatte der Wirt eine schöne Frau, um die ihn alle Männer am Fluss beneideten. Noch schöner aber waren seine Töchter. Die Älteste konnte hervorragend kochen. Allgemein herrschte die Ansicht, dass sie ihre berühmte Mutter, die seit Jahr und Tag für ihren Mann in der Küche stand, in dieser Kunst noch weit übertraf. Die Mittlere hatte eine engelsgleiche Stimme, deren Ursprung in dieser Familie von Landwirten sich niemand erklären konnte. Sie unterhielt die Gäste an den Wochenenden mit Liedern, die man in dieser Gegend gerne sang. Die Jüngste war von den dreien die Schönste. Sie konnte nichts Bestimmtes und hatte, wie man übereinstimmend meinte, ein reines Herz.
Es begab sich nun, dass zu der Zeit, da Napoleon mit Hilfe des englischen Generals Wellington endgültig aus Portugal vertrieben war, ein junger Mann auf der Suche nach Arbeit in das Dorf kam. Als Verwaltungssitz und Handelszentrum hatte es in der Region einige Bedeutung und Wohlstand erlangt. Der junge Mann stammte aus einer wohlhabenden Familie in Lissabon, hatte in Porto in einem Londoner Kontor als Buchhalter gedient und gedachte sich um einen Verwalterposten auf einem der Weingüter am oberen Douro zu bewerben, welchen der Marquês de Pombal ein halbes Jahrhundert zuvor per Dekret und mit ein paar Hundert Grenzsteinen in eine staatlich geschützte Anbauregion verwandelt hatte.
Der junge Mann nahm bei den Wirtsleuten und ihren Töchtern ein Zimmer und verliebte sich augenblicklich in alle drei. Auf die Älteste wartete er morgens an der Küchentüre hinter dem Haus, wo er ein paar Worte mit ihr wechseln konnte, während die Lieferburschen ihre Waren abluden. Die Mittlere begleitete er in der Wirtsstube auf der Gitarre. Die Jüngste führte ihn durch die Dörfer der Umgebung und zeigte ihm ihre liebsten Stellen am Fluss.
Schon bald begann er, seine Arbeit zu vernachlässigen, die er aufgrund seiner Empfehlungsschreiben aus Porto rasch gefunden hatte. Als er eines Morgens nicht zur Weinlese auf der Quinta in Pinhão erschien, wo man ihn für eine Probezeit als Assistent des Kellermeisters eingestellt hatte, wurde er kurzerhand entlassen. Er musste sein Zimmer im Wirtshaus aufgeben und Quartier bei einem Ehepaar am Dorfrand nehmen. Die Familie in Lissabon, als sie nach Monaten durch einen reisenden Bekannten davon erfuhr, schickte einen Bruder, der ihn zur Vernunft bringen und finanzielle Unterstützung anbieten sollte. Der Bruder lud ihn für die Neujahrsfeier zu sich in das Wirtshaus ein. Er unternahm lange Spaziergänge mit ihm durch die Weinberge, wo die Rebstöcke für den Winterschnitt von den Spalierdrähten genommen wurden. Im Frühjahr reiste er unverrichteter Dinge wieder ab.
Danach konnten Tage vergehen, ohne dass einer der Dorfbewohner den jungen Mann zu Gesicht bekam. Man erzählte sich, er verbringe seine Zeit im Bett und lese. Jeden Samstag ging er zum Mittagstisch in das Wirtshaus, wo er dann bis zur Sperrstunde um Mitternacht hocken blieb. Die Töchter besuchten ihn dort noch, als sie das Dorf schon lange verlassen hatten. Die Älteste betrieb eine Gastwirtschaft im Geschäftsviertel von Porto; die Jüngste lebte in Lissabon, wohin sie der Bruder bei seiner Abreise eingeladen hatte, und pflegte mit den aufständischen Liberalen freundschaftlichen Umgang; die Mittlere dirigierte ein Kammerorchester am Hof der österreichischen Königin Leopoldine in Rio de Janeiro und schrieb ihm lange Briefe.
Zwei Jahrhunderte später ist das Dorf verfallen. Den Patrizierhäusern wächst Gras am Dach. In der Kirche hausen Tauben. Das Wirtshaus ist verschwunden; ein Gemischtwarenhändler verkauft jetzt aus einem Kühlschrank hinter der Ladentheke Bier, das man an zwei Klapptischen vor seiner Türe trinken kann, im Angesicht des barocken Dorfplatzbrunnens, der als Hintergrundmotiv für Selfies von Touristen auf Instagram Karriere gemacht hat.
Wenn man heute in dem Dorf vorbeikommt, angelockt von Schnappschüssen auf Tripadvisor oder als zufälliger Reisender von der Küste – es gibt eine kleine Bahnstation in Pinhão unten, wo auch die Kreuzfahrschiffe aus Porto für die Nacht haltmachen, und ein ordentliches Hotel am Flussufer –, kann man ein paar alte Männer sehen, die vor diesem Mercado in der Sonne sitzen. Man kann sich zu ihnen setzen, mit ihnen auf die sonnenbeschienenen Häuserwände schauen und sich von der eigenartigen Melancholie anstecken lassen, die von den zerstreut besiedelten Hügeln und endlosen Weinbergzeilen ausgeht. Man kann sie auf ein Bier aus dem Kühlschrank einladen, das sie gerne annehmen werden. Wenn man selber ein junger Mann ist, kann man gar auf die Idee verfallen, einer dieser Männer wäre immer noch jener junge Mann aus Lissabon, der in Provesende die Liebe gefunden hat. Man wird ihnen verstohlen beim Trinken zusehen und suchen, ob nicht irgendein Zeichen, die Anmut einer Geste, die Fahrigkeit einer Erinnerung, die Tiefe einer Verzweiflung diesen Schluss erlaubt. Aber weil zu viel Zeit vergangen ist, die Männer im Dorf einander sehr gut kennen und in den Weinbergen wie seit Jahr und Tag, wenn man an einem Nachmittag im Spätsommer die Finger in das dunkle Laub steckt und in eine Traube beißt, deren Saft im Inneren heiß und süß ist, kann das wohl unmöglich sein.
WIDE BODIED JETS
Du bist das! Ich habe von dir gehört, Christoph Narholz. Es war nichts Gutes. Man sagte mir, du seist glücklich und wolltest schreiben. Ich bestreite dein Recht dazu.
Wohl wahr. Lass mich, bevor wir anfangen, bitte festhalten: Wir sprechen an dieser Stelle noch vor dem neuen Krieg. Als ich mit den Geschichten begonnen habe, herrschte in der Ukraine zwar kein Friede, die Invasion Russlands lag aber jenseits unserer Vorstellungskraft. Wir waren mit anderem beschäftigt.
Ja. Es ist der zweite Sommer der Pandemie.
In Ordnung. Wir kommen, weil der Krieg im folgenden Winter begonnen hat, darauf zurück. Worüber wir mit den Geschichten zu reden haben, reicht sehr weit. Weil du mir gleich so schmutzig kommst: Wer hat mir in meinem Leben keine Vorhaltungen gemacht? Drei, vielleicht vier Menschen. Die Eltern zählen in dieser Rechnung nicht.
Rousseau wollte für sein Unglück gehört werden.
Nicht nur er. Es war sein gutes Recht. Er hatte allen Grund! Ich habe anderes erfahren. Weil ich an meinen Wunden wenig Interesse zeige, glauben viele, ich bildete mir ein, ich hätte keine. Dasselbe gilt für meine Fehler.
Du bist aber nicht allein, und nicht jeder ist privilegiert wie du. Gibt es denn Mitleiden, das aus dem Glück erwächst, nicht wieder aus dem Leid? Wissen die Glücklichen nicht vom Schmerz am meisten? Manche wenigstens, denen ihr Glück über den Rand hinaus springt und weltgroß wird? Und du, traurig bis auf die Knochen, hältst dich wirklich für so ein unwahrscheinliches Geschöpf?
Ich bin oft traurig, das stimmt.
Erwarte nicht, dass ich dich dafür bewundere.
Ich will deine Bewunderung nicht. Es ist nicht die klebrige Traurigkeit von Christian Kracht. Diederichsen hat das mal über seine Literatur gesagt.
Anderer Vorschlag?
Nein, nicht im Moment. Aber frag später wieder.
Du weichst mir aus.
Das siehst du richtig.
Bemüh dich etwas. Sei kein Arsch.
Jetzt wirst du unhöflich.
Ja.
Meinen Arsch, wenn du so willst, wird mir das Schreiben retten, das du nicht gelten lassen willst. Ich muss die Moral einen Zacken anders verstehen als, man das heute postkolonial, kapitalismuskritisch oder queer in meinen Kreisen tut. Wiewohl diesen Bewegungen meine totale geteilte Sympathie gehört. Den latenten Antisemitismus, auf den sich dort offenbar viele einigen können, natürlich eingeklammert. Ich wäre gern dabei.
Total? Zugleich geteilt? Was für Logik soll das um Gottes willen sein?
Ja, total geteilt, ganz genau. Auf der anderen Seite ist mir nämlich ein stiller und seit Jahren geliebter Dichter wie Philippe Jaccottet, du wirst in den Geschichten noch sehen, was ich von ihm habe, warum ich ausgerechnet mit ihm hier anfange, bei Weitem nicht genug. Er sucht justesse im Ausdruck seiner Welt, Triftigkeit, Genauigkeit, auch Dringlichkeit, das ist etwas anderes als die moralische oder politische oder ökonomische Gerechtigkeit, jede ist ja nochmal anders, auch da muss man genau sein, wieder anders genau als er, justice. Und wenn er dann doch mal von seiner Dichtung weg in die Richtung der sogenannten Praxis schaut, gänzlich vermeiden lässt sich das ja für einen rundherum wachen Menschen nicht, springt ihm vor dem offenbaren Elend anderer, wie ein kalt gestarteter Motor im unerforschlichen Inneren seines Herzens, mit einem hässlichen Kracher der alte Psychozirkus der Religionen an. Natürlich hält er selber geziert Abstand zur Religion. Aber die Symptome sind alle da: hochfliegende Spekulation, wenn er nach Gründen für seine Dichtung sucht; erfahrungsfreies Meckern über die pragmatischen Akteure in Wirtschaft und Politik, nenn sie mit dem eseligen Wort unserer Zeit gern Leistungsträger, damit zwischen uns Klarheit darüber herrscht, wer ihm nicht passt; die eilfertige Bereitschaft, sich vom Glaubensbekenntnis an das eigene autohypnotisch eingebläute System befeuern zu lassen, auf dem Fuße gefolgt von Exzessen der Druckabfuhr durch Selbstbeschuldigungslitaneien und Zerknirschungsekstasen, denn unwohl ist ihm mit dem beanspruchten Privileg der Weltfremdheit eben doch: All das ist genau dasselbe wie bei den künstlerischen und sozialavantgardistischen Linken in den reichen Gesellschaften des Westens auch. Ich sollte nicht über die eigenen Leute herziehen, weiß ich, mache ich aber trotzdem, die Rechten sind für meine schwierige Unternehmung durch Machtvernarrtheit ohnehin verloren. Ich brauche keine privilegierte Theorie der Kritik, ich brauche endlich eine kritische Theorie des Privilegs, Privileg natürlich affirmativ gemeint, wenn du mir diesen dialektischen Chiasmus als eine Art Verbeugungswitz vor unseren marxistischen Freunden hier erlaubst. Jedoch ist es mir bitter ernst. Es ermüdet und deprimiert mich einfach, durch die Jahrhunderte immer denselben Schmarrn zu lesen. Der dann anspruchsweise auch noch meiner werden soll. Er ist es nicht. Er soll es nicht. Die eigenen Leute, verzeih bitte noch rasch die Projektion, mich akzeptiert ja keine Seite, mit meinen selbstgewählten Lasten bin ich frei.
Na gut. Angenommen, ich verstehe dich. Ich will nicht behaupten, dass ich es kann! Oder gut finde, was du da sagst. Vielleicht willst du zum Auftakt auch einfach ruppig sein. Lass mich dreister fragen: Was verstehst du unter Glück?
Das ist krass.
Jetzt wirst du gleich bös mit mir! Gewiss findest du mich plump.
Überhaupt nicht. Die Antwort ist ganz leicht: Überflüssiges Geld. Langer Friede. Großmütige Freunde. Entrückte Götter. Gute Lehrer, Frauen natürlich mitgemeint. Abwählbare Regierungen. Einklagbares Recht. Ein Arbeitsmarkt, der dich ohne Schikanen gedeihlich ernährt. Die Freiheit für jeden und jede mit jedem und jeder auf jede Weise zu vögeln, die beide wollen. Oder wer oder wie viele es im Bett oder sonstwo eben gerade sind. Nimm in unserer pandemisch besorgten Zeit die Gesundheit noch mit dazu. Frag nach bei Aristoteles oder Kant, und meinetwegen auch bei Marx: Sobald man die Moral naturalistisch bereinigt hat, klingt die Auskunft bei allen mehr oder weniger gleich. In dieser oder einer anderen Reihenfolge. Lass dich von dem minimalen Naturalismus an der Basis aber nicht auf dumme Gedanken bringen: Es bleibt als eigentliche Aufgabe immer noch die gemeinschaftliche Organisation der individuellen Freiheit und der eigensinnigen Lust. Hier freilich scheiden sich dann die Geister. Fehlt etwas? Eine erfüllende Tätigkeit, mit der sich die Grübelei über den Sinn deines Lebens elegant vermeiden lässt? Du kannst die Liste leicht ergänzen. Sie enthält alles, was die illiberale Rechte seit einigen Jahren aus den niederträchtigsten Motiven abgeräumt sehen will.
Das ist interessant. Du hast die Kunst vergessen.
Habe ich das? Angenommen, mein Schreiben taugte nichts, und meine paar guten Taten sonst blieben im Verhältnis zu meinen schlechten, oder bösen, oder bloß unachtsamen, bedeutungslos; ich hätte also wie zahllose andere nur individuell gut gelebt, ohne Gelingen im Versuch, mich gerechtfertigt zu sehen: Welcher gnädig schummelnde Engel an der Seelenwage, welches barmherzige Gericht verrechnete das? Was tun mit den verschonten Vielen, die guten Willens sind, politisch engagiert, postheroisch reflektiert, tätig beschränkt auf ihren Kreis und fehlerhaft bis in die Haarspitzen, denen von radikalen Moralen schwerlich am Zeug zu flicken ist? Dass Bosheit nicht attraktiv, sondern böse ist, bezweifeln heute unter den halbwegs erreichbaren Leuten doch nur ein paar verpeilte Ästheten und sexistische Rapper. Was ist mit all den anderen Verwöhnten? Das große Thema der Moral sind nicht die Normen, Pflichten, Werte. All das ist entweder leicht zu haben, oder regressiver Kitsch. Das große, rätselhafte, ungelöste Thema, für die Moral genauso wie für die Kunst, ist das Glück.
Du hast, wie man so sagt, etwas zu sagen.
Habe ich etwas zu sagen? Weißt du was, fick dich doch einfach selbst.
Hoppla! Das war grob.
Schon wieder richtig.
Ich habe dich gereizt.
Warum wartest du nicht ab, was in den Geschichten steht, so wie ich selber auch?
Mir fehlt mit dir halt manchmal die Geduld.
Ja, mir auch, da verstehe ich dich gut.
Wer hat dir eigentlich von dem jungen Mann aus Lissabon erzählt?
Der Weinberg.
Ach.
Die alten Häuser. Der lange Tag. Ein Moment auf der Straße.
Warum Provesende?
Kein Grund.
Du warst dort.
Natürlich. Die heiße Weintraube habe ich auch gekostet.
Seltsame Geschichte.
Ich mochte die Frauen darin.
Waren wir nicht alle in Lockdowns eingesperrt?
Wohl wahr. Ich bin im ersten Sommer an den Fluss gekommen. Die Inzidenzen waren überall in Europa verschwindend niedrig.
Und so altmodisch legendenhaft soll es jetzt weitergehen?
Oh nein! Manchmal. Ich sehe und höre viel.
Also?
Flugzeuge. Ich werde in diesem Buch so viele Geschichten aus der angebrochenen Covid-Epoche erzählen wie die Lufthansa vierstrahlige Transkontinentalmaschinen zum Beginn der Pandemie stillgelegt hat, sechsundsiebzig Stück. Wenn du mit dem Zug an Frankfurt vorbeifährst, die Züge fahren ja, siehst du sie mit Staubkappen auf den Triebwerken am Waldrand stehen. Andere sind in den Wüsten von Spanien oder Arizona geparkt. Das trockene Klima soll die Toten am Leben halten. Die meisten werden allerdings nie wieder fliegen.
Das ist pervers. Warum der Flugzeuge gedenken und nicht der Toten?
Das wäre pervers. Ich bin kein Bundespräsident.
Ich stimme dir wohl oder übel zu. Die Mailänder Scala hat nach der ersten Welle zu Ehren der Corona-Opfer ein Konzert im Dom gegeben. Was ist ehrenhaft daran, an Corona zu sterben? Und für wen oder was sind diese unglücklichen Menschen Opfer? Nichts davon macht Sinn. Sobald etwas Furchtbares geschieht, fällt den Offiziellen immer noch nichts Besseres ein als die unverschämte und beleidigende Sprache aus dem Krieg.
Ich stimme zu, jetzt ich. Und weiter, es geht noch weiter: Die Pandemie wird gar nicht mein Thema sein. Ich werde von Corona erzählen, aber mich um Corona dabei möglichst wenig kümmern. Ich schreibe die Geschichten jetzt, und Corona gehört zum Jetzt eben jetzt dazu, c’est tout. Einen Zusammenhang mit den Toten gibt es aber doch. Höre beispielsweise die folgende Geschichte: Im vergangenen Winter saß ich in Deutschland in einem Zug am Fenster und schaute während eines Halts auf den Bahnsteig hinaus. Passagiere mit Masken stiegen aus einem ICE im Nachbargleis. Da fühlte ich mich plötzlich sicher, aber nicht vor einer Infektion, sondern weil ich uns als Gemeinschaft sah. Wir waren alle potenzielle Verletzte, Erkrankte, vom Tod Bedrohte, und würden einander unter solchen Umständen beispielsweise nicht mehr ausrauben oder gar Kriege gegeneinander führen. Es schien lächerlich, sich zu dem unvermeidlichen Leid noch willkürlich Böses anzutun. Die Pandemie hatte eine Bande fürsorglicher und rücksichtsvoller Erdenhäftlinge aus uns gemacht. Sie hatte unser naturgeschichtliches Bewusstsein für die universelle Kausalität geweckt. Wir teilen alle dieselbe schmale Lufthülle, mit oder ohne kontaminierte Aerosole.
Coronaleugner bist du anscheinend keiner.
Ich muss doch bitten.
Die paar Flugzeuge, die man jetzt noch im Himmel rauschen hört, wirken wie Dinosaurier, übriggebliebene Tiere aus einer versunkenen Welt.
In vielen davon bin ich vor der Pandemie geflogen. Mir hat die Vorstellung gefallen, dass in jedem Augenblick welche um den Planeten kreisen, die einen in der Sonne, die anderen in der Nacht. Wie ich vor Jahren an einem grauen Nachmittag allein in einer überfüllten Brasserie im Pariser Osten plötzlich erstaunt gedacht habe: Komisch, so ist das hier immer, das Leben lebt, es ist herrlich. Ich muss gar nicht dabei sein, um es zu empfangen. Ich verschwand und hinterließ eine Leerstelle, durch die ein Strom von anderen zog. Im Augenblick, solange ich da am Tresen stand und auf die Place de la Nation hinausblickte, waren diese anderen noch ich selbst, wenn ich gezahlt und die Brasserie verlassen hätte, andere statt mir, und immer noch ich selbst. Ich empfand das als Belebung für mich, an mir, als einen stabilen Hintergrund, so vielleicht, wie man von einer intakten Familie spricht, die jemand hat. Hier war es die Menschheitsfamilie, oder die Brasseriefamilie, die Sorgenfamilie, die Frohsinnsfamilie, die Herumtreiberfamilie und die Geschäftigenfamilie, es war ganz gleich. Wir waren eben, was jede und jeder war, nicht dieselben, nicht verschiedene, schon gar nicht eins, sondern teilten uns einen langen und wiederholbaren Ort und Moment. Selten habe ich mich so allgemein gefühlt wie da, allbelebt, aber nicht allmächtig. Weißt du, wer weiß schon, ob nicht einer meiner Lieben demnächst an dem Virus stirbt, oder gar ich selbst, warum nicht? Ich wollte dann keinen Gedenkzynismen von weiterlebenden Offiziellen ausgeliefert sein. In meinen Wunden selber Sinn zu sehen, ist das eine; wenn andere das für mich tun, etwas ganz anderes.
Ich verstehe.
Habe ich mich für deine Begriffe ausreichend bemüht?
Schon. Trotzdem ist mir dein Feinsinn suspekt.
Ich entschuldige mich dafür. Die Flugzeuge gehören bei uns zur Familie. Meine Mutter hat bei der Swissair gearbeitet. Wir waren Kinder. Lass es mich besser sagen. Wide Bodied Jets: Das ist eine Horde von Muttertieren, das verspricht mir eine Suche, eine Anthropologie. Die Großraumflugzeuge sind nur ein Massentransportmittel in die Ferien oder der Bürosessel eines Chefs. Ich bin wie eine grüngepflückte Avocado im Bauch von transatlantischen Müttern nachgereift.
Also doch: die Herkunft.
Natürlich. Was denn sonst? Rechne aber diese edlen Flieger, manche Schallplatten oder Streams und viele Bücher, Filme, Bars und Restaurants, Schwimmbäder in den Städten, Bahnhöfe, alle möglichen Erfindungen sonst, Anästhetika, den Fünfzehnuhrdreißigbus von Brest nach Le Conquet, den Acrobat Reader von Adobe, neuerdings auch die Corona-Impfstoffe mit dazu. Herkünfte gibt es viele, ich darf gar nicht anfangen, sie alle aufzuzählen. Überall treten sie an uns heran, schau dich nur mal um! Ich bin der Neuseeland-Apfel im europäischen Treibhauswinterland. Ich bin die Mexiko-Blaubeere in den Juniregalen der Supermärkte in München oder Köln. Ich bin das technoide neotene Küken aus unser aller ungeplatztem Ei. Die neuzeitliche Globalisierung und westliche Nachkriegszeit haben ein schreckliches Kind in mir gezeugt. An meinen vielbegabten Händen mit den sauberen weißen Fingernägeln klebt Blut. Wir haben nicht nur leibliche Eltern.
Schon gut. Beruhige dich. Noch einmal: Was willst du hier erzählen?
Wenig von mir. Mehr von anderen. Doch von mir, warum auch nicht? Reine Willkür. Persönliche Vorlieben. Kosmische Traurigkeiten. Sozialen Zorn. Manchmal Quatsch, den ich selber nicht ganz verstehe.
Das ist kokett.
Es ist kein Programm.
Du widersprichst dir.
Meinetwegen! Vor allem sollen meine Erzähler viele sein, Frauen darunter, Gruppen, Haufen von Fremden, zufälligen Bekannten, nicht nur Freunde, nicht nur Familie, nicht nur Kollegen, nochmal: vor allem nicht nur ich, schon auch, nicht nur, wer immer das ist, oder die sind. Jetzt schlagen bei dir die Alarmglocken der Geschlechterdifferenz und cultural appropriation an, ich kann sie hören, ich sehe das an deinem Gesicht, lass läuten, ich bin dabei. Lies aber halt erstmal weiter, bevor du jetzt schon weißt, was ich denn meine, und schimpf mich dann. Wenn man in der kleinen Form einen Hauch Vergeblichkeit und die zufälligen Lieben unseres Menschenlebens spürt, ist es gut und genug.
Klingt schön.
Ich hoffe.
Großmäulig.
Na ja.
Was geht mich das an?
Entscheide selbst.
HAGEL
Wir kamen von der Autobahn. Bei Pinsdorf standen die Bäume entlaubt, von den Hagelschauern wie von Heuschrecken kahlgefressen. Die Sträucher an den Feldrändern waren leergefräst. Vor dem Autohaus an der Umfahrung sahen wir Neuwagen, deren Türen aus den zertrommelten Chassis herausgeplatzt waren. Knietief bedeckte an den Straßenrändern Sommerlaub den Boden, das nach einem Tag in der Hitze schon zu riechen begonnen hatte.
Zu Hause fanden wir unter dem Nussbaum zwei tote Amseln. Der Hagel hatte sie auf dem Ast erschlagen. Wir gingen zu den Apfelbäumen hinterm Haus. Die Früchte waren von Hagelpocken zernarbt; auf der Wetterseite waren die Bäume leer.
Im Juli, lange vor der Erntezeit, schauten wir wieder hin. Unser Dach war noch immer mit Plastikplanen gedeckt. Die Äpfel waren gewachsen, schleppten aber ihre blauen Hagelkrater weiter in den Herbst.
PRINCIPE DI SAVOIA
Mein Mann war Chirurg. Er arbeitete für die Weltgesundheitsorganisation in Genf und reiste viel. Von Amts wegen ausgestattet mit einer geradezu fürstlichen Macht, liebte er seinen Beruf und praktizierte ihn vor den Sterblichen aller Kontinente jeden Tag aufs Neue wie neu, beseelt von einer humanistischen Sorgfalt, die er sich im Studium der antiken Philosophie für diese moderne Institutionenwelt angeeignet hatte.
Seine Leidenschaft freilich, die keine geheime war, sondern allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wohlbekannt, galt den Hotels. In jeder Stadt suchte er das eine große mit dem klingenden Namen für sich heraus, zahlte privat dazu, was ihm die Spesen nicht erlaubten, mied aber dann die illustren Bereiche wie Bar oder Restaurant und zog sich stattdessen in die kleinen Lokale der unmittelbaren Umgebung zurück.
Dort suchte er keineswegs den Kontakt zur örtlichen Bevölkerung. Vielmehr blieb er am liebsten allein. In Madrid verbrachte er den Morgen vor einer Tagung in einer Cafeteria im Nachbarhaus des Ritz, wo man von einem Platz an der Theke die Topfpalme und den mit Sand gefüllten Aschenbecher am Rand der Hotelauffahrt stehen sah; auf Schloss Lackenbach im österreichischen Burgenland folgte er nach einem Festvortrag nicht den Kollegen zum Buffet in den berühmten Speisesaal aus der Renaissance, sondern ging lieber ein paar Schritte aus dem Park hinaus in das Gasthaus Prokopetz neben der Tankstelle an der Ortseinfahrt. Sogar im Urlaub hielt er an seiner Gewohnheit fest. Auf Waikiki in Honolulu wurde er täglicher Gast einer Kellerdiscothek in einer Seitenstraße hinter dem Halekulani-Hotel, Treffpunkt von Soldaten aus Pearl Harbor und abenteuerlustigen Touristinnen aus Australien oder dem amerikanischen Mittelwesten, wo man in Stroboskopgewittern auf der Tanzfläche mit den hochgeworfenen Händen den beschwitzten Plafond abklatschen konnte. Im Honolulu Star Advertiser musste er Jahre später online lesen, dass eine Investorengruppe den Gebäudekomplex für eine Shopping Mall mit Springbrunnen und italienischen Restaurant-Patios abgerissen hat.
Wir lernten uns in Mailand kennen, in der Bar Americano, einem kleinen Café unter dem Stadthügel des Principe di Savoia, vor der Tiefgarageneinfahrt des Hotels. Ich war von einem Spaziergang durch die Stadt zurückgekehrt und hatte noch keine Lust verspürt, in das Zimmer hinaufzugehen. Meine Schwester hatte eine Schlaftablette genommen und war zu Bett gegangen. Sie erholte sich von ihrer Scheidung und hatte mich um ein Wochenende mit den Alten Meistern in der Pinacoteca di Brera und den Läden in der Via Monte Napoleone gebeten. An einem Fenstertisch unterhielt sich ein Mann mit einem Kollegen aus Asien über Endoskopie. Neben den beiden stand eine aufgeklappte Aktentasche auf der Erde. Es war spät in der Nacht, und die Bar war bis auf uns drei und den Kellner leer. Ich bestellte an der Theke ein Glas Wein und sah zu, wie der Kellner über der Spüle Karotten und Gurken schnitt und in ein Wasserbecken legte. Der Mann nahm Broschüren aus der Aktentasche und redete auf den Kollegen ein. Dabei schaute er mich über dessen Schultern hinweg die ganze Zeit an.
Wir heirateten schnell und trennten uns bald. Viele Dummheiten in meinem Leben habe ich bereut, diese nicht. Man sagt, Glück sei ein furchteinflößendes Wort, das zu gebrauchen einem Frevel gleiche, für den wir einen Gott um Vergebung bitten müssten. Nach allem, was ich in der kurzen Zeit meiner Ehe beobachten konnte, trifft das eher zu auf Worte wie Gerechtigkeit oder Solidarität, besonders dann, wenn jemand wie mein Mann oder ich sie im Munde führen.
Und überhaupt, wer sind wir, unsere Lieben zu halten? Wir küssen gern und kümmern uns spät darum, ob uns der andere wohl oder wehe tut. Von den Träumen der Menschen neben uns in den Betten wissen wir nichts. Bei niemandem sind wir die Ersten, und bei kaum einem bleiben wir die Letzten. Ich habe mit meinem Mann gelernt, dass unsereins Gott als Zeugen einer schwer zu praktizierenden Dankbarkeit nötiger hätte als zur Befreiung von einer Schuld. Die kleine Bar in Mailand, wo sich das Neonlicht aus der Garage tief im Berg auf den Tischen spiegelt und das Hotel auf der Gartenklippe in den Nachthimmel wächst, besuche ich seit unserer Trennung jedes Jahr, wie eine Kapelle.
DIE SEILZÜGE VON ALTMÜNSTER
Drei Elektromotoren für die Bahnschranken im Zuständigkeitsbereich des Landbahnhofs waren im Kasten neben dem Zimmer des Stationsvorstehers untergebracht. Der eine bediente den Übergang auf dem Gelände des angrenzenden Sägewerks. Der zweite galt dem Übergang weit hinten an der Straße zum Reiterhof. Der dritte sicherte die Zufahrt in eine nahegelegene Neubausiedlung.
Jeder Motor hatte sein eigenes Abteil in dem Kasten, das jeweils mit einem separaten Lüftungsgitter verschlossen war. Wie die Maschrabiyyas vor den unverglasten Fenstern der Paläste und Handelshäuser Arabiens war jedes davon in einem individuellen Muster geschnitzt, das den Gegenstand dahinter in einem unergründlichen Halbdunkel barg. Eine Blechdose mit Schmieröl und Drahthenkel stand wie ein Farbtopf auf dem Boden unter dem Kasten und verstärkte noch den Eindruck lange tradierter Kunst und Pflege, sparsam in den Mitteln, aber reich an Sorgfalt und Effekt. Als die Stationsvorsteherin auf den Bahnsteig trat und die Motoren in Gang setzte, einen nach dem anderen, leuchteten auf dem Kasten nacheinander drei Lampen auf, zur Erinnerung daran, dass die Schranken jetzt bis zur nächsten Betätigung der Knöpfe geschlossen wären. Entlang der Gleise schwangen die langen und dünnen Zugseile wie lose Gitarrensaiten zum Erdboden durch, ein taktiles Gespinst, das abwechselnd ein Peitschen, dann Schnalzen, dann hohes Pfeifen hören ließ; flimmrig wie Haare, zugleich drahtig und schwer; unter dem fernen Nahen unseres Zuges und vor dem leuchtenden See weiter unten glichen sie auch der Takelage eines sturmbewegten Schiffs.
Es war ein heller und blauer Tag. Flugzeuge legten schneeige Spuren in den Himmel. Der Frühling hatte begonnen, aber es war noch kalt, sodass die Kondensstreifen über den beschneiten Bergen sich wie von selbst den weißen Gipfeln zuordneten. Wir fuhren durch Tunnel und an Ufern von Buchten, die mich an die Calanques vor Marseille erinnerten, stiegen in Ischl aus und ließen uns in der Trafik unter dem Wolfshügel, weil an diesem Sonntagmorgen kein Anschlusszug verkehrte, ein Taxi zur Marienkirche nach Lauffen rufen.
Die Stationsvorsteherin, mit der wir vor dem Einsteigen ein paar Worte gewechselt hatten, erzählte uns, dass der Bahnhof im kommenden Jahr abgerissen und durch einen zeitgemäßen Neubau ersetzt werden würde. Ständiges Personal gäbe es dann keines mehr. Unsere Altmünsterer Zugehfrau mit ihrer schwachsinnigen Tochter





























