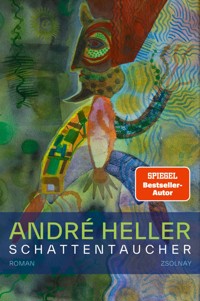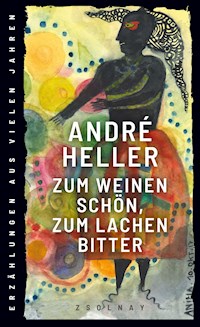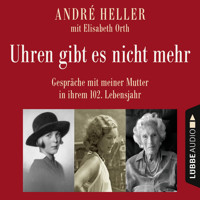9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Diese Erzählung greift einige Themen und Begebenheiten auf, die meine Kindheit für mich bereithielt. Die Oberhand beim Schreiben hatte allerdings die Phantasie.« André Heller Paul wünscht sich nichts dringlicher, als dem erzkatholischen Internat zu entfliehen, auf und davon, um endlich ein solch eleganter und freier Mensch zu werden wie sein skurriler Onkel aus New York. Als Pauls Vater, der Süßwarenfabrikant und Kommerzialrat Roman Silberstein, zu Tode kommt, darf der Junge in die Familie zurückkehren. Die jüdischen Onkel aus Übersee sind zur Beerdigung angereist und übertreffen einander im Schildern von Anekdoten aus dem merkwürdigen Leben der Silbersteins. Aus dieser schillernden Gesellschaft des Wiener Großbürgertums, in der die versunkene k. u. k. Welt weiterlebt, siedelt Paul über in das selbstgeschaffene Reich des Unsichtbaren, der vorüberhuschenden Träume und fernen Zukunftsvisionen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
André Heller
Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein
Eine Erzählung
Erzählung/en
Fischer e-books
Für Ferdinand in tiefer Dankbarkeit
Diese Erzählung greift einige Themen und Begebenheiten auf, die meine Kindheit für mich bereithielt. Die Oberhand beim Schreiben hatte allerdings die Phantasie.
1
Zuerst starb der Papst. Das war eine ernste Angelegenheit. Der Generalpräfekt versammelte um sechs Uhr dreißig vor der Frühmesse alle Präfekten, Vizepräfekten und Zöglinge im ungeheizten Theatersaal und verkündete: »Der Heilige Vater ist tot. Jetzt sind wir Waisen. Lasst uns für seine Seele beten, und dass uns die Dreifaltigkeit Trost gewähre.« Einige Mitschüler waren klug genug zu weinen. Sie erhielten nach der Trauerveranstaltung von der Schwester Immaculata als Anerkennung ein Stollwerck-Bonbon. Die Schwester war die einzige sichtbare, lebendige Frau im Kollegium. Sie leitete die Krankenabteilung. Dort roch es nach Wundbenzin und Kampfer. Genauso, dachte ich, muss es zuletzt im Schlafzimmer des Papstes gerochen haben. Pius XII. – was für ein schöner Name. Eugenio Pacelli klang noch schöner. Aber so hatte er nur bis zu seiner Wahl als Nachfolger Petri heißen dürfen. Dass die Päpste nicht aus Fleisch, Knochen und Blut bestanden, sondern aus Stein, wusste ich, denn Jesus hatte seinen Stellvertreter mit den Worten ernannt: »Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.« Aber rätselhaft blieb, wieso Felsen sterben können und warum ich deshalb jetzt ein Waisenkind sein sollte. Offenbar gab es für jeden von uns einen heiligen Vater und einen unheiligen. Den unheiligen nannte man auch den leiblichen. Es zählt zu den nachhaltigsten Traurigkeiten meiner Kindheit, dass Mutter mich nicht unbefleckt empfangen hat. Was besaß die Mutter Gottes, dachte ich damals, das meiner Mutter fehlte? Sie konnte doch kein seideneres Haar haben, keine größere Sanftmut und kein einnehmenderes Lachen. Dass derjenige, der Mutter befleckte, nach der himmlischen Logik als unheilig galt, war zu verstehen, aber nicht ganz. Denn wie wäre ich wohl in diese Welt gekommen, wenn Vater das Beflecken nicht gelungen wäre, und wer hätte dann dem Paul Kaltner die Ohrfeige gegeben, die er von mir im Streit bekam und die ihn schlagartig von seinem heftigen Stottern befreite – von anderen Wundern und Heldentaten, die von mir wahrscheinlich in Zukunft noch zu erwarten waren, ganz zu schweigen.
Die zwei Stunden Freizeit nach dem Mittagessen entfielen. Die Präfekten berichteten stattdessen den Schülern aller Stufen vom Leben Pius’ XII.: dass er ein nobler Italiener war, der so ausgezeichnet Deutsch sprach, dass es sogar Herrn Hitler imponiert hatte, und dass er von Anfang an aus nichts als Gutem und Güte bestand. »Schaut euch auf dieser Fotografie seine Hände an. Wie von Dürer. Was der Pontifex berührt hat, bleibt gesegnet bis zum Jüngsten Tag.« Dafür war es nun zu spät. Mich würde er nicht mehr berühren können. Das bedeutete ziemlich schlechte Voraussetzungen für den Tag der Auferstehung. Aber immerhin hatte die Sopranistin Lotte Lehmann in der Drehtür des Hotels Bristol neben der Staatsoper einmal meine Schulter gestupst, weil es ihr zu langsam voran ging. Der Musikprofessor hatte uns von der herzzerreißenden Stimme der Lehmann erzählt und dass der Komponist Richard Strauss darüber schrieb: »Sie sang, dass es die Sterne rührte.« Ich hoffte innig, dass diese Lehmann-Berührung in der Stunde der Wahrheit am Ende der Zeiten ebenso viel zählte wie jene des Papstes.
Abends, nach dem Auslöschen der Lichter, lagen die vom frommen Leben erschöpften Buben in ihren Militäreisenbetten. Fünf Reihen mit je zehn Zöglingen, die häufig aus Träumen aufschrien oder in dem hohen Schlafsaal eine Kuppel aus Seufzern errichteten. Ich wusste nicht, wie es geschieht, dass man einschläft. Du liegst wach und denkst, dass es nicht gelingen wird, und dann überlistet dich irgendetwas in deinem Gehirn Verborgenes und hebt dich unbemerkt in eine Entrücktheit. Ein größeres Rätsel kannte ich nicht als dieses gleichzeitig Bei-sich- und Außer-sich-sein.
Im Traum war ich einmal so groß wie der Stephansdom, und wir haben uns in die Augen geschaut, der Nordturm und ich. Dann hat er zu mir gesagt: »Elfriede, pass gut auf deine Glocken auf.« Wenn es stimmt, dass jeder Traum einen Sinn hat, dann soll mir bitte jemand den Sinn dieses Stephansdom-Traumes erklären.
In der Nacht nach dem Tod des Papstes gelang es mir nicht einzuschlafen. Der Präfekt Pater Mokloszi ging stets gegen zweiundzwanzig Uhr durch die Bettenstraßen und erfasste mit der Taschenlampe kurz, Gesicht für Gesicht, die ihm anvertrauten Zöglinge. Der Leuchtturm, dachte ich immer, wenn ich ihn sah. In meiner Einbildung schliefen wir auf einem Amphibienboot, und der Leuchtturm bewahrte uns zu Wasser und zu Lande vor Schiffbruch. Denn ich war überzeugt, dass man überall auf Erden untergehen konnte, außer vielleicht in den Umarmungen meiner Mutter.
Als der Präfekt mich mit dem Licht streifte, schloss ich rasch die Augen. Aber er bemerkte mein Wachsein, stellte die Lampe auf die schwächste Stufe, befestigte sie mit einer Lederschlaufe an einem Knopf seiner Soutane in Brusthöhe und trat an das Betthaupt. Dann begann er, mich wortlos an den Schläfen zu streicheln. Seine Finger rochen stark nach Tabak, und da er ein Jesuit war und dieser Orden die »Gesellschaft Jesu« heißt, stellte ich mir auch Jesus und die zwölf Apostel als Kettenraucher vor und den Vatikan als eine Art unermesslich große Tabaktrafik, in der die Kapläne und Pfarrer, die Prälaten und Pröpste, die Monsignores und Bischöfe, die Erzbischöfe und Kardinäle ihre Smart- und Jonny-Filter-Päckchen erhielten. Ich schmiegte mich in die Hände des Präfekten und wusste, dass der Lichtkegel des Leuchtturms jetzt nur für mich in das Dunkel schnitt und ich mich für die Dauer seiner Zuwendungen in Sicherheit wiegen konnte.
Was mir stets gegen Abend Angst bereitete, war meine Überzeugung, dass ich mich schon zu lange gezwungenermaßen am falschen Ort und bei den falschen Leuten aufhielt. Das meiste schien hier aus Grobheit und Kälte gemacht, und selbst im Juni und September fröstelte mich, und die einzige Musik, die wir hören und singen durften, waren Kirchenlieder während der Messe und Volkslieder während der Gesangsstunden, und hätte ich nicht manchmal heimlich für Minuten auf der Toilette ein Detektorradio, das nur aus Drähten und einem einzelnen Kopfhörer bestand, an die Wasserleitungsröhren angeschlossen, wären mir die großartigen Existenzen von Bo Diddley und Fats Domino verborgen geblieben, die dem Generalpräfekten mit Sicherheit als sündig gegolten hätten.
Überall stieß man auf das Wort »Sünde«. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und dieses Wort heißt Sünde, dachte ich. Wenn man bei der täglichen Kommunion während der Frühmesse irrtümlich auf die Hostie biss, war es eine Sünde. Und wenn ich sagte, dass ich lieber eine Schwalbe wäre als der Zögling Nummer 42, war es eine Sünde. Und zu widersprechen war eine Sünde, aber die schwerste Sünde überhaupt war, laut zu behaupten, dass man nicht an die Sünde glaubte. »Hände auf den Rücken«, schrien die Präfekten bei jedem Vergehen. Wenn man es tat, schlugen sie einem ins Gesicht, und wenn man es, wie ich, nicht tat und sich augenblicklich zu Boden fallen ließ, traten sie einen mit den Schuhen.
Am falschen Ort und bei den falschen Leuten: Kollegium Attweg. Mit der Straßenbahnlinie 60 bis zur Endstation Kepplergasse und dann mit dem Autobus bis zum Rodauner Hauptplatz. Von dort zu Fuß durch die Gansterergasse und auf die Holzbrücke, über den Liesingbach, in dem sich Äschen und Forellen tummelten, geradewegs in die Heimwehfestung. Künftige Kirchenfürsten und Minister der christlichen Volkspartei, Generaldirektoren bürgerlicher Großbanken und Universitätsprofessoren züchtete man dort.
Aber ich hatte anderes mit mir vor. In einem Asbest-Anzug als erster Mensch in das Innere des Vesuvs hinabzusteigen, um in der glühenden Lava nach Feuerfischen zu suchen, war einer meiner Pläne. Inhaber des Eichkatzl-Fütterungsmonopols im Park von Schönbrunn ein anderer, und der dritte lautete: Weltmeister im Unsichtbarsein. Auf nichts davon wurde man im Kollegium vorbereitet. Am falschen Ort und bei den falschen Leuten.
Der Präfekt hatte aufgehört, meine Schläfen zu streicheln. Jetzt beugte er sich über mich und küsste meine Stirn. »Niemandem etwas erzählen«, sagte er, »Verrat ist eine Sünde.« Am nächsten Morgen beteten wir schon vor der Frühmesse einen Rosenkranz für Pius XII. und einen weiteren für den fehlbaren Menschen Eugenio Pacelli, der auch noch irgendwie im, bei Bedarf unfehlbaren, Papst gesteckt hatte. Außerdem verordnete uns der Generalpräfekt einen Trauerfasttag, und eine ganze Woche durften wir in der Freizeit zwischen dem ersten und zweiten Studium keinen Sport treiben. Dies war das Einzige, das mich Dankbarkeit gegenüber der prächtig gewandeten, gesalbten und geschminkten Leiche empfinden ließ, an der in der Stadt Rom täglich Tausende andächtig vorüberzogen und deren zweiundachtzigjähriger Mund mit Weihrauchkörnern gefüllt war, wie uns der Chemieprofessor erzählte.
Fast jede Nacht trat der Leuchtturm an das Kopfende eines anderen Zöglings und blieb dort für eine Weile. Mir erschien das ungerecht, denn meine Not hielt ich für die bitterste, bis am 18.Oktober vor dem Abendgebet zwei Fratres aus der Tischlerei erschienen und das Bett vom Gabor Benedek aus dem Schlafsaal auf den Gang trugen. Der Gabor schrie: »Nein! Das könnt ihr mir nicht antun! Bitte nicht!« Dann fiel er auf die Knie und riss sich büschelweise die Haare aus, und das Blut tropfte ihm übers Gesicht. Aber es half nichts. »Du bist es nicht wert, bei den anderen zu schlafen. Du Kameradschaftsschwein hast einen Mitschüler bestohlen.« »Wen hat er bestohlen, und was hat er genommen?«, fragte ich den Präfekten Mokloszi. Er sah mich ausdruckslos an, und im selben Augenblick wusste ich, dass meine Frage mich für immer aus der Leuchtturmgnade geworfen hatte. »Neugierde ist eine Sünde«, antwortete der Präfekt. »Ich hab mir aus dem Spind vom Zeidler die Fotografie seiner Mutter geholt«, schluchzte der Gabor Benedek. »Aber warum denn?«, fragte ich. »Weil sie so schön ist, die Frau Zeidler«, antwortete er, »mein Gott, sie ist so wunderschön. Da kann ja ich nichts dafür. Wie sie bei unserer Firmung im Kollegium war, hat sie mir ein halbes Kilo Kirschen geschenkt. Einfach so. Die Kerne hab ich in meinem Polster versteckt und seither drauf geschlafen. Ich bin doch kein Schwein.« »Kameradschaftsschwein«, wiederholte der Präfekt. Ich begriff, dass das Unglück des Gabor Benedek in Wahrheit ein großes Glück war, und beneidete ihn, weil er um seiner Liebe willen morgen das Institut verlassen musste.
Als wir zehn Stunden später, wie jeden Morgen, um sechs Uhr durch den erschreckenden Klang einer Trillerpfeife geweckt wurden, war Gabor tatsächlich verschwunden, sein Lernpult und sein Spind waren ausgeräumt, seine Nummer 38 von der Spindtüre entfernt, und sein Name kam den Präfekten und Professoren nie mehr über die Lippen.
Im nächsten Monat geschah wenig Erzählenswertes, außer dass ein weiterer Klassenkamerad von einem Tag auf den anderen aus Attweg verbannt wurde. Alles, was man ihm vorwerfen konnte, war, dass seine Eltern sich scheiden ließen und für Kinder Geschiedener nach Auffassung der Jesuiten kein Platz unter dem gesternten Schutzmantel der Mater Ter Admirabilis, unserer Patronin und Gottesmutter, vorgesehen war.
Die eisigen hohen Gänge, die auf fünf Stockwerken die zahllosen Studiensäle, Klassenzimmer und Lehrmittelkabinette, die Schlaf- und Studierräume, das Refektorium, den Musiziersaal, die Direktionskanzleien, die Kapellen und das Theater verbanden, rochen wie immer nach Kohl, Gummi arabicum und zu wenig gewaschenen Buben. Es gab auch noch einen sogenannten Geheimgang, der zur Klausur führte, in der jene Patres wohnten, die wegen ihres greisen Alters keine Präfekten oder Professoren mehr waren. Den Geheimgang kannte jeder im Kollegium, aber wir Zöglinge durften ihn im Normalfall nicht betreten. In die Krankenabteilung allerdings gelangte man ausschließlich über diesen Weg, und von einem Eckfenster des Quarantänezimmers sah man in die Freiheit eines Nachbargrundstückes, auf dem gelegentlich ein kleines Mädchen mit schwarzen Stoppellocken auf einem Shetland-Pony im Kreis trabte. Dieses Mädchen bedeutete für mich, was Zeidlers Mutter für Gabor Benedek gewesen war. Ihre Entdeckung hatte ich einer Schafblatternerkrankung im zweiten Attwegjahr zu verdanken, und seitdem betete ich um Mumps oder Röteln, aber ich schien bei den Wunscherfüllungsgeistern auf einer schwarzen Liste zu stehen, denn außer gelegentlichem Nasenbluten und einem Gerstenkorn stellte sich in meinem Körper nichts Ungewöhnliches ein. Ich schrieb dem Mädchen innige Briefe. Auf dem Dachboden über der Wäscherei hatte ich eine Ausstiegsluke für den Rauchfangkehrer entdeckt. Von dort kletterte ich aufs Dach des kasernenartigen Baus und faltete die Blätter zu Papierflugzeugen, die ich in die Welt der Stoppellockigen senden wollte. Wenn sie durch die Lüfte segelten, rief ich ihnen nach: »Hopp, hopp, ihr Wolkenpferdchen, findet rasch zum Herzen des Fräuleins!« Aber keine einzige Botschaft gelangte ans Ziel.
Zweimal im Monat durfte ich den Geheimgang betreten, weil ich zum Ministrieren beim Hundertjährigen in der Klausur-Privatkapelle eingeteilt war. Der Hundertjährige war ein spindeldürrer Pater, wie ein gepresstes Blatt aus einem Herbarium. Es hieß von ihm, dass er vor langer Zeit Beichtvater des unglücklichen Kronprinzen Rudolf gewesen sei. Dass der Kronprinz 1889 seine Freundin Mary Vetsera im Schloss Mayerling ermordete und anschließend Selbstmord beging, verursachte dem Pater einen solchen Schock, dass er als Missionar in den Kongo ging und dort diente, bis ihn Malariaschübe vollends aus der Bahn warfen und er in Attweg sein Ausgedinge fand. In seinem afrikanischen Missionsgebiet hatte er lange Jahre ebenso hartnäckig wie erfolglos versucht, eine äquatoriale Version der Wiener Küche durchzusetzen. Als späten Nachhall davon murmelte er manchmal zusammenhanglos mitten im Zelebrieren der Messe Sätze wie: »Kaiserschmarrn aus Flamingoeiern, Serviettenknödel aus Maniok.«
Ich erinnere mich, dass in dieser Zeit im Theatersaal eine Vorführung des Films »Das Lied von Bernadette« stattfand. Alle bestaunten das französische Kind, dem in Lourdes die Madonna erschienen war. Ich überlegte mir daraufhin einige Tage, ob ich nicht eine Marienerscheinung vortäuschen sollte, um der Mittelpunkt des allgemeinen Interesses zu werden, aber dann gab ich den Plan wieder auf, weil ich Attweg einen zu trostlosen Ort fand, um ihn durch meine Phantasie unsterblich zu machen. Außerdem gönnte ich den Jesuiten den unermesslichen Reichtum nicht, der ihnen durch Souvenirverkäufe an die Millionen zu erwartender Pilger in den Schoß gefallen wäre.
In dieser Zeit regnete es viel, und die Präfekten, die den Tod des Papstes nicht vergessen konnten, sagten: »Selbst der Himmel weint.« Das verstand ich nicht, denn schließlich war ja der gute und gütige Heilige Vater in den Himmel übersiedelt, und der hätte sich doch darüber freuen müssen. Das Unlogische ist eine Grundlage des Römisch-Katholischen, dachte ich mir. Es regnete und regnete, und der Boden wurde immer schlammiger, und ich bedauerte, dass die Stoppellockige bei diesem Wetter unmöglich ausreiten konnte. Vom Schlafsaal aus beobachtete ich, wie der würdige Herr Generalpräfekt auf dem Weg vom Pförtnerhaus zum Turnpavillon der Länge nach in den Dreck fiel, rasch aufstand und so tat, als wäre nichts passiert und er sähe nicht aus wie eine große Tonskulptur vor dem Brennen.
Das Aus-dem-Fenster-Schauen ist ein Glück. Ich fand es erstaunlich, dass unsere Augen und Ohren etwas erfassen, das weit entfernt ist. Wie Hunde an einer langen Leine sind sie, dachte ich, sie eilen mir voraus oder halten sich dort auf, wo ich mit den Füßen nie hinkomme. Man kann einen Menschen einsperren, aber solange man ihm einen Ausblick lässt, klettert das Schauen auf Gebäude und Berge, überquert Brücken und Mauern oder reist von der Milchstraße zum Kleinen Bären.
In manchen Nächten gab es die Seligkeit, weinen zu können. Zunächst kündigte sie sich mit einem Kribbeln in den Zehen an. Von dort sprang sie auf die Kopfhaut über, sodass sich eine Art Klammer bildete, die meinen Körper umschloss, der bald darauf in Schluchzen ausbrach. All meine Wut, mein Ausgestoßensein, meinen Ekel warf ich in die Tränenflut und ließ sie fließen.
Stundenlang gab ich mich diesem Weinen hin, das mir auch eine erstrebenswerte Gegenhaltung zu dem Tapferkeitswahn schien, den man uns Zöglingen aufzwingen wollte. Am darauf folgenden Morgen war ich stets in ausgezeichneter Unfügsamkeit, und anstelle der verabschiedeten dunklen Energien trat die tröstliche Gewissheit, dass alles immerzu ein Vorübergehen ist.