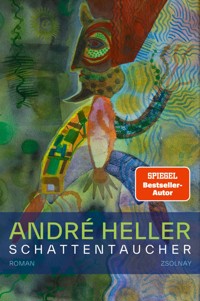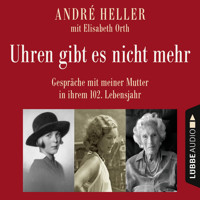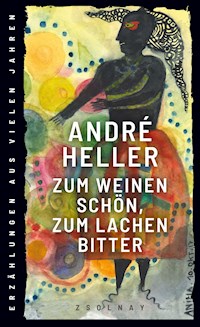
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tiefgründig, schillernd, phantasievoll: Wie in seinem Bestseller „Das Buch vom Süden“ erzählt André Heller ganz besondere, tiefgründige und schillernde Geschichten. Eine Weltmeisterschaft im Händefalten, Shlomo Herzmanskys wundersames Überleben dank Himmler und ein wildes nächtliches Durcheinander von Lipizzanern mitten in Wien. Alles ist möglich, selbst die Abschaffung des Todes kann einen nicht wirklich erstaunen, wenn man in die Erzählwelt von André Heller eintaucht. Wie in seinem Bestseller "Das Buch vom Süden" vermischt André Heller Anekdotisches mit Autobiografischem, schafft Bilder und Porträts seiner Welt, die die Vergangenheit in die Gegenwart holt und die Ferne in die Nähe. „Ein Maupassant, ein Schnitzler, sogar ein Joseph Roth von morgen könnte André Heller werden.“ (Joachim Kaiser, Süddeutsche Zeitung)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Tiefgründig, schillernd, phantasievoll: Wie in seinem Bestseller »Das Buch vom Süden« erzählt André Heller ganz besondere, tiefgründige und schillernde Geschichten. Eine Weltmeisterschaft im Händefalten, Shlomo Herzmanskys wundersames Überleben dank Himmler und ein wildes nächtliches Durcheinander von Lipizzanern mitten in Wien. Alles ist möglich, selbst die Abschaffung des Todes kann einen nicht wirklich erstaunen, wenn man in die Erzählwelt von André Heller eintaucht. Wie in seinem Bestseller »Das Buch vom Süden« vermischt André Heller Anekdotisches mit Autobiografischem, schafft Bilder und Porträts seiner Welt, die die Vergangenheit in die Gegenwart holt und die Ferne in die Nähe. »Ein Maupassant, ein Schnitzler, sogar ein Joseph Roth von morgen könnte André Heller werden.« (Joachim Kaiser, Süddeutsche Zeitung)
André Heller
Zum Weinen schön, zum Lachen bitter
Erzählungen aus vielen Jahren
Mit einem Nachwort von Franz Schuh
Paul Zsolnay Verlag
Inhalt
Gedächtnispassagiere 3
Über die Reisegeschwindigkeit
Die Frau in der Tür zum Park
Der Sprung in den Himmel
K. u. K. — Ein Monolog
Eisregen im Rotlichtdistrikt
Die Nacht des alten Mannes
Diamanten auf den Augen
Vom wirklichen Leben
Der Äquator am Rand der Arktis
Ein Ort der selbstverständlichen Täuschungen
Raubkatzenmusik
Gedächtnispassagiere 1
Ratschlag für Reisende
Was einem Ungarn in Wien begegnen kann
Albert
»Götterliebling« (Für Christine de Grancy)
Ein römischer Freund
Der Fall Moskovic
Der erste April
Was wann?
Wien gebaut auf Dreck
Flamm
Die Ernte der Schlaflosigkeit in Wien
Dem Himmler sein Narr
Warum ich ein Hornissennest nicht entfernte
1959
Eine Begebenheit vom 2. Juli 1990
Onkel Plumps
Ganz und gar
Die Handbewegung
Wie es wirklich war
Ein rascher Vorgang
Charifa
Der Aufenthalt im Freien
Der glücklichste Mensch von Wien
Damals
Jacob Friedkins Erinnerungen an verlorene Fotografien
Der erste Mai
Pallawatsch
Adlitzbeere
Ein Ehrentag
Olga Cator
Die kleine Frau
Hände
Über Clowns
Gedächtnispassagiere 5
D Welt steht auf kein Fall mehr lang
Franz Schuh: Willkommen Österreich
Gedächtnispassagiere 3
Unsere Milchfrau hieß Begovich und trug einen weißen Haarschopf, als hätte sie sich in einem unachtsamen Augenblick eine Portion Schlagobers auf den Kopf gepatzt. Ich durfte bei ihr aufschreiben lassen. Alle meine Freunde holten sich täglich ein bis zwei Topfengolatschen oder Schnittlauchbrote, und einmal im Monat bezahlte Mutter die so genannte »Gfraster-Rechnung«. Die Schwester der Milchfrau litt an Elefantiasis und konnte auf ihrer rechten Hand dreiundzwanzig Nußkipfel servieren. Sie wirkte nie unappetitlich, eher wie eine lebende Auslage, und hatte ein sehr hübsches Gesicht. (Der erste erotische Traum, an den ich mich erinnern kann, handelte zwischen ihr und mir, und die gewaltige Hand spendete dabei Schatten wie ein Kondor, der regungslos über seinem Opfer schwebt.) »Du bist a tramhaperter Bua«, spottete die Begovich, »du wirst no amoi mitn Voglkäfig um d Mili gehen.«
Das Verkaufslokal glich im Grundriss einem gleichschenkeligen Dreieck und befand sich Ecke Windhagergasse/Leitnerstraße. Die Wände waren mit Tiermustern tapeziert. Eigentlich war der Raum ein Kinderzimmer bzw. ein wirklichkeitsgetreuer Kaufmannsladen in einem Kinderzimmer. Die meisten Kunden kannten einander seit langem und legten Wert auf die Schokoladenmünze, welche jedem Einkauf gratis beigelegt wurde. »Das ist die einzige stabile Währung in Europa«, hieß es. Aber die Schwestern Begovich träumten von anderen Kontinenten. Sie sparten für eine Reise zum Kilimandscharo und lernten bei einem greisen ehemaligen Missionar mit bewunderungswürdigem Fleiß Kisuaheli, »damit die Wüden uns net für Wüde halten, und damits merken, dass a Weaner a a Hirn hat«. Sonntags spazierten die beiden in Spitzenkleidern wie brüchige Engel durch die Alleen und fütterten Tauben mit Semmelbröseln. Wenn der Sommer kam, meinten sie: »Jetzt wirds Afrika!« Und man sah sie mit dem Missionar im Hügelpark Vokabeln lernen oder bauernschnapsen, wobei die Elefantiasiskranke mitunter »zuadraht is« schrie und mit der Rechten den Talon verdeckte.
(1969)
Über die Reisegeschwindigkeit
Der kleinste Ort hat seinen schlechten Kerl, den sie im Grunde alle beneiden, weil sein Leben jenseits des Vorhersehbaren, jenseits des geduldig Ertragenen, jenseits der Spielregeln verläuft. Er dient als Abschreckung vor den Nachtseiten und Abgründen des menschlichen Seins. Und doch bereitet, schon über ihn zu lästern, eine süße Ahnung jener Achterbahnkitzel, denen die Bewohner der Tagseite und freundlichen Ebenen so ganz entsagen müssen.
Freilich gibt es auch unter den schlechten Kerln Kreaturen, die zu träge und mutlos sind, sich aus eigener Kraft zu gestalten, und die als Schmarotzer oder Trabanten stärkerer Persönlichkeiten ihr blasses Auskommen finden. Der wahre schlechte Kerl allerdings ist ein Juwel, das seinen Schliff ganz und gar selbst bestimmt. Sein Funkeln dringt bis tief in die Träume seiner Opfer und Richter, und er beschäftigt eine Armee von Feinden, die ihm unausgesetzt nachstellt. Wie ein König Pfründe und Titel verleiht, so bringt er Ruhelosigkeit und Tränen, Schmach und Staunen unter die Leute. Den Guten gibt er das Bewusstsein ihres Gutseins. Ohne seine Taten hätte das Wort Sünde geringe Bedeutung. Daher beten die klügeren Bischöfe, dass jeder schlechte Kerl die sieben Leben der Katze haben möge.
Den Marcel Kreissel konnte man für die Erfüllung solch eines Gebetes halten. Aus jeder Schurkerei schien er gestärkt hervorzugehen und unwiderstehlicher. Die Wände der Dreizimmerwohnung, die Kreissel gegenüber der Universität am Wiener Ring bewohnte, waren im Laufe der Jahre Zeugen von mehr Versprechen gewesen, als ein Dutzend Menschen hätte jemals halten können. Oft betrachtete Kreissel vom Fenster herab die Studenten und Studentinnen, die aus dem steinernen Bienenkorb der Alma Mater in alle Richtungen schwärmten, und jedes Mal empfand er eine Art aufrichtigen Mitleids mit ihnen. So nutzlos erschien ihm ihr Fleiß und ihre Wissbegier, und so fahrlässig unvorbereitet auf die wirklichen Gefahren des Erwachsenseins entließ man sie in die Wildnis der Welt.
Manchmal hätte er ihnen zurufen wollen: »Schreibt euch in meine Schule ein. Ich werde euch den Blick schärfen für Nutz und Unnütz. Ich zeige euch Kopfbewegungen oder Arten, Briefe zu schreiben, die tausendmal mehr bewirken können als das Studium des bürgerlichen Gesetzbuches. Von denen, die Macht über die Mächtigen haben, will ich euch erzählen: von den Mätressen und Freudenknaben, den Erpressern und Beichtvätern. Vergesst die Portale und Feststiegen, die arabeskengeschmückten Haupteingänge und roten Läufer. Alles, was zählt, ist die Kenntnis der Hintertüren und die geflüsterten Losungsworte, die aus selbstgefälligen oder würdevollen Herrschaften Wachs machen in den Händen von meinesgleichen.«
Aber dann dachte Marcel Kreissel, dass es besser war, zu schweigen und die jungen Leute nichts von alledem wissen zu lassen, da es nie genug Opfer geben konnte: wehrhafte und fügsame, kapitale und marginale, Übungsopfer und solche für Meisterstücke. Im Grunde betrachtete er jeden und jede mit den Augen des vollkommenen Jägers, der sein Wild nach Gefährlichkeit, Schnelligkeit und Kraft einschätzt, um es dann so schmerzlos wie möglich zu erlegen.
Das Universum bestand für Marcel Kreissel ausschließlich aus Opfern, früheren Opfern, künftigen Opfern und Komplizen. Es gab darin auch die Richter und Staatsanwälte, Polizisten, Privatdetektive, Advokaten und Spitzel, aber sie waren Komplizen im höheren Sinne, denen er in besonderer Dankbarkeit verbunden war. Denn obwohl er sie fürchtete, schärften sie durch ihre bloße Existenz seinen Verstand und seine Wachsamkeit und ließen ihn zu einem einzigartigen Präzisionsinstrument der Niedertracht werden.
Als Falschspieler in den besten Kaffeehäusern des ersten und dritten Wiener Bezirkes hatte er seine Lehrjahre während der alliierten Besatzungszeit zwischen 1945 und 1955 begonnen. Damals, als jede Geschicklichkeit ein Kilo Kaffee einbringen konnte oder eine Stange Chesterfieldzigaretten und Kaffee und Zigaretten Leitern in den Himmel waren.
Ein wenig später wurde ihm die Leichtgläubigkeit sehnsüchtiger Frauen bewusst. Und die Tatsache, dass man in Herzensangelegenheiten nur ein einziges Gegenüber irreführen musste, anstatt zwei bis drei wie bei den Pokerspielen, die man überdies nur im Sitzen ausüben konnte, obwohl ihm grundsätzlich im Liegen die besseren Ideen kamen.
Wann immer er anfänglich einer Frau Geld oder andere Vergünstigungen entlockt hatte, erwartete er einen Blitzschlag, einen Stolperer, der ihm die Hand brach, oder sonst wie ein Strafgericht Gottes. Aber nie geschah etwas, und er gelangte zu der Auffassung, dass es Gott entweder nicht gab oder ihm die Gaunereien gegenüber Mädchen und Frauen gleichgültig waren. Marcel Kreissel dachte manchmal sogar, Gott selbst habe sein ganzes unfassbares Universum mit all seinem Überfluss durch geniale Heiratsschwindeleien ergaunert.
So sah er bald in allem Weiblichen eine Einladung, eine unwiderstehliche Gelegenheit. Das Folgenschwerste an seiner neuen Erkenntnis aber war der völlige Verlust von Skrupeln. Ja, sie verkehrten sich geradezu in ihr Gegenteil, denn er empfand jedes Mal eine tiefe Genugtuung, wenn er ein weibliches Wesen auf dem dünnen Eis seiner Vorspiegelungen tanzen ließ, um sie dort haltlos stehen zu lassen, wenn ihre Nützlichkeit als Opfer verbraucht war.
Marcel Kreissel war eigentlich kein schöner Mann, aber in den Stunden seiner Höchstform, wenn er ganz der Erregung über die Hohe Schule des Gaunertums gehörte, bekam sein Gesicht etwas regelrecht Prachtvolles, und man hätte von einem Antlitz sprechen können.
Das Fräulein Aurelia Donatelli jedenfalls hatte von allem Anfang an nicht die geringste Chance gegen dieses Übermaß an Wirkung, das sich als schlechter Kerl in Gestalt von Marcel Kreissel auf ihre umfassend unerfahrene Person stürzte. Sie war aus reichem katholischem Veroneser Hause und von jener Ausgewaschenheit des Wesens, die manchen sogar ihre beträchtliche Hübschheit übersehen lassen konnte. In Wien hielt sie sich auf, um die deutsche Sprache, die man in diesem Fall wohl die österreichische nennen muss, zu studieren. Ihre Familie hatte Großes und durchaus nicht nur auf Verehelichung Gerichtetes mit ihr vor. Das Fliesen- und Sanitäranlagen-Imperium der Donatellis erstreckte sich über ganz Norditalien, und das einzige Kind sollte nach Erlangung des akademischen Grades mehrere Zweigstellen zur selbstständigen Führung erhalten.
Marcel Kreissel hatte sich Aurelia bei einer Veranstaltung der Stiftung Pro Oriente genähert. (Es waren diese kirchlichen und halbkirchlichen Organisationen, die ein unübertreffliches Revier für seine Beutezüge darstellten, weil die Wachsamkeit der Menschen im Schatten Roms weit unter gewöhnliche Fahrlässigkeit hinabsank. Nur die allerwenigsten besitzen nämlich die Fantasie, den Teufel gerade im Hause seines Erfinders und zugleich größten Widersachers zu erwarten.)
Ein Luftwesen sei er, sagte Marcel Kreissel. Ein alles und jedes aus der Vogelperspektive betrachtendes. Er arbeite zur Zeit an einer Geografie der menschlichen Scheitel, Haarwirbel und Haarschnitte, die dem Fachkundigen die Deutung des wahren Charakters jedweden Frisurenträgers ermöglichten.
Aurelia hörte gar nicht wirklich, was er sagte, sie war zu sehr damit beschäftigt, darüber zu staunen, wie er es sagte. Als gebe es zwischen ihnen ein unbezweifelbares Einverständnis, dem viele klärende Gespräche vorangegangen waren und das sich nun als süße nahrhafte Frucht zu ihrer Verfügung hielt. Und augenblicklich war sie bereit, von dieser Frucht zu essen. Das erste Mal in ihrem Leben begegnete sie nämlich von Angesicht zu Angesicht jemandem, der ein Bürger jenes geheimnisvollen Territoriums war, das sie jenseits der Eltern, jenseits der Verwandten, Freunde und Bekannten, jenseits der Ratschläge ihrer Lehrer und Erzieher seit längerem geahnt und erhofft hatte. Ihre Verstörung über Ton und Benehmen des Mannes, der sich als Marcel Kreissel vorgestellt hatte, schüchterte sie nicht ein, ganz im Gegenteil, sie diente ihr als Bestätigung, dass die gewohnten seichten Gewässer hinter ihr lagen und die Tiefen namenloser Abenteuer erreicht waren. Endlich, dachte sie. Denn so viel verstand sie von der Schifffahrt, dass im Seichten keine großen, schnellen und stolzen Dampfer fahren konnten, und sie fühlte sich nicht fürs Ruderboot geboren.
Marcel Kreissel war ein guter Liebhaber. Das gehört zur Grundausstattung des schlechten Kerls und lässt die Opfer sich zuletzt nicht gar so betrogen vorkommen, weil doch Millionen Menschen freiwillig viel dafür gäben, einige Male unverlogen lustvoll jauchzen zu können.
Aurelia jauchzte sieben Monate lang. Von Mitte Februar bis Mitte September. Dann lernte sie den Oskar Samek kennen und jauchzte mit dem.
Das schreibt sich leicht, aber für den Marcel Kreissel war es unendlich von allem entfernt, was er fassen konnte. Er hatte nämlich noch nicht einmal begonnen, richtig böse Absichten zu haben. Aurelia war während all der Zeit eine so begnadete Zuhörerin gewesen, dass ihn weit mehr als jedes Bubenstück die Erfindung immer neuer Geschichten faszinierte. Sie konnte sich anscheinend nicht satthören an seinen Erzählungen, und er konnte sich nicht sattschauen an ihren Augen. Und wenn sie miteinander schliefen, war ihm, als stiege er hinab zum Grund ihres Staunens, der ganz erfüllt war von dem Satz: Marcel Kreissel ist wunderbar.
Er hatte sich zwar schon Jahrzehnte an seine Wirkung auf Frauen gewöhnt, denn diese war die Basis seiner Geschäfte. Aber durch Aurelia hatte ihn erstmals ein Echo dieser Wirkung erreicht, das ihn selbst betörte.
Im innigen Anschauen ihres innigen Schauens erfuhr er, ohne dass er sich dessen bewusst wurde, eine Läuterung und verlor so zuletzt das Um und Auf des idealen schlechten Kerls: das kalte Blut. Es war eine Katastrophe, und das Erscheinen Oskar Sameks offenbarte sie aller Welt und Halbwelt.
Was bringt einen Menschen dazu, sich brüsk von jemandem abzuwenden, der ihm nicht nur nichts getan hat, sondern ihm bislang als Heiligstes und Weltenmittelpunkt galt? Die lachhaftesten und die erhabensten Gründe sind es, müsste man antworten. In unserem Fall war es ganz einfach Aurelias Entdeckung dessen, was Marcel Kreissel auch an ihr entdeckt hatte: die kolossale Wirkung, die andere von sich selbst durch ihre Wirkung auf sie empfanden. Sie begriff, dass sie einen Schatz besaß, und nun wollte sie ihn auch unter die Leute bringen. Mit Nymphomanie hatte dies nichts zu tun. Schon deswegen nicht, weil Aurelia ja erst beim Oskar Samek angelangt war und noch gar nicht wusste, dass sie den eines Tages bloß als Auftakt erinnern würde.
Der Marcel Kreissel aber war nicht fähig, sich mit der Einsicht zu bescheiden, dass er in einer jungen Italienerin schlafende Löwen geweckt hatte. Er beharrte auf dem Unerfüllbaren: Alles sollte sein, wie es war, ehe es anders wurde. Um die Erfüllung dieses Wunsches betete er sogar zu Gott, von dem er, wie wir wissen, glaubte, dass es ihn entweder nicht gab, oder dem, falls es ihn doch gab, die Schicksale betrogener Mädchen und Frauen gleichgültig waren. Doch Gott schienen auch die Schicksale geläuterter schlechter Kerln gleichgültig zu sein.
Und Marcel Kreissel lernte die peinigende Benommenheit des eifersüchtigen Verlassenen kennen. Wie man mit einem einzigen Daumen den Augen die riesige Sonne verdecken kann, so verdeckte ihm die Eifersucht die ganze Welt. Nichts blieb ihm als ein unaufhörliches Sehnen nach Aurelia, das ihn überwucherte und durch sein Gewicht zu erdrücken drohte. Noch immer glaubte er, die Geliebte einholen zu können, aber zu diesem Verlust an Realität gehört gewöhnlich auch die Fehleinschätzung der Reisegeschwindigkeit einer sich entfernenden Person. Man wähnt sie noch erreichbar, wenn sie schon hinter dem Horizont Feste ausrichtet, in denen der Name des Verlassenen nicht mehr den Schimmer einer Bedeutung hat.
(1987)
Die Frau in der Tür zum Park
Ich will es nicht mehr haben. Es macht mich kaputt. Es schlägt mich in Scherben. Gestern Mittag war ich so müde, dass ich grundlos lachen musste. Mein Gesicht hat mit mir plötzlich gemacht, was es wollte. Das kommt vom vielen Unentschlossensein.
Nichts strengt mehr an, als ohne Entscheidung zu leben. Man hat bald keine Mitte mehr und muss immer geschickter balancieren, um nicht zu stürzen. Aber woher soll das Eindeutige kommen? Ich wünschte, man könnte in ein Geschäft gehen und eine Bestellung auf einen klaren Kopf machen. Ein Entweder/Oder brauch ich, aber alles, was ich denken kann, ist sowohl/als auch.
Weil es wahr ist: Der eine ist ein Glück für mich und der andere ist ein Glück. Und doppeltes Glück macht einen offenbar unglücklich. Gott selber hat sich nie entscheiden können und alles in tausend Variationen geschaffen. Wenn man sich nur die Tiefseefische im »Haus des Meeres« anschaut, weiß man schon ganz genau, was für einer Gott ist.
Und ausgerechnet ich soll sagen: Der ist es. Aus Milliarden Männern nur der. Ich weiß nicht, ob man wirklich zwei lieben kann, aber es zerrt ja nicht nur die Liebe an einem herum, es gibt ja auch noch die Vertrautheit und die Moral und den Kleinmut und die Rücksichten und die Vernunft.
Ich hab ja nicht leichtfertig geheiratet, sondern mit dem Willen zur Ewigkeit. Er war mir ja alles und mehr. Und seine Hände waren die zärtlichsten, und wenn er geschwiegen hat, war es noch interessanter als die verrücktesten Geschichten der anderen.
Und jetzt, wenn ich etwas unterschreiben muss, stört es mich ein wenig, dass ich seinen Namen trag, den ich mir früher so gewünscht habe. Es ist eine Schande, wie kurz manchmal die Ewigkeit ist. Wie kann ich mir noch jemals vertrauen, wenn mein Urteil, für das ich Jahre überlegen konnte, nicht standgehalten hat.
Der andere ist sich so unbeirrbar sicher, und das gefällt mir an ihm. Das und seine Grenzenlosigkeit. Er hat keinen endgültigen Umriss und doch nichts Ungefähres. Man schaut bei ihm in eine große Kraft, die auch etwas Furchterregendes hat, weil sie das Ende jeder Bequemlichkeit ist. Aber womöglich sind die Geliebten alle so, ehe man sich ganz für sie entscheidet. Vielleicht ist das ihr Lockmittel, das nur im Unentschiedenen gedeiht.
Es ist wirklich nicht leicht. Zuerst habe ich immer das Gefühl gehabt, meinen Mann mit dem anderen zu betrügen, und jetzt weiß ich manchmal schon, dass ich den anderen mit meinem Mann betrüge.
Was sind das überhaupt für Wörter: der andere und mein Mann. Beide sind mir ganz nahe und immer wieder, Augenblicke später, ganz fremd. Die Wahrheit ist, der Geliebte ist mir öfter fremd als mein Mann. Ich kenne ihn ja auch um fünf Jahre kürzer.
Das Fremdsein hat aber auch sein Gutes. Auf vieles ist man ganz unvorbereitet und lernt sich selber in neuen Situationen kennen. Das Fremde ist immer die Voraussetzung für das Abenteuerliche, und ohne das Abenteuer habe ich kein frohes Herz. Trotzdem bekomme ich oft mitten im Abenteuer Heimweh. Ich glaube, nur wenn mir ein Mensch begegnet, der das Vertraute mit dem Abenteuer in Einklang bringen kann, werde ich gerettet sein.
So leicht ist das und so schwer.
Vielleicht sollte ich einmal wirklich frei sein. Ich bin ja immer von einer Abhängigkeit zur nächsten gelangt. Von den Eltern zu den Freunden, von den Freunden zu den Verlobten, von den Verlobten zum Ehemann und jetzt von ihm zum Geliebten.
Ich habe das Alleinsein nie gelernt. Immer nur gefürchtet, dass Alleinsein Einsamkeit bedeutet. Aber bewiesen hab ich mir das nicht. Meine Schwester behauptet, dass man auf das Alleinsein süchtig werden kann. Man ist sich mit einem ständigen Partner gar nicht bewusst, aus wie viel Rücksichtnahmen und Selbstverleugnungen vierundzwanzig Stunden bestehen, sagt sie.
Und wenn sich die Persönlichkeiten unterschiedlich entwickeln, empfindet das der andere immer als Verrat an einer Übereinkunft, für deren Garantie nur ein Idiot die Verantwortung hätte übernehmen können. Dann beginnen die meisten, ihre seelischen Bedürfnisse zu verheimlichen, oder sie verwirklichen sie auf Kosten des anderen. Sagt meine Schwester. Aber die hat eine sehr große Nase und ist ziemlich dick, und es könnte auch der Fuchs aus ihr sprechen, dem die Trauben zu hoch hängen.
Gute Ratschläge sind allesamt einen Dreck wert. Man muss sich auf das Spüren verlassen. Wenn es nur nicht so viele Arten von Spüren gäbe. Das Spüren beim Aufwachen, und er schläft noch neben einem und ist absichtslos und staunt seine späten Träume an. Das Spüren, kurz ehe man jemand wiedersehen wird, den man lange vermisst hat. Und man stellt sich den Klang seiner Schritte vor und die vertraute Bewegung mit der Hand über die Stirne. Das Spüren, wenn man im Theater mit dem Ehemann einige Reihen entfernt vom Geliebten sitzt, und der Hauptdarsteller sagt jene Sätze, die der Geliebte gestern Abend nach Erwähnung des Stückes zitiert hat. Das Spüren. Das Spüren. Das Spüren, wenn man weiß, es ist endgültig vorbei, und das Spüren zwei Minuten später, wenn man weiß, es wird niemals vorbei sein, nicht vor dem letzten Atemzug. Das Spüren. Das Spüren schlägt Haken. Das Spüren ist launenhaft. Und doch, es muss ein Gefühl geben, das unantastbar ist, unbesiegbar, unbeirrbar, unaufschiebbar.
Ich weiß nicht, ob man darüber gar nicht nachdenken soll, weil es mit dem richtigen Menschen ohnedies von selbst kommt. Holt es einen gewissermaßen ab, oder muss man aus großer Höhe springen, um es je berühren zu können? Ist Springen fahrlässig oder notwendig? Man weiß es erst nachher, wenn es dann überhaupt ein Nachher gibt. Ich kenn nämlich einige, die ihren Mut nicht überlebt haben. Das heißt, sie haben weitergelebt, aber irgendwie waren sie innerlich durch die Wucht der Enttäuschung ausgelöscht. Wie ein Spieler, der alles, aber auch wirklich alles, auf eine Zahl gesetzt hat, und es kommt eine andere. Oder noch schlimmer: Er bemerkt, wie das Kasino ihm seine Chance durch Betrug vorenthält. Oder am allerschlimmsten: Er verwechselt in Trance die Spiele. Roulettegemäß hat er sich verhalten, aber was tatsächlich stattfand, waren Hunderennen.
Ich glaub, ich will jetzt nur meinen Mut entmutigen. Aber hab ich ihn überhaupt? Meinen Mut? Meine Ängste sind ganz meine eigenen, das weiß ich. Beim Mut bin ich mir nicht sicher, dass ich nicht nur den hab, den er mir macht. Er ist ja scheinbar ein Mutmilliardär, der Herr Geliebte. Und dann auch wieder gar nicht. Manchmal versteinert er für Stunden und traut sich und uns gar nichts zu. Wer nicht von Zeit zu Zeit alles in Frage stellt, sagt er, hat bald weder sinnvolle Fragen noch die geringste Chance auf eine nützliche Antwort.
Mein Mann ist da berechenbarer. Das hat viel Beruhigendes. Vielleicht ist er auch das, was man eine gefestigtere Persönlichkeit nennt. Bei ihm baut man auf sicherem Grund. Aber vom Grundstück des anderen hat man die schönere Aussicht.
Alles ist ungerecht, was ich denke.
(1989)
Der Sprung in den Himmel
Ramón war der schwierigste Fall in der psychiatrischen Klinik von Cádiz. Niemand, nicht einmal der Direktor des Instituts, sagte übrigens psychiatrische Klinik, alle verwendeten noch das Wort Irrenhaus. Von den Patienten sprachen sie als Vulkane. Erloschene, ruhende oder tätige Vulkane.
Ramón war immerzu tätig. Er spie seine inneren Zustände, seine Gewissheiten und Vermutungen, in jedem wachen Augenblick aus, und kein Medikament brachte die Uhr seiner Rasereien zum Stehen. Natürlich bändigten bestimmte Drogen vorübergehend seine Motorik, seinen Redefluss, sein Wutgetöse, aber nur in dem Sinn, wie ein Deckel den Dampf einsperrt, bis er vom Überdruck weggeschleudert wird. Höhere Dosierungen hätte Ramóns Körper nicht entgiften können, und so wirkte er inmitten der anhaltenden Mattheit und Langsamkeit der anderen Patienten häufig, als wäre er der Stellvertreter all ihrer Lebendigkeiten.
Ramóns Leiden war, dass er unter dem Eindruck stand, Hunderte Male am Tag neu gefaltet zu werden. Wie ein Blatt Papier oder eine Serviette, deren sich die Hände eines Hypernervösen bemächtigt hatten. Überall spürte er unangenehme Knicke und sehnte sich nach nichts mehr als nach vollkommener, unangetasteter Glätte. Als Verursacher kamen für ihn entweder Bewohner der Gischt des nahen Meeres oder ein gewisser Louis del Monte infrage. Oft hatte Ramón schon darum gebeten, tiefer ins Landesinnere gebracht zu werden, wenn möglich nach Sevilla, weil der lange Arm der Gischtgeister nicht so weit reichen konnte und auch der Getreidehändler del Monte dort keine Interessen besaß. Aber die Ärzte wiesen seine Wünsche ab, und manchmal dachte er, sie stünden im Sold seiner Quäler. Dann schrieb Ramón Briefe an die Königin von Spanien, deren Herzensgüte über jedem Gesetz und selbst über der Allmacht der Ärzte stand, und erflehte ihren Beistand. Aber er erhielt nie Antwort, und daran waren mit Sicherheit wieder die Gischtgeister oder del Monte schuld, die, wie er vermutete, in der Umgebung der Anstalt Fallgruben für Briefträger errichtet hatten.
Dreizehn Jahre dauerte dieser schreckliche Zustand bereits. Anfänglich waren noch seine Eltern auf Besuch gekommen, später nur mehr die Schwester, dann löste sich alle Verwandtschaft in Luft auf. Er roch sie nur noch gelegentlich, wenn der Wind aus Richtung Afrika blies. Was sie dort zu schaffen hatten, war ihm ein Rätsel. Ebenso, warum alle Speisen nach Wermut schmeckten. Oder warum er immer deutlich den ganzen Mond sah, auch wenn der laut Kalender im Ab- oder Zunehmen begriffen war. Unmöglich, dass ihm seine Einbildung Streiche spielte, und noch dazu größtenteils traurige. Dass es unterschiedliche Wirklichkeiten gab, konnte er gelten lassen. Die Ärzte aber dachten nicht so. Ihr Beruf bestand aus dem steten Versuch, ihn ganz in ihre Wirklichkeit zu holen und dort zu verankern. Es musste ihm gelingen, ihnen für immer zu entschlüpfen.
Also suchte Ramón Rat bei den glitschigen Dingen. Stundenlang betrachtete und betastete er nasse Fische, Seifen und Schmieröl. Mit Letzterem bedeckte er dann eines Nachts seinen Körper und fing zu lärmen an, bis die Pfleger alarmiert herbeirannten.
»Ich entschlüpfe euch«, schrie er, »es gibt kein Halten mehr!«
Aber sie warfen eine Decke über ihn und verschnürten das zuckende Bündel, und bald war wieder alles beim Alten.
Monate vergingen, und die Hitze Andalusiens kochte die Eier in den Ärschen der Hennen, wie der Kaplan zu sagen pflegte. Viele Patienten rieben den Rücken an den kühlen Wänden des ehemaligen Klosters, das sie bewohnten. Einer rieb sich blutig und hinterließ auf dem Mauerkalk ein seltsames rötliches Bild, das Ramón als Schlüssel deutete.
Damit werde ich das Paradies aufsperren, dachte er.
Aber weder wusste er, wo das Paradies war, noch, wie er den Schlüssel materialisieren konnte. Er schlug mit dem Kopf an das Fresko und hoffte, es auf diese Art in sich zu übertragen. Es misslang. Dann kratzte er es von der Wand und aß es, und es war das Erste seit einer halben Ewigkeit, das nicht nach Wermut schmeckte.
Der Schlüssel selbst ist das Paradies, dachte er.
Sein nächster Einfall war, sich mittels des Paradieses abzuschließen. Er machte ein paar drehende Handbewegungen über den Augen, den Ohren, dem Mund und der Nase. Jetzt hatte ihn der Schlüssel vollends von der Welt der anderen getrennt.
»Hoffentlich ist es so«, seufzte er.
Ramón wartete, ob man ihn falte, aber nichts dergleichen geschah. Auch andere Patienten waren nicht zu bemerken. Auch die Ärzte und Pfleger gab es nicht mehr. Er misstraute dem Glück und zählte langsam bis zehntausend. Dann erst begann er die Wandlung zu glauben. Ganz in sich und bei sich war er. Den Paradiesschlüssel, oder besser das Schlüsselparadies, musste ihm die Königin von Spanien über geheime Wege gesandt haben. Er wollte ihr augenblicklich einen Dankbarkeitssaal in seinem Körper errichten. Am besten gleich neben der Milz. Und in der Leber würde er künftig eine Sternwarte betreiben und geduldig in seinen Adern reisen, bis er die entferntesten Winkel seines Reiches kannte, vom Scheitel bis zur Sohle. Schon zündete Ramón die Lichter im Dankbarkeitssaal an. Sie brachen sich in den zahllosen Facetten der geschliffenen Spiegel, die den Raum begrenzten.
Aus jedem Blickwinkel bemerkte er die grotesk verzerrte Königin, die sich herabließ, persönlich sein Geschenk zu inspizieren. Von überall streckten sich ihm ihre mit Seidenbändern umwickelten Finger entgegen. Er küsste sie und küsste sie immer wieder aufs Neue, bis die Lichter verloschen. Dann versetzte ihn die Regelmäßigkeit seines Pulsschlags in Trance und seine Kindheit stieg aus der Vergangenheit. In einem einzigen Erlebnis war sie zusammengefasst, und dieses Erlebnis wiederholte sich, als wäre jetzt damals und damals jetzt:
Mit seinem Vater sitzt er auf einer der Steinbänke der kleinen Stierkampfarena seines Heimatortes. Eine Begeisterung hat die anderen Zuschauer erfasst, der Ramón noch nie begegnet ist. Sie werfen Hüte und Kappen in die Luft. Sie umarmen einander. Sie rufen Worte, deren Bedeutung ihm fremd ist. Plötzlich brausen sie auf. Es klingt wie Sturm, der in Tausende Wäschestücke fährt. Er hält sich die Ohren zu. Sein Vater reißt ihn an den Haaren.
»Schau hin, du Idiot! Versäume keinen Bruchteil eines Bruchteils! Dort unten, in der Arena, kämpft El Cordobes, der Liebling der Heiligen, der Tapferste und Geschmeidigste seit Manolete. In seinen Venen fließt Stierblut, darum ahnt er die Reaktionen der Bullen besser als jeder andere Sterbliche. Die Heiligen haben ihm Stierblut verliehen, weil er sich der Ehre Gottes vermählt hat. Verstehst du, du Idiot.«
»Ich verstehe nicht, Vater«, antwortet Ramón.
Im selben Moment wird der bestickte Mann, dem die Anbetung seines Vaters gehört, von den Hörnern des Stieres erfasst und hochgeschleudert, und alle Geräusche verstummen. Er sieht, wie El Cordobes höher und höher steigt. Das Blut des Matadors regnet aus zwei funkelnden Wunden auf die Arena, und Ramóns Vater sammelt es größtenteils in seinen Strohhut. Der Held steigt weiter empor und direkt in die Ehre Gottes, und Ramón sieht es und wird davon geblendet. Eine Woche später vertraut man ihn der Anstalt am Campo Verde an. Das Weinen seiner Mutter, monoton und von Wimmern begleitet, ist das letzte Zeichen, das er der Kindheit zurechnet.