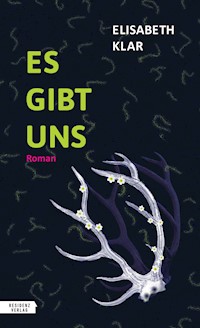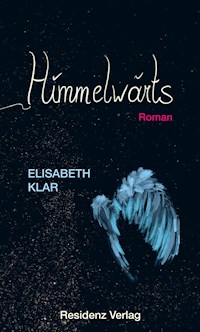Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karin lebt mit ihrem Freund Alexander in dem Haus am Waldrand. Auch ihre Pflegeschwester Lisa hat da früher gelebt, ebenso wie die Eltern August und Inge, die Geschwister Margarethe und Peter. Damals waren Karin und Lisa glücklich, sie sind gewachsen wie wilde Brombeersträucher, sind Hand in Hand zum Grund des Sees getaucht und haben sich in engen Wurzelhöhlen versteckt. Dann ist etwas geschehen, August ist tot und das Pflegekind wurde verstoßen. Jahre später holt Karin Lisa zurück und die beiden verstricken sich in ein ebenso verstörendes wie betörendes Spiel, sie geraten in einen Sog von Abhängigkeit, Anziehung und Abstoßung, der uns bis zur letzten Seite in seinen Bann schlägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elisabeth Klar
Wie im Wald
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2014 Residenz Verlag
im Niederösterreichischen Pressehaus
Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
St. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN eBook:
978-3-7017-4479-4
ISBN Printausgabe:
978-3-7017-1636-4
Contents
Kapitel I
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
Kapitel II
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
Kapitel 12.
Kapitel 13.
Kapitel 14.
Kapitel 15.
Kapitel III
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
Kapitel 12.
Kapitel 13.
Kapitel 14.
Kapitel 15.
Kapitel 16.
Kapitel 17.
Kapitel 18.
Kapitel 19.
Kapitel 20.
Kapitel 21.
Kapitel 22.
Kapitel 23.
Kapitel 24.
Kapitel IV
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
Kapitel 12.
Kapitel 13.
Kapitel 14.
Kapitel 15.
Kapitel 16.
Kapitel 17.
I
1.
Sie hat Ja gesagt. Und dass Lisa etwas zu mir sagt, noch dazu »Ja« sagt, mir zustimmt, damit habe ich nicht rechnen können. Ich fahre und blicke auf die Straße und sie sitzt neben mir, von mir angegurtet, hat gesagt: Ja.
Karin sieht auf die Straße, ich habe ihre Hand die meine nehmen lassen, kalte Finger, die meine umschließen. Jetzt halten ihre Hände das Lenkrad, ich sehe aus dem Seitenfenster auf den vorbeiziehenden Wald. Ja, ganz ohne Umschweife habe ich Ja gesagt, zu allem und Ja zu ihrer Frage, ob ich wieder bei ihr wohnen wolle. Ich fahre zum Haus zurück, sehe aus dem Seitenfenster auf den Wald, habe Ja gesagt, und genau deshalb ist auch alles, was geschehen ist, seitdem ich von diesem Haus weggegangen bin, bloß ein Seitenfenster, mehr ist es nicht.
»Nach all dem, was geschehen ist«, sagt Grete, sie hat extra aus London angerufen, und das nur, um eine abgegriffene Phrase wie ein abgetragenes Kleid an mich loszuwerden. Und ich stimme ihr gleich zu, sage: »Genau, nach all dem, was geschehen ist, nach all den langen Jahren.« »Woher kommt das?«, fragt Grete dann, »Woher kommt das denn? Das kommt ja völlig aus dem Nichts.« Ich lache. »Von nichts kommt nichts«, sage ich und lache darüber, dass unsere Familie immer so überrascht ist von all dem, was ihr widerfährt und was sich doch längst angekündigt hat.
Von Lisas Weglaufen damals sind sie auch überrascht gewesen und überrascht darüber, dass Papa dann auch gegangen ist, von ganz allein und aus freiem Willen, und auch meine Entscheidung hat sich lange vorbereitet, ist aufgegangen wie Kuchenteig und hat gewartet, dass man mit der Stricknadel hineinsticht, um zu sehen, ob noch etwas anderes an ihr klebt.
Dann lenke ich das Auto über die Landstraße durch den Wald und später über die Autobahn und würde gerne wissen: Als man Lisa gefragt hat, ob sie einverstanden sei, mich wieder zu sehen, ist sie da auch überrascht gewesen? Ich weiß es nicht und außerdem hat sie, so sagte man mir, auch sofort zugestimmt, hat sofort gesagt: Ja.
Ich habe sofort Ja gesagt, als Julian gemeint hat, dass Karin mich gerne besuchen würde und ob ich das denn auch wolle: Ja. »Karin und du, ihr habt euch lange nicht gesehen«, hat er gesagt, und ich habe Ja gesagt. »Und du willst sie wiedersehen?«, hat er gefragt, und ich habe gesagt: Ja.
Und als der Tag dann kommt, an dem sie mich besucht, und als ich es läuten höre, spüre ich den Jeansstoff an meiner Stirn, an meinen Armen spüre ich den Jeansstoff, ich halte meine Beine umfasst, weil ich schon warte, schon lang. Es ist rau, wenn ich mit den Fingern über die Hose fahre, dann eine Schwelle, sie steigt darüber, über die Türschwelle in die Wohnung, es ist ein enger Zusammendrücken, ich drücke mich enger zusammen, als ich höre, dass sie mich besuchen will. Die Naht, die ich auf der Jeans mit den Fingern ertaste, ist hart und hügelig, ihre Stimme.
Sie fragt: »Lisa?«
Sie geht meinen Schenkel hinauf. Die Naht und Karins Stimme gehen meinen Schenkel hinauf. Ich fahre die Naht entlang und dann dreht sie sich, ändert die Richtung mittendrin. Und Julian meint, es sei Besuch für mich da, und der Jeansstoff ändert seine Richtung, ich fahre über die Kante, sehr hart. Er meint, es sei Karin Ludevik, und ich weiß, wer das ist, und will trotzdem nicht aufsehen, in dem Knick so viel Stoff auf einem Fleck, sehr hart, aber überall auf mein Gesicht gepresst nur Jeansstoff und Wärme.
Sie fragt, ob ich sie denn nicht begrüßen wolle. Unten, unter meinem Arm, sehe ich ihre Hände. Ein bisschen Jacke und ein bisschen Hände. Ob ich es denn gut hier habe. Ob es mir denn an nichts fehle. Weswegen bist du hier, Karin? Sag es ruhig, was du von mir willst. Ich erkenne ihre Hände, es sind dieselben, die ich gehalten habe. Etwas älter, aber ich habe sie gehalten, ganz kalte Finger, von meinen umschlossen.
2.
Alexander wartet nach dem ersten Besuch bei Lisas Wohngemeinschaft daheim auf mich. Er öffnet mir die Haustür, noch bevor ich den Schlüssel umdrehen kann, er begrüßt mich mit einer festen Umarmung. Ich stehe noch vor der Schwelle und er umarmt mich schon.
»Wie ist es gegangen?«, fragt er, als ich mich von ihm befreit habe. Ich gehe an ihm vorbei ins Vorzimmer, schlüpfe aus den Schuhen.
»Ja.«
Ich gehe in die Küche, ich bin hungrig, durstig außerdem. Der Betreuer hat mir gleich zu Beginn Himbeersaft angeboten, nur ist zu viel Sirup darin gewesen, viel zu süß, es ist ein Kindersaft gewesen. Er hat mich auch gleich zu Beginn gebeten, ihn Julian zu nennen, und mich trotzdem weiterhin gesiezt.
»Es ist ganz in Ordnung«, sage ich, klappe den Brotkorb auf. »Ich weiß nur nicht – was macht sie dort, das frage ich mich.«
»Was meinst du?«, fragt Alexander.
»Das ist doch eine Wohngemeinschaft für Behinderte.« Ich öffne den Kühlschrank, hole die Butter. »So habe ich das zumindest verstanden, dass das eine Wohngemeinschaft für Behinderte ist, aber Lisa ist doch nicht behindert. Also was macht sie dann dort? Sogar der Betreuer gibt zu, dass sie zu den anderen nicht passt.«
Eingerollt und keine offene Fläche. Das Einzige, was ich sehe, sind ihre Haare. Nur die blonden, fettigen Haare, die sich aus dem Zopf lösen. Ich schmiere die kühlschrankkalte Butter auf das Brot. Das Messer drückt sich tief in den Teig und er zerreißt. Ich drehe mich um.
»Er sagt natürlich, sie ist eine große Hilfe«, sage ich. »Er sagt, sie kümmert sich um die anderen.«
»Ist das nicht gut?«, fragt Alexander. Er steht an den Türrahmen gelehnt.
»Ich weiß nicht«, sage ich. »Ich meine, was soll das denn? Es ist so, als hätten sie nicht gewusst, wohin mit ihr, also haben sie sie dorthin gesteckt wie abgestellt.«
»Es wird eben überall gespart«, meint er. »Was soll man tun?«
»Ich weiß nicht.«
Ich stehe da, an die Abwasch gelehnt, und halte das Butterbrot in der Hand und weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll. Mir ist schlecht und ich muss an Weihnachten denken.
»Und wie ist es dir mit Lisa gegangen?«
Ihre Arme sind um die Beine verkrampft, ihre Finger fahren die Jeans entlang. Die Finger, die Hände habe ich sofort erkannt.
Im Gehen hatte ich die Hand schon auf der Klinke der Wohnungstüre, da ist der Betreuer noch zwei Schritte auf mich zugekommen. »Dieser Besuch ist sehr wichtig für Lisa gewesen«, hat Julian gesagt. »Ja«, habe ich geantwortet und die bunten Kleiderhaken angesehen, die an der Wand angebracht waren, mit Stickern unter jedem Haken, auf denen in kindlichen Handschriften Namen aufgeschrieben waren, Lisa, Mark, Robert, Uschi.
»Aber es ist auch eine Belastung für sie. Wir müssen es langsam angehen.«
Und ich habe mir überlegt: Hat Lisa hier ihren eigenen Namen hingeschrieben? Aber ich kenne ja ihre Handschrift, und die ist am Ende längst nicht mehr kindlich gewesen. Es ist die Handschrift einer Jugendlichen gewesen – wieso schreibt sie ihren Namen auf den Sticker wie ein Kind?
»Ja«, habe ich gesagt, »auch eine Belastung.«
»Ja«, sage ich auch zu Alexander.
Grete ruft am nächsten Tag aus London an, drängt mich, ich solle doch mit den Großeltern reden, und ich meine, was soll ich denn da reden, was geht es sie denn an? Peter ruft aus Salzburg an, meint, dass Grete ihn aus London angerufen hat, und will wissen, was da vor sich geht, was diese Besuche bei Lisa denn nun bedeuten sollen. Er meint, dass die Sache sehr wohl auch die Großeltern anginge. »Woher kommt das denn?«, fragt er. »Das kommt ja völlig aus dem Nichts.« Alexander will auch, dass ich mit offenen Karten spiele, und ich denke an das Kartenspiel, das ich bei meinem Besuch bei Lisa gespielt habe, und das auch ganz offen gewesen ist. Die Alten würden ja doch nicht mit mir um Lisa schnapsen, weil sie doch wissen, dass ich schummle.
An einem Montagmorgen trinke ich dann mit den Alten Kaffee und überlege dabei, wie und wann ich ihnen meine Pläne mitteilen soll. Es ist ein Montagmorgen, weil ich keine Bürozeiten habe, die die Großeltern daran hindern könnten, auch unter der Woche Besuche zu wünschen. Die Futterschüssel von Inges alter Katze steht leergefressen neben dem Kühlschrank, die Katze ist wie immer nicht zu sehen, die Sonne scheint hart auf den Küchentisch und auf die halbleere Maresi, wir trinken aus Tassen mit Zwiebelmuster. Die Maresi macht den Kaffee süß und am liebsten würde ich mir die Flasche direkt an die Lippen setzen. Opa, Oma und ich sitzen um drei Tischecken, die Oma hat eine Hand auf Opas Hand gelegt und redet, und ihr Gespräch rutscht so leicht zu August, wie Omas Hand auf die des Großvaters rutscht, so leicht wie die Reifen meines Autos in die Fahrrinnen rutschen. Würde ich etwas an diesen Fahrrinnen ändern, wenn ich die halbleere Flasche Maresi an die Lippen setzen würde? Aber ich trau mich ja doch nie, weil Oma jetzt über das Grab redet, das schon wieder voller Laub und Dreck ist und nicht sauber, wie es stattdessen sein sollte, und das, obwohl sie für die Grabpflege ein Vermögen zahlen und auch immer Trinkgeld geben, wenn sie einen der Friedhofsarbeiter treffen, und sie können auch nicht so oft dorthin, weil sie doch beide so kaputte Hüften und so kaputte Rücken haben. Und diese Friedhofsarbeiter reinigen Augusts Grab bestimmt absichtlich nicht so gründlich wie die anderen, machen ihnen das bestimmt zu Fleiß, und wann werden all die bösen Zungen endlich aufhören, August in dünne Streifen von Lügen zu schneiden?
»Es könnte sich auch einmal jemand anderer darum kümmern, dass das in Ordnung kommt«, sagt der Opa und meint damit mich, weil kein anderes Familienmitglied nahe genug wohnt, um regelmäßig hinzufahren.
»Ich habe viel zu tun«, sage ich.
»Du bist doch zuhause«, sagt Oma.
»Ich arbeite zuhause«, sage ich.
»Da muss man sich wirklich schämen, wie das aussieht, Augusts Grab.«
Oma sagt Augusts Grab, obwohl natürlich auch Inge darin liegt. Und ich frage mich, wenn nicht einmal Inges Name in Omas Satz über das Elterngrab passt, obwohl Inges Name nicht viel Platz verbraucht, wie soll man dann Lisa hier noch unterbringen? Und ich frage mich, wenn ich nicht einmal die Maresi aus der Flasche trinken kann, wie soll man dann Lisa noch hereinquetschen, die hier schon nicht Platz gefunden hat, als ihr Körper noch viel weniger davon verbrauchte – inzwischen ist er ja gewachsen? Und wie soll ihr Kartenspiel hier hereinpassen, diese Mischung aus Schwarzer Peter, Schnapsen, Uno, Quartett, dessen Regeln ich nicht verstehe.
Die Regeln sind einfach: Senke den Kopf. Weiche zurück, wenn Karin dich berührt, aber nicht zu viel. Zeige ihr deinen Nacken, nicht dein Gesicht. Fahre mit den Kanten der abgegriffenen Karten über deine Lippen, die Kanten sind weich und werden mit jedem Mal weicher. Lass sie deine Hand nehmen, aber drehe dich dabei weg. Während deine Finger die Steppdecke greifen, erzählt Karin dir von einem fremden Mann, der Alexander heißt, und der ihr gehört. Du brauchst nicht zu antworten. Jedes Mal, wenn du sprichst, könntest du fallen. Nicht jedes Mal fällst du in Julians Arme.
»In diesem Raum«, sagt Julian, als wir wieder alleine sind, »kannst du alles sagen«, und er zeigt um sich.
Ich weiß. In diesem Raum sind zwei gepolsterte Sessel, man kann darauf sitzen, den Kopf nach hinten fallen lassen und er findet eine Stütze. Man kann den Polsterstoff begreifen, er ist rau unter meinen Fingern. In diesem Raum sitzen Handpuppen auf den Regalen, und auf dem Regalbrett gleich neben der Tür die offene Nussschale mit dem Plastikkäfer darin. Er ist auf eine Metallfeder geklebt, und er zittert leicht, wenn man die Nussschale auch nur berührt. Dieser Raum ist abgeschlossen, die Wände legen sich fest um die Stimmen und lassen sie nicht hinaus, das Fenster ist zu, da ist nur Julian, und da bin ich. In diesem Raum kann ich meinen Mund öffnen, und was herauskommt, flutet das Parkett wie ein Bassin. Der Raum, in den Karin tritt, muss erst geöffnet werden, und gemeinsam mit ihr treten Regeln ein, von denen keine vorsieht, dass ich spreche.
3.
Aber Lisa sagt schließlich etwas. Das ist es, womit ich nicht gerechnet habe. Deswegen sitze ich jetzt hier und Lisa sitzt neben mir und blickt aus dem Seitenfenster des Autos. Deswegen sitze ich hier und sehe ihr zu, wie sie packt. Sehe ihr zu, wie sie an mir vorübergeht, von einer Ecke des Zimmers in die andere, mit gesenktem Kopf, und wieder zurück, und Sachen einsammelt und wieder verteilt und zu keinem Ende kommt. Deswegen liege ich davor noch im Bett und blicke Alexander an und er blickt zurück.
»Die Wohngemeinschaft ist nicht gut für sie«, sage ich noch einmal. Ich weiß nicht, wie oft ich es in den letzten Monaten gesagt habe. Jedes Mal die Handtasche nehmen, nach hinten auf den Rücksitz werfen, die Zündung starten, durch den Wald fahren, in die Stadt. Jedes Mal Julian begrüßen, Lisa begrüßen, mit Lisa Karten spielen, den Kindersaft trinken, den Supermarkt-Kuchen essen, mit Julian sprechen. Jedes Mal zurückkommen und jedes Mal sagen: Diese Wohngemeinschaft ist nicht gut für sie. Es ist zur Routine geworden.
»Ja«, antwortet er noch einmal.
»Sie sehnt sich auch nach dem Wald zurück«, sage ich. »Da bin ich mir sicher.«
»Soll sie uns denn mal besuchen?«, fragt er.
»Das würde doch nichts ändern«, sage ich. »Was würde das denn ändern?«
»Ja«, sagt er. »Was soll man denn da tun?«
Er fragt es, als gäbe es tatsächlich nichts zu tun. Er fragt es, als hätten wir alle unsere Möglichkeiten ausgeschöpft, ihr zu helfen.
»Man müsste sie eben auf Dauer nehmen.«
Er antwortet nicht gleich.
»Du meinst das doch nicht ernst«, sagt er dann.
Wird er denn jetzt auch noch überrascht sein, so wie alle anderen in der Familie? Er müsste es doch besser wissen.
»Du selbst hast gesagt, ich sollte wieder Kontakt mit ihr aufnehmen«, sage ich schließlich. »Die Wohngemeinschaft ist nicht gut für sie. Du hast mich gefragt, was man machen soll. Ich weiß, was ich machen kann.«
Alexander dreht sich auf den Rücken.
»Ja«, sagt er. »Ich meine …«
Eine Zeit lang ist es still. Ich weiß, dass er dabei ist, aufzugeben, und störe ihn nicht dabei. Wir küssen uns und schlafen miteinander und schlafen ineinander und am nächsten Morgen sagt er: »In Ordnung.« »In Ordnung«, wiederholt er noch einmal für sich.
Und es stimmt auch, dass er es war, der mich immer wieder bestärkt hat, »schau doch«, hat er gesagt, »all das ist lange her«. Und er hat recht. Doch gleichzeitig, als ich Lisa besuche und sie die Karten auf dem Bett herumschiebt, scheint es mir nicht lange her, dass wir gemeinsam auf dem Boden unseres Zimmers gesessen sind. Lisa deckt eine Karte auf und eine andere zu, und mir scheint der Zimmerboden von damals sogar auf dem versiegelten Parkett der Wohngemeinschaft noch leicht greifbar. Lisa ist mir leicht greifbar, Lisa, die die Maresi-Flasche an die Lippen gesetzt und getrunken hat und gesagt hat, das schmeckt viel besser als frische Milch, glaub mir. Wir haben die Maresi-Flaschen aus dem Keller gestohlen. Das Flaschenglas ist kalt gewesen, die Milch darin auch und süßsauer, als wäre sie etwas verdorben. Wir haben in unserem Zimmer die Maresi-Flasche herumgereicht, als wäre es Vodka. Und all die Jahre dazwischen, was ist mit denen? Wie eine Feder haben sich diese Jahre gespannt.
Julian ist auch überrascht von meinem und Lisas Wunsch, außerdem ist er dagegen.
»Es gibt noch so viel zwischen Ihnen zu klären«, sagt er, und wieso so früh und im selben Haus, das ist schwierig. Das alles ist endlos schwer, bevor es angefangen hat, denke ich. »Ich denke, dass wir beide lange genug gewartet haben«, sage ich, und was soll ich denn tun, ich kann doch nicht einfach das Haus aufgeben, bloß weil es das Elternhaus war, das ist doch Unsinn. Dabei ist es noch dazu ein so leicht zu erhaltendes Haus, weil August es gebaut hat, er hat Material von guter Qualität genommen, Jahrhunderte sollte dieses Haus stehen.
»Aber wieso nicht einfach die Besuche aufrecht erhalten?«, fragt Julian. »Wieso Sie beide wieder diesem Szenario aussetzen, wieso riskieren, dass es ihr wieder schlechter geht?«
Im Grunde ist es mir egal, dass er nicht einverstanden ist. Wir wissen beide, dass nur Lisa darüber entscheiden kann, was mit ihr passiert. Was soll ich mir denn von ihm vorwerfen lassen?
Zu tun gibt es immer etwas bei einem Schwimmteich, in dem kein Chlor das Wasser totfärbt. Ich hocke auf dem Steg mit dem Algennetz an einer langen Stange und fange damit ein, was an die Wasseroberfläche treibt und sich sonst beim Schwimmen im Badeanzug verfangen würde. Die Algen, die sich im Wasser schwerelos zerteilen, sacken zusammen, sobald das Netz sie hebt. Sie fallen ins Gras, in das ich sie kippe, am Rand des Teiches, wo sie in der Sonne trocknen werden. Die Wurzeln der Seerosen haben die Kübel längst durchbrochen, ihre Blätter bedecken einen großen Teil des Schwimmteiches und ich denke, dass ich sie wohl bald wieder stutzen muss. Alexander setzt sich neben mich, er lässt die nackten Füße ins Wasser zwischen ein paar Algenfäden hängen.
»Diese blöden Seerosen«, sage ich. »Mein Vater hätte die niemals einsetzen dürfen, die werden wir jetzt nie wieder los.«
Alexander meint, wahrscheinlich nicht, nein, aber irgendwie gefielen ihm diese Pflanzen, deren Wurzeln einfach durch die Kübel brechen. Er weiß ja nicht, wie sich die Wurzeln durch die Folie in den Boden fressen.
»Ich möchte es mit Lisa zumindest versuchen«, sage ich. Alexander bewegt seine Füße im Wasser.
»Ich weiß«, sagt er dann, »wir haben doch eh schon darüber geredet. Ich habe doch eh schon zugestimmt.«
Ich nicke. »Sie gehört hierher«, sage ich, weil es stimmt.
Grete meint vielleicht, sie müsse Lisa nicht mehr Schwester nennen, nicht nach all den Jahren. Aber Grete hat ihr Zimmer auch nicht mit Lisa geteilt. Man kann noch immer die Spuren von Lisas Nägeln im Parkett nachfahren. Und ich könnte noch so oft aussortieren, ich würde immer noch Sachen finden, die einmal ihr gehört haben. Das ist ein Gehölz, unser Zimmer, und ihre und meine Äste haben sich dort ineinander versperrt.
»Ich verstehe nicht, warum das notwendig ist«, sagt Grete aus dem Telefonhörer, weil sie meint, sie müsse Lisa nicht mehr ihre Schwester nennen. Sie ist dagegen, dass ich Lisa besuche, von meinen anderen Plänen weiß sie noch gar nichts. »Warum jetzt auf einmal, nach all den Jahren? Ihr seid doch lange genug ohne einander ausgekommen.«
All die Jahre haben sich wie eine Feder gespannt. Ich verstehe nicht, warum das notwendig war, die Jahre wie eine Feder zu spannen.
4.
Deswegen sitze ich jetzt in Lisas Zimmer auf einem Stuhl und warte, dass Lisa fertig ist mit dem Packen, damit wir ihre Sachen nehmen und heimfahren können, endlich. Ich habe die Jacke nicht ausgezogen und halte meine Handtasche auf dem Schoß fest im Durcheinander ihres Abschieds.
Für die Ruhe, die wir endlich haben, hat Julian gesorgt. Er ist gekommen und hat Uschi hinausgetrieben, mit ihren dicken Brillengläsern und der Zunge, die sich immerzu vorgeschoben hat aus ihrem Mund. Und bis Julian sie endlich gefragt hat, ob sie ihm nicht beim Kochen helfen wolle, und bis er endlich die Tür hinter Lisa und mir geschlossen und versperrt hat, ist Uschi immerzu im Zimmer umhergegangen und hat alles, was Lisa in die Reisetasche gelegt hat, wieder herausgenommen. Und dann hat sie Lisas rosa Weste genommen und gesagt: »Das ist meins«, und Lisa hat nur genickt, und dann hat sie Lisas Robbe genommen und gemeint: »Das ist meins«, und Lisa ist bloß dagestanden und hat nichts dazu gesagt. Ich hätte Uschi am liebsten selbst die Robbe aus den Armen gerissen. Jetzt höre ich sie im Nebenzimmer heulen, und ich denke, dass sich die ganz genau hat ausrechnen können, dass Lisa sich nicht gegen sie wehren würde. Das sieht man doch gleich, dass Lisa eine ist, die sich nicht wehren wird. Lisas rosa Weste liegt zusammengelegt in der Reisetasche, Lisa nimmt sie gerade wieder heraus.
Sie besitzt nicht viel, und was sie besitzt, stapelt sie und legt es wieder weg und stapelt es neu und gibt es in die Reisetasche, legt es wieder auf das Bett, als stünde ihre Entscheidung noch nicht fest. Das Kartenspiel, das ich mit ihr so oft in den letzten Monaten gespielt habe, und dessen Regeln ich immer noch nicht verstehe, liegt jetzt zuoberst in der Tasche, es ist ganz abgegriffen. Sie trägt ein paar Bücher zur Reisetasche, zum Bett, legt sie auf den Boden, das Buch, das ich ihr geschenkt habe, ist auch dabei. Ich habe ihr von Alexander erzählt, ich habe ihr von meiner Arbeit erzählt, von den Übersetzungen. Ich habe ihr eine dieser Übersetzungen mitgebracht und den Titel vergessen. Jetzt würde ich ihn gerne nachlesen, aber das Buch ist zu weit entfernt. Die Robbe liegt auf dem Bett direkt vor mir und sieht mich an. Sie ist alt und ihr Fell ist angedunkelt von Schmutz und Schweiß, und sie sieht mich an mit ihren großen, schwarzen Plastikkugeln. Ich blicke schon eine Zeitlang zurück.
Und so fahren wir nachhause, oder zu Karins Zuhause, der Gurt drückt auf meine Brust. Meine Reisetasche und Karins Handtasche liegen auf der Rückbank, das Haus ist vor uns und hinter uns, und der Wald rundherum. Vorwärts zurück nachhause. Hinter mir liegt es, vor mir liegt es, das Haus, das mich anblickt. Auf dem Weg vom Haus zum Haus, nur das Seitenfenster bleibt.
Nur das Seitenfenster bleibt, das Seitenfenster all dieser anderen Räume, all dieser anderen Menschen. Und alle Räume der Wohngemeinschaft finden Platz in diesem Seitenfenster. Vorzimmer, Gang, Küche finden Platz in diesem Seitenfenster. Uschis Zimmer links neben meinem, Mark und Roberts Zimmer am anderen Ende des Ganges. Julians Raum, der Bassinraum für meine Worte, für die Worte des Puppenspielers, die auch aus mir kommen. Die Küche, die Geschirrspülmaschine links neben der Abwasch. Die Gläser oben, die Teller unten. Uschi kann ich zeigen, wie man den Tisch deckt. Schau, so, Gabel links neben den Teller, Messer rechts neben den Teller. Jedes Mal wieder. Mein Zimmer, das ich nun für jemanden anderen ausräume.
»Wenn du das doch nicht willst, Lisa, dann musst du es mir nur sagen«, hat Julian gemeint.
Er hat dabei die Reisetasche für mich geschlossen. Karin hat im Vorzimmer auf uns gewartet, darauf, dass ich nun endlich ihre Hand nehme, nun endlich meine Reisetasche auf ihren Rücksitz lege.
»Wir haben doch darüber gesprochen«, hat Julian gesagt, »über dieses ganze Verräterspiel. Willst du dich auf das wirklich wieder einlassen? Lisa, ich will ganz ehrlich sein, ich habe Angst, es wird dir schlechter gehen. Wenn du das doch nicht willst, Lisa, dann ist es noch nicht zu spät.«
Doch, doch, Julian.
Denn Karin legt mir ein Foto auf den Küchentisch, es ist ein altes Foto mit uns allen darauf, da waren wir zehn Jahre alt, wir beide, da bist du und die, die sind alle nicht mehr da. Nimm einen Kuli, streich durch, wer nicht mehr da ist. August nicht, und Inge ist auch nicht mehr da, nimm den Kuli, nimm doch, streich sie doch durch. Deine eigene Mama, wie hieß sie noch, ist auf dem Foto schon gar nicht mehr zu sehen, steht nur noch in deinem Schatten und liegt in deinen Gesichtszügen. Man erkennt ihre Augen und ihre Nase noch in deinem Gesicht, aber du würdest sie kaum mehr erkennen, so lange hast du sie schon hinter dir gelassen, auf deinem Weg vom Haus zum Haus. Und Karin legt das Foto auf den Tisch und man muss alle anderen Räume und Menschen von diesem Tisch räumen, damit das Foto mit uns allen darauf Platz findet. Das sind wir, auf dem Foto, wer nicht auf das Foto passt, ist jemand anders, findet auch nicht Platz auf dem Tisch, auf dem das Foto liegt. Was nicht auf das Foto passt, ist so klein, es findet Platz im Seitenfenster, aus dem ich hinausschaue, auf den Wald.
Karin steigt auf die Bremse, wir halten an. Ich sehe zu Boden, weil mir das Seitenfenster nicht mehr bleibt. August und Inge und Karin und Peter und Grete, alle stehen sie aufgereiht nicht da. Nimm den Kuli und streich alle durch. Ich kann da nicht hinausgehen. Ich hätte nie hierher kommen dürfen. Ich müsste jetzt und sofort erschlagen werden, nur dafür, genau hier zu sein. Karin nimmt mich an der Hand und zieht. Ich steige aus dem Auto und ich gehe an Karins Hand.
Karin kommt auf mich zu, Hallo, sagt sie und nimmt meine Hand, ich bin Karin und du bist wohl Lisa, die meinen Vater töten wird, nicht wahr? Und da ist die Treppe, auf der wir spielen werden, sie ist noch warm von unseren Fingern, und da durch die Haustüre geht es hinein, rechts das Wohnzimmer, links die Küche, er kommt auf dich zu mit offenen Armen und sagt, hab keine Angst, Lisa, komm ruhig herein.
Noch kann ich umdrehen.
»Komm ruhig herein, Lisa, hab keine Angst, es ist alles in Ordnung.«
Karin zieht mich weiter und ich stolpere über die Schwelle.
»Kennst du dich noch aus? Rechts ist das Wohnzimmer, gelt, und links die Küche, links ist die Küche, gelt?«
Der Geruch ist sofort da. Ich schließe die Augen.
Ich bin im Haus des Puppenspielers.
Ich bin in Karins Haus.
Ich bin zuhause.
5.
Morgens ist das Haus ruhig. Ich sitze in der Küche und trinke Kaffee, das Häferl steht vor mir auf dem Tisch, drinnen ist es schwarz. Auch draußen vor den Fenstern ist noch alles schwarz. Ich bin heute sehr früh aufgestanden, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und die Decke lag fast hart an meinem Hals.
Alexander schläft noch, das weiß ich, von Lisa weiß ich es nicht. Sie ist oben in ihrem alten Zimmer. In unserem alten Kinderzimmer, eigentlich. Lisa hat Alexander die Hand gegeben, nach meiner Aufforderung, und weiter zu Boden gesehen und fast nichts gesagt. Sie ist sehr müde gewesen und wollte nichts essen, sodass ich sie gleich hinauf in ihr Zimmer gebracht habe.
»Willst du nichts essen?«, habe ich gefragt, aber sie hat nichts essen wollen.
Sie wollte das Fenster geschlossen haben, »Fenster zu«, hat sie gesagt, sie hat sich auf das Bett gesetzt, weiter nichts. Vielleicht hätte ich sie ausziehen und hinlegen sollen, ich weiß nicht. Ich wollte sie in Ruhe lassen. Sie ist aber einfach nur dort gesessen und ich bin irgendwann gegangen und habe die Tür hinter mir geschlossen.
Und Alexander? Er hat mich in der Nacht um die Hüfte genommen und ich habe ihm davon erzählt, wie ich am Vortag versucht hatte, unser altes Kinderzimmer für Lisa herzurichten. Aber es stehen noch immer zwei Betten drin. Zuerst wollte ich ihr Bett abbauen, ich wollte es in tragbare Bretter zerteilen und im Keller an die Wand lehnen, wo es kaum Platz eingenommen hätte. Ich wollte die Schrauben herausdrehen. Sie saßen zu fest, der Schraubenzieher ist in meiner schweißigen Hand gerutscht, ist mir ausgekommen und über das Holz gefahren, nicht einmal einen Kratzer hat er dabei hinterlassen.
»Ich hätte die Balken wohl zersägen müssen«, habe ich zu Alexander gesagt. Alexander hat seinen Arm um meine Hüfte gelegt und ich habe das Bett vergessen können. Jetzt denke ich daran. Mein Vater hat es zusammengeschraubt, er hat Laubholz verwendet, und deshalb wird es wohl bleiben, wie es ist, so lange, bis jemand mit einer Axt weit ausholt und darauf einschlägt. Und vielleicht wird es nachher trotzdem noch dastehen, wer weiß. Kurz lache ich auf. Es ist still in der Küche.
Ich bin zuerst ans Fenster getreten und habe es geöffnet. Das war das Erste, das Fenster in meinem alten Kinderzimmer zu öffnen, weil hier drin ganz alte Luft steht. Erst dann drehe ich mich um und sehe das zweite Bett, das neben dem Kasten an der Wand steht. Das muss weg. Ich werde das Werkzeug holen, denke ich, aber während ich mit Schraubenschlüssel und Zange versuche, es auseinanderzunehmen, muss ich an meinen Vater denken, wie er Lisas Bett zusammengeschraubt hat, wie er eines Tages die Holzbretter heimgebracht hat und sie in seiner Werkstatt auf die richtigen Maße geschnitten und geschliffen hat. Er hat Holz von guter Qualität genommen, das hält ewig, hat er gesagt, und es hat auch bis jetzt gehalten. August ist in meinem Zimmer vornübergebeugt gesessen und hat das Bett direkt dort zusammengeschraubt, dort, wo früher mein Puppenhaus aus Karton gestanden ist. Er hat die Schrauben so fest zwischen die engen Fasern gedreht, dass sie kaum mehr sichtbar sind, so fest, dass ich sie jetzt nicht mehr herausdrehen kann, so sehr ich mich auch bemühe. Und ich habe ihm zugesehen, wie er gehämmert und geschraubt hat, und ich sitze jetzt auf dem Boden, meine Hände sind schweißnass von der Anstrengung, aber das Bett ist noch immer da.
Später sind wir beide in unseren Kinderbetten auf dem Rücken gelegen, und obwohl sie lang genug waren für uns, weil mein Vater weit in die Zukunft geplant hat, sind sie uns doch zu klein geworden, besonders Lisa, mit ihren langen Beinen, die sie aufstellt, und während sie an die Decke starrt, die hier schief ist, eine Dachzimmerdecke, schwingt sie ihre aufgestellten Beine hin und her, öffnet sie mal breit, mal schließt sie sie und schlägt ihre Knie zusammen. Dann dreht sie sich zur Seite, zu mir. Weißt du, an was ich gerade gedacht habe, fragt sie dann.
Als ich in dem Gehölz von Lisas und meinem Zimmer meine Laden durchsuche, merke ich: Mama hat fast nichts entrümpelt, die Sachen liegen teilweise immer noch an genau demselben Ort, an dem ich sie das letzte Mal abgelegt habe, vor Jahren. Ich habe, als ich endlich in das Zimmer von Grete gezogen bin, das meiste hier so gelassen, wie es war, weil man den Raum ja nicht benötigt hat in dem leeren Haus, und habe all das Kinderzeug zurückgelassen, und nach und nach ist das, was ich nicht mehr wollte, von meinem neuen Zimmer in unser altes Zimmer gewandert, und das alte Zimmer ist eine Gerümpelkammer geworden. Es ist eine Gerümpelkammer geblieben, trotz Aussortieren. Und jetzt, beim Aufräumen, tauchen nach und nach Schulhefte auf, Spiele von mir und Lisa, tausend Kilometer und die unendliche Geschichte. In den Schachteln der Brettspiele liegen bekritzelte Blätter mit unseren Punkteständen, manchmal nur von Lisa und mir, manchmal von Lisa, mir, Margarethe und Peter, manchmal die ganze Familie, und weil August sich oft um den Punktestand gekümmert hat, taucht auf den Zetteln überall seine Handschrift auf. Zwischen den Notizen fürs Activity finde ich Kritzeleien, kleine Zeichnungen. Ich habe nie verstanden, warum man das aufheben muss, dieses Brettspielgeschmiere. Die alten Punktestände anzusehen, nimmt mir jede Lust zu spielen, als wäre es mühselige Arbeit. Aber dann finde ich in einer verstaubten Mappe richtige Zeichnungen. Es ist unsere Mappe aus dem Zeichenunterricht und meine Mutter hat da wohl alles hineingelegt, was sie sonst noch von uns gefunden hat, und unsere Zeichnungen sind wild durcheinandergemischt. Wir im Wald, wir mit Fischschwänzen im Wasser, Piraten, hier hat Lisa mich mit schwarzen Flügeln gezeichnet, oder war das ich? Keiner kann da mehr sagen, welche von mir und welche von Lisa sind, wenn wir nicht zufällig unsere Namen auf die Rückseite geschrieben haben. Es sind sogar Zeichnungen aus der Zeit dabei, bemerke ich, bevor Lisa zu uns gekommen ist. Wie lang ist das her, denke ich, die Zeit, als ich noch allein war, bevor ich dann allein war. Und dann sitzt da mein Vater in meinem Zimmer und zimmert ein Bett zusammen, es wird an der Stelle stehen, wo früher mein Puppenhaus aus Karton gestanden ist, das ist jetzt im Müll, weil es schon nicht mehr gut war und ich ohnehin zu groß dafür bin, das ist mir gleich, weil ich stattdessen eine Schwester bekommen werde, und unten läutet das Telefon.
Das Telefon läutet in der Küche und ich sehe auf. Es ist schon interessant, dass Peter ausgerechnet jetzt anruft. Ich weiß genau, dass es Peter ist, wer sollte es auch sonst sein? »Komm doch zur Vernunft«, wird er sagen. Aber trotzdem, dass er ausgerechnet jetzt anruft, wo ich hier sitze und mich erinnere an den Tag, als Lisa gekommen ist, in einem roten Auto, als ein Mann sie in einem roten Auto hierhergebracht hat. Wir haben schon vorher gehört, dass ein Auto die Straße durch den Wald zu uns herauffährt, das Auto hat vor unserer Hauseinfahrt gehalten und der Mann ist ausgestiegen und hat Lisa die Autotür geöffnet. Und dann war sie da und ich habe sie an der Hand genommen, und sie hat sich an der Hand nehmen lassen und ich habe sie herumgeführt und sie hat sich herumführen lassen und war ganz still. Ich habe ihr das Haar gekämmt und sie hat sich kämmen lassen. Ihr Haar war fein und sehr weich. Sie hat fast gar nichts geredet die ersten Stunden. Ich habe sie umarmt und ihr gesagt, dass wir viel lieber zu ihr sein werden als ihre alte Mami, und dass sie jetzt meine Schwester ist. Sie hat sich nicht gerührt. Sie hat gut gerochen.
6.
Es ist aber nicht Peter am Telefon. Es ist Grete, und schon wieder ruft sie aus London an. Dass sie das nicht zu teuer kommt.
»Du weißt doch, dass ich Freiminuten habe«, antwortet Grete, »jede Menge. Und wir müssen reden.«
Ich weiß, worüber wir reden müssen, und wünschte, Grete hätte ihre Minuten schon aufgebraucht. Es geht um meinen letzten Besuch bei den Großeltern. Ich muss an Weihnachten denken, da werden wir alle wieder beisammen sein.
»Was hast du da bloß wieder angestellt, Karin? Oma ist ganz vernichtet. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, Oma solche Grauslichkeiten zu erzählen.«
Grauslichkeiten, denke ich, und denke weiter an meinen letzten Besuch bei den Alten, wir sind in der Küche, ich stehe an den Tisch gelehnt. Diesmal kein Kaffee und keine Maresi. Oma macht uns dafür Mittagessen, hat mich dabei nicht helfen lassen, »Nein, ich mach das schon«, hat sie gesagt, und Opa redet von den Maulwürfen in seinem Garten. Das Gespräch kommt auch wieder auf meinen Vater. Ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie kommt es doch jedes Mal auf meinen Vater. Ich habe noch keinen Nachmittag bei ihnen verbracht, an dem das Gespräch nicht irgendwann auf meinen Vater gekommen wäre.
»Der Gustl hat sich immer furchtbar gegrämt, wenn mein Hermann mit der Schaufel auf die Hügel geschlagen hat«, hat die Oma gesagt. »Er war ein sehr sensibles Kind. Vielleicht allzu sensibel, in Wirklichkeit.«
Der Opa hat die Arme vor der Brust verschränkt.
»Maulwurfshügel muss man wegräumen«, sagt er. »Das sind Schmarotzer. So sehr die einem auch leidtun, die darf man nicht dulden, das hat der Bub später auch verstanden.«
»Lisa wird wieder bei mir einziehen«, habe ich daraufhin gesagt.
Damit habe ich sie also vernichtet. Vernichtungen passieren bei Grete recht schnell.
»Du hast das aber doch nicht ernst gemeint, oder?«
»Lisa ist seit gestern Abend da.«
Margarethe schweigt. Ich stehe mit dem Telefonhörer in der Hand da und warte, dass ihre Stimme das Leitungsrauschen unterbricht.
»Jetzt, ernsthaft?«, fragt sie endlich.
»Ja, schon«, antworte ich.
»Du bist ja völlig übergeschnappt. Das ist ja eine Katastrophe. Und hier, in unserem Haus?«
»Eine Katastrophe ist das natürlich nicht«, sage ich. »Außerdem ist es jetzt mein Haus.«
»Hör doch auf mit diesem Unsinn!«
Ich stehe da am Tisch in der leeren Küche, mit dem Telefonhörer in der Hand, und frage mich, mit welchem Unsinn ich denn jetzt aufhören soll. Damit, das Haus für alle zu erhalten, damit man es nicht verkaufen muss? Damit, den von Seerosen und Algen verseuchten Schwimmteich zu reinigen?
»Und darum geht es doch außerdem gar nicht«, sagt sie jetzt. »Ich meine, was soll das denn?«
Und ich frage mich, wo genau Grete gerade ist, ob sie von der Arbeit aus anruft oder von Zuhause, ob Harry mithört oder ob sie alleine ist. Ich versuche mir vorzustellen, dass sie aus der Küche anruft, an die Wand gelehnt oder an den Küchentisch, den Hörer in der Hand oder zwischen Kopf und Schulter eingeklemmt. Und wie sie in diesem Moment gerade aussieht, vielleicht schon im Kostüm, vielleicht schon die Haare gemacht, diese steife Frisur, ihr breiter Haarreifen. Und die lederne Handtasche neben ihr auf dem Küchentisch, daneben der Autoschlüssel. Oder der Autoschlüssel in der Hand, mit dem sie spielt, und die Handtasche schon auf der Schulter, und weil die schwer ist, möchte sie nicht allzu lange reden. All das würde ich wirklich gerne wissen.
»Wie geht es dir in London?«
Grete antwortet nicht gleich.
»Gut, mir geht es gut. Ich habe letzten Monat eine Gehaltserhöhung bekommen.«
»Du machst deinen Job recht gut, oder?«
»Ja, es scheint so.«
Grete will das nicht zugeben, außerdem hat Grete anderes im Sinn, und in der Familie redet sie nicht über das Büro, in dem sie Karriere macht, genauso wie sie im Büro nicht über ihre Familie redet, die ohnehin verstümmelt und hässlich anzusehen ist. Ich wünschte, sie würde mehr von sich erzählen, statt immer nur mir Ratschläge zu geben. Das würde uns beiden das Leben erleichtern.
»Kannst du sie denn noch bei der WG rückanmelden?«, fragt sie jetzt.
»Ich weiß nicht. Ich denk nicht dran.«
»Aber was soll dabei denn herauskommen? Wie soll das denn enden? Was stellst du dir denn vor?«
Wenn ich mehr über ihr Leben wüsste, müsste ich mich vielleicht jetzt auch nicht fragen, ob sie gerade ihr Frühstücksbrot in der Hand hält. Ob sie denn nun wirklich überrascht war von meiner Entscheidung. Sie hat von den Besuchen gewusst. Alles andere kann man sich doch ausmalen.
»Was genau stellst du dir denn vor, Grete?«
»Stell dich nicht dumm. Nimm das hier ernst. Das hier ist eine Katastrophe.«
Später stehe ich an den Küchentisch gelehnt und reibe mir die Stirn. Ich vermute, dass Grete in eben diesem Moment ein SMS an Peter oder an ihren Mann Harry schreibt, mit bloß einem Wort, »Katastrophe«. Das sähe ihr ähnlich. Ich mag es nicht, mit Margarethe zu telefonieren. Wir werden einander zu Weihnachten sehen, bis dahin gibt es nur diese kurzen abgeschnittenen Minuten, in denen man in die Luft redet zu niemandem, und die Stimme meilenweit laufen lässt, und eine Stimme hört von Niemandem, die meilenweit hat laufen müssen, und sich eben den Rest ausmalen muss, was offensichtlich keiner von uns richtig gut kann. Und ich weiß auch gar nicht warum, ich kann am Telefon noch weniger anfangen mit diesem »Was stellst du dir vor?«, mit dem »Das kommt doch völlig aus dem Nichts.« Ich gehe, um Alexander zu wecken und Lisa zu holen. Ich denke, dass ich Lisa heute werde baden müssen, weil das notwendig ist. Das ist notwendig, denke ich, und der Gedanke tut mir gut.
Ich halte die Robbe an mich gepresst, das Fell der Robbe in meinem Gesicht. Es ist warm und es ist feucht, denke ich, und ich kenne den Geruch so gut, den Geruch dieses weichen Kunststofffells. Vor mir steht Karins und mein Kleiderkasten, aber es sind nicht mehr unsere Kleider drin, er ist leer. Es gehören in diesen Kasten durcheinandergeworfen Karins und meine T-Shirts, Jeans und Pullover hinein. Es gehören an die schiefen Wände Poster, die an den Ecken schon eingerissen sind. Das Bett, auf dem ich sitze, ist Karins, das Bett dort drüben ist meines, es gehört bezogen. Und wo ich liege, soll sie liegen, es soll dunkel sein, und wir sollen uns Geschichten erzählen.
Aber das Bett ist nicht bezogen. Gleich beim Hereinkommen habe ich gesehen, das Bett ist nicht bezogen. Das wird unser Zimmer sein, sagte sie, es gehört uns zusammen, nebenan schläft meine Schwester, Mamas und Papas Zimmer ist am Ende des Ganges. Und unten im Erdgeschoß schläft Peter, mein Bruder. In der Küche war Blut, aber keine Angst, ich habe es schon aufgewischt. Ich bin früh aufgestanden, habe mich niedergekniet und es mit einem Waschlappen aufgewischt. Ich komme herein, die Tür geht auf, die Tür geht zu, das Zimmer schließt sich.
Pack ruhig schon deine Sachen aus, du bekommst das Bett dort drüben am Fenster, mein altes Bett, schau, das Fenster, das auf den Wald hinausgeht. Setz dich schon mal auf das Bett, stell die Tasche ruhig schon hin, das ist dein neues Zuhause und die Türe geht auch ganz leise auf und zu.
Ja, es ist ein Zimmer für zwei, aber das andere Bett ist nicht bezogen, das heißt, etwas wurde herausgeschnitten. Ich sitze auf Karins Bett und mein altes Bett ist nicht bezogen. Etwas ist anders, verschoben. Etwas ist kleiner. Klein wie die Wurzelhand, wie die Höhle zwischen den Felsen, wo wir unsere langen Beine übereinanderstapeln müssen.
Setz dich schon mal, durch das Fenster sieht man hinaus in den Garten und auf den Wald, der Wald legt sich um uns.
Der Schatten des Fensters fällt bereits auf den Holzboden. Der Schatten liegt auf der Maserung, die ich wiedererkenne, weil ich sie schon so oft angesehen habe, genau so. Jedes einzelne Astloch kenne ich, ist mir vertraut, bin ich mit den Fingern nachgefahren. Ich möchte mich bücken und die Vertiefungen berühren, die ich in die Maserung geritzt habe, aber ich tue es nicht. Sie gehören zu dir, August, all diese Augenpaare. Ich kann sie nicht berühren, ohne gleichzeitig dich zu berühren. Ich kann sie nicht ritzen, ohne gleichzeitig meine Nägel in deine Haut zu drücken. Und auch wenn ich mich entschieden habe, zurückzukehren, noch will ich dich nicht berühren, noch will ich Nein sagen zu dir, und ich sage es laut, jetzt, wo es hell ist: Nein.
Dann öffnet sich die Tür. Die Tür ist offen, so leise und schnell hat sie sich geöffnet, schwingt über den Boden und über die Maserung auf dem Boden und mit ihr schwingt ein heller dünner Schatten, kaum erkennbar, über das Holz. Karin und der fremde Mann sind gemeinsam hereingekommen, stehen nebeneinander und Karin sagt: »Guten Morgen.«
»Guten Morgen, Lisa«, sagt der fremde Mann. Sie sagen es beide, nicht gleichzeitig, aber beide.
Ja, ich habe verstanden. Karin, ja. Ich bin nicht dumm, Karin, ich weiß schon, was der Fremde neben dir für dich bedeuten soll, auch wenn er durch einen weißen Fleck neben dir ersetzt werden könnte.
»Hast du Hunger?«, fragt sie, »möchtest du frühstücken?«
»Komm«, sagt sie. »Gehen wir.«
Sie sagt, gehen wir, ich möchte schreien, aber ich habe mich dem selbst ausgesetzt. Ich habe mich entschieden, also jetzt nicht schreien, dafür ist es längst zu spät. Sie kommt zu mir her und steht da, ich blicke ihre Beine an, und wie sich ihre Hose ihre Beine entlang faltet, und sie streckt die Hand aus und berührt meine Hand. Ihre Hand schließt sich um meine Hand und nimmt meine Hand weg von der Robbe und die Robbe ist nicht mehr so fest an meinem Gesicht. Die Robbe wird kalt und feucht, wenn man sie nicht fest an sich drückt. Mein Schweiß kühlt ab, sobald ich sie nicht mehr halte, wird klamm und fängt an zu riechen. Sie zieht mich hoch, ich spüre ihre Hand um meine herum, die Finger. Gehen wir. Sie führt mich zur Tür, sie führt mich an dem fremden weißen Fleck vorbei, der herumsteht, viel zu groß zwischen den schiefen Wänden. Weglaufen, denke ich, das Haus in Ruhe lassen. Das Haus in seinem Frieden lassen, in seinem klammen Schlaf, es nicht aufwecken, bevor. Aber sie darf das nicht erlauben. Sie darf das nie erlauben, weil dieser Weg ist für uns beide. Dieser Weg ist nur für uns allein.
Deshalb strecke ich, noch während ich auf den Gang trete, meine freie Hand aus. Die nicht von Karin gehaltene Hand fährt über die Türe und die Türe spannt sich an. Ich fahre mit den Fingerspitzen die Wand des Gangs entlang, und die Wand zuckt zusammen. Den ganzen schmalen Gang entlang fahre ich über den weißen Anstrich, über das Glas, das Bilder verdeckt, und das Bilderrahmenglas spannt sich an. Der weiße Anstrich ist teilweise schon grau, und unten, knapp über der Sesselleiste, haben unsere Schuhe Schmutzfahrer hinterlassen, die nie jemand gezählt oder übermalt hat. Wir kommen zu der Treppe, die hinunter ins Erdgeschoß führt, zum Wohnzimmer und zur Küche, links ist die Küche, gelt? Ich fahre, während ich Stufe für Stufe hinuntersteige, das Stiegengeländer entlang und das Geländer spannt sich an. Ich spüre es unter den Fingern, jede Faser von dir, jedes Stück des von dir geölten Holzes, und du spannst dich an. Ich fasse dich von innen.
Wir gehen langsam vorwärts, ich schließe die Augen. Das Holz wird dichter rund um mich, erst wenn ich weiter weg bin, kann es wieder aufatmen. Geh weg, Karin lässt meine Hand nicht los. Plötzlich sage ich: »Nein.« Ich bleibe stehen.
»Was ist denn?«, fragt Karin, »was hast du denn?«
Hast du schon aufgewischt?, will ich fragen. Hast du schon aufgewischt? Ich schließe den Mund rechtzeitig. Bevor etwas herauskommt. Ich weiß: auf dem Boden in der Küche. Du hast dich selbst ausgesetzt. Hierher gesetzt. Aus, geh vorwärts. In der Küche ist – iss, was du gekocht hast. Iss nur, was in dir von unten nach oben gewandert ist. Von oben nach unten, von unten nach oben. Schau jetzt nicht weg. Schau hin. Auf dem einen Weg hinein, auf demselben Weg hinaus. Hinein, hinaus, ganz einfach. Sie führt dich weiter, du betrittst. Rutschiger Boden. Das ist das, was du gekocht hast. Im Hals, überall, das, was du gekocht hast. Im Hals steckt. Mitten in den Raum. Auf dem Boden liegt. Du fährst dir mit dem Handrücken über die Nase. Der Geruch in deiner Nase. Der Geruch kriecht die Nase hinauf, hinauf bis in deinen Kopf. In deinem Hals steckt alles, du willst schreien, aber stattdessen. Etwas greift dich von innen.
Ich spüre ihre Hand auf der Schulter und daran, wie sie aufliegt, spüre ich – »Komm«, sagt sie, »geh zur Seite.« Ich bin nach vorne gebeugt. Ich bin über mein Inneres gebeugt. »Ich wisch schon auf, wenn du nur zur Seite gehst.« Die Küche ist rund um mich und atmet noch nicht auf. Der Boden ist voller – der Boden ist rein.
7.
Ich drehe den Wasserhahn auf, es rauscht laut, und einen Moment lang ist das alles, was ich höre, das Rauschen. Wasser, das ist alles, was sie gebrochen hat, Wasser, sonst war nichts da, nichts als Wasser in ihr. Ein ausgeleerter Eimer. Sie steht hinter mir, als ich mich über die Badewanne beuge, den Wasserhahn aufdrehe, dem Rauschen zuhöre. Nicht so schlimm. Und dann wird es anders. Ich weiß nicht wie, aber es kommt anders. Denn ich habe sie natürlich allein gelassen, im Badezimmer, ich habe ihr ihren Raum gelassen, natürlich. Aber als ich nach einer Weile die Tür wieder öffne, nachsehe, steht sie in der Mitte ihres Raumes, als könnte sie nichts damit anfangen.
Die Wanne ist voll und das überschüssige Wasser rinnt in den Abfluss. Es gurgelt. Sie hat ihre Plüsch-Robbe dicht ans Gesicht gepresst und sieht dem gurgelnden Wasser zu, als hätte sie dort etwas erschreckt. Ich gehe langsam hin und drehe ab. Ich drehe mich zu ihr.
»Willst du nicht baden?«
Aber Lisa antwortet nicht. Ich weiß nicht, ob sie mich verstanden hat, ich weiß nicht, wie das bisher gewesen ist. Man hat mir nichts davon gesagt, dass sie nicht alleine baden kann. Wenn ich jetzt wieder hinausgehe und sie allein lasse, wird sie sich ausziehen und in die Wanne steigen und sich waschen? Wird sie nur hier stehen bleiben, bis das Wasser kalt geworden ist? Und dann beginnt – aber was soll ich schon tun? Was soll ich schon tun, wieso fällt mir denn das alles so schwer? Ich fasse ihre Wollweste. Ja, und ich beginne sie aufzuknöpfen, weil ich sonst keine Möglichkeit weiß. Knopf für Knopf, als wäre sie ein kleines Kind. Sie wehrt sich nicht. Sie hält den Kopf gesenkt. Es sind die kleinen Knöpfe im dichten rosa Wollstoff zwischen meinen Fingern, die sich wehren, so dichter Stoff, als wäre er eingegangen. Die Knöpfe lösen sich widerwillig von ihm, ich muss an ihnen nesteln, und meine Finger werden ungeduldig. Ich ziehe ihr die Weste aus, sie lässt die Arme fallen und die Robbe auch, damit ich es leichter habe, und die Robbe fällt auf den Boden. Ich fasse sie unten am Hemd. Sie hebt die Arme, kurz ist ihr Gesicht vom Stoff verdeckt, dann kommt es mit zerzausten Haaren wieder zum Vorschein. Was genau hab ich mir gedacht? Sei nicht aufgewühlt, es gibt keinen Grund. Nur noch den BH hat sie an und schaut an mir vorbei auf die Seite. Sie ist sehr mager geworden, knochig, ihre Haut ist voller Sommersprossen, und wie sie dasteht mit diesem krummen Rücken, fallen die Schultern nach vorne. Die verfilzten Locken fallen an ihr herunter und in ihr Gesicht. Ich gehe um sie herum, nehme sie von hinten am BH. Ich bin ganz dicht an ihren Locken. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Als ich den BH öffne, fallen die Bänder sofort zur Seite, er verliert seine Spannung und liegt nur noch locker auf ihrer Brust. Es ist etwas in der Art, wie sie dasteht, dass ich mich wegdrehen möchte – gleichzeitig brauche ich nur leicht die Träger von ihren glatten Schultern streifen, damit er zu Boden fällt.
Ich knie mich hin, ich öffne ihre Hose von hinten, fasse sie am Bund, ziehe sie hinunter. Ich fasse ihre Unterhose und ziehe sie hinunter. Ich halte den Kopf gesenkt. Sie bewegt sich, sie steigt heraus. Der rechte Fuß hebt sich, steigt aus der Unterhose, die ich halte, die leicht wird, und setzt ein bisschen weiter vorne wieder auf dem Boden auf, die Zehen zuerst, sie wackelt dabei, dann folgt der linke, sie steht trotzdem nicht ganz sicher auf den Beinen. Das ist nicht leicht, denke ich, gleichzeitig werde ich mich daran gewöhnen müssen. Wer weiß, was sie noch alles nicht kann.
»Willst du nicht ins Wasser steigen?«