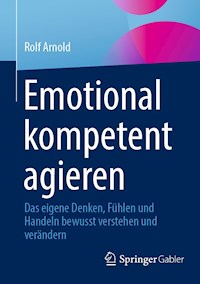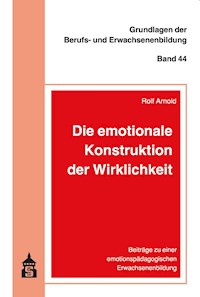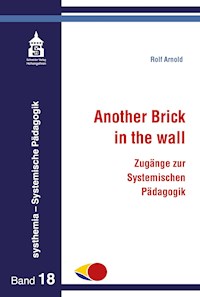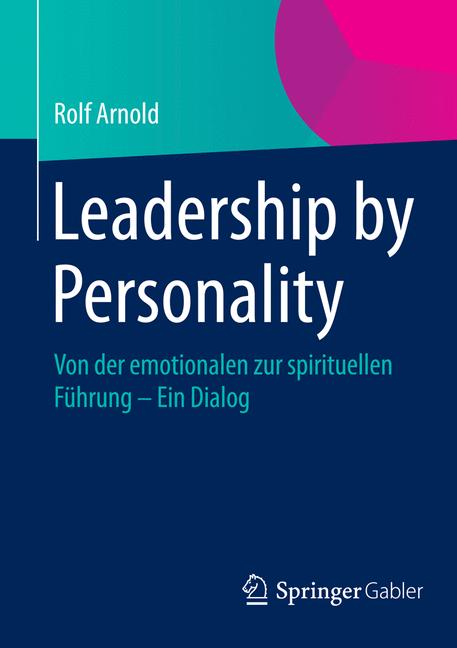Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Carl-Auer Lebenslust
- Sprache: Deutsch
Jeder Mensch ist in seiner Erkenntnis, seinen Urteilen und seinen Handlungen von dem bestimmt, was in seinem Verhaltensrepertoire und Denken angelegt ist. Wie sieht unter solchen "Voraus-Setzungen" der Spielraum für einen Entwicklungsprozess aus? Wie viel Überzeugungskraft besitzt die Reflexion gegenüber Gewohnheiten, Gefühlen, der soziokulturellen Prägung? Rolf Arnolds 29 Regeln zur Persönlichkeitsbildung helfen, die eigene Persönlichkeit zu überprüfen und voranzubringen. Die Regeln sind dabei eher als Denkimpulse zu verstehen denn als rigide Anweisungen. Rolf Arnold leitet sie konsequent aus seiner Praxis als Berater und Pädagoge ab und untermauert sie mit Erkenntnissen aus der Hirnforschung. Fragen zur Selbstreflexion erschließen die persönliche Vergangenheit und Gegenwart, Übungen ermutigen dazu, mögliche Zukünfte zu erproben, anschauliche Beispiele erleichtern den Einstieg in Veränderungen. Wenn Rolf Arnold am Ende seines gut lesbaren Buches mit Regel Nr. 29 alle vorherigen wieder einkassiert, so passt dies zu seinem Ansatz, Persönlichkeitsbildung als eine Spiralbewegung in immer höhere Regionen zu begreifen. Die Reflexionsreise soll auch nach der Lektüre weitergehen, selbständiger und freier als zuvor. Regel Nr. 29 lautet deshalb: "Misstraue den 28 Regeln und komme ohne sie aus."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Fragebögen und Checklisten aus diesem Buch finden Sie als Download unter: http://www.carl-auer.de/machbar/wie_man_wird_wer_man_sein_kann
Rolf Arnold
Wie man wird,wer man sein kann
29 Regeln zurPersönlichkeitsbildung
Zweite Auflage, 2019
Umschlaggestaltung: Uwe Göbel
Umschlagmotiv: © Feng Yu | Dreamstime.com
Zweite Auflage, 2019
ISBN 978-3-8497-0102-4 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8038-3 (ePUB)
© 2016, 2019 Carl-Auer-Systeme Verlagund Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Wenn Sie Interesse an unseren monatlichen Nachrichten haben, können Sie dort auch den Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Vorwort
Einleitung
29 Regeln zur Persönlichkeitsbildung
Regel 1: Nimm deine Biografie als das, was sie ist: eine Erzählung dessen, was gewesen ist. Lies sie und integriere sie, ohne beständig aus ihr zu zitieren!
Regel 2: Prüfe nicht (nur) das, was dir zu sein scheint, sondern richte deinen Blick auf das, was sein könnte, aber noch nicht in Erscheinung treten durfte!
Gleichberechtigender Vergleich
Regel 3: Trauere nicht dem Versäumten nach, sondern beteilige dich an dem Möglichen!
Sich an dem Möglichen beteiligen
Regel 4: Prüfe deine Werte und vergleiche sie wertschätzend mit denen der anderen!
Regel 5: Teile die tiefen, nicht die exklusiven Gedanken der Überlieferung!
Was bedeutet dieser bildungstheoretische Kommentar?
Regel 6: Denke und gestalte dein Leben von seinem Ende her!
Regel 7: Trainiere den frischen Blick auf die Gegebenheiten und vermeide dein erwartungsgemäßes Urteil!
Regel 8: Suche im Gegenüber die Potenziale, nicht Bestätigungen für deine eigenen Erfahrungen und Befürchtungen!
Die Kunst der erschließenden Nachfrage
Die Kunst des Reframings
Regel 9: Arbeite an der Verfeinerung deiner Beobachtung und der Eleganz deines Auftretens!
Am Anfang steht die Beobachtung
Gelingend kooperieren
Regel 10: Öffne dich den zunächst unvorstellbaren, aber faktisch bereits wirksamen Veränderungen in der Lebens- und Arbeitswelt!
Das Internet der Dinge – ohne Menschen?
Was tun?
Führung und Verantwortung
Regel 11: Pflege die Referenzpunkte eines sicheren, richtigen und guten Handelns in Alltag und Beruf!
Wichtig: Der vertagte Nutzen
Worum es im Kern geht
Was tun?
Regel 12: Diene den großen Anliegen der Zivilisation!
Das Ideal der entwickelten Persönlichkeit
Rhetorische Überhöhung oder Notwendigkeit?
Regel 13: Lerne deinen eigenen Gefühlskörper kennen und übe, seine wahrnehmungsverzerrenden Auswirkungen zu beherrschen!
Der Gefühlskörper
Was tun?
Regel 14: Bemühe dich darum, den Stand deiner eigenen Persönlichkeitsbildung nüchtern zu verstehen!
Welches sind die Bedingungs- und die möglichen Turbofaktoren meiner Persönlichkeitsentwicklung?
Regel 15: Übe dich darin, Beziehungen emotional kompetent zu gestalten und zu entwickeln!
Emotionale Achtsamkeit
Emotionale Nachreifung
Regel 16: Nutze das »Mensch ärgere dich nicht! plus« zur Neuerfindung und Übung alternativer Ichzustände!
Wenn aus Spiel Ernst wird
Emotionale Kompetenz braucht einen Referenzpunkt
Regel 17: Dokumentiere die Geschichte deiner emotionalen Selbstreflexion in einem Emotionsportfolio!
Regel 18: Nutze Etüden zur Stärkung deiner emotionalen Gewandtheit!
Etüde A: »Ich lerne meine bevorzugten Gefühlszustände kennen und mute mich mit diesen anderen nicht länger zu«
Etüde B: »Ich übe mich im Zurückrudern und im Umfühlen«
Etüde C: »Ich trainiere die emotionale Perspektivenübernahme«
Regel 19: Übe dich in den Kunstfertigkeiten der Metakommunikation!
Regel 20: Trainiere die Formen eines gewinnenden Umgangs, indem du auch »vom anderen her« zu agieren lernst!
Wenn die Identitätsbalance nicht zu gelingen scheint
Wie lernen wir, »vom anderen her« zu agieren?
Regel 21: Heile dich selbst durch präsentes und zugewandtes Nichtantworten auf das Leiden!
Polaritätsprofil
Regel 22: Baue dir einen inneren »Ausguck«, um die emotionalen Untiefen, Strömungen und Strudel frühzeitig zu erkennen!
Regel 23: Suche dir in den Jahrhunderten Denk- und Gesprächspartner und pflege deinen eigenen Dialog mit diesem äußeren Team!
Am Anfang war der überlieferte Inhalt
Am Anfang war die selbstgesteuerte Aneignung
Literarische Räume für Persönlichkeitsbildung
Regel 24: Stärke deine persönliche Meisterschaft im erfolgreichen Umgang mit anderen!
KATHARSIS – 9 Schlüsselfähigkeiten von Führungskräften:
Regel 25: Schaffe dir Feedback- und Supervisionsgelegenheiten und nutze sie regelmäßig!
Regel 26: Trainiere dich im absichtlichen Umdeuten und Umfühlen!
Regel 27: Nutze das kognitiv-emotionale Echolot für deine Selbstreflexion und Selbstveränderung!
Wege aus der Alltagstrance
Auswege aus der Trance des Durchschnittswertes
Regel 28: Präzisiere die Hidden Agenda deiner Selbstbildung (Motto: »Wer kann ich werden und wenn ja wie?«)!
Angeleitete Selbstreflexion mithilfe der Portfoliostrategie
Regel 29: Misstraue den 28 Regeln und komme ohne sie aus!
Das Münchhausen-Syndrom: Ich werde selbst, wer ich sein kann
Literatur
Über den Autor
Vorwort
Das vorliegende Buch handelt von der Persönlichkeitsbildung. Diese bezeichnet ein altes Anliegen des Nachdenkens über Lernen, Bildung und menschliche Entwicklung, zu dem es in der Vergangenheit unzählige Konzepte und Entwürfe gegeben hat. Diese behaupteten meist mehr, als sie einzulösen vermochten. Sie spannten den Einzelnen in ein Korsett aus überlieferten Ansprüchen und unterstellten Wirkungsversprechen. Konkrete Hinweise darauf, wie er selbst zu werden vermag, der er ist, enthielten sie kaum. Es ist nicht das Ziel der hier vorgelegten Hinweise und Überlegungen zur Persönlichkeitsbildung, diesen Überlieferungen eine weitere Lesart hinzuzufügen.
Dabei rückt eine These in den Vordergrund, welche die Bildung der Persönlichkeit als Ausdruck einer doppelten Spiralbewegung beleuchtet: der Selbstreflexion und der Übung. Spiralbewegungen haben die Eigenart, kreisförmig zu verlaufen und doch fortzuschreiten. Dieses Bild steht dafür, dass Bildungsprozesse stets pendelartig verlaufen: zwischen dem Individuum mit seinen sich entpuppenden Einsichten und Fähigkeiten auf der einen Seite und den Anregungen, Ansprüchen und Zumutungen seiner sozialen Lage andererseits. Meistens ist das Individuum dieser Pendelbewegung ausgesetzt, und es wählt nur selten selbst aus, womit es sich zu befassen hat. Anders die Persönlichkeitsbildung! Diese lebt von der zunehmenden Autonomie des sich entwickelnden Menschen, sich gezielt mit sich selbst und den Formen seines Umgangs mit seiner inneren und äußeren Welt auseinanderzusetzen.
Das vorliegende Buch eröffnet Möglichkeiten einer solchen selbstreflexiven Übung. Es stellt zahlreiche Regeln und Tools zur Verfügung,1 die keiner instrumentellen Logik folgen. Vielmehr ist es das Ziel dieser Tools, Zugänge zum eigenen Ich und seinen bevorzugten Formen der Wirklichkeitskonstruktion anzubahnen. Die dabei formulierten 29 Regeln folgen keiner Wenndann-Logik. Das Regelhafte der hier vorgelegten Anleitungen zur eigenen Persönlichkeitsbildung wird vielmehr durch die Regel 29 selbst konterkariert und dementiert, die da heißt: »Misstraue den 28 Regeln und komme ohne sie aus!«
Noch ein Wort zum Titel dieses Buches. Er widmet sich nicht der Frage »Wer bin ich und wenn ja wie viele?«, die auch als Titel für einen Bestseller herhalten musste. Diese Frage ist älter als das erwähnte Buch. Sie findet sich bereits in unterschiedlichen anderen Veröffentlichungen (vgl. Arnold 2007) und zierte wohl auch als Graffiti die Berliner Mauer. Gleichwohl ist dieser Spruch ungenau, da wir nicht »sind«, sondern »werden«. Zu Persönlichkeiten jedoch werden wir nur durch eigene Bewegung, die Suche, Selbstbildung und Übung ist. Das eigentliche Thema der Persönlichkeitsbildung lautet deshalb: Wie kann man werden, wer man ist?
Rolf ArnoldApril 2016
1 Die Fragebögen und Checklisten aus diesem Buch finden Sie auch als Download zum Ausdrucken auf der Seite http://www.carl-auer.de/machbar/wie_man_wird_wer_man_sein_kann.
Einleitung
In den Tagebüchern des Schriftstellers Max Frisch (1911–1991) findet sich die Formulierung: »So löse ich mich auf und komme mir abhanden« (Frisch 1998, S. 131). Mit diesen Worten charakterisiert Frisch selbst zwar sein eigenes Altern, markiert jedoch auch nicht ganz ungewollt den Pfad einer wahrhaften Persönlichkeitsbildung. Menschen altern zwar, doch werden sie erst erwachsen, wenn sie sich selbst zu einem Veränderungsanliegen geworden sind. »Sich abhandenkommen« ist dabei eine unvermeidbare Erfahrung. Mit ihr erleben wir die Zufälligkeit und Wandelbarkeit dessen, was uns gewiss und sicher zu sein scheint. Diese Gewissheiten haben wir in ihren Grundfesten mit der Muttermilch eingesogen. Sie bestimmen nicht nur unsere Spontanreaktionen, sondern auch unser vermeintlich noch so besonnenes Handeln. Wir leben nach dem Motto »Ich will so bleiben, wie ich bin!« und freuen uns über jedes Echo, das uns zuruft: »Du darfst!«
»Gewissheit« beschreibt diesen Zustand der unmittelbaren Evidenz – frei von »Unruhe und Schwanken«; wir fühlen, »dass die Sache sich so verhalte, sich nicht anders verhalten könne, dass sie notwendig so sei, wie wir sie erkennen« (Leimbach 2010, S. 5 f.). Dieser Zustand geht oft mit einer emotionalen Entschiedenheit einher, getragen von einer tief verankerten Angst vor Aufgabe, Selbstverlust und Neubeginn. Das Vertraute können wir nämlich nicht so ohne Weiteres abstreifen, ohne unseren Halt zu verlieren. Wir spüren: Wenn wir unseren Gewissheiten zu misstrauen beginnen, geht dies nicht ohne das Risiko der Selbstaufgabe, gegen die sich alles in uns sträubt (vgl. Hofmann 2000). Doch wer diesen Schritt scheut, für den bleibt seine Welt, wie sie ist: berechenbar und gewiss, aber auch immer ähnlich und ohne wirkliche Entwicklung. Er beraubt sich der Chance,
−die Welt zu verändern, indem er lernt, in anderer Weise auf sie zu blicken und auf sie zu reagieren,
−mit dem Gegenüber in einen tieferen Kontakt zu kommen, weil man es durch dessen Möglichkeiten und nicht durch die eigenen Befürchtungen zu betrachten lernt, und
−so allmählich aus den immer wieder gleichen Schleifen der sich selbst erfüllenden Beurteilungen und Befürchtungen auszusteigen.
Während einer didaktischen Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern entstand eine hitzige Debatte zu der Frage, ob Jugendliche bloß unter Druck zu lernen in der Lage sind. Eine ältere Lehrerin bemerkte: »Ich habe in meiner langjährigen Praxis vieles aufgeben müssen, was eigentlich meinem pädagogischen Ethos entsprach: u. a. auch die Illusion, dass Kinder und Jugendliche neugierig sind und begeistert selbst lernen können, wenn man ihnen den Raum dafür gibt.« Auf den Hinweis, dass die neuere Hirnforschung immer deutlicher die Möglichkeit von Vermitteln, Lehren und Intervenieren grundlegend infrage stelle2, reagierte sie gereizt: »Wollen Sie damit sagen, dass meine Erfahrungen nicht stimmen und ich mir alles bloß so zurechtlege?« Ein Teilnehmer versuchte die Wogen mit den Worten zu glätten: »Ich verstehe dies so, dass wir als Lehrende nicht auf der Grundlage dessen handeln, was tatsächlich der Fall zu sein scheint, sondern auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrungen, Deutungen und Interpretationen. Diese sind jedoch nicht allein deshalb richtig, weil wir sie haben. Unsere Erfahrungen haben aber auch die Tendenz, sich zu verfestigen und zu verselbstständigen. Wie ich aus eigenem Erleben weiß, beurteilen und bewerten wir dann die Absichten und Möglichkeiten des Gegenübers mithilfe der Erfahrungen, die wir bereits in die Situation mitbringen. Mich zermürben deshalb ganz andere Fragen: Was kann der Schüler oder die Schülerin dafür, dass ich nur diese Erfahrungen habe und keine anderen? Wie vielen von ihnen habe ich bereits Unrecht getan, weil ich ihre Möglichkeiten nicht zu erkennen vermochte und deshalb nicht in der Lage gewesen bin, tatsächlich unterstützend zu handeln? Ich muss sagen: Die Ergebnisse der neueren Hirn- und Lernforschung verunsichern mich auf eine produktive Weise und veranlassen mich dazu, nach neuen Wegen des Lehrens und der Lernbegleitung zu suchen – Wege, die für meine Schülerinnen und Schüler passender und hilfreicher sind.«
Dieses Beispiel zeigt:
Erfahrungen können verunsichert werden, und aus dieser Verunsicherung können Lernprozesse erwachsen: Wir verlassen dann die Trance unserer lieb gewonnenen Interpretationen und suchen nach neuen Formen des Denkens, Fühlens und Handelns.
Bisweilen werden wir aber auch ungewollt mit Erlebnissen konfrontiert, deren distanzierende Wirkung wir auch mit größter Interpretationskraft nicht von der Hand weisen können. Es fällt uns schwer oder erweist sich gar als unmöglich, so zu bleiben, wie wir sind. Solche Lagen sind:
•Wir erreichen trotz aller Bemühungen das Ziel nicht, das wir mit allen Mitteln erreichen wollten.
•Oder wir erleiden den Verlust eines Partners durch Tod oder Trennung.
•Auch über unsere Gesundheit verfügen wir nicht sicher, wir können plötzlich und unerwartet mit einem Leiden konfrontiert sein, das unsere bisherige Lebensweise umstülpt und auf den Kopf stellt.
Solche Erlebnisse stürzen uns ohne unser Zutun in Krisen. Wir müssen uns nicht zu einer Infragestellung und Neuinterpretation des Bisherigen durchringen – es wird uns abverlangt. Sie dementieren unsere bisherigen Gewohnheiten und fordern von uns eine Neuorientierung. Nichts ist mehr, wie es einmal gewesen ist, und selbst wenn wir das Vertraute festzuhalten versuchen, wird es uns mehr und mehr fremd.
»Meine erste Frau« – so berichtet Robert in einem Seminar zur Persönlichkeitsbildung – »habe ich verlassen, weil ich den Eindruck hatte, ich würde an ihrer Seite mein Leben verpassen. Damals zog ich zu meiner Freundin, und alles fühlte sich großartig an: Es war ein prickelnder Neubeginn. Heute – nach zwanzig Jahren – beschleichen mich bisweilen ähnliche Befürchtungen und nahezu dieselben Gefühle. Vielleicht muss ich mir selbst die Frage stellen, warum ich mich hier wiederhole?«
Solche Rückbesinnungen auf das Eigene sind selten, aber weiterführend. Sie sind selten, weil Menschen dazu neigen, die äußeren Bedingungen für ihre Befindlichkeiten verantwortlich zu machen – eine Schlussfolgerung, die es immer und immer wieder nahelegt, seine Lebensumstände, nicht die eigenen Lebensgewissheiten zu verändern. Es sind dann die Kollegen, die Partner, die Obrigkeit oder gar eine bestimmte Gruppe von Mitmenschen, die wir für die von uns als defizitär empfundene Lage verantwortlich machen. Wir unterliegen dann – meist, ohne dass uns dies bewusst wird – der »Illusion der falschen Urheberschaft« (Roth 2007, S. 280), einer Art zerebralem Kurzschluss. Wir halten das Verhalten des Gegenübers für die Ursache unseres Befindens, indem wir unsere Gefühle »an bestimmte Geschehnisse (heften), die im Zweifelsfall primär gar nichts mit ihnen zu tun haben« (ebd., S. 9).
Diesen Mechanismus der falschen Verursachungszuschreibung zu durchschauen ist ein erster wesentlicher Schritt jeglicher Persönlichkeitsbildung. Mit diesem brechen wir nicht bloß aus der unterkomplexen Welt der linear-mechanistischen Zuschreibungen aus, wir entkommen auch der Opferrolle.
In der Opferrolle verharren wir nämlich bevorzugt, weil sie uns – scheinbar – entlastet: Andere sind schuld und tragen die Verantwortung für unsere Lage! Eine solche Sicht der Dinge ist aber nur auf den ersten Blick eine Entlastung, in Wahrheit beschweren wir uns – wir machen es uns schwer! –, und wir verpassen den Aufbruch in die Selbstverantwortung. Die Selbstverantwortung, um die es hierbei geht, ist umfassend. Sie zeigt uns, dass wir eine Wahl haben: Wir können den Mechanismus einer »Illusion der falschen Urheberschaft« (ebd.) durchschauen und hinter uns lassen oder an ihm festhalten. Wem es gelingt, tatsächlich zu begreifen,
»(…) dass er der Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeit ist, dem steht das bequeme Ausweichen in Sachzwänge und in die Schuld der anderen nicht offen« (Watzlawick 2011b, S. 80 f.).
Hat man diesen Schritt in die Ernüchterung erst einmal absolviert, dann bewegt sich das eigene Denken, Beurteilen und Schlussfolgern behutsamer. Wir können dann beginnen, den emotionalen Kräften und den inneren Bildern in uns nachzuspüren, die uns immer und immer wieder dazu drängen wollen, Recht zu haben und Recht behalten zu wollen. Dabei decken wir mehr und mehr unsere eigenen Unsicherheiten gegenüber einer unerklärten, unsicheren und deshalb unbegreifbaren Wirklichkeit auf, und wir entdecken, dass wir nicht nur zur falschen Zuschreibung der Urheberschaft tendieren, sondern auch zur Entschiedenheit. Diese Haltung ist ungeduldig und drängt uns dazu, spontan zu urteilen und zu bewerten: »Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende!« – lautet die Parole dieses Ausbruchs aus der Unsicherheit: »Lieber erkenne ich in dem Ungewohnten und mich Ängstigendem das, was mir vertraut ist, als dass ich noch länger in der beängstigenden Erklärungssuche verharre!«
Persönlichkeitsbildung ist der Weg zur Bewusstheit durch Selbstreflexion. Dieser führt uns zu einem immer tieferen Verständnis der Mechanismen in uns und zwischen uns, die unser Bild von der Wirklichkeit erzeugen. Dieser Weg ist kein Spaziergang durch den Lustgarten anregender und unterhaltsamer Eindrücke. Er ist vielmehr ein mühsamer Aufstieg zu der Aussichtsplattform, die uns nicht nur den Blick auf das, was uns treibt, eröffnet, sondern auch auf unsere verpassten Gelegenheiten, diejenigen zu werden, die wir sein könnten.
Wer sich auf diesen Aufstieg einlässt, wird fündig. Zunächst findet er zahlreiche Gründe dafür, sein bisheriges Erleben neu zu bewerten. Dabei stößt er auch auf viele Anlässe, sich bei den signifikanten Konfliktpartnern seines Lebens für die Verwechslung zu entschuldigen: »Verzeihe mir, dass ich dich so gesehen habe, wie ich dies vermochte. Dadurch bist du mir in dem, was du eigentlich bist und auch für mich hättest sein können, entgangen! Welche Begegnung wäre zwischen uns möglich gewesen, wenn ich die Mechanismen meiner Wirklichkeitskonstruktion nur früher hätte durchschauen können!«
Robert war mit diesen Gedanken keineswegs einverstanden; zu unausweichbar meldete sich seine Entschiedenheit zu Wort: »Das klingt ja so, als würde ich mir alles, was ich in meinen Beziehungen empfinde, selbst machen. Das kann doch wohl nicht sein! Es gibt doch neben allen ›Illusionen der falschen Urheberschaft‹ auf meiner Seite auch so etwas wie die Offenheit, Selbstreflexion und Beziehungsfähigkeit des Gegenübers! Was machen Sie denn, wenn Sie mit Ihrer Selbstreflexion gut vorangekommen sind, es aber mit einem Gegenüber zu tun haben, für das Sie der Urheber allen Übels sind und bleiben?«
Auf diese und andere Fragen wird in dem vorliegenden Buch eingegangen. Dabei wird auch zur Sprache kommen, dass die Persönlichkeitsbildung uns nicht nur selbst verändert, sondern schließlich auch dazu führt, dass wir die Rollen in unseren sozialen Beziehungen und diese Beziehungen selbst neu bewerten. Wir erkennen dann nicht nur, welche Verwechselung wir selbst an den anderen vornehmen, sondern auch, welchen Verwechselungen wir selbst beständig ausgesetzt sind. Und wir erfahren, wie wir solchen Indienstnahmen elegant ausweichen oder uns auch von ihnen abgrenzen können.
Die gereifte Persönlichkeit benötigt reife Kontexte, um sein zu können, was sie mittlerweile geworden ist, und sie weiß, wofür sie zur Verfügung steht und wofür nicht (mehr).
Der Hintergrund für die hier vorgetragenen Überlegungen, Vorschläge und auch Empfehlungen ist der einer systemischkonstruktivistischen Bildungstheorie. Diese geht davon aus, dass Bildung bzw. Gebildetheit letztlich eine Kompetenzreifung beschreiben, die mehr umfasst als ein Sichauskennen in Themen, Fachgebieten und Kulturbestandteilen. Bildung wird in ihrem Kern als Persönlichkeitsbildung gedacht, zumal man viel wissen kann, ohne dadurch in seiner Persönlichkeit zu wahrer Selbsterkenntnis, sozialer Resonanzfähigkeit und konstruktiver Gestaltungskraft vorangeschritten zu sein (vgl. Arnold 2015a).
Persönlichkeitsbildung beschreibt den Zustand gestärkter, gezügelter und bezogener Ichkräfte: Wer diese Kräfte aus sich heraus entwickeln konnte, weiß, was in ihm steckt (= Stärkung), ist gleichwohl den Selbsterwartungen und den Erwartungen der anderen nicht einfach nur ausgesetzt (= Zügelung), sondern ist insbesondere in der Lage, seine Bezogenheit auf andere sowohl »mit« als auch »gegen« diese so zu balancieren, dass Ichbildung und Identitätsbewusstsein gelingen können (= Bezogenheit) (vgl. Stierlin 2014, S. 57).
In diesem Prozess der Persönlichkeitsbildung bewegt sich das Individuum zwischen Anpassung und Widerstand, zwischen Aneignung und Gestaltung – mit jeweils spezifischen Ausdrucksformen, die sich kaum prognostizieren und nur schwer verändern lassen. Diese Ausdruckformen bilden eine Art Basispersönlichkeit, mit der wir für andere, aber auch für uns selbst berechenbar bleiben. Der Mensch ist somit kein unvoreingenommen auf seine Umwelt blickendes Wesen; er beobachtet, schlussfolgert und reagiert vielmehr auf der Basis seiner biografisch erworbenen »Annahmen«. Der Physiker David Bohm (1917–1992) schreibt:
»Der Beobachter ist das Beobachtete. Wenn wir die beiden nicht zusammensehen, den Beobachter und das Beobachtete bzw. die Annahmen und die Emotionen, erhalten wir ein völlig falsches Bild. Wenn ich sage, ich will sehen, was in meinem Geist vorgeht, aber meine Annahme nicht mitbedenke, bekomme ich ein falsches Bild, weil die Annahmen es sind, die beobachten« (Bohm 2011, S. 136).
Dies bedeutet: In dem, was in ihm ein Erkennen, eine Resonanz, eine Interpretation oder gar einen Handlungsimpuls auszulösen vermag, ist der Mensch vornehmlich von dem bestimmt, was er an Erfahrungsmustern bereits in sich trägt. Er ist ein »Erfahrungstier«, wie dies Michele Foucault auszudrücken wusste (Foucault 1996). Als solches handelt er »strukturdeterminiert«; sein Denken, Fühlen und Handeln folgen der Struktur der eigenen Deutungs- und Emotionsmuster – mit der Folge: Er ist »lernfähig, aber unbelehrbar« (Siebert 2015).
Der Mensch ist zwar prinzipiell in der Lage, seine bisherigen Formen des Denkens, Fühlens und Handelns aufzugeben, wenn diese ihm kein weiterführendes Handeln mehr ermöglichen – auch, wenn er meist darum bemüht bleibt, seine bewährten Annahmen, Sichtweisen und Gewohnheiten lediglich zu modifizieren und an ihnen so lange wie nur möglich festzuhalten. Doch ist er nicht nur ein Gewohnheits- und Erfahrungs-, sondern auch ein Reflexionstier! Dabei ist es jedoch keineswegs so, dass die überzeugende Kraft des besseren Arguments bereits aufklärend zu wirken vermag – eine ärgerliche Tatsache, mit der sich alle Formen einer professionellen Erwachsenenbildung nur sehr mühsam zu arrangieren vermochten. Nur allmählich öffneten sich deren Theorien und Konzepte
»(…) gegenüber den nüchternen Einsichten der Emotions- und Hirnforschung, dass das Fühlen, Denken und Handeln der Menschen komplexeren – inneren – Logiken folge. Deutungsmuster lassen sich somit nicht allein durch Wissensvermittlung und damit Inhaltsaneignung ›aufklären‹. Erwachsene sind stets im Kokon ihrer gespürten Identität und Plausibilität gefangen, weshalb ein wirklich nachhaltiges Lernen nur gelingen kann, wenn die Lernenden ebenso umfassend in ihrer emotionalen Identitätsentwicklung angesprochen und auch zu dichten emotionalen Prozessen des Umspürens, des Selbsterlebens und der Selbstveränderung veranlasst werden können« (Arnold u. Schüßler 2015, S. 70).
Das vorliegende Buch ist ein solcher Anlass. Es greift die wesentlichen Einsichten zur Persönlichkeitsbildung auf – Einsichten aus der Bildungsforschung, aber auch aus der Denk- und Wahrnehmungsforschung sowie aus dem Bereich des Emotionalen Konstruktivismus (vgl. Arnold 2012). Dabei verbleibt die Darstellung nicht bei der nüchternen Erörterung der inneren Mechanismen, mit denen die Menschen sich ihre inneren Bilder, ihre Beurteilungs- und Handlungsmuster aneignen und diese zu einer authentischen Gewissheit verdichten. Es wird vielmehr versucht, die dabei zutage tretenden Einsichten pragmatisch zu wenden. Ziel ist es, zu konkreten Formen der Übung und Selbstveränderung vorzustoßen, damit Persönlichkeitsbildung als das wirksam werden kann, was sie in ihrem Kern ist: eine persönliche Weiterentwicklung zu vielfältigeren und Perspektiven eröffnenden Formen des Denkens, Fühlens und Handelns – allein und in der Beziehung zu anderen.
2 So betonen u. a. die Hirnforscher Gerhard Roth und Manfred Spitzer unisono, »dass Bedeutungen gar nicht übertragen werden können, sondern in jedem Gehirn erzeugt (konstruiert) werden müssen« (Roth, S. 269). Oder: »Vermitteln kann man eine Mietwohnung oder vielleicht sogar eine Heirat. ›Stoff‹ jedenfalls kann man nicht vermitteln! Ebenso wenig wie Hunger. Hunger produziert sich jeder selbst, und Lernen produziert sich auch jeder selbst. Jeder auf seine Weise; und jeder lernt auch auf seine Weise und eben genau dasjenige, was in das Gefüge seiner Synapsengewichte am besten passt« (Spitzer 2007, S. 417).
29 Regeln zur Persönlichkeitsbildung
Regel 1: Nimm deine Biografie als das, was sie ist: eine Erzählung dessen, was gewesen ist. Lies sie und integriere sie, ohne beständig aus ihr zu zitieren!
Menschen leben im Repeat-Modus: Sie sind in ihrem Denken, Fühlen und Handeln stets auch dem treu, was sie waren und was sie geworden sind. Kaum einer vermag aus einer ständigen Distanzierung von seinem früheren Leben heraus eine wirklich tragfähige Vorstellung von der eigenen Zukunft zu entwickeln. Selbst, wenn wir uns aus vergangenen Bindungen gelöst haben, um neue Wege zu gehen, nehmen wir uns selbst und unsere Sicht der Welt mit. Dadurch sorgen wir dafür, dass wir uns nicht völlig verlieren, sondern auch in den neuen Lebenslagen auf vertraute Weise denken, fühlen und handeln können. Nicht selten entfalten die dabei wirkenden inneren Mechanismen allerdings auch eine Art Eigenleben, und ehe wir‘s uns versehen, finden wir uns in den vertrauten Gefühlen der Vergeblichkeit, der Ausgrenzung oder der Enttäuschung wieder. Doch die Anlässe für diese Gefühle liegen nicht im Außen – selbst, wenn wir sie dort immer wieder zu finden meinen.
»Was heißt das denn? Soll ich mich etwa völlig auflösen, um dann mit meinen 52 Jahren Lebenserfahrung völlig ohne Substanz dazustehen?« – so die Frage eines Workshopteilnehmers. »Schließlich bin ich doch bislang ganz gut gefahren mit dem, was ich für angemessen, richtig oder zumutbar hielt, und meinen entsprechenden Reaktionen!« Auf die Nachfrage, ob er denn der Meinung sei, dass er den Menschen, von denen er sich in seinem bisherigen Leben abgewandt hat, mit seiner Beurteilung wirklich gerecht geworden ist, wurde er still und sagte: »Um ehrlich zu sein. Mir passiert es immer wieder, dass ich mich schnell über jemanden aufrege und ihm dann auch kaum mehr eine weitere Chance biete, sich mir anders zu zeigen!«
Dieses Beispiel zeigt: Die eigene Kontinuität ist eine wichtige, aber nicht unproblematische Substanz. Sie gibt unserer Persönlichkeit Beständigkeit, legt ihr aber auch Fesseln an. Lektionen der Vergangenheit, die dereinst das Überleben sicherten, können uns in unserem heutigen Leben einengen und von den einmaligen Potenzialen der jeweiligen Situation trennen.
Wir sehen dann den neuen Arbeitsplatz durch unsere bisherigen Erfahrungen. Dem neuen Vorgesetzten begegnen wir mit dem bei früheren Führungspersonen oder bereits bei den eigenen Eltern entstandenen Unbehagen. Oder wir nähern uns dem neuen Partner voller Ängste und Vorbehalte, die mit ihm nichts, mit unserer Biografie aber viel zu tun haben. Indem wir uns in dieser Weise dem Neuen nähern, betrachten wir es aus unserer Vergangenheit – nicht selten mit dem Ergebnis, dass auch dieses Neue mehr und mehr der Erfahrung gleicht, die wir bereits in uns tragen. »Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind!« heißt es im Talmud, einer jüdischen Schrift aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Dies bedeutet: Wir zitieren beständig aus unserer bisherigen Biografie – meist leise, oft aber auch laut, indem wir in unseren aktuellen Beziehungen Redewendungen verwenden und Vorwürfe adressieren, deren Originalton dem eigenen Kinderzimmer entstammt.
Diesen Wahrnehmungsmechanismus bezeichnet die Sozial- und Wahrnehmungspsychologie seit Langem als Projektion. Gemeint ist damit der Sachverhalt, dass
»(…) ein Mensch immer nur wahrnehmen kann, was er zumindest als Hypothese in sich trägt, bzw. die äußere Realität immer seinen Mechanismen angleicht« (Maurer 2000, S. 36).
Unsere Biografie stiftet uns somit die Hypothesen, mit deren Hilfe wir uns in der Zukunft orientieren – nicht eins zu eins, wohl aber in der Form unserer tragenden Gewissheiten, lauernden Befürchtungen, ausschnitthaften Fokussierungen und in dem steten Bemühen, uns selbst mit unseren vertrauten Formen des Denkens, Fühlens und Handelns wiederentdecken zu dürfen.
Eine tragfähige Konzeption der Persönlichkeitsbildung weiß nicht nur um die Mechanismen der selbst erfüllenden Prophezeiung, sie kennt vielmehr auch deren zähe Verankerung in unserem Leben mit seinen Lektionen (vgl. Watzlawick 1988).
Bereits der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget (1896–1980) hat diesen Mechanismus des Erkennens, Deutens und Schlussfolgerns genauer analysiert. Er sprach von zwei gleichzeitig stattfindenden Wechselbewegungen des Erkennens und Lernens, welche er mit etwas sperrig daherkommenden Begriffen bezeichnete – nämlich der Assimilation (auf eine neue Situation wird mithilfe bereits vorhandener Muster des Denkens, Fühlen und Handelns reagiert) und der Akkomodation (bisherige Muster werden erweitert und an die Wirklichkeit angepasst). Er schreibt:
»Erkenntnis erwächst ursprünglich weder aus den Objekten noch aus dem Subjekt, sondern – aus zunächst unentwirrbaren – Interaktionen zwischen dem Subjekt und diesen Objekten. Diese (anfänglich) sehr einfachen Interaktionen formen ein engmaschiges und unauflösliches Netz. (…)
Kein Verhalten nämlich, selbst wenn es für Individuen neu ist, bedeutet einen absoluten Neuanfang. Es wird stets auf schon vorhandene Pläne übertragen und bedeutet deshalb im Grunde nur die Assimilierung neuer Elemente an bereits aufgebaute Strukturen« (Piaget 1981, S. 32 u. 42).
Wir sind somit ebenso mit unseren Annahmen identisch, wie wir auch zur nüchternen Prüfung, Auswertung und verändernden Schlussfolgerung fähig zu sein vermögen. Dann können sich unsere vertrauten Deutungsmuster wandeln, und wir können auch aus beengenden oder beängstigenden Emotionsmustern aussteigen und Neues wagen. Solche Veränderungen bewirken letztlich eine »Modifikation« unserer »Assimilierungsstruktur« – ein Effekt, den Jean Piaget, wie gesagt, als »Akkomodation« bezeichnet (ebd., S. 44). Diese ist zunächst unwahrscheinlich, funktionieren unsere Wahrnehmungsmechanismen doch so, dass sie nach Bestätigung suchen und die uns verfügbaren und vertrauten Erklärungen zunächst dazu verwenden, das Neue zu interpretieren. Die Hirnforscher sprechen in diesem Zusammenhang davon, dass angesichts solcher neuen Lagen ein »Neuronennetzwerk«
»(…) neu angelegt bzw. ein vorhandenes ›umverdrahtet‹ werden (muss). Die entsprechenden Areale erhalten nun die Aufgabe, sich mit dem Problem zu befassen. Dabei kann es sich um das Erkennen eines unbekannten Objekts, das Verstehen einer neuartigen Aussage, das Erlernen einer ungewohnten Bewegung, das Lösen eines Problems oder das Vorstellen eines neuartigen Sachverhalts handeln. Letztlich müssen immer neue Neuronenverknüpfungen angelegt werden, die in der Lage sind, ein Verhalten zu steuern oder einen internen Zustand zu erzeugen, welcher vom Gehirn als Lösung des Problems angesehen wird. Das geschieht mit allen Mitteln, die dem Gehirn zur Verfügung stehen, und dies sind neben den aktuellen Sinnesdaten auch die Gedächtnisinhalte, die auf ihre mögliche Relevanz hin geprüft werden müssen« (Roth 1997, S. 232).
Persönlichkeitsbildung muss deshalb – so die diesem Buch zugrundeliegende These – um die eigenen – gewissermaßen: bevorzugten – Erfahrungs-, Interpretations- und Bewertungsmuster wissen, will sie nicht die für jegliche Persönlichkeitsbildung grundlegende Dimension der Bewusstwerdung verfehlen.
Wer in diesem Sinne wirklich um seine eigene Strukturdeterminiertheit weiß, der beobachtet, beurteilt und bewertet zurückhaltender. Ihm bleibt stets bewusst, dass er »nicht weiß«, um den bekannten Spruch von Sokrates (469–399 vor Chr.) korrekt zu zitieren. Dieser hatte nämlich keineswegs behauptet, dass er »nichts« wisse, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass alles menschliche Wissen letztlich ein »Scheinwissen« sei (Böhme 2002, S. 195 ff.) – gespeist und häufig zur Entschiedenheit versteift durch unser Bedürfnis nach Sicherheit, Bescheidwissen und Rechthaben, weil wir nach Berechtigung streben. Letztlich können wir heute einen Schritt weiter gehen als Sokrates und ernüchtert feststellen: »Ich weiß, dass ich nicht weiß, sondern nur beständig aus meiner Biografie, der Summe meiner Geschichten, Erfahrungen und Ichzustände, zitiere!«
Wer in diesem Sinne das eigene Wissen als Scheinwissen entlarven konnte und diesen Zustand tatsächlich auszuhalten vermag, der mutet sich seinem Gegenüber dann nicht mehr so zu, wie er selbst die Situation kognitiv und emotional zu konstruieren gelernt hat, sondern weiß um die beständig störende Einmischung seiner eigenen Gewissheit. Für ihn ist der Satz Ludwig Wittgensteins leitend, der feststellte: »Dass es mir – oder Allen – so scheint, daraus folgt nicht, dass es so ist« (Wittgenstein 1984, S. 119). Er muss dann nicht mehr derjenige bleiben, der sich berechtigt fühlt, weil er Recht hat, sondern er kann sich berechtigt fühlen, weil ihm die Vordergründigkeit dieses Gefühls bewusst geworden ist und er nach anderen Substanzen seiner Identität zu suchen in der Lage ist. Welche Substanzen könnten dies sein? Ludwig Wittgenstein schreibt:
»Dass es den Menschen so scheint, ist ihr Kriterium dafür, dass es so ist. (…) Wir haben Vorurteile die Verwendung der Wörter betreffend« (ebd., S. 60).
Die Substanz der Persönlichkeitsbildung kann sich deshalb auch nicht aus einer anderen Gewissheit – frei von Vorurteilen und Überlieferung – ergeben. Sie kann nur aus der spürbar gelebten Ernüchterung über das, was uns zäh umklammert und zur Entschiedenheit drängt, entstehen. Zunächst ist es deshalb weiterführend, in Konflikten und dissonanten Lagen nicht nur nach den als beengend oder beängstigend empfundenen Bedingungen im Außen zu fragen, sondern nach den sich immer wieder in unsere Sicht der Welt einmischenden Erfahrungen und Gewissheiten. Aus diesen auszusteigen und das Lamentieren vermeiden zu können öffnet uns gegenüber anderen neue Möglichkeiten des Denkens, Fühlens und Handelns. Wir lernen mit der Zeit, unseren Spontanbewertungen selbst elegant auszuweichen, eine »Stop-and-think-Schleife« einzulegen und in den Unterschied des »Es könnte alles auch ganz anders sein!« (Stock 2015) zu gehen.
Der Unterschied kennt nicht nur den Gegensatz, sondern auch das »Und«. Wer in den Unterschied zu gehen versteht, der lässt das Entweder-oder-Denken hinter sich, von welcher der Maler Kandinsky aus kunsttheoretischer Sicht zu sagen wusste: »Neue Erscheinungen werden von der alten Basis aus betrachtet und auf eine tote Art behandelt« (Kandinsky 1973, S. 99). Demgegenüber plädiert Kandinsky für ein Denken und Handeln im Modus des »Und« – so der lapidare Titel seines ursprünglich im Jahre 1927 veröffentlichten Aufsatzes. »Das Erkennen des Äußeren« – so Kandinsky –
»kann nur in dem Fall eine Tür in die Zukunft werden, wenn diese Erkenntnis eine Brücke zum Inneren schlägt« (ebd., S. 100).
Der Modus des »Und« markiert somit eine systemische Form der Beobachtung, welche die Ganzheit der Wirkungsgefüge zwischen dem Innen und dem Außen der Akteure stets mit beobachtet. Diese Ganzheit ruft uns auch stets die Relativität der eigenen Gewissheiten ins Bewusstsein, nicht deren Beliebigkeit. Erst, wenn uns bewusst geworden ist, dass alles auch ganz anders sein könnte und der andere, z. B. der uns fremde Mensch auch Recht hat, nämlich sein Recht, dann können wir uns auch der Frage zuwenden, an welchen universalen Kriterien wir unser Zusammenleben und unseren Selbstausdruck in Zukunft messen wollen.
Offenheit braucht Akkomodationskompetenz. Diese beschreibt nach Piaget die Fähigkeit des Menschen, die eigenen Deutungs- und Emotionsmuster zu transformieren und zu neuen – offeneren – Formen vorstoßen zu können. Wer die beiden komplementären Mechanismen des Erkennens kennt und deren Wirken in seinem eigenen Denken, Fühlen und Handeln zu reflektieren vermag, der ist auch leichter in der Lage, aus den vertrauten Assimilationstechniken auszusteigen. Er ist den Wirkungsmechanismen seines Erkennens, Interpretierens und Schlussfolgerns nicht mehr besinnungslos ausgesetzt, indem er zunächst assimiliert und erst im Versagensfall zur Akkomodation schreitet, er kann sich vielmehr darin üben, das Akkomodieren zu einer bewussten Erkenntnistechnik zu verfeinern, indem er stets die Frage in sich trägt, was ihm das aktuelle Geschehen über sich selbst in Erinnerung ruft. Dabei verliert die Vergangenheit mehr und mehr ihre bestimmende Kraft und wird als wesentlicher, aber abgeschlossener Anteil in die eigene Persönlichkeit integriert.
Abbildung 1 stellt Fragen auf dem Weg zur Akkomodationskompetenz zusammen.
Dieser Selbst-Check beinhaltet eine Bewegung, die der Konstruktivist Francisco Varela (1946–2001) als »selbsteinschließende Reflexion« beschrieb (Varela u. a. 1995). Diese Reflexion beschreibt eine Beobachtungsform, welche man mit einiger Übung zur Routine werden lassen kann. Dadurch kann erreicht werden, dass »gewohnheitsbedingte Urteile aufgegeben (werden)« und »bei der Beobachtung von Phänomenen plötzlich unsere eigene Regie wahrnehmbar (wird)« (Scharmer 2009, S. 60). Dadurch wandelt sich unsere Fokussierung, und es kann neu bzw. Neues wahrgenommen werden und entstehen.
Selbst-Check:
Assimilierst du noch oder akkomodierst du schon?
Anregungen zur Selbstlösung aus vertrauten Sichtweisen und Reaktionsformen
Anhalten
•Was geschieht gerade?
•Welche bekannten Reaktionsweisen bauen sich in mir auf?
•Möchte ich deren Folgen dem Gegenüber wirklich zumuten?
Konfliktvermeidung
•Welche verstehbare Anfrage an mich wird hier artikuliert?
•Wie kann ich deren Berechtigung wertschätzend aufgreifen?
•Welche – überraschende – andere Reaktion wäre meinerseits möglich?
Konstruktion
•Welcher neuen Interpretation werde ich folgen?
•Welche Sichtweisen muss ich dabei verändern oder aufgeben?
•Welche Auswirkungen wird dies für mein Leben haben?
Offenheit
•Wie vermeide ich, dass ich mich an meine Beurteilungen klammere?
•Wie übe ich mein Anfreunden mit dem Unterschied?
•Wie werde ich selbst vielfältiger?
Meditation
•Wie werde ich meiner inneren Bilder und Empfindlichkeiten gewahr?
•Wo haben diese ihren Ursprung?
•Wie kann ich sie dort lassen, wo sie hingehören?
Opferlosigkeit
•Wo bewege ich mich selbst gerne in einer Opferrolle?
•Wie kann ich diese vermeiden?
•Wie vermeide ich, andere in der Opferrolle zu lassen?
Defizitvermeidung
•Wie vermeide ich den Defizitblick auf andere?
•Wo fühle ich mich selbst defizitär?
•Wie vermeide ich die sich daraus ergebenden Interpretationen und Handlungen?
Abb. 1: AKKOMOD – Die Kunst des Akkomodierens
Regel 2: Prüfe nicht (nur) das, was dir zu sein scheint, sondern richte deinen Blick auf das, was sein könnte, aber noch nicht in Erscheinung treten durfte!
Die Einsicht, dass »alles auch ganz anders sein (könnte)« (Stock 2015), verweist den Beobachter nachdrücklich auf die Beobachtung seiner bevorzugten Formen der Beobachtung und deren mehr oder weniger wertschätzenden Vergleich mit den Beobachtungen anderer Beobachter. Diese reflexive Bewegung ist für eine rauschfreiere Deutung und Interpretation dessen, was er sicher zu sehen glaubt, von grundlegender Bedeutung, wobei das Rauschen sich durch die beständigen Zwischenrufe der eigenen Gewissheiten ergibt.
Und doch stellt diese Selbstreflexion bloß den ersten Schritt auf dem Weg zu einem Potenzial erschließenden Umgang mit Gegenübersystemen dar. Der Beobachter muss auch (er)klären, wie anders das sein könnte, was er beobachtet. Er muss wissen, wie er herauszufinden vermag, was das Gegenüber tatsächlich beabsichtigt. Und schließlich muss er mit der Frage umgehen können: »Wie anders kann das, was mir der Fall zu sein scheint, wirklich sein, wenn es Evidenzen oder gar Standards gibt, die nicht nur ich als solche (an)erkenne?« – Fragen über Fragen, auf die eine beobachtertheoretisch durchgearbeitete Wahrnehmungstheorie Antworten geben muss.
Nicht alles, was auch gemeint sein könnte, ist gültig, d. h., die verschiedenen Interpretationen sind zwar für den einzelnen gültig, aber nicht für alle Beobachter gleich gültig. Sie beinhalten nach deren Einschätzung keinen gangbaren – viablen – Weg zur Lösung. Wäre alles gleich gültig, dann hätten wir es mit einer gleichgültigen Wahrnehmungstheorie zu tun, die uns nicht zu erklären vermag, wie wir in der gesellschaftlichen Kommunikation Klärungen herbeiführen, Absprachen treffen und Handlungen – auf der Basis einer sozialen Konstruktion der Wirklichkeit – wirksam koordinieren können. Kenneth J. Gergen plädiert deshalb in seiner »Hinführung zum sozialen Konstruktionismus« für dessen Position mit den Worten:
»Hier liegt der Schwerpunkt auf Diskursen als Vehikel für die Artikulation des Selbst und der Welt sowie auf der Art und Weise, in der diese Diskurse innerhalb sozialer Beziehungen wirken« (Gergen 1999, S. 81).
Konkret geht es um die Frage, wie der reflektierte Beobachter selbst nicht nur an seiner eigenen, sondern auch an der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit beteiligt ist. Diese entsteht nämlich aus den Diskursen über die Vielfalt der Deutungen und Interpretationen mit dem Ziel, – gemeinsame – Lesarten zu (er) finden, die von mehreren Beteiligten als tragfähige Sicht der Wirklichkeit angesehen und akzeptiert werden können. Zwar fließen in diese Lesart auch weiterhin unterschiedliche Interpretationen und Interessen ein, doch geht von dem im Diskurs vereinheitlichten Sprachgebrauch eine verbindende Kraft aus, die einem sozial geteilten Verständnis schon sehr nahe kommt. Diese sozialkonstruktivistische Dimension der Wirklichkeitserzeugung wird meist übersehen. Deshalb tragen die Argumentationen systemisch-konstruktivistischer Provenienz bisweilen eigenartig individualistisch-solipsistische Züge. Sie lassen den Eindruck entstehen, jeder Beobachter könne sich seine ganz eigene Welt konstruieren. Solche Einschätzungen werden oft als unterkomplex – wenn nicht sogar als trivial – empfunden. Demgegenüber folgt eine beobachtende Gestaltung der Einsicht, dass