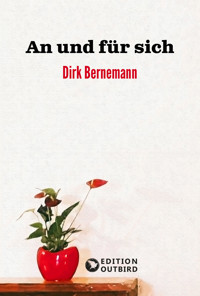Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unsichtbar
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leute bewegen sich durch Dörfer und Städte, essen Dosenravioli und trinken Spezi und gehen auf subversive Popkonzerte. Irgendwo beginnt ein Krieg, der aber nie sein Gesicht zeigt, immer aber da ist. Ob Liebe Fragen beantwortet oder eher welche stellt, weiß man erst, wenn man sich traut, die Fragezeichen in seinem Leben zuzulassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
©opyright 2015 by Autor
Cover: Liú Quara
Lektorat: Miriam Spies
Satz: Fred Uhde, Leipzig (www.buch-satz-illustration.de)
ISBN-EBook: 978-3-95791-028-8
ISBN-Print: 978-3-95791-027-1
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist
nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet.
Hat Dir das Buch gefallen? Schreib uns Deine Meinung unter:
Mehr Infos jederzeit im Web unter www.unsichtbar-verlag.de
Unsichtbar Verlag | Wellenburger Str. 1 | 86420 Diedorf
Dirk Bernemann
Wie schön alles begann und wie traurig alles endet
Wie schön alles begann …
Die Wolken da oben, die machen mir Sorgen. Ich stelle mir vor es wären Flugzeuge, die bis zum Rand mit Bombenmaterial gefüllt sind, die so schwer sind, dass sie gerade noch fliegen können und die irgendwann, ganz, ganz bald ihre Klappenaufmachen und den ganzen Ballast, den sie in sich bergen, einfachfallen lassen. Wie eine alte, stuhlinkontinente Frau, die nach langer Zeit der Obstipation endlich mal alles schmerzfrei rauslassen kann, was da in ihr gärt.
Die Stadt tut so, als sei sie ein sicherer Ort. Ganz so, als sei sie eine Festung, in der es sich lohnt, irgendwie gesund zu bleiben, sich gut zu ernähren und Sport zu treiben, zu joggen oder Fahrrad mit Fahrradhelm zu fahren, nicht zu rauchen und ein stabilesSozialleben mit Spieleabendfreunden zu führen. So mit allem was dazu gehört. DasganzeSpektrumderBürgerlichkeit. Und dazu gehört eine Menge. So ein Leben, das man mit einer Lebensversicherung lohnenswert versichern kann. So ein versicherbares Leben muss man sich erstmal leisten können. Doch auch die Leben knistern, überall höre ich alles zerbrechen, Steine reißen ein, ganz langsam wird der Beton porös und zersetzt feinstaubend die Mauern, hinter denen sich die Leute in Sicherheit wähnen und ihre gesunden Sachen essen und Joggingtouren, Wellnessurlaube und eigene Begräbnisse planen. Und ich laufe durch die Schneisen dieser Stadt, denn ich habe ein konkretes Anliegen.
Doch während ich durch die betont schattigen Betonschluchten laufe, höre ich es knistern und ich weiß, es ist das Knistern, welches entsteht, bevor Beton bricht. Es ist noch sehr leise und man kann es nur wahrnehmen, wenn man sich darauf konzentriert. Manchmal bleibe ich auf Ampelkreuzungen stehen, um dem Verfall zuzuhören. Ob sie mich deswegen für einen Irren halten, ist mir egal. Sie alle werden betroffen sein, wenn die Häuser einstürzen. Ich bin nicht verrückt, ich höre es deutlich, dass die Wohnblöcke knistern. Wir stehen alle am Rand einer Katastrophe, die scheinbar unscheinbar vonstattengeht.
Und die Menschen knistern erst recht. Wenn ich zum Beispiel in diesem großen vierstöckigen Kaufhaus auf der Rolltreppe fahre, dann schließe ich mit mir selbst Wetten ab, dass pro Rolltreppenfahrt maximal zwei Personen so etwas wie ein Lächeln oder ein Lachen mit sich führen. Der Rest guckt ausschließlichangewidert. Ich gewinne diese Wetten immer. Zu jeder Tageszeit. Ihre Angewidertheit ist irgendwie schick. Die Gesichtsausdrücke wirken wie einstudiert, die Art, wie sie Getränke halten, wie sie Einkaufstüten tragen und wie sie in engen Hosen gehen. Wie sie ihre Bärte trimmen, wie sie ihre Studien beenden. Wie sie ihre Leben planen. Wie sie trotzdem so tun, als sei alles ein Zufall. Wie sie trotzdem so tun, als sei alles gut. Wie sie trotzdem so tun, als engagierten sie sich gegen etwas Böses. Sie sind längst Teil des Bösen geworden. Ich wahrscheinlich auch. Ich fahre mit ihnen Rolltreppe. Fühle mich oben und unten und mittlerweile sogar in der Mitteschlecht. Ich suche dich. Ich habe ein konkretes Anliegen.
Du hast immer gesagt, dass der nächste Krieg bestimmt ganz bald kommt und wir ihn noch erleben werden und eigentlich hast du gemeint, dass diese Welt durch den Krieg vielleicht aufgeräumt werden würde, zumindest ein bisschen und außerdem hast du gemeint, dass wir beiden uns, solange es diesen Krieg gibt, in einem kleinen Zimmer verstecken, ab und zu ein Auge auf den Krieg werfen, aber uns ansonsten ruhig verhalten. Solange es eben dauert, hast du gemeint und man könnte Dosenravioli und Spezi kaufen und die Zeit des Krieges mit Leuten verbringen, die man gerne hat. Jetzt spüre ich, dass der Krieg kurz bevorsteht und du einfach mal unerreichbarer als der Weltfrieden bist. Die Häuser knistern, die Menschen knistern. Ich habe ein konkretes Anliegen. Ich suche dich und ich will dich finden, bevor der Krieg losgeht. Ich habe Dosenravioli und Spezi für uns gekauft. Der Kühlschrank ist voll, alle Akkus sind aufgeladen. Nur du fehlst mir. Ich suche dich.
Ich weiß, dass diese Stadt dich irgendwo verschluckt hat, vielleicht verdaut sie dich gerade und wird dich irgendwo anders wieder ausscheißen. Ich würde dich dann trotzdem mit nach Hause nehmen, auch wenn die Stadt dich unlängst ausgeschissen hätte und du genauso aussehen und riechen würdest, als wärest du unlängst von der Stadt ausgeschissen worden. Ja, ich würde dich in mein Zimmer tragen, dich von der Lebensscheiße säubern und dich mit Dosenravioli und Spezi füttern und ins Leben zurückholen. Ich würde dir aus der Zeitung vorlesen. Zum Beispiel vom Krieg, wenn dich das interessiert. Ich weiß, dass du immer die Feuilletonscheiße gelesen hast und dich dann gut informiert gefühlt hast. Es ist unbedeutend, habe ich immer gesagt und du hast lass mich oder so geantwortet. Die Bedeutungslosigkeit der Feuilletonscheiße wäre mir jetzt sowas von egal, ich würde dir gern 10.000 unbedeutende scheiß Feuilletonzeilen vorlesen, wenn du sie nur von mir vorgelesen bekommen wollen würdest.
Auf der Suche nach dir laufe ich durch den Dreck der Stadt, vorbei an plakatierten Wänden, die vom kulturellen Leben in der Stadt erzählen. Sie, die Plakate, erzählen Metalfestival, Soulparty, ErotikmesseundBeachvolleyballturnier. Alles nicht von Belang. Was denn noch von Belang sei, außer zu überleben, fragt es leise und bestimmt in mir und ich habe darauf erstmal keine Antwort. Keine Antwort, aber ein konkretesAnliegen. Ich laufe weiter. Hätte mich jemand mit einer Kamera verfolgt, als ich heute um 12 Uhr 34 das Haus verlassen habe, hätte er mich für einen ziellosen Charakter gehalten. Einer, der erstmal ein paar Bahnen besteigt, irgendwo hinfährt, sich Leute anschaut, die zurückschauen, woraufhin er dann wegschaut. Einer, der Plätze begeht, die ihm egal zu sein scheinen und trotzdem irgendwie wichtig. Einer, der gehetzt wirkt, obwohl er Zeit hat. Einer, der streunt, der sich verstreut, der mit seinen Augen Areale scannt und sich durch die Betonwüste kämmt, der sich auskennt und verläuft. Einer, der ganz unwahrscheinlich ein konkretes Anliegen hat.
Mittlerweile dämmert es. Ich laufe am Fluß entlang. Lang und schmutzig zieht er sich durch die Stadt und trägt Touristen auf Booten und arrogante Schwäne. Hier und da stehen Biertrinker mit Freunden, Freundinnen und irgendwelchen gefundenen Menschen. Es ist ruhig, das Leben knistert hier etwas anders und etwas leiser. Hier und da stehen sich aneinander reibende und halbwegs ineinander verkeilte Paare. Am Spätkauf habe ich mir ein paar Flaschen Bier gekauft und der Himmel verfärbt sich orange, als ob er bluten würde. Ich trinke. Ich gewöhne mich an den Gedanken, dich vor Beginn des Krieges nicht mehr zu finden. Ich denke an Dosenravioli, Spezi und dich, die du weit weg bist, irgendwo in den Gedärmen dieser Stadt irgendetwas tust. Vielleicht bin ich noch ein kleiner Fleck in deinem Kopf, irgendetwas, was sich wie eine Erinnerung anfühlt und hoffentlich kein Tumor wird.
Ich erinnere mich an einen anderen Fluß, an dem ich als Jugendlichersaß, mitmeinenkomischen, bunten Freunden, die von sich behaupteten, Punks zu sein. Immer saßen wir da am Fluß, in diesem Dorf, hatten diesen Kassettenrekorder dabei, der Schrammeliges von sich gab und auch wenn die Musik gut produziert und klar definiert war, durch den Rekorder bekam sie die nötige Schrammeligkeit, um von uns betanzt zu werden. Und so vergingen die Tage der Jugend und wir hingen ab an diesem einen Platz, der uns gehörte, ein Ort, von dem uns niemand vertreiben konnte, an dem wir die Elite waren. Und manchmal hüpfen einem Dinge in den Kopf, Dinge, die man schon damals seltsam fand und die plötzlich wie zufällige Déjà-vus in den Kopf einbrechen.
Ich weiß noch, es war ein Donnerstag. Sommer. August oder so. Sehr warm auf jeden Fall. Ich war noch Schüler, hatte also an Nachmittagen nicht viel zu tun. Jugendfußball hatte ich zugunsten von Punkfreunden hinter mir gelassen und so beschäftigte ich mich mit abseitiger Kultur und das war das schönste und freieste, was man mit fünfzehn erleben konnte. An diesem Nachmittag waren wir zu viert. Dosenbier, selbstgedrehte Zigaretten. Kleine Leben im Aufwind und dazu Schrammeliges aus der illegalen Magnetbandkopiererei. Schramm, schramm, schramm und wir alle so: gegen Bullen, gegen Nazis, gegen Deutschland und gegen die Gesamtscheiße, die wir auch Schweinesystemnannten. Wie man heute weiß, eine viel zu harte Diskreditierung von Schweinen. Aber egal, damals brauchten wir diese mächtigen Worte, um irgendwie einen Platz in der Gesellschaft für uns zu definieren. Dann: eine Regung im Gebüsch, zunächst sah nur ich es, die anderen drei waren in ein Gespräch über Dosenraviolivertieft. Etwas kroch langsam heraus. Ein Tier. Zunächst dachte ich an eine Ratte, aber dafür war es zu langsam. Bei genauerem Hinsehen erkannten wir ein Kaninchen, das sich in sehr langsamer Bewegungsart auf uns zuschleppte. Normalerweise sind diese Tiere ja schreckhaft und halten sich ungern in der Nähe rumpelnder Punkjungendlicher auf. Dieses Exemplar hier aber sah so arg zerrüttet und todesnah aus, dass es einem beinahe Angst machen konnte. Zombiekaninchen. Es hatte ein komplett zerzaustes Fell und stark zugeschwollene Augen. Irgendjemand von uns sagte: »Kaninchenpest«. Und ja, davon hatte ich gehört, mein Vater hatte mal davon erzählt. »Myxomatose«, sagte der einzig wirklich Kluge unter uns, der in späteren Jahren eine FDP-Lokalpolitikerkarriere antreten sollte, an deren Ende er sich mit neununddreißig in der väterlichen Scheune erhängte. Wir alle wussten aber, was das war und dass dieses Tier hier auf jeden Fall keine lange Lebenserwartung mehr haben würde. Ungefähr einen Meter vor unserer sitzenden Gruppe hielt das Tier inne, senkte den Kopf, sah mitleidserregend aus und irgendwer von uns, ich glaube, dass es der FDP-Politiker war, meinte, wir sollten das Tier kaputtmachen. Ja, ich weiß noch, das Wort kaputtmachen hing über uns und wir sahen dem Kaninchen zu, wie es einen halbherzigen Hoppelversuch unternahm, um noch näher an unsere Gruppe heranzukommen. »Es stirbt ohnehin und es quält sich, wir sollten es erledigen.« Noch so ein Satz, der gesagt wurde, aber ich weiß nicht mehr genau, wer ihn sagte, vielleicht war ich es ja auch. Man einigte sich darauf, dass es wohl das Beste sei, dem Tier einen faustgroßen Stein, den wir gefunden hatten, aus geringer Höhe auf den Schädel zu werfen. Man hatte damit eine gewisse Distanz zum Opfertier und trotzdem ging man von der größtmöglichen Wirksamkeit und dem Eintritt des unmittelbaren und vor allem erlösenden Todes des Kaninchens aus. Wie man dann darauf kam, dass ich es tun sollte, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall stand ich keine zwei Minuten später mit diesem faustgroßen Stein in der Hand über dem Kaninchen, während meine Freunde mich anstarrten. Ich überlegte wegzulaufen, aber da war dieser soziale Druck, der sich in den Blicken meiner Freunde manifestierte. Dieser Gruppenzwang und die Erwartung eines knackenden Schädels, all das war eine ungute Melange an diesem Sommernachmittag. Das Kaninchen saß still da, mümmelte irgendwas. Es war eh viel zu kraftlos, noch davonzulaufen. Sein Fell war zerzaust, an einigen Stellen am Kopf und am Rücken fehlte es komplett. Myxomatose, hörte ich mich sagen, schloss die Augen und ließ den Stein sinken. Doch anstatt des erwartbaren Knackens des Schädelknochens nur ein unglaublich hoher Schrei aus dem Kaninchenmaul und als ich die Augen wieder öffnete, sah ich in die entsetzten Gesichter meiner Freunde, dann runter zum Tier, dem ich mittels Stein beide Hinterbeine gebrochen hatte. Und es schrie und schrie und schrie und ich sah, wie sich jemand seine Ohren zuhielt und jemand anderes zu weinen begann. Ein elendig schreiendesKaninchenmachte uns alle wieder zu verwundbaren Kindern. Das Tier wirkte wie ein angeschossener Frontsoldat, der versucht, sein unrettbares Leben mit den Körperteilen, die noch zur Fortbewegung zur Verfügung stehen, doch irgendwie zu retten. Inklusive Schmerzgeschrei. Irgendwann fasste sich der angehende FDP-Politiker und Selbstmörder ein Herz und trat mit seinen dicken Springerstiefeln drei- oder viermal auf das elende Hasenhäufchen ein, bis es endlich verstummte. Danach waren wir nicht mehr dieselben. Schweigend gingen wir alle nach Hause und verkrochen uns in unsere Kinderzimmer. Diese verdammten Schreie, ich höre sie heute noch und immer wenn ich an sie denke, bekomme ich Zahnfleischbluten, einfach so, ohne Anlass habe ich plötzlich Blutgeschmack im Mund.
So auch jetzt und ich spüle ihn mit dem letzten Schluck des zweitletztenBieresherunter, bevor ich dann auch das letzte Bier aufmache und in den Himmel schaue. Zahnfleischblut mit Bier runtergespült, das Geräusch der Schreie ist wieder da, die Erinnerung an entsetzte Gesichter. Ich entferne mich vom Fluß. Die Schreie, so denke ich, die passen zum herannahenden Krieg. Ich habe nicht vergessen, dass der Krieg kommt. Die Häuser sind in ein alles durchdringendes Schwarz-Grau getaucht und die Stadt hat ihre Beleuchtung angemacht. Ich laufe, ziellos, alles wird ohnehin kommen, was kommen will. Ein kleines Stück Vergangenheit hat mich heute überholt, was ich gut finde, dann ist die Gegenwart manchmal weniger schlimm. Weiterlaufen. Noch paar Bier beim Späti. Weiterlaufen. Trinken. Aus einem Gebäude schallen Technobässe. Ich gehe rein. Mich erwartet angenehm mild beleuchtete Dunkelheit und eine Treppe, an deren Ende man genau das vorfindet, was man am Ende einer solchen Treppe erwartet. Da sind Sofas. Sofa, so good, denke ich und setze mich. Neben mir liegt noch etwas Menschliches mit Zuvielkonsum und streichelt sich selbst die Frisur. Liebe, denke ich und habe wahrscheinlich Recht. Ich sehe mich um. Leute tanzen, als würde es demnächst keinen Krieg geben, andere tanzen, als hätte es nie Krieg gegeben und die Umstände, die Krieg auslösen, die wären frei erfunden. Aber: Draußen knistern Gebäude. Hier drinnen nur: knisternde Herzen. Alles gut. Ich sehe mich um, du bist nicht hier. Es wird Krieg werden ohne dich. Viel Glück. Ich sitze den ganzen Abend auf dem Sofa und gucke mir tanzendeMenschen und knisternde Herzen an. Fürs selber tanzen und knistern fühle ich mich zu schwach. Aber ich beginne zu mögen, dass du nicht hier bist und dass trotzdem Krieg kommt und du Dosenravioli und Spezi mit irgendwem anders haben wirst, der dich festhalten wird, wenn die Häuser zerbrechen. Ich habe nur mich selbst, das ist mehr als genug.
Später in der Nacht: Ich baller mir ’ne Line mit der Klofrau und muss dann trotzdem alleine weiter. Immerhin habe ich ein konkretes Anliegen. Leben. Hochzivilisierte Populationen hatten schon immer die Tendenz, sich selbst zu zerstören.
Auf dem Nachhauseweg sehe ich, wie die Stadt langsam erwacht. Taxis rauschen vorbei. Menschen rauschen vorbei. Rausch rauscht vorbei. Ich sehe ein Kaninchen vorbeihoppeln und wünsche ihm keine Myxomatose, sondern ein erfolgreiches Leben. Immer noch höre ich das Geräusch langsam zerbrechenden Betons. Dieses Knistern in großer Höhe und ich meine auch, dass hochkonzentrierter Feinstaub in meine Augen fällt, wenn ich in den Himmel gucke. Alles wird zerbrechen. Ich weiß es einfach. Bald ist es soweit. Ich suche den Himmel nach Flugzeugen ab, aber ich sehe nur Wolken. Es beginnt zu regnen. Ich freue mich auf mein Bett. Ich liebe dich, brüllt es in mir, aber nur im Hintergrund, unhörbar, weil das Knistern immer lauter wird. Wenn alles kaputt ist, kann ich dich endlich vergessen. Ich wünsche dir Myxomatose und mir einfach nur Schlaf. Leider bist du kein Kaninchen und ich etwas zu weit weg von meinem Bett.
Ich glaube ich habe aufgehört dich zu suchen. Nicht weil ich dich gefunden habe, sondern weil ich einfach müde bin.
… was zuvor geschah
Du hörst doch nur Xavier Naidoo, weil du für Heroin zu feige bist
Ich öffnete ein Fenster an einem Dienstag. Die Idee habe ich manchmal, ein Fenster zu öffnen. Einfach nur so, weil es sich gut anfühlt ein Fenster zu öffnen. Verbrauchtes Leben raus, neues Leben rein. Und die Handgriffe sind so einfach. Das ist manchmal wie einen Vitaminsaft trinken. Man reißt so eine Packung Saft auf und denkt sich so: Da sickert neues Leben in ein Glas, meine verbrauchten Zellen werden sich freuen, dass sie vitaminisiert werden. So einen Saft in mein Leben hineinzugießen ist zwar eine Lüge, aber immerhin hilft es auszuhalten. Vortäuschen hilft Aushalten. Ist so. Ist ja auch gut so, denn immer nur aushalten führt dazu, dass man irgendwann zu schwach zum Vortäuschen ist und einfach so kaputtknistert, am Boden liegenbleibt und es akzeptiert, am Boden liegend, zugedeckt mit einer Überdosisvorgetäuschtem Leben, wartend auf irgendwas, was nie kommt, dann sterben, Ende, Licht aus.
Die Nacht klebte mir noch in den Augen. Ich bin jemand, dem ständig was im Auge klebt, häufig sind es solche Nächte. Sie bleiben kleben, weil sie stauben und krümeln und auch ein bisschen weh- und auch ein bisschen guttun. Und ich habe ein Leben, in dem diese Nächte vorkommen können. Es ist nicht wichtig, was genau ich tue, aber ich tue etwas, was mir im rein kapitalistischen Sinne mein Leben lebbar macht. Häufig ist es eng, aber immer breit genug, dass man irgendwie durchkommt. Ja, man könnte mich beschreiben als einen, der irgendwie durchkommt.
Ich war irgendwo tanzen gewesen, mit irgendwelchen Leuten und immer, wirklich die ganze Nacht, hatte ich ein Getränk in der Hand gehabt. Weil ich dachte: Wenn man immer ein Getränk in der Hand hat, geht die Zeit schneller und attraktiver vorbei als ohne Getränk. Und jetzt klebte mir diese Nacht in den Augen. Ich machte mir einen Kaffee und wollte mich auf die Fensterbank setzen. Draußen war eine Luft unterwegs, die geatmet werden wollte. Und wenn man nicht sofort nach dem Aufstehen das Haus verlassen muss, dann setzt man sich mit dem ersten Kaffee des Tages auf die Fensterbank.
Von dem Platz auf der Fensterbank konnte ich den ganzen Innenhof einsehen. Fahrradständer. Kleine, nicht ganz so grüne Rasenfläche. Mülltonnen. Da stand die Nachbarin wieder. Hatte sorgfältig ihre wegschmeißbaren Dinge in Bio-, Rest- und Papiermüll getrennt und verweilte ein paar Momente zu lang vor den Tonnen. Sie sieht mich nicht. Ich saß also auf der Fensterbank wie der hinterletzte Spanner und schaute der Tragödie zu. Das Mädchen aus dem ersten Stock begannn zu weinen. Vor den Mülltonnen. Sie hatte zwei Papierkörbe in die Tonnen sortiert und jetzt stand sie da und weinte in einer Hemmungslosigkeit, dass ich sie, als ich sie erstmals auf diese Weise weinen sah, für jemanden hielt, der sich nur mit allergrößtem Abschiedsschmerz von seinem Hausmüll zu trennen imstande ist. Also eine Irre, ja, ich hielt sie für eine Irre, für eine, der man nicht gerne begegnet, weil man wahrscheinlich ihren Irrsinn nicht auszuhalten vermag.
Irgendwann war sie fertig, wischte sich mit der Außenfläche ihrer rechten Hand die Restfeuchtigkeit aus dem Gesicht, hob ihre beiden kleinen Mülleimer auf und ging, in einer Mischung aus überzogener Theatralik und verschrobener Eleganz, wieder Richtung ihrer Wohnungstür. Keine zwei Minuten später dröhnte aus dem offenen Fenster über meiner Wohnung die weinerliche Stimme von Xavier Naidoo.
Ich widmete ihr ein paar Gedanken, meiner Nachbarin, die seitichhierwohnetäglich in ohrenbetäubender Lautstärke das Gesamtwerk von Xavier Naidoo konsumiert und mich so zum Mitwisser und Experten in dieser Musiksparte gemacht hat. Danke, unbekannte Schöne, die manchmal an der Mülltonne weint. Ich hoffe, es geht dir gut. Dieser Weg wird kein leichter sein …
Leute wie sie gehen auf Xavier Naidoo-Konzerte. Endlich mal echte Gefühle, denken sie. Warme Wogen wülstiger Wortketten wabern wirkungsvoll. Leute schreien. Normalerweise sitzen sie im Büro und halten ihren Mund. Oder weinen heimlich. Oder öffentlich an Mülltonnen. Aber dann ist da dieses Konzert und da steht er. Heiland wäre jetzt zu viel gesagt, aber Mensch ist irgendwie auch zu wenig. Irgendwo in diesem Zwischenbereich wird er emotional abgehandelt, der Xavier. Und er meint es ernst. Das sieht man doch. Alles, was er singt, meint er ernst, der Xavier. Der hat das bestimmt auch alles erlebt. Er scheint einen großen Rucksack voller Vergangenheitsbewältigung mitschleppen zu müssen. Oder Zukunftsbewältigung. Und Gegenwartsanalyse. Die gebrochenen Herzen auf dem Weg. An den Wegesrändern all die vergessenen Lieben, das ganze nicht gelebte Leben und der Schmerz aufzustehen und der Schmerz liegenzubleiben. Und der Schmerz, schmerzempfindlich zu sein. Und scheinbar emotional unbedarfte Leute wie meine Nachbarin zieht er einfach mit in die Hölle des angeblichen musikalischen Himmels. Dort stehen sie dann und haben ein paar teuer bezahlte gute Momente.
Wenn diese Leute dann zu Hause sind, legen sie Naidoo-Musik auf. Ziehen ihre Frotteeschlafanzüge an, weil sie sich krank fühlen. Aber nicht zu krank, um morgen wieder zur Arbeit zu gehen. Wie gerne, denken die Leute, die Naidoo hören, würde ich den Frotteeschlafanzug für immer anbehalten, weil der fühlt sich an wie dauerhaftes Angefasstwerden von wem, der einen mag. Mit dem Frotteeschlafanzug zur Arbeit. Nein, besser, mit dem Frotteeschlafanzug nicht zur Arbeit, sondern liegen bleiben und Xavier hören. Den ganzen Tag. Kurz zum Gefrierfach. Da ist noch die Familienpackung Schokoladeneis. Man schlummert zwischendurch weg, weil das hat er drauf, der Xavier, einen wegschlummern lassen. Man wacht dann auf und Xavier ist immer noch da, weil man sein Album auf Repeat gestellt hat. Der Frotteeschlafanzug klebt schon ein bisschen, fühlt sich aber immer noch an wie gestreichelt werden. Man entscheidet, morgen nicht ins Büro zu gehen. Das Schokoladeneis verschließt angenehm den Darm. Später liegt man da, man hat im Halbschlaf etwas gebrochen, weil es doch zu viel Eis war und Xavier singt: Ich kenne nichts, was so schön ist wie du.
Und meine Nachbarin und viele andere glauben es ihm, wischen die Kotze von ihren Mündern und fügen sich in ihre hingestellten Schicksale. Man wird morgen doch zur Arbeit gehen. Man ist in dieser Zwischendramatik gefangen. Man will nicht, aber man muss, denkt man und dann noch: Warum muss man eigentlich? Da kommen auch schon die Antworten in Form eines vollgestellten Lebens. Einzuhaltende Verträge, abzuzahlende Kredite. Diese blöden Angewohnheiten zu essen und warm zu wohnen. Fügt sich also dem, was ist, dem Arbeitsvertrag, dem Vorgesetzten, dem Vermieter, den Umständen und irgendwie auch sich selbst, weil man so geworden ist, dass man sich selbst Vorschriften macht. Sich fügen heißt Vergnügen, belügt man sich und macht den Xavier wieder lauter, der immer auch als Schutz fungiert. Wenn man ihn im Ohr hat, ist die Welt etwas weniger schlecht, aber generell …
… Welt ist schlecht. Ist bekannt. Drogen würden helfen, eine andere Welt zu errichten, zumindest kurzfristig. Eine schöne Wand zwischen dem, was ist und dem, was man dazu empfinden muss. Ich verstehe fast jeden, dessen Antwort auf Alltag Drogenkonsum ist. Das hat jetzt mit Xavier Naidoo nur bedingt zu tun, aber es geht um diesen Effekt, dass man da ein Leben hat, das schwer ist, dass man dieses Leben und seine Schwierigkeit aushält und sich aber nicht um ein anderes Leben kümmert, sondern dieses bestehende Leben mit Dingen füttert, die es aushaltbar machen. Ein aushaltbares Leben zu führen ist heute die Maxime der Mitte. Xavier Naidoo hilft beim Aushalten. Er ist das Heroin derjenigen, die verlernt haben, auf ungute Gefühle mit Veränderungen zu reagieren und sich lieber noch eine extra Portion künstliche Schwermut und ratgebende Kalendersprüche in ihr Leben holen, damit es auszuhalten ist, dieses Leben.
Naidoo jammert immer noch in voller Lautstärke. Da ist aber auch etwas Kämpferisches in seinen Texten. Eine hohe Dosis Trost und irgendwie die Aussage: Auch wenn alle gegen dich sind, depressiv-gestörte Nachbarin, ich werde dich festhalten.
Leute suchen sich Verstecke. Weil die Realität ist böse. Und immer, wenn sie näher kommt, die böse Realität, dann braucht es was wie Xavier, der mit seinen Worten einen Kamillentee kocht, der auf einem Tablett mit weichen Soundteppichen präsentiertellert wird. Und dann hört er einem zu, der Xavier und gibt Ratschläge, zum Beispiel: Alles wird besser werden // wir holen uns den Himmel auf Erden // und keiner muss sein Leben mehr gefährden // einer der kostbarsten Schätze auf Erden. Man möchte dankbar sein für diese begleitenden Worte. Leider bin ich undankbar geworden, weil ich sie viel zu oft hören muss.
Oben lief die Musik immer noch, die Nachbarin sang laut die traurigen Lieder mit. Ich ahnte, wovor sie weglief, fragte mich aber nicht danach, aber ich glaube auch, dass ich die Antwort nicht ausgehalten hätte. Außerdem interessierte sie mich nicht, diese Antwort. Das war das Leben der anderen, das da über mir verwelkte und dumme Worte sang, ich wollte damit nichts zu tun haben, ich wollte nicht, dass diese Dummheit in mein Leben eindringt und es verwässert. Ich suchte in mir nach sowas wie Mitleid. Vergeblich, denn: wofür?
Ich glaube, diese Lieder sind eine Wand, hinter der man abhängen kann, wenn einem das Leben zu viel wird. Meine Nachbarin schien diese Wand auf Dauer zu brauchen. Auf der Suche nach Schutz findet man häufig Lieder von Xavier Naidoo. Es ist Musik, die niemanden wirklich stört in ihrer Unaufdringlichkeit, aber das subtile Gefühl vermittelt, dass da jemand ist, der einen festhält. Einer, der einem aushalten hilft. Ein Handaufleger und Streichelexperte. An der Musik tut gar nichts weh. Harmonie und Pathos kleistern alles zu und man fühlt sich an einen Ort versetzt, wo erstmal alles gut ist. Notaufnahme, nimm mich in die Arme.
Sie sang mit immer mehr Inbrunst. Vielleicht half ihr das wirklich? Vielleicht geht dadurch die extern dargestellte Zerbrochenheit etwas weg? Vielleicht sollte ich mir auch einen Lieblingspopstar zulegen, von dem ich denke, dass er mich versteht und den ich laut bei geöffnetem Fenster in die unsichere Welt rezitiere? Aber ich traue mich das nicht. Ich kann nicht Philipp Poisel oder Revolverheld hören und mir wie ein gesunder Mensch vorkommen. Ich suche nach Normalität in diesem Leben. Ich weiß, es gibt sie nicht, aber ich suche sie trotzdem.
Xavier Naidoohingegen ist der König derer, denen scheinbarjemandgesagt