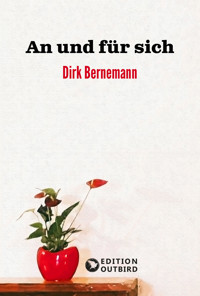Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: U-Line
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Anti-Pop
- Sprache: Deutsch
Dirk Bernemanns neuestes Werk über Menschen mit Vergangenheit, die erkennen, dass sie auch Menschen mit Zukunft sein könnten. 'Und ich dachte: ein Frühlingstag. Ja, ja, ja, ein Frühlingstag. Der Mai hat seine Mitte erreicht. Doch was bringt die Mitte eines Mais, wenn es so was wie Vergänglichkeit gibt, wenn man von der Mitte eines Mais schon das Ende eines Novembers erkennen kann?'
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vogelstimmen
Dirk Bernemann
Roman
1. Auflage Oktober 2010
Titelbild: Sebastian Rühl, www.sebastianruehl.comunter Verwendung einer Fotografie von Thorsten Richter
©opyright 2009/2010 by Dirk Bernemann
Lektorat: Franziska Köhler
Satz: nimatypografik
ISBN: 978-3-86608-135-2
eISBN: 978-3-86608-624-1
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck odereine andere Verwertung ist nur mit schriftlicherGenehmigung des Verlags gestattet.
Hat Dir das Buch gefallen? Schreib Deine Meinung an [email protected]
Möchtest Du über Neuheiten bei Ubooks informiert bleiben?
Einfach eine Email mit Deiner Postadresse an:
Ubooks-Verlag | Wellenburger Str. 1 | 86420 Diedorfwww.ubooks.de
« … everything is beautifulbecause everything is dying …»
New Model Army – Autumn
Die Zeit ist mit einer Geschwindigkeit unterwegs, die mir nicht behagt. Ich habe um Entschleunigung gebeten, schon so oft, um die Möglichkeit zur Rückkehr zum Denken. Um mich herum scheint sich alles rasant zu entwickeln, fix aufzublühen und kurze Zeit später zu verwelken, während ich ewig gleich dumm herumvegetiere und mein Leben beobachte wie Regentropfen an der Fensterscheibe. Dieses Gleichdummbleiben kommt mir vor wie Stagnation, als ob die Grenze jeder meiner menschlichen Möglichkeiten bereits erreicht wäre und es für mich keinerlei Entwicklungschancen mehr gäbe. Als ob mein System ausgereizt, das Spiel bereits gezockt wäre und irgendwo schon Game over stünde, wo ich nicht richtig hingeguckt habe, weil ich einfach zu müde bin. Die Tage zu grau, die Nächte zu schwarz, die Zwischentöne zu unsichtbar.
Sein eigenes Leben angucken zu müssen, während es sekundenschnell auf eine glatte Glasplatte tropft, rumperlt, runter fließt und irgendwann tröpfelnd verschwindet, sich aus dem eigenen Blickfeld stiehlt, das ist eine Tatsächlichkeit, die ich kaum begreifen kann. Ich fühle mich dann wie ein Autist, der seine Ordnung im Leben verloren hat, der dringend eine Struktur benötigt, die die Umstände des Lebens für ihn einschätzbar und nachvollziehbar macht. Aber da das Leben mit dieser hirnrissigen und herzzerreißenden Geschwindigkeit unterwegs ist und es einfach unmöglich ist, alle mir überantworteten Informationen zu verarbeiten, fühle ich mich wie ein tief greifend entwicklungsgestörtes, stereotyp agierendes Geschöpf, das zu Überempfindlichkeiten neigt. Diese Überempfindlichkeiten bewirken, dass ich sehr häufig unter den Anforderungen des Lebens einfach zusammenbreche, wie ein marodes Gebäude einstürze, meine Existenz unter mir begrabend. Aber mein Zusammenbrechen bekommt niemand mit, das findet nur in mir statt, auf ganz innigem Niveau, ohne Außenwirkung. Mag das Niveau der mir zugemuteten Gefühle noch so niedrig oder durch vielfache Wiederholung bekannt sein, immer ist was dabei, das mich hindert, ganz bei mir zu sein, mich selbst zu steuern, meine Bewegungen oder Gedanken dem Umfeld anzupassen.
Die Dinge zwischen den authentischen Abbildungen hatten Zeit zur persönlichen Gärung, manches wurde Essig, anderes Champagner, aber beim Meisten kann ich mich bis heute nicht entscheiden. Diese Unfähigkeit, am Leben der Entscheider teilzunehmen, macht mein Leben fortwährend langsamer, und mir wird die Qual bewusster, Inhaber eines Schicksals zu sein, das immer teilweise aus Gefangenschaft besteht.
Sich in der Mitte einer eigenen Existenz zu entwickeln, während um einen alles verwelkt, was vor einem schon da war, das ist eine der schwersten Aufgaben, die einem so ein Leben stellt. Man stellt fest, dass da schon einige Zeit vergangen ist, die unwiederbringbar kaputtgelebt wurde.
Natürlich gibt es auch die Leute, die überhaupt nicht mitbekommen, dass das Leben überhaupt was von ihnen will, und die unter Decken in Betten oder unter Tischen in Wohnzimmern mit Kuchen oder kleinen Tieren in den Mündern warten, dass alles schnell vorbeigeht. Oder langsam. Oder überhaupt. Zu diesen Leuten gehöre ich leider nicht. Ich hatte immer den Antrieb, dem Leben etwas abzugewinnen, sinnsuchend zu sein, obwohl das natürlich schon eine Herausforderung ist, die in etwa dem Wettlauf mit einem hungrigen Löwen entspricht. Ich hatte auch immer gedacht, mit fortschreitendem Alter irgendwie milde zu werden, nicht mehr der druckvolle, Magenwand durchschneidende und spontan Kackreiz erzeugende Espresso sein zu müssen, sondern eine entspannte, subversive Schale Café au Lait sein zu dürfen. Ein Stuhl mit Rückenlehne, von dem aus man betrachtet, was man mag und verachtet und sich ab und zu einen Rundflug über seine Vergangenheit gönnt. Mit Altersmilde erreichen meine ich, zumindest ab der Mitte meines Lebens die Möglichkeit der inneren Ruhefindung zu haben. Jetzt stehe ich in der Mitte dieser einen Möglichkeit, dieses einen Lebens, und um mich herum explodieren die Zeiten, und die Ereignisse schlagen um sich wie Boxer, die nicht mehr aufhören können zu prügeln; und ich fühle mich als Opfer, als Zivilist, als reaktionsarmes Ding. Es gibt kaum noch Gefühle, nur noch Reaktionen, Reaktionen auf den Umstand, dass das Leben ein Fluss ist, dessen Geschwindigkeit ich weder beeinflussen noch messen kann. Er fließt einfach und irgendwann versandet er, wird vom Boden aufgesaugt und verschwindet. Übrig bleiben vielleicht Memoiren, kleine Fetzen wertschätzende oder aber auslachende Dokumentation. Und ich, der unbedeutende Mensch, der ja statt Wurzeln Füße hat, der geht am Flussufer spazieren und fühlt sich wie ein nackter Nichtschwimmer im Hallenbad am Beckenrand. Immer die Angst hineinzufallen.
Mir wurde als Kind und Jugendlicher so viel erzählt über diese Altersmilde. Sie sei das Tuch, das sich über unkontrollierbare Gefühlsregungen lege, um diese abzuschwächen. Ein Zaubertuch gar, und ich wartete auf die Magie dieser Augenblicke, ich wartete auf die Kontrolle über mein Leben. Bücher und Filme und Geschichtenerzähler haben mein Bewusstsein damit zu füttern versucht, wie es sein kann, wenn man über dreißig ist und ein ruhiges Leben möglichst nicht an einem vorbei, sondern durch einen durchfließt. Und dieser Durchfluss Leben, den wollen doch alle in den Leib geballert haben, am liebsten ohne großartig Abtanzbewegungen Richtung Abgrund machen zu müssen.
Ich fühle mich in meinem Leben oft, als säße ich in einem großen Kinosaal, die Eintrittskarte überteuert, der Vorfilm massiv unlustig, das Popcorn zäh und flau und die Kinder auf den Nebensitzen sind unaufmerksam, rascheln mit ihren Gummitiertüten und reden wirre Quergedanken. Und man wartet auf den Hauptfilm, die ganze Zeit wartet man, fühlt sich wie ein Stundenzeiger, der von den blöden Sekunden- und Minutenzeigern abhängig bleibt, und fühlt nichts außer die Angespanntheit der Erwartung. Und während man sie durchlebt, diese abstrakte Erwartungsschwierigkeit, währenddessen also fällt einem auf, dass die eigene Existenz so banal wie ein Regenschauer in Nordengland ist.
Das ist in etwa das Gefühl, das ich in der Jetztzeit mit mir rumschleppe; viel gesehen und nicht wirklich was erreicht zu haben. Auch sind Ziele nicht mehr das, was Ziele mal waren, als ich ein Kind war. Es sind derzeit Ziele in mir am Start, die nach einer undefinierten Veränderung schreien, weil alles im Ab- oder Umbruch ist. Die Gedanken werden immer unklarer, manchmal sieht es in mir aus wie ein abstraktes Kunstwerk, von dem man denkt, das hat gerade ein Geistigbehinderter im Ausdrucksmalen veranstaltet und ist dann abgehauen, weil es irgendwo Kuchen gab. Ein wirres Farb- und Formenspiel, das sich aber zu ernst anfühlt, um wirklich ein Spiel zu sein.
Ein Ziel ist: überleben und Gefühle haben.
Das Leben ist kein Theaterstück, für das es Rezensionen gibt. Wäre es so, dann wäre der Dramaturg meines Lebens ein misanthropischer Pfandflaschensammler, nach toten Fischen und abgestandenem Alkohol riechend, der sich nur zum Spaß mein Leben ausgedacht hat, und zwar nur wegen des Umstandes, seine eigene Kümmerlichkeit aufzuwerten. Und vielleicht hätte er mal Glück und es käme zu einer Aufführung dieses Stückes trister Theaterlandschaft, dann würde eine Rezension wie folgt in einer durchschnittlich abgeranzten Lokalzeitung stehen:
Gestern fanden sich im Sorgtheater fünf Zuschauer ein, um der wohl langweiligsten Aufführung seit Bestehen des Hauses beizuwohnen. Zwei verließen den Theatersaal nach dem ersten Akt. Zum Inhalt kann ich leider nicht viel erzählen, weil ich einer von denen war, die nach dem ersten Akt verschwunden sind, um in eine triste Bahnhofskneipe umzusiedeln, hinter deren Tresen eine verruchte Fünfzigjährige rauchte und schale Biere zapfte, aber immerhin besser als dieses Stück.
Keine Premiere, sondern immer nur banale Proben, und das Theaterstück, das Leben heißt, soll endlich vor dankbarkeitserzitterndem Publikum uraufgeführt werden und nicht bloß in den kleinen Pisskatakomben der eigenen jämmerlichen Existenz stattfinden. Das Altern, das ich erwarte, zwingt mich zur Aufmerksamkeit, zur Beschäftigung mit den Umständen der Vergänglichkeit. Alles ist unewig, jeder Umstand eines Lebens ist verrottbar, und der genetische Schrotthaufen, den man irgendwann in eine kühle Leichenhalle tragen wird, den man also nach seinem biologischen Leben darstellt, der kommt in die Holzkiste und wird ehrenvoll verbuddelt neben anderen ehrenvoll Verbuddelten. Ein Stein kommt darauf, und die Erinnerung ist schon so blass, als ob es sie nie geben wird. Ich werde hier kaum was hinterlassen, außer den Spuren eines Idioten, der eine Art Sinn sucht. Aber wie viele Sinnsucher scheitere ich schon an der Definition von Sinn. Deswegen habe ich es aufgegeben, so hochtrabende Ziele mit mir rumzuschleppen, sondern ich will lediglich ein Leben haben, das mir passt wie eine nicht zwickende Unterhose.
Ich warte. Warte auf Veränderung in meinem Sein, das langsam vor sich hin altert. Auf die sich einstellende Gelassenheit bezüglich des mich umgebenden Universums, in dem ich nur Staub bin, zu dem ich irgendwann wieder werden werde. Ich warte auf den Heiligenschein, der meinen Kopf umranden soll, damit man schon von Weitem erkennt, das ich einfach ein zurückhaltendes Leben im Klappstuhl meiner eigenen Trägheit führe. Mein Krieg ist nur defensiv, ist nur Aushalten, war nie Aktionismus, war kein Übermut. Und niemand hat mich auf die Wahrheit vorbereitet, dass man die anderen Leute und auch sich selbst mit den Jahren immer schlechter erträgt, dass man dann nur einfach zu müde zum Schreien ist. Denn ein Schrei wäre eine aktive Handlung, wäre auffällig, wäre dokumentierbar, irgendwie speicherbar. Da würde dann in meiner mein Leben aufzeichnenden Akte stehen: «Und als er bemerkte, dass er die anderen nicht mehr ertrug, begann er jeden Tag zu schreien. Zunächst nur eine Minute täglich, später eine halbe Stunde, und irgendwann war alles nur noch ein Schrei der Ablehnung.»
Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das Altern lediglich das Verwalten der Dinge ist, die ich noch kann. Und der Dinge, die ich noch habe. Es ist wie Jonglieren mit dem, was da ist; ich werfe es durch die Luft, ungewiss, ob ich es auch wieder auffangen können werde, wenn es herunterfällt. Es sind schon Dinge abgestorben, die das Bild, das ich dargestellt habe, einst komplettiert haben. Da gehen ein paar Haare, da wächst etwas Fettablagerung, da verschwinden schon mal gute Gedanken. Dafür wächst ein großer Tumor in mir, der sich Erfahrung nennt und alles, was mit Naivität zu tun hatte, schlicht verdrängt. Da hilft auch kein Bestrahlen und keine Chemotherapie, die Erfahrung wächst und frisst das Kind auf, das in einem zu Hause ist, nagt hier einen Spieltrieb fort, frisst dort etwas Leidenschaft, kleidet einen irgendwann in durchschnittliche Kleidung und hinterlässt eine Trauer in uns, die manchmal so tief geht, dass sie einen bewegungsunfähig macht.
Auch die Liebe ist mit jeder ihrer Anwendungen immer kleiner geworden. Sie verhält sich wie eine Droge, die von Einnahme zu Einnahme immer weniger von ihrer Wirkung offenbaren will. Und trotzdem gilt es sie zu miss- oder gebrauchen, weil man drauf ist, weil man denkt, ohne ginge es nicht, und man traut sich ja auch nicht auszuprobieren, ob ein Leben ohne Liebe möglich wäre, und wenn man sich dann umguckt, ist man vielleicht erstaunt, dass viele schon ohne leben und aus entspannten Gesichtern in die Welt gucken. Ich habe schon viel gehört über die Abschaffung der Liebe, und es ängstigt mich ein wenig, davon abzulassen, denn sie ist wie ein gewohntes Tier, das einen freudestrahlend anspringt, wenn man durch die richtige Tür geht. Und ich will weiter angesprungen werden von ihr und sie soll mir durchs Gesicht lecken, die Liebe, bis auch ich nur noch sabbern kann …
Es war Tocotronic-Wetter. Tocotronic-Wetter ist dieser Übergang vom Frühling in den Sommer oder vom Sommer in den Herbst, Hauptsache irgendein Übergang. Tocotronic-Wetter hat die Angewohnheit unter 20 Grad Celsius zu sein und irgendwas mit Wind zu präsentieren. Kurz nach oder vor einem Gewitter ist auch immer Tocotronic-Wetter. Ich mag dieses Wetter, weil man nicht weiß, in welche Richtung es tendieren wird; in so einer Tocotronic-Wetter-Phase ist alles möglich.
Liebes Tagebuch, heute habe ich angefangen, meine Gedanken auszugraben, als wäre ich ein Hund und mein Denken alte Knochenbestände fremder Kleintiere, die keiner Stabilität mehr nutzen. So könnte, würde ich meine Gedanken einem Tagebuch offenbaren, der heutige Eintrag beginnen. Dann würde ich dem Tagebuch von der kleinen Trauer zwischendurch erzählen, und es würde stumm meine Tinte in sich aufsaugen. Des Weiteren würde ich dem Tagebuch von den Menschen um mich und meiner uneffektiven Sehnsucht berichten, und ich würde ihm von Kindheitserinnerungen und von Zukunftsängsten und von allem, was dazwischen stattfindet, kundtun. Ich würde ihm von meiner Orientierungslosigkeit erzählen, von diesem Gefühl mitten im Leben zu stehen und nicht mehr über irgendeine Richtung Bescheid zu wissen, weder die, aus der man kam, noch die, in die man sich zukünftig bewegen mag. Das Tagebuch würde einfach so daliegen und sich diesen ganzen Text zunächst gefallen lassen.
Ich fühle mich wie unangenehmer Schall, der aus einer kleinen Bar dringt, in der Free Jazz probiert wird, und zwar mit viel zu viel gespielten Tönen in viel zu wenig Zeit. Free Jazz klingt ja eigentlich immer, als ob er gerade geübt wird; ja, mein Gefühl entspricht einer Free-Jazz-Probe. Das würde ich dem Tagebuch alles erzählen, und die Blätter des Buches würden sich langsam füllen mit eigenartigen Gedankenformulierungen der Gegenwart eines Menschen, der ich zu sein scheine. Identitätslosigkeit. Irgendwie ist dies eine Zeit, die Entscheidungen verlangt, aber alle Entscheidungen, die ich treffen kann, fühlen sich nur falsch an.
Das Tagebuch würde schweigen, einfach schweigen, alles annehmen und es bei Bedarf wieder preisgeben. Seitenlang Gedankenabfall. Dann würde das Tagebuch zu seinen Tagebuchkollegen gehen, wenn ich grad nicht in Sichtweite bin, und sie würden über mich lachen, weil ich nichts auf die Reihe kriege. Aber ich führe kein Tagebuch, ich habe ja nicht einmal Worte für das, was ich bin. Außerdem habe ich keine Lust von den Büchern, die ich schreibe, ausgelacht zu werden.
Ich habe wieder mal das Gefühl, ein verschwendetes Leben zu leben, ein Leben, das viel lauter, bunter, fühlbarer sein könnte. Ein Gefühl wie Giraffenkotze, ein viel zu langer Weg zu einem doch misanthropischen Endergebnis.
Ich halte eine Tasse Kaffee in der Hand und stehe lediglich mit einer Unterhose bekleidet auf dem Balkon. Wind umspielt wie zärtliche Hände meinen Körper. Drumherum hält sich ein Frühling auf, einer mit zwitschernden Vögeln, zimperlichen Zwischentönen und einer vollkommenen Unperfektheit. Franz Kafka hat einmal geschrieben: «Das Leben ist unerträglich, ein anderes unerreichbar.» Das trifft meinen Standpunkt ziemlich gut. Das, was man nicht ertragen konnte, lag da draußen, zu allem anderen hatte man keinen konkreten Weg.
Es war Frühling, und ich viel zu beschäftigt mit mir selbst. Ich wartete und wusste nicht auf was. Vielleicht darauf, dass meine Mutter endlich starb? Oder auf einen erfüllenden Job mit der Perspektive, da jemanden darzustellen, den man selbst mochte? Oder auf eine Liebe, die mein Herz anfüllte, bis es zu platzen drohte? Da musste doch irgendwas sein, warum guckten den alle da hin …?
Der Kaffee war lauwarm und ich lauwach. Und ich stand da und schaute und leichter Wind strich mir über den nackten Bauch, und dann juckte es am Geschlecht und ich kratzte mich, und das war gut, es hinterließ das Gefühl, etwas richtig gemacht zu haben.
Gut, dass ich kein Tagebuch schreibe, dachte ich noch, während ich mich da kratzte, wo es immer einmal weniger juckte, als man kratzte. Ein Tagebuch, das ist doch was für Leute, die sich an alles erinnern mögen, deren Leben so dünn ist, dass dieser Effekt nicht ganz automatisch eintritt. Obwohl ich glaube, dass mein Leben so ist, so dünn. So unauffällig und schwach. Ich wäre so ein typischer Tagebuchschreiber, ein mit allerlei Weltschmerz verseuchtes Arbeiterkind, das versucht, Welt und Wort in Einklang zu bringen. Zustandsbeschreibungen zu liefern, ja, das könnte ich, aber ich machte es nicht, weil ich diesen Zustand nicht wahrhaben wollte, weil der Zustand noch weniger Ich war als ich selbst. Aber ich weigerte mich, Tagebuch zu schreiben, ich wäre nur einer mehr in der Statistik der nicht stattfindenden Menschen, die mehr innen leben als außen sterben.
Heute wehte eine leichte Brise durch die sonnengetränkte Luft, man konnte nicht sagen, ob es warm oder kalt war, es war irgendwo dazwischen; ein Wetter, das sich, wie ich, nicht wirklich entscheiden konnte. Aber was waren Entscheidungen überhaupt wert in dieser viel zu schnellen Welt. Kaum hatte man sich für einen Sinn des Lebens entschieden, schon waren die Anforderungen an ein solches Leben wieder radikalsten Veränderungen unterzogen worden, und man stand da, mit der Unterhose auf dem Balkon und trank lauwarmen Kaffee in einem lauwarmen Leben und fragte sich: Hä? Das Leben, das man sich vorstellt, kann doch nicht von solch erschreckender Banalität sein, oder? Die Daten und Fakten, die mein Leben über mich schreibt, sind von eindeutiger Präsenz. Meine Optik, meine unabgebrochene Lebenszeit. Von Gefühlen, die mich ausmachen, ist dabei nicht die Rede. Aber von Gefühlen sollte die Rede sein, von Gefühlen, die jeden Widerspruch in sich tragen und genau diesen Umstand als Genuss empfinden.
Stünde man vor mir und wollte man mich beschreiben, könnte man Folgendes berichten: männlich, aber mit androgyner Ausstrahlung (die Haare, die Haut, ich weiß es doch auch nicht …), fünfunddreißig Jahre alt, alleinstehend. Leicht gebückte Haltung; irgendwie ist das so, weil der Rücken sich von selbst krümmt, sobald die Konfrontation mit der Welt kommt, die fortwährend Dinge verlangt und wissen will, die dieser Rücken tragen soll. Deswegen ist er leicht schief, dieser Rücken, etwas nach vorn gebeugt der ganze Mensch, der ich bin.
Ich bin immer irgendwie woanders als dieses rote Kreuz auf der Landkarte, neben dem immer «Dies ist ihr Standort» steht. Allein das Wort alleinstehend ist eine Farce, wie ich finde. Ich habe keine Partnerin, aber ich finde Liebe im Leben, so mir das Leben Angebote macht. Die Abwesenheit einer Frau an meiner Seite stürzt mich nicht in abgrundtiefe Traurigkeit, lässt aber einen Hauch Melancholie mitschwingen.
Gut, es gab Frauen, aber sie fluteten durch mein Leben, tranken aus der Quelle meiner Leidenschaft und zogen dann weiter, andere Gefilde und Gefühle zu erforschen. Für das langfristige An-mich-Binden bin ich wohl nicht interessant genug. Meinen Selbstwert zu definieren fand ich immer schwierig. Ich war schon immer irgendein unfertiges Ding, weil ich mit Erwartungen konfrontiert war, die ich weder erfüllen noch einordnen konnte. Ich fühlte mich bereits in jungen Jahren wie eine nicht ganz gelungene Erfindung. Perfektionismus kommt später, dachte ich immer und wartete und versuchte und scheiterte schweigend und versuchte weiter und scheiterte auf höherem Niveau und war dann plötzlich dieses überromantisierte Wesen, das aus Versuchen und Scheitern zu bestehen scheint. Irgendwo zwischen Exklusiv und Durchschnitt, Olymp und Gosse, Misanthropie und Philanthropie, Heute und Morgen, Glanz und Dreck, Fiktion und Realität, Hochbegabung und Unfähigkeit. Ich bin ein Ausfüller der unaufgeräumten Zwischenräume. Hochseilautist.
Den Erwartungen meiner Eltern entsprach ich in keiner, manchmal nur in geringer Weise, aber was sind das auch für Eltern, die Töchter und Söhne in die Welt werfen und diese mit Erwartungen vollpumpen, die immer wieder an Unerfüllbarkeit scheitern. Ich bin Einzelkind, das heißt auch, dass die Gewehre der Erwartungen meines Elternhauses nur auf mich zielten. Schulbildung, Berufsausbildung und dann doch irgendwo gelandet, wo man mich fast in Ruhe lässt.
Ich war Buchhändler. Ich arbeitete in so einem kleinen Buchladen, der zu einer lokalen Kette gehörte. Als Teil dieser Kette war ich dort zuständig dafür, dass der Laden profitabel blieb. Und als Teil einer Kette war man nichts Besonderes, war man ein Stück von vielen, und Kettenglieder sind auch nur umrandete Löcher. Auch dieser Laden war ein Loch, der manchmal wie eine Falle wirkte, in die ich wie ein tollpatschiger, orientierungsloser Bär geraten war.
Gelesen wurde ja immer, auch wenn sich die Leute Literatur in die Köpfe klopften, die ihnen nicht guttat, und bevor sie das merkten, hatten sie wieder einen Bestseller bestellt und unkritisch verschlungen. Lecker, Bestseller, dachten sich die Leute dann, und die Medien, von denen die Leute den Hinweis hatten, dachten: Hahaha, wieder ein Opfer, und ich dachte mir: Irgendwo dazwischen muss doch was sein, was wie Wahrheit aussieht und wo es wie zu Hause riecht.
Der Wind tat gut, heute war Tocotronic-Wetter und das passte zur Ausdrucksweise dieses Tages. Manche Tage sprechen nicht, aber jene, die bereits mit Tocotronic-Wetter beginnen, erzählen stundenlang Geschichten über das kleine Leben, das man sich in die Tasche stecken kann.
Ich ging rein, die Kaffeetasse aufzufüllen, und kam an meinem CD-Schrank vorbei. Das Leben sei ohne Musik ein Irrtum, hat uns Nietzsche vor vielen Jahren in das Bewusstsein getrötet. Wenn er recht hatte, konnte ich ja schon mal einem Irrtum entgehen. Ich wühlte mich durch meinen Plattenbestand, und da kamen auch Erinnerungen in mich. Statt einem Tagebuch konnte man auch bequem seine Plattensammlung nach seiner Vergangenheit befragen. Eine Plattensammlung verrät manchmal mehr über einen, als die eigene Mutter imstande war zu erzählen. Sie erzählte von Lieben, Idealen und Trümmern eines Lebens.
Als hätte ich jemals Ideale gehabt, einen Idealzustand. Alles hier war und ist und bleibt nur Phase. Feiner Song mit passend formulierter Härte. Ich lief aus aus dem Hafen des Schicksals, mein undichtes Boot war mein Leben, mein Steuermann die eigene Flugunfähigkeit, und dann erinnerte ich mich an ein Sprichwort: Kurze Strecken gehen Vögel auch zu Fuß. Ich glaube, ich würde nie mehr zu Fuß gehen, wenn ich fliegen könnte.
Später ging ich aus dem Haus, tauchte ins Tocotronic-Wetter ein. Ein Sonntag, gefüllt mit eigenartiger Stimmung, und das Tagebuch, dem ich das hätte erzählen können, gab es gar nicht. Es gab nur mich, und ich musste mir immer selbst antworten. Ich suchte eine Position im Leben, vielleicht Meinungen und Erkenntnisse, die von Belang sind. Ich war jetzt fünfunddreißig, stand mitten in einem Leben, das ich mir so nie gewünscht hätte, und fand dieses Leben trotzdem irgendwie interessant. Es gab ein Hinten und ein Vorn, ein Links und ein Rechts, ein Oben und ein Unten, und es gab so was wie Orientierung, den inneren Routenplaner. Der war bei mir aber defekt. Wenn mich das Teil um die Eingabe eines Fahrziels bat, damit es mir den kürzesten, energiesparendsten und effizientesten Weg dorthin vermitteln konnte, dann scheiterte ich schon an der Definition von Ziel. Was will ein Ziel von mir? Und warum ist der Weg dahin immer unsichtbar? Ein Ziel ist ja immer auch das Ignorieren und Vergessen anderer Ziele.
Ich war auf dem Weg zur Bushaltestelle. Ein Kurzzeitziel. Die Bushaltestelle. Ein Platz, an dem täglich Weichen gestellt werden. Heimkommen und Verreisen geben sich hier die Hände und Abschiedsküsse und Wiedersehensumarmungen. Hier werden Entscheidungen getroffen, aber ich hatte heute einen Weg vor mir, der mir schon bewusst, weil automatisiert war. Es war Sonntag.
Mit mir warteten noch ein paar Ghettokids auf die Linie 7. Das waren so kleine Klischeerapper, drei an der Zahl, und die dialogten sich schwallweise was gegenseitig in die kindlichen Antlitze. Ihre Sprache so undeutlich und faulgrau wie trüber Regen. Verbaler Schlachtabfall. «Ey, was’n, die Bitch hat mich abgefuckt, Alda, dafür bekommt sie ins Maul geschlagen.» Der Typ, von dem diese gewaltverherrlichende Aussage ausging, war allerhöchstens fünfzehn, stark adipöser Fettschürzenträger und irgendwie hautkrank. Er trug einen blauen Adidas-Trainingsanzug, der sehr edel und gepflegt erschien im Gegensatz zum Wortschatz und Denkmuster seines Trägers. Seine wortunterstützenden Bewegungen wirkten wie Spasmen. Die Hand schnellte bei jedem herausgespuckten Wort durch die Leere der Atmosphäre, als wollte er die Luft mit Handkantenschlägen und Fingerzeigen zerteilen. Einer seiner Freunde hob ebenfalls an, die Unterhaltung in Gang zu bringen. «Ey, der Bitch aufs Maul zu geben is doch kacke, Digga. Ey, Mann, man schlägt keine Mädchen.» Der, der das gesagt hatte, sein kleiner, ebenso schlechthäutiger Freund mit größerer Mütze als Kopf und eine dürre Nike-Werbung beklebte Litfaßsäule darstellend antwortete eher pazifistisch, und der Dicke schaute ihn darauf verächtlich an. Neben den beiden stand ein dürrer arabisch wirkender Typ, mit angedeutetem Bartflaum, auch in sportliche bequeme Schnellfickerhosen gehüllt und irgendwas auf dem Kopf, was sowohl Geschenkkörbchen als auch Baseballmütze darstellen könnte. Er schwieg, und der Adidas-Mann sagte dann zu Freund Nike: «Ey, mein Herz is am Bluten wegen der Bitch, Alda, ey, ich mach die Alte Körperkontakt, die alte Zivilistensau. Ey, ich prügel das Mistmädchen, bis sie lacht.» Was da wohl vorgefallen war? Unnachvollziehbar, aber eine Erkenntnis kroch trotzdem zu mir herüber. Das Ghetto hatte Gefühle, wurde mir da bewusst, die Wut regnete mit dem Wortschwall zwischen die anderen beiden Jungs, und die schwiegen und standen cool da, und der Adidas-Adipöse machte wirre Gesten, wie sie ein außer Kontrolle geratener Roboter machen würde, wenn der Akku voll aufgeladen ist, aber keiner sich für seine Kontrolle verantwortlich fühlt. Die Jungs wirkten so alleingelassen mit ihrem Gedankendreck, und der schmächtige Araber sagte plötzlich mit seiner jungenhaft dünnen Stimme was Kluges: «Jungens, ich klatsche keinen Beifall, wenn der Verstand die Schlacht gegen das Gefühl verliert …» Hatte er das gerade wirklich gesagt? Manchmal unterschätzte ich die kleinen Menschen hier. Der Dünne, diesen wunderbaren Satz ignorierend, sagte: «Sie is’n Opfer, Digga, mach locka, eh, atme durche Hose, asch ma ab und verhalt dich ruhig.» Dabei gestikulierte er beschwichtigend, und der Pommes geblähte Junge trat daraufhin ziemlich heftig gegen einen Mülleimer, der neben dem Wartehäuschen aufgestellt war. «Ey, fuck, ich will, dass alle leiden!» Ein Satz wie aus einem amerikanischen Actionfilm, wenn der Held, dessen Frau und/oder Kind von Bösewichten ermordet worden war, der Welt und ganz speziell den Tätern Rache schwor. Ich ging einen Schritt zur Seite und einen nach hinten und presste mich wurstgleich in einen rechten Winkel der Bushaltestelle. Das sind sie also, die unberechenbaren Zerstörerkids des neuen Jahrtausends. Sie treten Mülleimer aus Liebeskummer um und manchmal sagen sie richtig schlaue Dinge.
Ich sah den Bus kommen. Linie 7. Die zischenden Türen gewährten mir Einlass. Die drei Sportanzugträger ließen sich einige Reihen vor mir in die schmuddeligen Sitze sinken und kommunizierten sofort ohne Unterbrechung weiter. Ich fragte mich, ob diese Kinder wirklich so unberechenbar waren, wie sie medial immer dargestellt wurden, und ob sie noch die Zärtlichkeit zwischen Gewaltangebot und Vollrausch kannten.
Gutes Wetter hatte sich mittlerweile gegen nicht entscheidungsfähiges Tocotronic-Wetter durchgesetzt und frühlingsentsprechende zarte Sonnenstrahlen brachen sich in der Fensterscheibe des Busses, und ich saß sehr weit hinten und starrte auf drei bemützte Schülerköpfe mit der Fragestellung im Anschlag, was in diesen wohl vorging. Der kleine Araber, der diesen einen schlauen Satz gesagt hatte, war wieder zu einem stillen Häufchen Opferbereitschaft geworden, während sich seine Markendesignsportartikel geschmückten Dudes lautstark über das Für und Wider einer Offensive gegen die heartbreaking Bitch unterhielten. Der Aufgedunsene erging sich mittlerweile in Gewaltfantasien allerprickelndster Güteklasse. «… Beine brechen und dann in’n See werfen …», war nur zwischendurch mal zu hören, und der Ausgemergelte wollte immer noch beschwichtigend wirken, hatte aber verbal und verständnismäßig kaum eine Chance gegen den gewaltbereiten Dicken. Ich kramte meinen Mp3-Player hervor und stellte auf zufällige Wiedergabe, weil das genau dem Gefühl entsprach, das ich gegenüber diesen Menschen hatte. Der Zufall hatte uns hier hingemacht. Und da war die Wut und da die Beschwichtigung, vielleicht ein Splitter Intelligenz auch und Unmut über so vieles wie auch Unwissenheit über so manches.
Ich sollte eigentlich mitten im Leben stehen, aber ich stand eher daneben, und wenn es hier eine Pfütze Leben gab, in der ich zufällig stand, bekam ich davon allerhöchstens unangenehm nasse Füße. Ich saß stattdessen, also statt mich in der Mitte irgendeines großen Lebens aufzuhalten, in einem Stadtbus und sah aus dem Fenster ins hässliche Antlitz der anonymen Großstadt, die dastand mit ihren vielfältigen Optionen und mich auslachte, dass ich an den meisten nicht teilhaben konnte. Der Bus fuhr, ich machte die Musik lauter und wollte endlich da sein, wo ich hinwollte. Wo das aber war, wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass alle Tage gleich lang, aber verschieden breit waren.
Nach etwas mehr als 20 Minuten Busfahrt hatte ich mein Ziel erreicht, draußen eine frische Luft, die man gern ungefiltert in seinen Körper ließ, denn sie schmeckte nach Leben, nach purem Leben, und wenn man nur ewig imstande wäre, diese Luft zu atmen, nichts könnte einem je geschehen. Ich wusste ja, auf was ich zulief, auf etwas, was mit Atemlosigkeit trotz ruhigem Puls zu tun hatte.
Und ich dachte: ein Frühlingstag. Ja, ja, ja, ein Frühlingstag. Der Mai hat seine Mitte erreicht. Doch was bringt die Mitte eines Mais, wenn es so was wie Vergänglichkeit gibt, wenn man von der Mitte eines Mais schon das Ende eines Novembers erkennen kann?
Immer wenn ich dieses Gebäude betrete, umfängt mich die Angst. Es ist nicht so eine plötzliche Angst, also so eine, die kommt, weil irgendwas akut in unnachvollziehbare Unordnung geraten ist, sondern die Angst, die ich fühle, ist konsequenter. Es ist die Angst, nichts festhalten zu können, was wichtig wäre für den Moment. Das Leben fließt runter, ist komplett mit Banalitäten vollgestellt, die es zu umschiffen gilt, wenn man sinnsuchend ist. Unter der Oberfläche, da lebt noch was, was eventuell Bedeutung hat. Unaufhaltsam fallen die Sekunden, unwiederbringbar.
Die Drehtür des Eingangsportals des Seniorenheims St. Anna schlurft sich über einen abgeranzten braunen Teppich. Ich drehe mich hinein, in dieses Gebäude, und augenblicklich erfüllen langsam vor sich hinplappernde, teilweise gebrochene Stimmen und ein Automatenkaffeegeruch die Atmosphäre. Alles passiert hier in einer eleganten Langsamkeit. Eine alte Frau in einem grauen, blau geblümten Kleid geht auf einen Rollator gestützt an mir vorbei. Sie geht, wie jemand geht, der zwei Weltkriege überlebt hat. Sie schaut nicht auf, ihr Blick verfolgt scheinbar konzentriert ihre eigene Fortbewegungsart, ihren schleppenden, nach rheumatischer Qual aussehenden Gang. Ich gehe links an ihr vorbei. Die Halle ist voller frischer Luft, die aber schnell von allen Seniorinnen und Senioren weggeatmet wird. Anscheinend halten sich die mobilen Alten immer hier in der Nähe der Tür auf, um noch ein wenig die Außenwelt betrachten zu können und ab und an, wenn sich mal eben die Tür dreht, einen Schwung frische Luft in die Lungenbläschen zu lassen.
Ich ging auf die Anmeldung zu. Frau Overberg. Natürlich. Frau Overberg. Es ist Sonntag. Frau Overberg lächelte. «Sie hat schon nach Ihnen gefragt», sanftmutete ihre Stimme, und ich nickte und lächelte zurück und wusste doch, dass sie log. Ihr Heileweltschmerzausdruck skizzierte ihre mentale Oberflächlichkeit in meine Richtung. Sie trug eine beige Strickjacke, und ihr rotwangiges Frauengesicht erzählte eine Geschichte vom Bluthochdruck. Vor sich hatte sie einen Kuchenteller mit einem halb aufgegessenen Stück Bienenstich, aus dem eine Kuchengabel ragte. Sie war einer dieser Menschen, dieser verdorbenen Helfersyndromfrauen, die sich ehrenamtsbekleidet in einem egozentrischen Hochgefühl suhlten. Sie gehörte zu jener Menschenriege, die sich ihr Herz frei spendeten, ihr Seelenheil in CDU-Politikern vermuteten und eben einen Sonntag «opfern», um an der Anmeldung eines Seniorenheims allsonntäglich ihre frustrierende Freude zu verschleudern.
Ich kannte den Weg, es ist immer der gleiche. Durch den Flur, zwei Etagen treppauf. Und während ich so lief, veränderte sich der Geruch in meiner Nase und die Frequenz der mobilen Menschen, die mir auf dem Weg begegneten, sank rapide. Der Frischluftflavour aus dem Eingangsbereich wich beim weiteren Gehen durch den Gebäudetrakt einem Gemisch aus hochkonzentriertem Urin und einer abgestandenen Gewebewolke. Ab und an hörte ich aus den Zimmern Gestöhne, das Gestöhne alter Menschen, die sich erheben oder umdrehen und denen das zu viel oder zu schmerzhaft wurde.
Im zweiten Stock angekommen hörte ich Frau Bender schreien. «Wota, wota, äh … wota, wota, äh …» Frau Bender bewohnte das erste Zimmer auf der linken Flurseite, und ich wusste um ihre Demenz und dass sie seit mehreren Wochen nur noch imstande war, diesen einen Slogan rauszudrücken. «Wota, wota, äh … wota, wota, äh …» Aber anstatt dieses Wortgebilde in sachlichem Ton vorzubringen, brüllte Frau Bender diesen in ihrem Zustand wahrscheinlich alles bedeutenden Satz durch den Flur. Ich ballte meine Faust in der Jackentasche, als ich an ihrer Zimmertür vorbeiging; ihr Gebrüll machte mich wütend, ich wusste nicht warum, wahrscheinlich weil ihr Zustand ein so unnachvollziehbarer war und ich jedes Mal mit der Unnachvollziehbarkeit ihres inneren Daseins konfrontiert wurde und vielleicht dafür einfach zu einfühlsam war. Zu viel Empathie würde mich irgendwann töten.
Das war schlimm, dieser Kontrollverlust im Gehirn; das Einzige, was blieb, waren Worthülsen, die alle Gefühle und Gedanken ausdrücken mussten, die doch bestimmt auch Frau Bender noch hatte. Trauer, Wut, Liebe, Demut, Geilheit, alles war «Wota, wota, äh …», und ich war froh, noch Worte zu haben, die mein diesbezügliches emotionales Nichtklarkommen beschreiben können. Ich hatte Frau Bender schon einige Male gesehen, und wenn man sie sah, dann wusste man einfach, dass in ihrem Leben noch mehr stattfand als eben jene ausgestoßene Dauerphrase. Frau Bender war ein armes Ding in Menschengestalt, so viel Bedarf an Leben sie hatte, so wenig Möglichkeiten hatte sie, diesen zu entäußern. Die Schreie wurden leiser. «Wota, wota, äh …»
Zwei Meter weiter stand ich dann vor einer Tür, deren Klinke ich mit schweißnasser Hand umklammerte. Ich hatte immer Angst, diesen Raum zu betreten, obwohl ich ihn jeden Sonntag betrete. Ich gab der Klinke ein wenig Druck, und die schwere Zimmertür öffnete sich nach innen. In diesem Zimmer lebt meine Mutter.
Als ich das Zimmer betrete und die Tür bedächtig hinter mir schließe, tritt ein Geruch in meine olfaktorische Wahrnehmung ein, der sich aus der Melange konzentrierten Eigenurins an Baumwolle und Desinfektionsmittel bildet. Ich rieche Atmosphäre und auch ein wenig das, was von der Mütterlichkeit dieser Frau übriggeblieben ist. Diese Mischung aus chemischer Bakterienvertilgung und der Inkontinenz einer undurstigen Frau, das ist seit fast einem Jahr meine Mutter.
Meine Mutter ist demenzkrank. Dem Gehirn meiner Mutter passiert in etwa das, was einer handelsüblichen Aspirintablette widerfährt, die in ein Wasserglas geworfen wird. Das hat mir ihr Arzt erklärt. Auflösung in Wohlgefallen. Mit dem Gehirn verschwinden auch so langsam alle Funktionen dieses Organs. Zu allererst verabschiedete sich damals ihr Kurzzeitgedächtnis; Schlüssel wurden verlegt, Namen verwechselt, der Herd angelassen und Termine vergessen. Später dann ließ das Denkvermögen als solches nach; meine Mutter vergaß tausendmal zubereitete Gerichte, erinnerte sich nicht mehr an langjährige Freunde, verbrachte tagelang im Kopfdelirium, ohne zu wissen, was eigentlich los war. Dann kam die Diagnose, die sogenannte Alzheimer-Krankheit wurde bestätigt. Der Prozess der Gehirnzersetzung zog dann weitere Kreise, mein tapferer Vater versuchte all das auszugleichen, was ihm schwerfiel, denn er war unfähig, einen Herd oder eine Mikrowelle zu bedienen. Meine Mutter war ohnehin schon immer eine sture Persönlichkeit gewesen, die Krankheit verstärkte dieses Bild noch. Sie wollte in ihrer Küche nicht klein beigeben, die väterlichen Versuche, ihr zu helfen, empfand sie als Schmach und wurden nicht akzeptiert. Mein alter Vater war kein konfliktbereiter Mann, und so passierten einige Unfälle im Haushalt, ein brennendes Hemd unter einem aktivierten Bügeleisen war noch das harmloseste.
Ihr Geist löste sich weiter auf, der Prozess des sich Versprudelns ihres Gehirns war unaufhaltsam. Es gab dann dieses Irgendwann, diesen Erkenntnispunkt, dass es nicht mehr ohne fremde Hilfe ging, und darin wohnte eine Tragik. Wenn ein Sohn erkennt, dass die Frau, die ihn geboren hat, nicht mehr imstande ist, sich selbst zu versorgen, bricht auch von ihm was ab. Essentielle Teile meiner Liebe musste ich drangeben, um zu akzeptieren, was da im Kopf meiner Mutter abging. Mein Herz weichte auf.
Irgendwann als ich bei meinen Eltern zu Besuch war und wir zu Tisch saßen, wusste meine Mutter nicht mehr, was man mit einer Gabel macht. Mein Vater hatte Tränen in den Augen, als meine Mutter den Metallgegenstand vom Tisch aufhob und ihn von allen Seiten begutachtete, ihn aber keiner Funktion zuordnen konnte. Kindlich fragende Mutteraugen sahen mich und meinen Vater an, und auch ich spürte, wie von innen Tränen anklopften. Ich hatte ein Stück Rinderbraten im Hals, das passte ganz gut dahin, in meinen Hals, denn zum Runterschlucken des Fleisches war ich einfach zu traurig. Mich durchweichte eine Schwäche wie ein herbstlich plätschernder Regenschauer. Ich spürte eine unsagbar zerrende Schwermut. Die Unfähigkeit der Mutter zu essen. Ich fühlte mich wie ein durstiger Seemann auf dem Meer: Wasser, Wasser überall, aber nirgends ein Schluck zu trinken.
Sie steht mit dem Rücken zu mir und schaut aus dem Fenster in die Weite. Meine Mutter. Neunundsechzig Jahre alt und von magerer Gestalt. Sie trägt einen rosafarbenen Jogginganzug, der die Dünnheit ihres Körpers bestätigt, dazu braune Pantoffeln. Ihr Blick scheint sich in vor dem Fenster gesehenen Dingen zu verlieren. Ich versuche ein zärtlich zaghaftes «Hallo», doch ich ernte keine Reaktion. Sie starrt weiter in die ihr vor dem Fenster offenbarte Weite. In der reflektierenden Fensterscheibe sehe ich ihre sehnsüchtigen, nassen, geröteten Augen, die auf irgendetwas zu warten scheinen, was es nicht gibt. Auf etwas zu warten, was nicht existent ist, kann einem den Tag retten.
Von draußen dringen gedämpfte Kinderschreie und Autobetriebsgeräusche in den Raum. Irgendwelche Vögel zwitschern, in meinen Ohren eher unbehagliche Zwischentöne. Ich erinnere mich an kindliche Waldspaziergänge mit meiner Mutter, und wenn irgendwelche Vögeltöne zu hören waren, hatte sie immer innegehalten, um mir daraufhin den Verursachervogel dieser Geräusche zu nennen: Rotkehlchen, Amsel, Kohlmeise, weiß der Geier, was da noch so rumgeflogen war. Meine Mutter hatte ihre Kindheit in den 50er- und 60er-Jahren verlebt, da hatte man für derartige Hobbys wie Vogelstimmenzuordnen noch Zeit, und außerdem hatte es auch noch entschieden mehr Vögel gegeben, die die Sache vielleicht interessanter gemacht hatten. Für mich war das nie was, ich wollte mich nicht auf dieses fiese Gefiepe konzentrieren, um dann am Ende als unliebsamer Nerd irgendwo soziophob im Wald herumzukrauchen. Selbst als Kind war mir das schon klar, dass mich diese gefiederten Kleinlebewesen, die den Luftraum bevölkern, nicht die Bohne interessieren. Das wusste ich schon damals, aber meine Mutter blieb davon unbeeindruckt und erklärte mir weiter die subtile Welt der Kleinflugtiere.