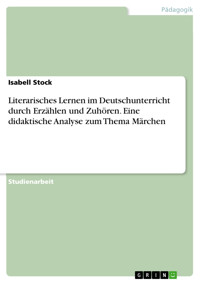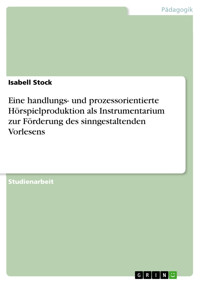Wie spricht man mit Kindern über den Tod? Die Themen Tod und Trauer im Sachunterricht der Grundschule E-Book
Isabell Stock
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Obwohl er uns alle gleichermaßen betrifft, spricht niemand gerne über den Tod. Dabei kann eine aufgeklärte Haltung zum Sterben den Umgang damit erleichtern. Das trifft auch auf Kinder zu. Wie aber vermittelt man ihnen dieses emotional schwierige Thema? Wie Isabell Stock betont, hilft es nicht weiter, den Tod zu tabuisieren und zu dämonisieren. Sie erklärt, warum die Themen Tod und Trauer Teil des Sachunterrichts sein sollten. In diesem Rahmen können Lehrerinnen und Lehrer die kindlichen Todesvorstellungen nämlich positiv beeinflussen. Gerade im Grundschulalter sind diese Konzepte noch nicht voll ausgeprägt. Stock hilft Lehrenden, die eine solche Death Education didaktisch angemessen umsetzen wollen. Gespräche sind dabei genauso wie gezeichnete Bilder letztlich hilfreiche Ausdrucksformen. Denn Kinder mit dem Tod zu konfrontieren heißt auch, sie und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen. Aus dem Inhalt: - Tod und Trauer; - Trauerkultur; - Trauerbewältigung; - Kinder; - Grundschule
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © Studylab 2019
Ein Imprint der GRIN Publishing GmbH, München
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: GRIN Publishing GmbH | Freepik.com | Flaticon.com | ei8htz
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffserklärung: Tod und Trauer
2.1 Der Tod in seiner Vielfalt
2.2 Todesvorstellungen
2.3 Trauer
2.3.1 Trauerkulturen - Früher
2.3.2 Trauerkulturen - Heute
3 Gesellschaftliche Entwicklungstendenzen zu Tod und Trauer
3.1 Tabus und die Tabuisierung bzw. Enttabuisierung
3.2 Der gesellschaftliche Umgang mit thantalen Themen
3.3 Das kindliche Todeserleben in der Gesellschaft
4 Die Todesvorstellungen des Kindes
4.1 Einflussfaktoren auf die kindlichen Todesvorstellungen
4.2 Die Entwicklungslinien einer Todesvorstellung
4.2.1 Das Vorschulalter
4.2.2 Das Grundschulalter
5 Das Trauerverhalten von Grundschulkindern
5.1 Trauerreaktionen
5.2 Trauerarbeit
6 Tod und Trauer als Thema im Sachunterricht
6.1 Die Ziele des Sachunterrichts
6.1.1 Die Dimensionen des Sachunterrichts
6.1.2 Die vier leitenden Prinzipien
6.2 Die Themenstellung im Unterricht
6.2.1 Angestrebte Ziele
6.2.2 Potentielle Themenkreise
6.2.3 Berücksichtigung des Themas innerhalb des Perspektivrahmens
6.2.4 Vorgaben des Kerncurriculums für das Fach Sachunterricht in Niedersachsen
7 Methodisches Vorgehen: Studie zu Kindervorstellungen
7.1 Forschungsgegenstand: Die Kinderzeichnung
7.1.1 Definition des Gegenstandsbereichs der Kinderzeichnung
7.1.2 Kinderzeichnungen unter entwicklungspsychologischen und persönlichen Aspekten
7.2 Durchführung in der Grundschule
7.3 Auswertung der Kinderzeichnungen
7.4 Zusammenfassung und Vergleich der Ergebnisse
8 Konkrete Überlegungen zur praktischen Umsetzung im Sachunterricht
8.1 Voraussetzungen für die Thematisierung
8.2 Death Awareness und Death Education
8.3 Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Thematisierung
8.3.1 Möglichkeiten und Chancen
8.3.2 Herausforderungen und Lösungsansätze
8.4 Bausteine für die Praxis
8.4.1 Der integrative Ansatz
8.4.2 Der ästhetische Ansatz
9 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Anhang
1 Einleitung
„Der Tod gehört zum Leben, er ist ein Problem der Lebenden.“ (Daum 2003, 25).
Die Verleugnung, die Unsicherheit und die Distanz bei der Auseinandersetzung mit dem Tod sind jedoch die häufigsten Formen in der Gesellschaft, um dieses „Problem“ vorerst auszuweichen. Todesverleugnung als eine Gleichgültigkeit gegenüber Leichen gab es tatsächlich während der ganzen Frühphase der Altsteinzeit. Da sich die Lebenden nicht zuständig fühlten, wurden die Toten nicht bestattet, sondern dem Prozess der Verwesung in der Natur überlassen. In der heutigen Gesellschaft ist ein solches Vorgehen nicht vorstellbar. Das Leben jedes Menschen endet mit dem Tod. Wieso unterliegt das Thema Tod dennoch einer ständigen Tabuisierung?
Ein überfahrenes Kaninchen auf der Straße, das achtlose Zerschlagen einer Fliege oder das wehmütige Betrauern des verstorbenen Hamsters: Kinder begegnen dem Thema Tod und Trauer täglich auf vielfältige Weise in ihrem unmittelbaren Umfeld. Auch der Tod von Familienmitgliedern, wie beispielsweise der Großeltern, ist eine Erfahrung, die schon Grundschulkinder erleben. „Wir kommen auf die Welt, und wir verlassen sie wieder – so einfach ist das.“ (ebd.). Eine sehr primitive, aber durchaus plausible Äußerung. Verstehen nicht auch Grundschüler und Grundschülerinnen[1] dieses Prinzip? Daher wäre die Behauptung, dass die Kinder von den medialen und persönlichen Kontroversen des Todes nichts mitbekommen würden, schlichtweg unrealistisch und unzutreffend. Die Medien zeigen Bilder und berichten durchgehend über Krieg, Unfälle, Katastrophen und Verbrechen. Der Tod ist an dieser Stelle omnipräsent, sodass sich aufgrund der Fülle der Reizüberflutung die Gefühle in einem bestimmten Rahmen zum Selbstschutz betäuben lassen. Dieses lässt die Vermutung aufkommen, dass der neue, offene Umgang mit den Medien vielmehr als eine Art der Sensationslust, als eine aktive und adäquate Auseinandersetzung zu verstehen ist.
Die Intention dieser Arbeit geht aus der zukünftigen Tätigkeit als Lehrer hervor, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen, die nicht immer emotional leicht gestrickt sind. Ein Lehrer muss sich dennoch mit dieser Thematik beschäftigen, um die Kinder in einer Notfallsituation angemessen zu unterstützen und eine sachgemäße Abhandlung des Themas für die Erfassung der kindlichen Lebenswelt zu gewährleisten. Darüber hinaus erfolgt diese Arbeit aus der persönlichen Motivation heraus, weitere Erfahrungen und Erkenntnisse zu diesem Gebiet innerhalb der fach- und sachgemäßen Argumentation zu erlangen, da dies bisher nicht bzw. kaum erfolgt ist. Der Titel „Tod und Trauer als Thema im Sachunterricht – Möglichkeiten und Grenzen: Eine Studie zu Kindervorstellungen“ fordert zentrale Fragestellungen, die in dieser Arbeit vorrangig geklärt werden sollen:
Inwiefern eignet sich der Sachunterricht, um der Tabuisierung des Themas Tod und Trauer innerhalb der Gesellschaft entgegenzuwirken? Wo bieten sich bei der Umsetzung des Unterrichtsgegenstandes unter Beachtung der kindlichen Todesvorstellungen[2] didaktisch-methodische Möglichkeiten und Grenzen für den Sachunterricht?
Diese Arbeit verfolgt das wesentliche Ziel, eine Basis für das Thema Tod und Trauer für Lehrer zu schaffen, sodass ihnen eine Orientierung für die bestehenden Vorstellungen der Kinder durch die erarbeiteten Todeskonzepte gegeben wird. An welchen Aspekten und zu welchem Zeitpunkt mit den Kindern unter Betrachtung der individuellen und situativen Voraussetzungen gearbeitet werden kann, ist durch das Erfassen der kindlichen Todesvorstellungen ein geeigneter Rahmen, um weitere Bausteine für den Unterricht zu entwickeln. Hieran können Lehrer anknüpfen, indem sie jene Grundlage nutzen und auf die jeweilige Klasse in ihrer Heterogenität bei der Planung und Durchführung anpassen.
Mit dieser Fragestellung im Fokus und der abgeleiteten Zielsetzung gliedert sich die Arbeit in drei aufeinander aufbauende Teile: Die Grundlage der Arbeit bilden die entscheidenden Begriffe und Definitionen für das Tabuthema Tod und Trauer, die mit wesentlich weiteren Bezeichnungen und Subkomponenten einhergehen. Hierfür werden zunächst die verschiedenen Blickwinkel und Definitionen aus der Literatur herausgearbeitet, die für die weitere Arbeit als zentrale Anhaltspunkte gelten.[3] Es folgt der gesellschaftliche Umgang mit Tod und Trauer, insbesondere mit der Betrachtung des Erlebens der Kinder, welche durch die bereits erwähnte Verdrängung des Themas durch die Erwachsenen resultiert. Die daraus entstehenden Folgen für die aktuellen Entwicklungen der Todesvorstellungen der Kinder können dann anhand von entwicklungspsychologischen Tendenzen und kindlichen Zeichnungen herausgestellt werden. Aus den Zeichnungen kann abgeleitet werden, inwiefern die Kinder fähig sind, das entsprechende Thema zu erfassen. Weiterhin folgt daraus die Begründung der pädagogischen Relevanz in der Schule. Darüber hinaus werden die Ziele und Aufgaben des Sachunterrichts in den Fokus gestellt, sodass geprüft werden kann, inwiefern das Thema überhaupt berechtigt ist, als Inhalt für den Sachunterricht genutzt zu werden.
In dem zweiten, empirischen Teil der Arbeit wird ein Überblick zu den Todesvorstellungen und dem Todeserleben von Grundschulkindern vorgestellt. Dieser wird durch eine eigene explorative Studie in Form der Analyse von Kinderzeichnungen überprüft und ergänzt. Die erarbeiteten Ergebnisse werden anschließend mit den aktuellen Erkenntnissen der Literatur verglichen und kritisch hinterfragt.
2 Begriffserklärung: Tod und Trauer
2.1 Der Tod in seiner Vielfalt
Der Tod ist eine Tatsache, die nicht aus eigenen Erfahrungen resultiert. Wenn jemand stirbt, gibt es keine Möglichkeit mehr, über diesen Vorgang zu berichten. So ist zum Einen die Begrenzung des Wortschatzes bei einer möglichen Definition des Todes festzustellen, zum Anderen gibt es zahlreiche Synonyme, die sich aufgrund der Tabuisierung zu diesem Begriff gebildet haben. Das direkte Vermeiden des Wortes „Tod“ folgt aus der Angst, dass die Aussprache des Wortes ein Heraufbeschwören des Todes verursacht. Hinsichtlich der Dichtkunst und Metaphern des heutigen Sprachgebrauchs bestehen zahlreiche Ausdrücke, wie z.B. der „Schlaf“ oder die „Ewige Ruhe“, wobei der Vergleich des Todes mit einem Schlafenden eine desillusionierte Vorstellung vermittelt. Die Metaphern sollen den Tod beschönigen, dennoch besagen sie eben doch nichts anderes, als dass der Tod die Beendigung unserer bewussten Existenz ist.
Aus dem anthropologischen Blickwickel betrachtet wird der Tod vorerst als eine unerlässliche Grenze, die sich als das Ende des Lebens kennzeichnet, benannt. So beinhaltet er die „Ganzheit des menschlichen Lebens. Das heißt, daß der Mensch im Tod einmal als biologisches Wesen aufhört zu sein, und zum anderen beendet er das Personsein des Menschen.“ (Arens 1994, 15). Demnach ist der Mensch aus biologischer Sichtweise vergänglich, denn der Tod ist unausweichlich. Das Sterben ist von dem Tod abzugrenzen, es ist ein Gesetz der Natur und kann sehr früh, oder auch erst sehr spät in der Lebensspanne auftreten. Es bleibt eine Notwendigkeit, die durch individuelle Ursachen impliziert wird und „[…] bezieht sich auf die prinzipielle Endlichkeit jedes Lebewesens einschließlich des Menschen.“ (Schuster 2003, 35). Das Sterben ist dabei immer ein zeitlich ausgedehnter Prozess, da die Organe eine unterschiedliche Überlebensdauer haben. Der Tod trifft erst nach diesem Vorgang ein, sofern keine Wiederbelebungsmaßnahmen mehr möglich sind (vgl. ebd.). „Das Bewußtsein kehrt nie wieder zurück“ (Arens 1994, 16), wenn das Großhirn länger als fünf Minuten ohne Sauerstoff versorgt ist. Durch eine Beatmungsmaschine kann der Organismus allerdings noch weiterhin überleben. Es stellt sich demnach die Frage, ab wann ein Mensch wirklich tot ist. Hierfür lassen sich einige Kennzeichen nennen, die den sicheren Tod bestätigen, z.B. Totenflecke, die Totenstarre, Verwesungserscheinungen sowie eine Trübung in der Hornhaut (vgl. ebd.). Weitere Faktoren, wie beispielsweise fehlende Atmung oder Puls sind nicht ausschlaggebend für die Feststellung eines sicheren Todes, da sie nicht eindeutig sind. Bei der Abgrenzung des klinischen Todes, bei dem der Stillstand der Herztätigkeit erfolgt und die Atmung aussetzt, zu dem absoluten Tod, ist zu beachten, dass ersteres noch eine gewisse Form des Lebens beinhaltet. Man spricht erst von dem absoluten Tod, wenn der Sterbende als eine Leiche identifiziert wird (vgl. Arens 1994, 17f.). Auch das personal-menschliche Leben ist mit dem Tod beendet, wobei dies nicht als ein mechanischer Prozess gilt, sondern vielmehr meint, dass der Mensch nicht nur ein Wesen der Natur, sondern auch eine Person ist. „Er ist ein Beziehungswesen, das heißt, daß er nie als einzelner, isoliert für sich existiert, vor sich hinlebt, sondern in ein großes Gefüge von Beziehungen zur Welt und zu Mitmenschen hineinverflochten ist.“ (Manser 1977, 201). Der Mensch braucht Menschen, damit er menschlich sein kann. Dieses erfolgt durch die Gemeinschaft, in der Beziehungen aufgebaut werden, welche abbrechen, sobald der biologische Tod eintritt. „Er bricht die Verbindung des Menschen zur Welt ab.“ (Arens 1994, 17). Hier schwingt eindeutig die soziale Komponente mit, denn die Hinterbliebenen stehen nun mit dem Verlust alleine da, sie sind augenblicklich in ihrer Lebenswelt erschüttert. Sie haben dabei das Gefühl, dass auch ein Teil in ihnen gestorben ist. Der Tod ist radikal, unvermeidbar und bestimmend über das Leben. Diese Herrschaft über die Menschheit formt ein Hassobjekt, das widerlich und abscheulich erscheint und Todesangst mit sich bringt (vgl. Arens 1994, 18f.). Dennoch hat dieser neben diesem negativen Effekt auch noch eine andere Seite; der Tod macht das Leben erst wertvoll, schenkt wichtigen Momenten Bedeutung und vermeidet ein gleichgültiges Dasein, in dem alle Entscheidungen nachholbar oder aufschiebbar wären. „Erst durch seine Begrenztheit ist das Leben von unermeßlichen Wert.“ (vgl. ebd.).
In der Rechtswissenschaft und Medizin wird zwischen dem „natürlichen Tod “ und „nicht natürlichen Tod“ unterscheiden. Natürliches Sterben meint dabei, das Eintreffen des Todes durch eine Erkrankung, bei der es definitiv selbst bei „dem verhältnismäßigen Einsatz medizinisch-therapeutischer Maßnahmen [zu einer] nicht mehr revidierenden Zerstörung jener somatischer (insbesondere zerebralen) Wirkungsabläufe gekommen ist […]“ (Bormann zit. n. Schuster 2003, 38). Demgegenüber ist der Tod als nicht natürlich anzusehen, sofern er vor dem natürlichen Todeszeitpunkt (z.B. durch einen Unfall) oder nach dem natürlichen Todeszeitpunkt (z.B. durch den unverhältnismäßigen Einsatz intensivmedizinischer Medikamente) eintritt (vgl. Bormann zit. n. Schuster 2003, 38). In dieser Definition wird der Gegensatz zwischen Kultur und Natur, Technik und Natur sowie Rationalität und Natur aufgehoben. Eine weitere Definition von Auer befasst sich dabei mit normativen Vorgaben, so ist der natürliche Tod bei einem Menschen eingetroffen, sobald er diesem würdig ist und dabei die Einmaligkeit des Daseins unterstreicht. Währenddessen ist der nicht natürliche Tod unzeitig, einerseits bei einem abrupten Abbruch des Lebens oder andererseits bei einer künstlichen Verlängerung des Lebens (vgl. Bormann zit. n. Schuster 2003, 38). Auch in der Medizin muss respektiert werden, dass jedes Leben endlich ist. Hinsichtlich dieser Wahrheit sollte auch bei dem Tod der Einsatz von Maßnahmen und Medikamenten beendet werden, wenn ein Mensch im Sterben liegt. Anschließend sollten lindernde Medikamente genutzt werden. Auch Hilfestellungen von Seelsorgern können dabei in Anspruch genommen werden (vgl. Schuster 2003, 39).
In der Philosophie wird die Frage bezüglich der Bedeutung des Todes für uns Menschen betrachtet. So beschreibt Sokrates zwei Perspektiven für den Tod, sie umfassen das endgültige Erlöschen des Seins und Bewusstseins und das weiterführende Leben nach dem Tod in einer anderen Form (vgl. Hucklenbroich 2001, 10f).
Hinsichtlich der theologischen Deutung des Todes wird dieses Faktum im Licht des Glaubens interpretiert. Die Definitionen in den Religionen basieren auf ihrem jeweiligen, spezifischen Menschenbild. Es entwickelte sich aus der Kultur, sowie Sterbekultur und der jeweiligen Weltanschauung, die von der Grenze des Wissens und Könnens der Menschen abhängig ist (vgl. Schwikart 1999, 13), Dabei wird der Tod immer als ein Bestandteil des Lebens gesehen, der akzeptiert werden muss und bestimmte Umgangsformen mit sich führt.
Bei den Christen beispielsweise ist der Tod die Vollendung des Lebens, sodass es die Aufgabe der Christen ist, den Tod anzunehmen, welcher nur ein Übergang zu einem neuen, ewigen Leben ist und bereits durch die Auferstehung Jesu Christi verdeutlicht wird. „Damit wird die Annahme des eigenen Todes zu einem Akt des Gehorsams und vor allem der Hoffnung gegenüber Gott – so wie in urbildlicher Weise Jesus Christus selbst sein Leiden und Sterben freiwillig angenommen hat.“ (Schuster 2003, 37). Zusammenfassend ist zu beachten, dass die Theologie den Zeitpunkt, wann das Sterben eines Menschen einsetzt, nicht bestimmen kann.
Innerhalb der psychologischen Sichtweise sind der Tod und dessen Vorstellung etwas Primäres, Angeborenes und phylogenetisch[4] Erworbenes. Das Wissen von dem Tod ist unausweichlich, sodass dem Gedanken der Unsterblichkeit entgegen Freuds Theorien nicht auswichen werden kann. Aus diesem Grund müssen die Thesen von Freud weitergedacht und durch die Aspekte der Zeitlosigkeit und Unsterblichkeit als Strukturen, die eng mit dem Individuum verankert sind, ergänzt werden. Der herrschende Konflikt ist hierbei, dass „der Tod ein notwendiges Glied des endlichen Daseins [ist], die Unsterblichkeit gehört in den Bereich des transzendeten Seins.“ (vgl. Löwenthal 1984, 88f). Das bedeutet, es existiert beides zur selben Zeit, aber das Bewusstsein vermeidet aufgrund schmerzhafter Erfahrungen, dass die beiden Schichten aufeinander treffen. Hierfür ist die Todesangst als ein angeborenes Merkmal entscheidend. Diese ist ein Instinkt, welchen jedes Lebewesen besitzt und dennoch ist das Bewusstsein von Sterblichkeit ein rein menschliches Phänomen. Todesangst dagegen wird als eine Phobie deklariert, welche aus unbewussten Ängsten resultiert. Wichtig ist dabei, dass zwar jeder die Todesangst kennt, aber nicht alle Menschen sind Phobiker und nicht alle Phobiker haben die gleiche Ausprägung dieser Phobie. Die Todesangst resultiert nach Freud aus dem Trauma der Geburt, in dem die Erstickungsgefahr als ein Erlebnis im Unterbewusstsein bestehen bleibt. Durch den typischen Tod, also durch Versagen von Herz und Lunge, erlebt der Mensch genau denjenigen Erstickungsvorgang erneut, sodass die Todesangst als eine reale Furcht verstanden werden kann. Manche aus der Angst stammenden Affekte sind daher zwar wegzudenken, aber nicht in der Vorstellung zu vermeiden. Es besteht jeher eine Koexistenz zwischen dem Tod als Realität und der Verdrängung. Möchte man das eigene Wissen über den Tod erörtern, ist es notwendig sich von dem Unbewussten zu dem Bewussten zu wenden (vgl. Löwenthal 1984, 90). Es ist festzustellen, dass sich stark abgrenzende, aber auch teilweise überschneide Definitionen zu dem Tod bestehen. Aufgrund dieser differenziellen Blickwinkel entwickeln sich unterschiedliche Vorstellungen zum Tod.
2.2 Todesvorstellungen
„Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Vorstellungen von den Dingen. So ist z.B. der Tod nichts Furchtbares … sondern die Vorstellung, er sei etwas Furchtbares, das ist das wahre Furchtbare.“ (Epiktet 1954, 24).
„Todesvorstellungen“ oder gleichbedeutende Begriffe wie „Todeskonzepte“, „Todeserleben“ und „Todesbilder“ umfassen dabei stets die Gesamtheit aller kognitiven Bewusstseinsinhalte (Begriffe, Vorstellungen und Bilder), die einem Kind oder auch einem Erwachsenen zur Beschreibung und Erklärung des Todes zur Verfügung stehen. Zu dem Todeskonzept von Erwachsenen gehört die Nonfunktionalität, die das Abschalten der Körperfunktionen meint, die Irreversibilität, welche besagt, dass das „Totsein“ unumkehrbar ist, die Universalität, also dass alle Lebewesen sterblich sind, und die Kausalität, welche den biologischen Zusammenhang des Todes erfasst (vgl. Ritter 2015, 7). Demzufolge betrachtet der Mensch zwar den Tod konzeptionell rational als etwas „Normales“, dennoch wird jener immer eine belastende Funktion im Leben sein. Dabei soll allerdings der bewusste Umgang mit diesem dazu führen, dass dem Menschen deutlich ist, dass er nicht ewig lebt und somit den Moment des Lebens vollends ausschöpft. Das Todeskonzept beinhaltet eine kognitive Komponente, an der primär Wahrnehmung und Denken beteiligt sind, sowie eine emotionale Komponente, welche die mit einzelnen kognitiven Inhalten des Todeskonzepts verbundenen Gefühle abdeckt (vgl. Wittkowski 1991, 317). Der Tod wird insofern einerseits im hohen Maße individuell verarbeitet, andererseits von der Gesellschaft und Kultur geprägt, sodass die Todeskonzepte sehr stark variieren (siehe 4.2 Die Entwicklungslinien einer Todesvorstellung). Ferner ist der Tod durch die Institutionalisierung und Säkularisierung aus unserem öffentlichen Leben kaum noch präsent, sondern wurde in den privaten Bereich zurückgedrängt. Nun ist der Einzelne auf sich gestellt, entweder löst er diese Herausforderung oder er schiebt sie beiseite. Widersprüchlich dazu ist der Tod in den Medien stets vorzufinden und hat somit einen mächtigen Einfluss auf die Kinder (siehe 3.3 Das kindliche Todeserleben in der Gesellschaft).
2.3 Trauer
Der Trauerforscher Jorgos Canacakis beschreibt Trauer als eine gesunde, lebensnotwendige und kreative Reaktion auf einen Verlust und Trennungsereignisse (vgl. Canacakis 2002, 23f.). Die Reaktion auf einen Verlust oder auch dessen Bewältigungsversuch sind zwei Aspekte, die den Begriff Trauer erfassen. Diese beschreibt das emotionale Empfinden eines Menschen, der auf den schmerzhaften Verlust eines geliebten Gegenstandes oder einer Person reagiert und dann anschließend einen Prozess der Bewältigung durchläuft. Die natürliche Reaktion ist im hohen Maße individuell und von der persönlichen Wahrnehmung abhängig (vgl. Lammer 2003, 34).
Aus jenem Grund kann festgehalten werden, dass die Trauer angeboren ist und „eine Antwort der Seele und des Körpers auf Trennung und Verlust“ ist (Hinderer, Roth 2005, 26). Der Verlust oder die Trennung muss nicht immer heißen, dass jemand gestorben ist; wahrhaftig ist der Abschied gemeint, der fast schon gewöhnlich erscheint. Ereignisse, die jedoch unser Leben in höheren Graden verändern und somit einschneidender für die weitere Lebensplanung sind z.B. der Verlust der Wohnung oder des Arbeitsplatzes, von der Heimat oder den erwachsen gewordenen Kindern, müssen verarbeitet werden, indem wir trauern[5]. Das Trauerverhalten kann sich an diesem Punkt maßgeblich individuell unterscheiden. Es befindet sich in einer weiten expressiven Spanne; so können die verschiedensten Emotionen auftreten. Wut, Verzweiflung und Ratlosigkeit sind alles Formen der Trauer, welche sich sehr schnell verändern können, sodass Außenstehende diese teilweise nicht nachfühlen können (vgl. Hinderer, Roth 2005, 26). Besonders bei Kindern erscheint ein umstrittenes Trauerverhalten (siehe 5.1 Trauerreaktionen).
Trauer ist an vier Bedingungen geknüpft: Sie braucht Ausdruck, Raum, Zeit und Gemeinschaft. Ausdruck der Gefühle ist bei einem Trauernden ein notwendiger Schritt, damit die Heilung des Verlustes überhaupt erfolgen kann. Wird diese unterdrückt oder gar verboten, so kann sich Trauer pathologisch entwickeln und folgeschwere Krankheiten, wie Depressionen, fördern (vgl. Hinderer, Roth 2005, 27). Das herrschende Gefühl des Getrenntseins von einer nahestehenden Person, die man durch den Tod verloren hat, ist ein Dauerzustand bei den Trauernden. Dabei fühlen sie sich nicht nur von dem Verstorbenen verlassen, sondern ziehen sich auch stark von anderen Menschen zurück. Die Welt erscheint ihnen aus einer anderen Perspektive und die negativen Gefühle des Verlustes intensivieren sich. „Trauernde haben ein anderes Zeitgefühl, eine veränderte Wahrnehmung, Konzentrations- und Merkfähigkeitsschwächen und reagieren körperlich sehr heftig, z.B. mit Schlaf- und Appetitlosigkeit, Schwäche, Schmerzen oder Krankheit.“ (Hinderer, Roth 2005, 28). Problematisch ist hierbei, dass den Trauernden nur ein paar Tage Trauerzeit gewährt wird. Bald müssen sie sich wieder in ihrem Leben zurechtfinden und ihre alltäglichen Aufgaben pflichtgemäß bewältigen. Eine pauschalisierte Meinung, dass jegliches Trauerverhalten über sechs Monate krankhaft wäre, ist zu verwerfen. „Abhängig von der Intensität der Beziehung, der eigenen Lebenssituation, dem eigenen Alter, dem Alter des Toten, von Vorerlebnissen, der Art des Sterbens und des Abschieds, der Kultur und den religiösen Vorstellungen kann normale Trauer kurz erscheinen oder jahrelang dauern.“ (ebd.). Ferner lässt sich die Aussage festhalten, dass sie auch niemals komplett verschwindet, sie verändert sich nur in ihrer Art und Stärke des Erlebens. Gewisse Grenzsituationen, z.B. das Erleben eines weiteren Verlustes oder das Beobachten eines ähnlichen Geschehens, lassen die verdrängten oder eingedämmten Gefühle wieder zum Vorschein kommen. Dem Trauernden muss jedoch ein entsprechender Raum z.B. in Form eines Trauertisches, Tagesbuches oder Gottesdienstes zugesprochen werden, damit der Ausdruck der Gefühle ermöglicht wird. Viele Trauerrituale aus der früheren Zeit, die solches Trauerverhalten unterstützten, sind im Laufe der Zeit verloren gegangen, sodass heute ein rasches Abfertigen bei Verstorben notwendig erscheint.
Auch die Fähigkeit, Menschen bei dem Trauern zu unterstützen und zu trösten, ist selten vorzufinden. Meistens entscheiden sich die Menschen für hilflose Floskeln, die sich in geschriebenen Beileidskarten wiederfinden. Dabei ist es von Nöten, dass die trauernden Menschen begleitet werden, sodass sie sich ihren Bezugspersonen gegenüber jederzeit emotional öffnen können (vgl. Hinderer, Roth 2005, 28).