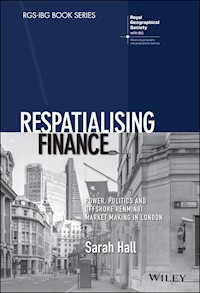17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman wie ein Schrei: über weibliches Begehren und künstlerische Kraft
»Du warst der letzte hier, bevor ich die Tür von Burntcoat schloss. Bevor wir alle unsere Türen schlossen.« – Im Schlafzimmer über ihrem riesigen Atelier in Burntcoat trifft die berühmte Bildhauerin Edith Harkness letzte Vorbereitungen. Die Symptome, die ihr Körper zeigt, sind bekannt: Ihr Leben wird in den nächsten Tagen zu Ende gehen. Ihr Atelier gleicht einem glühenden Ofen, befeuert von Erinnerungen und Sehnsüchten. Hierher brachte Edith Halit, als der erste Lockdown begann. Den Liebhaber, den sie kaum kannte. Eine Erscheinung aus einer anderen Kultur. Ein Tor zu einer neuen und fiebrigen Welt.
Sprachlich betörend und mit großem Sog erzählt Sarah Hall von weiblichem Begehren und der Kraft künstlerischen Schaffens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Als junges Mädchen verwandelte Edith Harkness tragische persönliche Erlebnisse in Kreativität. Sie wurde zur gefeierten Bildhauerin. Doch die Krankheit eines Mannes, dessen Begehren ihrem Dasein neue Dimensionen erschloss, brachte sie ins Taumeln. Nun zieht Edith Bilanz, blickt zurück auf ein Leben voll Melancholie und Schönheit.
In lyrischer Sprache, betörend und mit großem Sog erzählt Sarah Hall von weiblicher Stärke und der Kraft, die Kunst unserem Leben zu geben vermag.
Sarah Hall, 1974 in Cumbria geboren, hat Romane und Storys veröffentlicht, die mit bedeutenden Preisen und Stipendien ausgezeichnet wurden. Feministische Themen und intensive Naturbeschreibungen verbinden sich in ihrem Werk, das in 16 Sprachen übersetzt ist, auf überraschende, ungewohnte Weise. Auf Deutsch erschienen bislang ihre Romane Der Elektrische Michelangelo (2005), Die Töchter des Nordens (2021) und Bei den Wölfen (2016). Sarah Hall lebt mit ihrer Familie in Kendal.
Sarah Hall in der Presse:
»Ich kenne keine andere britische Autorin, deren Talent so beständig begeistert, überrascht und verblüfft.« Benjamin Myers
»Sarah Hall bringt Sprache zum Schimmern und Brennen. … Eine der gegenwärtig besten Schriftstellerinnen.« Damon Galgut
»Halls zärtlicher, brennender Roman wird Ihr Herz zum Weinen bringen.« The Independent
»Hall hat mit ihrem Roman Maßstäbe gesetzt … fein ausgearbeitet, intellektuell mutig und emotional ehrlich.« The Scotsman
»Ein brillantes Buch.« The Guardian
Sarah Hall
Wie wir brennen
Roman
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Die Originalausgabe erschien 2021
unter dem Titel Burntcoat
bei Faber & Faber, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2021, Sarah Hall
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Sabine Kwauka nach einem Entwurf
von Mumtaz Mustafa/Harper Collins US unter Verwendung einer Coverillustration von Owen Gildersleeve/levineleavitt.com
Gesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-29901-9V001
www.penguin-verlag.de
Für meine Tochter und für meinen Vater
Hauptteil
Wer Geschichten erzählt, überlebt. Das sagte meine Mutter einmal zu mir, als ich noch ein Kind war. Ich hatte sie stundenlang vermisst. Ich war überzeugt, dass sie nicht mehr lebte und mich allein in dem Cottage am Moor zurückgelassen hatte. Als sie dann endlich nach Hause kam – durchnässt und ohne ihren Mantel, draußen war es schon dunkel –, konnte sie gar nicht verstehen, worüber ich mich so aufregte. Sie war nur spazieren gegangen und hatte die Zeit vergessen.
Wie soll ich denn ganz allein hier leben?, schrie ich. Ich kann mich nicht um mich selbst kümmern!
Was natürlich nicht stimmte. Ich konnte Feuer machen und den Herd bedienen; mit zehn hatte ich gelernt, ihr Auto zu fahren. Ich war bereit für ihr Verschwinden.
Naomi sah in mein nasses, verstörtes Gesicht. Ihres war ausdruckslos. Sie zuckte mit den Schultern. Wer Geschichten erzählt, überlebt, sagte sie, als wäre das ein hilfreicher Tipp.
Weil Naomi dazu neigte, Wörter und Konzepte durcheinanderzubringen, glaubte ich im ersten Moment, sie sei verwirrt oder habe es andersherum gemeint: Wer überlebt, erzählt Geschichten. Ich verbesserte sie, aber sie blieb dabei.
Danke, Edith – ich kann allein stehen.
Das war ihre übliche, nicht unfreundlich gemeinte Antwort, ein Code für ihre wiedererlangte Autorität über mich. Zu dem Zeitpunkt hatte sie seit Jahren kein Buch mehr veröffentlicht. Ihre Workshops brachten nur wenig ein, und wir kamen kaum über die Runden. Die Furchen in ihrer Kopfhaut waren inzwischen von üppigem, bauschigem Haar überwuchert. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass sie alles neu hatte lernen müssen, sogar zu sprechen und ihren Namen zu schreiben. Sie hatte überlebt – die Kriegskatastrophe in ihrem Gehirn genauso wie den äußerlichen Wiederaufbau.
Ich habe oft über ihre Worte nachgedacht. Wäre es möglich, sich zu retten wie Scheherazade, die den Feind mit Geschichten in Schach hält? Können Geschichten die chaotische Welt ordnen? Vielleicht wollte Naomi mir lediglich sagen, dass das Leben nur eine Erfindung ist, eine Interpretation, die uns hilft, die Tatsache unserer Existenz zu akzeptieren.
Heute habe ich das Bett vorbereitet. Das neue Laken spannt sich straff über die Matratze und riecht nach Wind und Sonne, weil ich es draußen im Hof getrocknet habe. In den Falten Blütenblätter. Schon wieder Frühling – anscheinend eine menschliche Schwachstelle, wenn wir vom Winter müde sind, zögerlich loslassen und von der Flucht träumen. Mir fällt ein Sprichwort aus deinem Land ein: Verbrenn im Frühling nicht den Stiel der Axt. Ich habe Suppe und ein paar weiche Speisen vorgekocht, genug für etwa eine Woche. Auf dem Tisch liegen Bücher, darunter auch die von Naomi und ein übersetzter Gedichtband. Zu dieser Jahreszeit verändert das Licht auf dem Fluss seinen Winkel, fällt schräg von unten gegen die Mauern und zum Schlafzimmerfenster herein. Das Atelier im Erdgeschoss leuchtet wie eine Glühbirne.
Mir bleibt noch genug Zeit zum Organisieren, aber das meiste ist schon erledigt. Morgen werde ich zum Blumenstand auf dem Markt gehen. Sicher kann Rostam mir weiterhelfen, ohne dabei sentimental zu werden. Ich habe nicht aufgeräumt. Wir sind, wer wir sind; sich zu verstellen wäre sinnlos. Die Wohnung ist ohnehin nur spärlich eingerichtet, und meine letzte Arbeit ist fertig und wartet unten im Atelier in ihre Einzelteile zerlegt auf die Abholung. Mein Installateur hat die Entwürfe und das Modell viele Male überprüft, eigene Berechnungen angestellt und eine stählerne Ankerplatte gebaut. Trotz der hohen Decke ist das Stück zu groß, um in der Halle montiert zu werden. Ich vertraue Sean. Er kennt das Gewicht und die Flügel der Konstruktion, er weiß, in welche Richtung sie ausgerichtet werden muss – gen Osten, damit der Wind von hinten auf die Rotorblätter trifft – und wie das Holz sich in der Witterung verziehen und setzen wird. Die Vorstellung, dass ich sie nie vor Ort sehen werde, auf dem Gedenkhügel, ist eigenartig. Ehrlich gesagt kann ich ihren Anblick jetzt schon kaum ertragen. Zwischendurch gab es Phasen, in denen ich die Gesichter der Liebenden mit einer Plane abdecken musste. Manchmal hätte ich sie am liebsten zertrümmert und in Brand gesteckt.
Karolina hat das Projekt um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte verschleppt. Sie ist längst in Rente und betreut nur noch wenige Klienten. Zum Glück ist sie loyal. Dieser Auftrag ist ihr Ruin – die versteckten Kosten, die vielen Verzögerungen. Auf jeden Fall wird es nach der Enthüllung zu einem Eklat kommen, und dann wird Sir Philip seine Entscheidung bereuen. Immerhin muss ich mich nicht mit den Konsequenzen herumschlagen.
Weil es keine Erben gibt, habe ich dafür gesorgt, dass Burntcoat an den National Heritage Memorial Fund geht. Allein die Maschinen sind Tausende Pfund wert und die Gasbrenner immer noch in gutem Zustand; vielleicht könnte ein Dachdecker sie gebrauchen. Vielleicht werden sie das Atelier eines Tages für Besucher öffnen. Die Schlüssel liegen beim Notar, einen zweiten Satz werde ich zusammen mit meinen Anweisungen an Karolina schicken. Sicher hat sie sich das Szenario längst ausgemalt. Die Außenmauern dürfen nicht verändert werden, vor allem nicht die Schrift auf den Ziegeln. Ich wünsche mir keine Plakette.
Ich sollte im Gesundheitszentrum anrufen, aber ich war seit Jahren nicht mehr dort. Ich hatte genug von den Untersuchungen und den Fragen, den ständigen Blutabnahmen, den Beteuerungen, es lägen keine körperlichen Schäden und keine Neurodivergenzen vor. Zunächst hieß es, ich sei traumatisiert, später galt ich dann als außergewöhnlicher Fall. Ich kenne keinen der Ärzte mit Namen und möchte keine Hilfe. Bis heute bekomme ich schriftliche Einladungen in die Nova-Kliniken – heute heißen sie natürlich anders –, aber ich habe meine Lebenserwartung so oft überschritten, dass ich nicht mehr unter Beobachtung stehe. Neunundfünfzig ist alt für eine Trägerin.
Zuerst hatte ich es für Müdigkeit gehalten, für die Nachwehen des langen, ungewöhnlich harten Winters. Burntcoat ist wie eine Kathedrale mit schwer beheizbaren Gewölben. Die alten Wehwehchen sind zurück. Meine Schultern sind kaputt, weil ich gehoben habe, was ich nicht hätte heben dürfen, Balken und Paletten, und oft kann ich kaum die Finger bewegen. Anfangs habe ich mir eingeredet, ich befände mich in dauerhafter Remission. Vielleicht war ich wie die letzten, erstaunlich hohen Ulmen im Park, denen der Mehltau nichts anhaben konnte. Vielleicht hatte ich auch durch irgendeinen Trick zur Akzeptanz gefunden. Die Psychologen haben mir erklärt, ich besäße eine hohe Toleranz für Ungewissheit, fast so, als wäre ich ahnungslos. Aber jetzt bin ich mir sicher. An der Haut zwischen meinen Fingern haben sich kleine Bläschen gebildet. Das Herz wird schwächer, ich spüre einen Tiefenschmerz. Es ist in mir; es setzt sich erneut zusammen.
Und auch du bist wieder da, natürlich – wer du bei unser ersten Begegnung warst, wozu du wurdest. Es kommt zurück und bringt deine Schritte auf der Treppe mit, deinen Geschmack, dein Gewicht auf meinem Rücken. Du liegst wieder im Bett, benommen und mit leuchtenden Augen, und entschuldigst dich für die Schweinerei. Ich erinnere mich an die trügerischen Momente, als wir dieselbe Luft geatmet und – fast – einen Blutkreislauf geteilt haben. Ich erinnere mich an die Blüten des kleinen Orangenbaums – ein Geschenk von dir, wie eigenartig, mir auf diese Weise den Hof zu machen –, an ihre milde Würze und den Geruch nach erweckten Hainen, nach Duftwasser für die Gäste, nach Bestattungsinstitut.
Ich habe zwei Namen, hast du in der ersten Nacht gesagt, den einen habe ich bei meiner Geburt bekommen und den anderen vom Staat.
Bei welchem soll ich dich nennen?, habe ich gefragt.
Bald werde ich nicht mehr denken können, geschweige denn mich erinnern.
Timing ist alles, sagen die Leute, und sie haben recht. Du bist zeitgleich mit dem strahlenden Unglücksstern hier aufgetaucht. Ich betrachte dich als einen Boten. Du warst mein letzter Besucher, bevor ich die Türen von Burntcoat verriegelte, bevor wir alle uns einschlossen.
*
Als ich acht Jahre alt war, starb meine Mutter, und Naomi war geboren. Damals lebte mein Vater noch bei uns. Wir bewohnten ein Haus am Stadtrand. Die steile Straße führte zum Leuchtturm hinauf, von oben konnte man die Berge im Landesinneren sehen. Es war ein paar Tage vor Weihnachten. Die Gipfel waren schneebedeckt, die Luft war kalt und dünn wie Pergamentpapier. Wir wollten Geschenke kaufen, und mein Vater hatte beschlossen, das Auto zu nehmen – das Puppenhaus, das ich mir wünschte, war sehr groß und sehr schwer, und so war ich mir ziemlich sicher, dass ich es bekommen würde. Meine Mutter hatte den ganzen Tag über Kopfschmerzen geklagt. Wann immer wir ein Geschäft betraten, zuckte sie zusammen.
Das Licht ist so hell.
Sie zog die Füße nach, musste sich immer wieder setzen, massierte sich die Schläfen. In der alten Stadtbücherei hatte sie sich, völlig untypisch für sie, nichts ausleihen wollen. Mein Vater war gereizt.
Warum bist du, wenn du Migräne hast, überhaupt mitgekommen? Möchtest du nach Hause?
Auf dem Rückweg zum Auto stolperte sie. Mein Vater war ein Stück vorausgelaufen, um den Motor zu starten und die Heizung aufzudrehen, deswegen bekam er es nicht mit. Meine Mutter verlor das Gleichgewicht und stürzte auf den Gehweg. Ganz kurz kniete sie im Schneematsch, dann setzte sie sich auf.
Adam, sagte sie. Wo ist Edith? Ist sie da?
Sie klang ganz ruhig. Sie sprach sehr langsam.
Adam, ich kann sie nicht sehen.
Ich hielt es für ein interessantes neues Spiel. Manchmal konnte sie sehr albern und witzig sein. Hier bin ich nicht, Mami, sagte ich und ging um sie herum. Und hier auch nicht. Sie hob eine Hand und griff vorsichtig in die Luft.
Ich kann nichts sehen.
Ich hockte mich vor sie, musterte ihr Gesicht, wackelte mit dem Kopf. Ihre Augen folgten mir nicht. Eine Iris sah aus wie ein schwarzer Planet.
Papa!, rief ich.
Mein Vater kam zurück.
Lass mich mal, sagte er. Naomi, was ist los? Warum sitzt du im Dreck?
Sie streckte die Arme aus, er nahm ihre Hände und zog sie in die Höhe. Sobald er losließ, schwankte sie und sackte abermals zu Boden.
Er half ihr über den Parkplatz, öffnete die Tür des Volvo und setzte sie auf die Rückbank. Sie war mit jedem Schritt schwächer geworden, wie ein Spielzeug mit leerer Batterie. Sie streckte sich auf der roten Lederbank aus, stumm und mit weit aufgerissenen, leeren Augen.
Du steigst vorn ein, sagte er zu mir.
Ich hatte noch nie vorn sitzen dürfen. Ich schob die Metallzunge des Anschnallgurts ins Schloss. Der Gurt war für Erwachsene eingestellt und zu locker. Mein Vater ließ den Wagen an und fuhr in aller Ruhe los. Wir hielten an jeder roten Ampel. Aus irgendeinem Grund dachte ich, wir würden nach Hause fahren. Ich drehte mich immer wieder um. Meine Mutter atmete schnell, inzwischen hingen ihre Augenlider. Sie wollte etwas sagen, brachte aber nur Babylaute heraus. Ihre Kehle klickte. Als ich mich das nächste Mal zu ihr umdrehte, war ihr Gesicht von einer stückigen Flüssigkeit bedeckt.
Mama hat sich übergeben. Sie übergibt sich.
Alles klar, danke, Edith, sagte mein Vater.
Ich hatte keine Angst. Was gerade passierte, schien niemanden im Auto zu verängstigen.
Dreh dich wieder um und setz dich hin.
Er fuhr zum Krankenhaus, hielt vor dem Eingang der Notaufnahme und zog die Handbremse an.
Du wartest hier, sagte er.
Ich will mit rein.
Nein, sagte er.
Aber ich will mit Mama gehen.
Er langte über die Handbremse und schlug mir auf den Oberschenkel, ein unbeholfener, energischer Klaps, der mir durch Rock und Strumpfhose stach. Dann stieg er aus, verschwand in der Notaufnahme und kehrte mit einem Pförtner und einem Rollstuhl zurück. Sie zogen Naomi von der Rückbank und hoben sie in den Rollstuhl, und ich schaute zu, wie sie hineingeschoben wurde. Ihr Oberkörper hatte Schlagseite. Meine Augen wurden nass, die Tränen brachen das Licht, und ganz kurz hingen da zwei Frauen in zwei Rollstühlen. Ich blinzelte, und eine verschwand. Im Auto roch es säuerlich. Die Seitenscheibe erblühte kalt unter meiner Handfläche. Neben dem Auto hielt ein Rettungswagen, die Sanitäter zogen eine Trage heraus.
Mein Vater kam zurück. Er entschuldigte sich nicht. Ich schwieg, während er das Auto in eine Parklücke umsetzte. Im Krankenhaus legte er mir eine Hand zwischen die Schulterblätter und dirigierte mich wortlos durch die Korridore.
Die Frau am Empfang gab mir ein paar Kinderbücher.
Du siehst wie ein schlaues kleines Mädchen aus, sagte sie. Ich wette, du kannst schon allein lesen?
Ich hörte, wie sie mit den Ärzten redete, mit meinem Vater, mit Anrufern. Anscheinend musste meine Mutter so schnell wie möglich in eine andere Klinik verlegt werden. Als mein Vater kurz zur Toilette ging, schlich ich an den Tresen und fragte, ob ich meine Mutter sehen dürfe.
Oh nein, Schätzchen, das geht nicht. Sie ist sehr krank. Sie muss operiert werden.
Was fehlt ihr denn?, fragte ich. Liegt es an den Kopfschmerzen?
Die Frau nickte und sah erfreut aus, als wären wir in der Schule und als hätte ich die richtige Antwort gegeben. Ja, Schätzchen. Sie hat ein Blutgerinnsel im Gehirn. Oh, es geht schon los …
Der landende Helikopter war nicht zu überhören. Die wütenden Rotorblätter, die stampfende Luft vor dem Gebäude. Auf einmal begriff ich, dass es ernst war. Helikopter wurden eingesetzt, um abgestürzte Kletterer aus Schluchten zu bergen und Leben zu retten. Ganz kurz glaubte ich, wir würden alle mitfliegen, und plötzlich war ich hellwach vor Aufregung und Angst, denn ich war noch nie geflogen. Aber da hob der Helikopter auch schon wieder ab, noch lauter als bei der Landung. Ein Rotorenheulen, ein ohrenbetäubendes Tosen, das bald zu einem fernen Brummton verhallte.
Mein Vater fuhr mich nach Hause, machte mir einen Toast und schickte mich ins Bett.
Du musst jetzt ein großes Mädchen sein, Edith.
Ich lag auf dem Rücken und sah die Sterne unter der Kinderzimmerdecke leuchten.
Am nächsten Morgen erzählte er mir, dass meine Mutter nach Newcastle geflogen und operiert worden war. Sie würde für mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben.
Es war ein sehr komplizierter Eingriff. Sie mussten Sachen machen, die zur Folge haben, dass sie vorübergehend nicht sie selbst sein wird. Es könnte sogar sein, dass sie dich nicht wiedererkennt.
Er trug immer noch dieselbe Kleidung wie am Vortag. Seine Augen waren geschwollen. Sein ganzes Gesicht wirkte geschwollen, als hätten sich die Züge aufgelöst.
Doch, sie wird mich wiedererkennen, sagte ich.
Er schüttelte den Kopf.
Sie ist nicht bei Bewusstsein. Christines Mutter wird sich heute um dich kümmern.
Wir verbrachten ein elendes Weihnachten zu zweit und aßen Hackpasteten. Der Baum war nicht geschmückt, aber sein Duft war festlich und beruhigend. Kein Puppenhaus für mich. Mein Vater hatte mir in aller Eile einen Mantel gekauft und vergessen, das Preisschild zu entfernen. Am zweiten Weihnachtstag fuhr er wieder ins Krankenhaus. Christines Eltern machten großes Aufhebens um mich und boten mir Schokolade und Milch an. Christine wollte wissen, ob meine Mutter sterben würde. Ich log und sagte, ich wäre im Helikopter mitgeflogen. Als mein Vater mich wieder abholte, unterhielt er sich leise mit Christines Mutter, während ich mir Mantel und Schuhe anzog.
Wie in Frankenstein, sagte er. Der absolute Horror.
Alle paar Tage trat er die lange Überlandfahrt an. Ich fragte immer wieder, wann ich sie sehen dürfe.
Noch nicht, sagte er jedes Mal. Es geht ihr nicht gut. Sie kann sich nicht erinnern.
Bei meinem ersten Besuch in der Reha-Klinik saß meine Mutter an einem Tisch und malte ein Bild. Auf ihrem Kopf sah ich einen rasierten Streifen mit einer riesigen Narbe, die sich wölbte wie eine Raupe. Eine Gesichtshälfte sah zu straff aus, fast wie geliftet. Ich blieb in der Tür stehen.
Los, sagte mein Vater. Du wolltest doch unbedingt mit. Ich hole mir einen Kaffee.
Er sah meine Mutter nicht an, er hatte ihr nicht einmal Hallo gesagt.
Mein Vater verschwand im Flur. Meine Mutter schien mich nicht zu bemerken. Sie trug einen hellblauen Pyjama mit weißen Schneeflocken, der sie jünger wirken ließ. Hinter mir tauchte eine Schwester auf.
Du bist bestimmt Edith. Deine Mama hat dich sehr vermisst. Komm!
Sie begleitete mich an den Tisch und zog einen Stuhl heraus. Ich setzte mich. Die Schwester legte meiner Mutter behutsam ein Tuch über die wulstige, lila Quaddel und verknotete es im Nacken.
Bitte sehr.
Aber ich bekam den furchtbaren Anblick nicht mehr aus dem Kopf. Die Zeichnung auf dem Tisch war kindlich und zeigte einen Baum oder eine Gestalt. Meine Mutter schien nicht genau zu wissen, in welche Richtung die Linie weitergehen sollte. Ich nahm ihr den Stift aus der Hand. Sie sah mich an. Ihr Blick war leer, aber neugierig, wie der eines Vogels, der ein Objekt am Boden untersucht. Ich führte die Linie weiter und zeichnete ein Nest mit gesprenkelten Eiern auf den Ast. Ihr Mund klappte ein paar Mal auf und zu, ein nasses Ploppen. Sie konzentrierte sich, als bräuchte sie den ganzen Körper dazu, und sagte: Ih, bi, na, mi. Ich sah die Krankenschwester an, sie lächelte.
Was hat sie gesagt?, fragte ich.
Die Krankenschwester legte ihre Hände auf die Schultern meiner Mutter und stoppte das immer heftigere Schaukeln.
Sie hat sich vorgestellt. Sie hat gesagt: Ich bin Naomi.
Die Blutung hatte massive Schäden angerichtet, die Operation hatte ihren Preis. Ein exakt bemessenes Stück Knochen war herausgesägt und entfernt, das unberührte Vakuum des Organs verletzt worden. Man hatte das Gefäß abgeklemmt, das Gewebe geflickt und den Blutfluss umgeleitet. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit hatte der Riss meine Mutter nicht umgebracht. Naomi würde sich wieder erholen, langsam und in anatomischer Hinsicht, aber während der Reparatur war etwas Grundlegendes zerstört worden: das komplexe Archiv ihrer Gedanken, Erinnerungen, Gefühle, Persönlichkeit. Man hatte ihr Leben retten könne, aber nicht ihr Ich.
Die Computertomografie nach der OP zeigte ein zweites Aneurysma, unzugänglich und damit inoperabel. Im Kopf meiner Mutter hing ein weiteres weiches, rotes Schwert. Nach der OP, als sie wieder ansprechbar war, klärte man sie darüber auf. Sie nahm die Information entgegen wie einen zusätzlichen ärztlichen Hinweis zu ihrer Genesung; wie eine neue Art zu leben, nur eben mit dem Tod als ständigem Begleiter.
Wer sie war und wer sie nicht mehr war, bestimmte unseren Alltag. Als ich Jahre später an einem internationalen Austauschprogramm in Japan teilnahm, versuchte ich, es meinem Lehrer Shun zu erklären. Ich wohnte bei seiner Familie und erlernte eine Technik der Holzverbrennung, mit der ich bis heute arbeite. Das Reisestipendium kam vom Malin Centre, dessen Leiterin sechs außergewöhnliche Praktikumsplätze eingerichtet hatte: junge Künstlerinnen zu Gast bei Kunsthandwerkern auf der ganzen Welt. Ich war in einem Dorf in der Nähe von Kyoto untergekommen, mitten in einem riesigen, rot glühenden Wald.
Im Laufe der Monate hatten Shun und ich eine distanzierte Freundschaft aufgebaut. Ich aß zusammen mit seiner Familie, die ich mit meinem Unwissen und meinen fehlenden Manieren sanft vor den Kopf stieß. Den Kindern spielte ich über Kopfhörer meine Musik vor. Shuns Arbeiten waren bemerkenswert und gingen weit über das Tischlern hinaus. Er schuf nicht nur Fassaden für traditionelle Wohnhäuser, sondern auch massive, geschwärzte Skulpturen, die er in die ganze Welt verkaufte. Ich war seine erste Schülerin aus dem Westen. Ich hantierte mit Löschrohren und Harzen und versuchte, mich aus dem Korsett der bildenden Kunst zu befreien. Shuns Englisch war gut; bevor er in die Fußstapfen seines Vaters getreten war, hatte er in Kalifornien studiert. An den meisten Tagen fand er mich wahrscheinlich ebenso lästig wie unterhaltsam. Er zeigte mir, wie man die verbrannte Holzschicht mit einer Drahtbürste behandelt und die Maserung darunter freilegt. Als ich ihm von Naomi erzählte, hielt er inne.
Das Wort Identität ist gerade erst bei uns angekommen, sagte er. Es ist einzigartig. Wir haben keine Übersetzung dafür.
Ihr individueller Charakter, Shun. Du weißt, was ich meine.
Nein.
Ihr Wesen, ihr Naomi-sein!
Ich hatte gerade meinen Abschluss an der Kunsthochschule gemacht und war dabei, mich auszuprobieren und ein eigenes Verfahren zu entwickeln. An diesem eigenartigen, stillen, fremden Ort fühlte ich mich verloren. Gaijin: eine bizarre Person von außerhalb. Shun hob die Hand und deutete in den Wald, wo die Zedern in grün erleuchteten Reihen standen.
Sie ist deine Mutter. Solange sie nicht von allem getrennt ist, kann sie ihr Wesen nicht verlieren.
Damals war mir das wie eine schöne Leugnung des Konzepts erschienen.
*
Als ich heute Morgen auf dem Markt war, spürte ich einen ersten Anflug von Panik. Die Buden, lange Reihen aus Obst, Fisch und Ledergürteln, standen zu dicht beieinander. An den Engstellen musste ich mich an den Leuten vorbeizwängen. Das ganze Land und der größte Teil der Welt sind geimpft, deshalb darf ich öffentliche Luft atmen und mit anderen interagieren; es gilt nicht länger als Straftat. Ich trug eine gewöhnliche, weiße, vom Gesundheitsamt ausgegebene Maske und sah aus, als hätte ich bloß eine Erkältung. Oft bedecke ich meine Hände, vor allem, wenn ich arbeite oder den Karren durch die Stadt ziehe. Die medizinischen Silikonhandschuhe hatte ich mit Klebeband an meinen Handgelenken fixiert.
Der Tag war warm. Die Leute trugen ärmellose Kleidung und genossen die ersten echten Sonnenstrahlen. Die Stadt ist klein, man kennt sich. Die Cafébetreiberinnen, die Taxifahrer. Auf der Kreuzung unterhalb der Burg regelt Sam den Verkehr, Ginny verkauft handgemachte Seifen und übernachtet im Park. Die Markthändler sind meinen Anblick gewohnt, wie ich im Overall den Karren durch die Straßen ziehe, meistens mit lila getönter Brille und manchmal, wenn mir der Lärm zu viel wird, mit Gehörschutz. Sie halten mich für eine kauzige Millionärin, was zur Hälfte sogar stimmt. Mit den blau verpackten Händen wirke ich wahrscheinlich noch schrulliger. Oder wie das, was ich bin: ansteckend und paranoid.
Rostam bemerkte es sofort. Sein Blick verneigte sich kurz und wanderte dann aufwärts in mein Gesicht. Möglicherweise bildete ich mir nur ein, dass er plötzlich die Vergangenheit vor Augen hatte, zurückwich und sich dann wieder fing. Manche Leute erinnern sich, andere entscheiden sich bewusst dagegen. Die Anpassung hat uns viel Zeit gekostet.
Madam, sagte er. Wie schön, Sie zu sehen. Ich habe eine Lieferung aus Damaskus bekommen. Zartes Aroma! Mein Freund aus dem Kollektiv hat mir einen Sonderpreis gemacht, den ich an Sie weitergeben könnte.
Rostam ist unser Straßenkönig, ein Herrscher des Basars in Ledermantel und Trilby. Ich kann mich erinnern, wie er den Stand damals übernahm, ein junger Mann mit wulstiger Stirn, getrieben von Demut und verzweifeltem Optimismus. Dich hatte er über andere Einwanderer kennengelernt, über ein weitverzweigtes Netzwerk aus Cousins. Nicht, dass wir über dich sprechen würden; die Vergangenheit ist einfach in uns. Hin und wieder kaufe ich an seinem Stand ein. Ich mag die importierten Rosenblätter, aber für gefärbte Tulpen und Palmengärten habe ich nichts übrig. Trotzdem behandelt Rostam mich wie ein Mitglied der königlichen Familie oder wie eine Kundin, die regelmäßig ein Vermögen für Blumensträuße ausgibt.
Nein, danke, ich brauche keinen Tee.
Ich war wortkarger als sonst. Ich versuchte, meine Hände zu verstecken, und erklärte ihm, welche Blüten ich suchte – der Baum solle bereits Knospen tragen oder binnen einer Woche entwickeln. Innerhalb dieses Zeitfensters. Spätestens in zehn Tagen. Falls er mir nicht helfen könne, sagte ich, würde ich es woanders versuchen. Ich wusste natürlich, dass er es schaffen würde, denn seine Handelsbeziehungen reichen weit über den Markt hinaus. Vielleicht klang ich ein bisschen zu ungeduldig, denn zunächst wirkte er bestürzt. Er ergriff meine Plastikhände und hielt sie fest. Ich spürte seine Körperwärme durch die Handschuhe, und es kostete mich einiges an Willenskraft, mich nicht loszumachen und einfach zu gehen. Auf dem Markt wurde geklappert und geschrien, trotzdem hob das vertraute Geräusch an, rhythmisch und ebenso hoch wie tief. Wie elektrisch zischende Wellen, die sich über eine festgelegte Strecke aufbauen, aufwallen und dann brechen. Ich bilde mir nicht ein, dass andere sie ebenfalls hören, auch wenn sie direkt aus den Mündern zu kommen scheinen, aus den Lücken zwischen den Gebäuden, winzige Atome aus Schall.
Verstehe. Ich werde einen für Sie besorgen.
Rostam sprach leise und sparte sich jedes Händlergebaren.
Sie müssen mir versprechen, nirgendwo anders hinzugehen. Ich werde mich darum kümmern, in Ordnung?
Ja. Danke.
Er drückte noch einmal meine Hände und ließ dann los. Seine Freundlichkeit rührte mich. Ich wusste, er hätte es niemals offen angesprochen. Er ersparte mir sein Mitleid. Er ist ein Mensch, der die Masken zu lesen weiß; er sieht, was sie verbergen und was die Täuschung offenbart. Ich ging weiter, drückte mir die Hände auf die Ohren und stellte mich eine Weile zu den Fahrradständern unter die Kastanie, deren breite Blätter die Stadtenergie und den überwältigenden Krach verschluckten. Ich sah zum Café hinüber. Es ist jetzt dunkelblau gestrichen. Davor steht eine schmiedeeiserne Bank, auf der die Tauben herumlaufen oder aufgereiht sitzen.
Ich war ein paar Mal dort. Der Kaffee ist gut, bezahlbar, frei von Zichorien. Nach dir kamen neue Betreiber und eröffneten ein veganes Deli, eine Schneiderei, einmal sogar ein Ramen-Restaurant.
Ich saß am Fenster, legte die Hände um die Schale und dachte an Shuns Frau Umeko, die meine Technik so sanft korrigiert hatte, als wäre ich ein Kind. Das Eigelb auf den erlesenen Speisen erinnerte mich an das orange Auge in der Mitte eines Zedernstamms. Das Lokal war klein, der Platz reichte gerade für sieben Tische, aber inzwischen haben sie den ersten und zweiten Stock dazugenommen.
Doch die Erinnerungen bleiben, trotz des frischen Anstrichs und trotz der neuen Besitzer.
Bei welchem Namen soll ich dich nennen?
Beim ersten. Halit.
Im Fenster hing ein Schild: zu verkaufen. Vor dem Eingang kräuselte sich die Luft, als würde aus dem Innenraum Dampf abgelassen. Ich wandte mich ab und ging auf einem Umweg nach Hause.
Zum ersten Mal hatte ich das Restaurant an einem Januartag besucht. Der Name war auf den Türsturz gemalt: Biraz. Offensichtlich konnte es sich nicht entscheiden, was es sein wollte: Neben der Bar standen Bücherregale, zu hohe Pflanzen wölbten sich über die Sitznischen. An den Wänden hingen Wandteppiche, gestickte Granatäpfel, Emaillegeschirr. Über der Kasse das Foto eines hageren Mannes mit Augenringen und Fünfzigerjahrehut, der mit seinem Hund in einem Boot sitzt. In den winzigen Porzellanvasen steckten Rosmarinstängel und Zitronenmelisse. Die Leute tranken Kaffee, Wein oder Raki. Es gab nur eine einzige Kellnerin, die jung und überfordert wirkte. Und hinter dem Küchenvorhang: du.
Meine Freundinnen Kendra und Bee hatten gehört, das Essen sei fantastisch, konnten sich aber nicht auf die Küche einigen. Nordafrikanisch, Nahost, Fusion? Es gab keine Speisekarte; die Gerichte wurden angeboten und dann angenommen oder zurückgeschickt. Damals gingen wir nur selten aus. Ich lebte zurückgezogen und für meine Arbeit, Kendra hatte vor Kurzem ein Baby bekommen.
An dem Tag hatte sie mich genötigt, das Atelier zu verlassen und mich zu waschen und umzuziehen. Sie hatte das Baby zu ihrer Schwiegermutter gebracht und war fest entschlossen, etwas zu essen, was sie nicht selbst gekocht hatte.
Geradezu glamourös für deine Verhältnisse, sagte sie, als ich ihr im Holzfällerhemd die Tür öffnete. Mach wenigstens den oberen Knopf auf, Liebes. Und jetzt lass uns gehen, bevor ich auslaufe.
Meine Haare waren ein gutes Stück nachgewachsen. Nach dem unerwarteten, überwältigenden Erfolg und dem vorübergehenden Verlust meines Selbst hatte sich die Aufregung gelegt. Meine Knochen waren wieder ins Fleisch eingesunken.
Muss das sein?, hatte ich gefragt.
Draußen war es kalt. Die Luft war steif und roch nach Schwarzpulver und Salz – Winter. Der Monat wirkte jetzt schon wie abgestorben. Ich hatte den ganzen Tag im Atelier verbracht, mit Mütze und Handschuhen.
Hast du denn nicht gehört, was für schreckliche Sachen da draußen passieren? Kriege. Monsterkeime. Nicks Mutter. Wir sollten das Leben genießen, solange wir können.
Kendra kramte in ihrer Tasche, fand einen Lippenstift und hielt ihn mir hin.
Hier. Kahlo-Rot.
Als der erste Gang aufgetragen wurde, hatten wir schon fast eine Flasche Wein geleert. Die Kellnerin war verschwunden. Du bist aus der Küche an unseren Tisch gekommen und hast die Schüssel so vorsichtig getragen wie ein Vogelnest. Aus irgendeinem Grund waren die Haselnüsse von würzigem Zucker ummantelt, jede einzelne trug eine eigene, kleine Glashülle. Du hast die Schüssel in die Tischmitte gestellt und dann mein Messer zurechtgerückt, obwohl es absolut gerade lag. Deine Bewegungen waren so geschmeidig und anmutig wie die einer muskulösen, aufrecht gehenden Katze. Das Blau deiner Augen schimmerte wie eine Ablagerung, als befände sich darunter noch mehr Farbe. Ich starrte dich unverhohlen an, durch deine Fragen hindurch. War der Wein in Ordnung? Saßen wir bequem? Mochte eine von uns keinen Oktopus?
Ich liebe Oktopus, sagte Bee, obwohl sie Meeresfrüchte hasste.