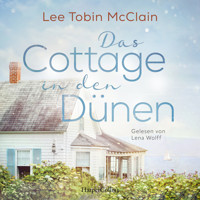9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Chesapeak Bay
- Sprache: Deutsch
Kehren Sie zurück an die Chesapeake Bay, wo gebrochene Herzen heilen
Das Knistern zwischen Ria und Drew Martin hatte ihre Ehe immer zusammengehalten – bis es plötzlich erlosch. Die alleinerziehende Hotelmanagerin Ria ist ratlos, als eine ihrer Töchter im Teenageralter in einen Teufelskreis gerät. In ihrer Panik bittet sie ihren entfremdeten Ex-Mann um Unterstützung, aber sie ist nicht auf den Mann vorbereitet, zu dem er geworden ist –, oder auf die unbewältigten Emotionen, die noch immer zwischen ihnen bestehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch:
Nach der Scheidung verlor Drew sein Augenlicht und seinen Job bei der Polizei und zog sich in sich selbst zurück. Als er jetzt erkennt, wie sehr seine Töchter ihren Vater brauchen, ist er entschlossen, alles wiedergutzumachen. Bei Ria ist er sich weniger sicher. Sie hatten echte Gründe, ihre Ehe zu beenden, aber sie haben sich beide in der Zeit ihrer Trennung verändert. Und wieder mit ihr an dem Ort zusammen zu sein, an dem sie sich zum ersten Mal verliebt haben, weckt Erinnerungen an alles, was sie einmal hatten. Können sie ihre Vergangenheit überwinden, um ihre Familie wieder zu vereinen, dieses Mal für immer?
Zur Autorin:
USA Today-Bestsellerautorin Lee Tobin McClain war noch viel zu jung, als sie das erste Mal Doktor Schiwago gesehen hat – es hat eine lebenslange Leidenschaft für Romantik in ihr ausgelöst. In ihren Liebesgeschichten stecken immer auch Probleme aus dem wahren Leben, doch sie sind auch voller herzerwärmender Gemeinschaft, Familie und Happy Ends – und Hunde! Jeder Menge Hunde! Wenn sie nicht schreibt, telefoniert sie viel mit ihrer Tochter, spielt mit ihren Haustieren oder unterrichtet an der Seton Hill University kreatives Schreiben.
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem TitelReunion at the Shore bei Harlequin Books, Toronto.
© 2020 by Lee Tobin McClain Deutsche Erstausgabe © 2023 für die deutschsprachige Ausgabe by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Covergestaltung von Zero Werbeagentur, München Coverabbildung von Dougal Waters / Getty Images, HTeam, New Africa, ShutterProductions, Coby H, Iryna_Kolesova / Shutterstock E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749905454
www.harpercollins.de
1. KAPITEL
Ria Martin hätte sich darüber freuen sollen, für einen Moment den schier endlosen Rechnungen und noch endloseren Pflichten zu entkommen, mit denen sie als Eigentümerin eines kleinen, nicht besonders gut laufenden Motels konfrontiert war. Wie gerne hätte sie einfach nur die frische Herbstbrise genossen, die aus der Bucht zu ihr herüberwehte. Aber sie hatte ein flaues Gefühl im Bauch, während sie sich auf den Weg zur Schule ihrer Tochter machte.
Können Sie Kaitlyn so schnell wie möglich abholen?
Es war gerade einmal Anfang Oktober, und seit Kaitlyn in die achte Klasse ging, war das schon die dritte Benachrichtigung dieser Art. Rias Herz schmerzte beim Gedanken an ihre sensible jüngste Tochter. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als sie einfach nur in die Arme zu nehmen und damit alle Probleme zum Verschwinden zu bringen. Aber Umarmungen hatten nicht geholfen, genauso wenig wie eindringliche Gespräche oder klare Konsequenzen. Kaitlyns Noten verschlechterten sich, und ihr Ruf als herausragende Schülerin wandelte sich langsam, aber sicher in den einer herausragenden Unruhestifterin. Was war mit Rias lieber Tochter passiert?
Offenbar reichte eine renommierte Schule nicht aus, um Kaitlyn zu helfen, zumindest im Augenblick nicht. Sie hatte immer sehr an ihrem Vater gehangen – und nach der Scheidung noch mehr.
Und er war einfach ohne irgendeine Begründung verschwunden.
Sie setzte sich auf die Bank vor der Eingangstür der Schule und wählte die Nummer von Drew auf ihrem Handy.
Diesmal kam nicht einmal seine persönliche Bandansage, die darum bat, eine Nachricht zu hinterlassen. »Die Mailbox ist voll«, verkündete eine mechanische Stimme.
Für einen kurzen Moment wurde ihre Wut durch Sorge überlagert. War ihrem Ex-Mann, dem Vater ihrer Kinder, etwa irgendetwas zugestoßen?
Aber nein. Er lebte zwar in Baltimore, zwei Stunden entfernt, aber seine Abteilung hatte ihre Kontaktdaten, und wenn er einen Unfall gehabt hätte, dann wäre sie mit Sicherheit benachrichtigt worden. Sie waren erst seit eineinhalb Jahren geschieden, und davor hatten sie bereits sechs Monate getrennt gelebt. Es war ja nicht so, als hätten er – und sein Arbeitgeber – sie und die Mädchen nicht mehr auf dem Schirm.
Das war einfach nur unverantwortliches Verhalten von Drew, was für ihn zwar eigentlich untypisch war, aber Männer drehten nach einer Scheidung ja regelmäßig durch. Das lag offenbar in ihrer Natur. Sie wollte das Handy wütend in ihre Handtasche pfeffern, traf allerdings daneben. Hektisch griff sie nach dem zu Boden fallenden Telefon.
»Ria! Was machst du da?«
Eine vertraute Stimme schreckte sie auf. Als sie aufblickte und in das besorgte Gesicht ihrer Mutter sah, deren Augen warm und von feinen Falten umrahmt waren und die ihr honigblondes Haar zu einem unordentlichen Pferdeschwanz zurückgebunden hatte, wäre sie fast in Tränen ausgebrochen. Aber das tat sie natürlich nicht; sie war schließlich erwachsen und hatte sich im Griff. »Ich bin ein Idiot«, sagte sie, während sie sich das Handy schnappte und auf das Display schaute. »Ich glaube, ich hab es angeknackst. Was tust du hier?«
»Ich habe eine Nachricht wegen Kaitlyn bekommen. Die Sekretärin meinte, sie hätte wieder den Unterricht geschwänzt.«
Ria stand auf und runzelte die Stirn. Sie hatte nicht angerufen oder zurückgeschrieben; sie war einfach hierhergeeilt. »Warum haben sie uns beiden geschrieben?«
Ihre Mutter zuckte mit den Schultern. »Manchmal, wenn sie dich nicht erreichen können …« Sie beendete den Satz nicht.
Rias immerwährende Schuldgefühle gegenüber ihrer Mutter schalteten ein paar Gänge höher. Es stimmte schon, manchmal war sie nicht zu erreichen, sie war in ihrem Job als Leiterin des Chesapeake Motor Lodge ganz schön eingespannt.
Sie wollte nie so eine Mutter sein, die sich auf ihre Karriere statt auf ihre Kinder konzentriert. Aber nach der Trennung von Drew war es einfach keine Option mehr, in Teilzeit zu arbeiten. Zum Glück waren sie nach Pleasant Shores gezogen, in die Nähe ihrer Mutter, die in den letzten anderthalb Jahren eine riesige Last von Rias Schultern genommen hatte. Vor allem, als die Katastrophe passiert war, von der weder ihre Mutter noch sonst irgendjemand etwas geahnt hatte. »Ich übernehme ab hier, Mom. Du machst schon zu viel für mich.«
»Bist du sicher? Ich helfe dir doch gerne.«
»Nein, ist schon in Ordnung. Geh du zurück zu deiner Arbeit.«
»Ich bin für heute fertig. Ich treffe dich dann bei dir zu Hause, wenn du möchtest.«
Unwillkürlich umarmte sie ihre allzeit hilfsbereite Mutter. »Das wäre prima. Danke.«
Als Ria ihre Mom weggehen sah, hätte sie ihr so gerne hinterhergerufen: »Bitte, bleib. Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
Ria wünschte sich nichts so sehr, wie ihrer Tochter zu helfen und sich so als Mutter zu rehabilitieren. Aber es schien eine undurchlässige Barriere zwischen ihnen zu geben. Kaitlyns Anblick erfüllte Ria mit tiefer Mutterliebe – aber sie schien sie nicht erreichen zu können. Sie musste einen Weg finden, das zu ändern.
Kaitlyn kauerte auf einem der Stühle vor den Verwaltungsbüros der Pleasant Shores Academy und beobachtete, wie ihre Mutter mit der Schulpsychologin sprach. Obwohl sie sich sicher war, dass sie einen Anschiss bekommen würde, war der Anblick ihrer Mom – mit ihren langen roten Haaren, die ein Glätteisen vertragen könnten, ihren altmodischen Jeans und dem schwarzen Blazer, der den Eindruck von Professionalität vermitteln sollte – eine große Erleichterung.
Die beiden Frauen legten die Stirn in Falten und blickten immer wieder in ihre Richtung. Ihre arme Mom war sowieso schon immer so gestresst, und das machte es jetzt noch schlimmer. Es war alles Kaitlyns Schuld. Am liebsten hätte sie sich in die Arme ihrer Mutter geworfen und wie eine Sechsjährige geweint, aber das ging natürlich nicht. Zum einen trieb ihre Mom sie in letzter Zeit in den Wahnsinn. Zum anderen wäre Kaitlyn dann in Versuchung geraten, ihr zu erzählen, was sie getan hatte.
Und das durfte niemals passieren. Zum Glück hatte sie Mrs. Gray, der Psychologin, nichts Konkretes gesagt. Sie hatte nur etwas von »Problemen mit Freunden« gemurmelt, weil Psychologinnen das immer glaubten. Und das war ja auch nicht wirklich gelogen. Es kursierten Gerüchte darüber, was sie getan hatte, deswegen waren die Hänseleien heute besonders schlimm gewesen. Und ihre Freunde vom letzten Jahr schienen sie nun zu ignorieren.
Das war der Grund, warum sie den Unterricht schwänzte. Sie musste einfach nur raus hier.
Anscheinend hatte die Psychologin Kaitlyns Gedanken gelesen, denn sie und ihre Mutter drehten sich gleichzeitig um und winkten sie herbei. »Es ist sowieso nur noch eine Schulstunde, also warum geht ihr nicht schon mal nach Hause?«, sagte Mrs. Gray. »Du und deine Mutter habt noch einige Dinge zu besprechen.«
Kaitlyn durchbohrte die Frau mit einem stechenden Blick.
Mrs. Gray tätschelte ihre Schulter. »Es ist nicht immer einfach für Mütter und Töchter«, sagte sie, »aber Kommunikation ist so wichtig.«
Okay, schon klar. Unglücklicherweise war Kommunikation nicht gerade die Spezialität ihrer Familie. Sie waren auf halbem Weg zum Auto, als ihre Mutter loslegte. »Ich weiß, dass die achte Klasse nicht einfach ist. Aber du bist alt genug, um dich zusammenzureißen und im Unterricht zu bleiben.«
Kaitlyn presste ihre Lippen aufeinander. Was wusste ihre Mutter schon über die achte Klasse? Was wusste sie über Kaitlyns Leben? An einer Schule, an der alle anderen sich schon seit dem Kindergarten kannten, galt Kaitlyn auch nach anderthalb Jahren immer noch als die Neue. Und dass sie die Größte und Dickste in der Klasse war und sich praktisch über die Sommerferien von einem A-Körbchen zu einem D-Körbchen entwickelt hatte, half auch nicht gerade.
Im Auto angekommen, seufzte sie erleichtert auf. Die Schule zu verlassen, war einfach ein großartiges Gefühl. Sie wünschte sich, sie könnte ganz aus Pleasant Shores verschwinden, einfach für einen Monat nach Baltimore zu ihrem Vater ziehen, so wie es für den Sommer eigentlich geplant war. Dabei war die Pleasant Shores Academy eigentlich gar nicht so schlecht, jedenfalls hatte sie das gedacht, als sie letztes Jahr dort aufgenommen worden war. Die Akademie war viel kleiner als die öffentliche Schule, die sie und ihre Schwester vor der Scheidung ihrer Eltern besucht hatten, und das hatte ihr ursprünglich gefallen, weil sie davon ausgegangen war, dass es einfacher wäre, dort Freunde zu finden. Auf jeden Fall war es dort leichter, als gute Schülerin aufzufallen.
Aber seit einiger Zeit hatte alles angefangen, den Bach runterzugehen, und da war eine kleine Schule mit klatschsüchtigen Schülern alles andere als hilfreich. Das hatte sie auf die harte Tour gelernt.
»Also, was genau ist passiert?«, fragte ihre Mom, als sie das Auto startete.
»Schrei mich nicht an!«
Ihre Mutter öffnete den Mund und atmete tief durch wie beim Yoga-Training. Sie hatte offensichtlich keine Ahnung, wie nervtötend das war. »Ich habe dir einfach nur eine Frage gestellt«, sagte sie und sprach dabei betont langsam und deutlich, als ob Kaitlyn ein Kleinkind wäre, »in einem ganz normalen Tonfall.«
Die Tatsache, dass sie recht hatte, spielte keine Rolle. »Lass mich einfach in Ruhe«, sagte Kaitlyn, und ihre Stimme begann zu beben.
Genau wie damals in der Schulbibliothek, als sie auf Chris Taylor zugegangen war, um mit ihm ins Gespräch zu kommen, nur um dann festzustellen, dass er die Augen verdrehte und höhnisch grinsend in Richtung von Shelby Grayson und ihrer Clique blickte, die gemeinsam über sie tuschelten und hämisch lachten.
»Oh, Mäuschen.« Ihre Mom streckte die Hand aus und rieb ihren Arm, wie früher, als Kaitlyn klein war und Angst hatte. »Was immer es ist, es tut mir leid, dass es wehtut.«
Tränen stiegen in ihr auf, und Kaitlyn zuckte zurück. »Bitte hör auf!« Die mitfühlende Stimme ihrer Mutter gab ihr beinahe den Rest. Ihre Mom presste die Lippen zusammen, und sie sprach erst wieder, als sie gemeinsam zu Hause angekommen waren.
Ihre Großmutter war auch da – zum Glück –, und dem Geruch nach zu urteilen, hatte sie eine Lasagne gemacht. Normalerweise liebte Kaitlyn die Lasagne ihrer Grandma, und seit dem Müsliriegel, den Mom ihr heute Morgen aufgezwungen hatte, hatte sie nichts mehr gegessen. Aber ihr Magen war wie zugeschnürt, unmöglich, auch nur an Essen zu denken.
Sie ging sofort rauf in ihr Zimmer und ignorierte den Protest ihrer Mutter, hielt dann aber mitten auf der Treppe an, um zu lauschen, was die beiden redeten. Sie musste nicht lange warten.
»Geht es ihr gut?«, fragte ihre Großmutter.
»Ich glaube nicht. Ich werde hochgehen und sehen, ob ich mit ihr reden kann.«
»Gib ihr ein bisschen Zeit«, sagte ihre Grandma. »Manchmal ist die Mutter die letzte Person, mit der eine aufgewühlte Vierzehnjährige reden will.«
»Aber … Nun ja.« Die Stimme ihrer Mutter klang traurig, fast hoffnungslos. »Ich schätze, du hast recht, aber es ist frustrierend, dass ich nichts tun kann, um zu helfen.«
»Hast du mit ihrem Vater gesprochen? Er hat sich immer so gut mit Kaitlyn verstanden.«
»Nein, aber nur, weil ich ihn nicht erreichen kann. Seine Mailbox ist voll, und er geht nicht an sein Telefon.«
Ihre Großmutter seufzte, und die beiden sprachen kurz darüber, ob Kaitlyns Schwester Sophia ihr helfen könnte.
Von wegen. Sophia war zu sehr mit ihrem eigenen fantastischen Leben beschäftigt, um Kaitlyn mehr als eines mitleidigen Blickes zu würdigen.
»Das ist nicht Sophias Verantwortung«, sagte ihre Mutter schließlich. »Und du hast recht, ich finde zurzeit keinen guten Draht zu Kait, egal, wie sehr ich es versuche. Ich werde Drew bitten.«
»Oh, Mäuschen«, sagte ihre Grandma in genau demselben besorgten, mitfühlenden Ton, in dem ihre Mom zu Kaitlyn gesprochen hatte. »Hältst du das für eine gute Idee? Ich bin natürlich froh, wenn ich bei den Mädchen bleiben kann, aber …«
Kaitlyn schloss die Augen. Ja, bitte, bitte ja. Wenn ihr Vater, der große, starke Polizist, in der Nähe wäre, würden Shelby Grayson und Tyler Pollackson und der Rest der fiesen älteren Kinder sie vielleicht in Ruhe lassen.
»Das ist das Einzige, was mir einfällt. Ich weiß, dass ich von Michael oder Barry Informationen bekommen kann.« Das waren die Beamten, mit denen ihr Dad bei der Polizei am engsten befreundet war und die regelmäßig zu Besuch gekommen waren, als Kaitlyn noch klein war.
»Aber wenn er nicht will, dass du weißt, wo er ist …« Ihre Großmutter verstummte.
»Im Moment«, sagte ihre Mom, »ist mir ziemlich egal, was er will.«
»Du möchtest ihn aber nicht in einer peinlichen Situation erwischen.«
Als sie begriff, was ihre Grandma meinte, musste Kaitlyn fast würgen. Sie wollte sich ihren Vater absolut nicht in einer peinlichen Situation vorstellen.
»Nur weil Dad innerhalb von Sekunden, nachdem er dich verlassen hat, Frauen aufgerissen hat, heißt das nicht, dass Drew dasselbe macht«, sagte ihre Mutter gereizt.
»Natürlich nicht, Schatz, aber du willst vielleicht trotzdem nicht …«
»Er hat die Mädchen seit drei Monaten nicht mehr gesehen. Völlig entgegen unserer Besuchsvereinbarung. Nur ein paar Textnachrichten und ein paar vage Ausreden. Er ist aus seiner Wohnung ausgezogen und hat uns nicht mal seine neue Adresse gegeben.«
»Kommen die Unterhaltszahlungen?«
»Ja, darin ist er super, aber wenn man Vater ist, geht es nicht nur ums Geld. Sie müssen ihn auch mal sehen. Vor allem Kait.«
Sie unterhielten sich noch weiter, aber Kaitlyn blieb nicht länger, um zu lauschen. Ihre Mom würde ihren Vater nach Hause holen, und dann würde alles besser werden.
Als Ria durch ihr altes Viertel in Baltimore fuhr, wurde sie von Erinnerungen überflutet. Sie war schon so oft durch diese von Bäumen gesäumten Straßen gelaufen, hatte Sophia an der Hand gehalten und Kaitlyn im Kinderwagen geschoben. Da war dieses kleine Restaurant an der Ecke, in dem sie und Drew so viele Abende verbracht hatten. Ihre alte Kirche, die sie anfangs so regelmäßig besucht hatten, bevor Drew zu sehr mit seinen Sonderschichten beschäftigt war und Ria zu verbittert wurde.
Sie ließ das Fenster herunter, und der Geruch von Herbstlaub brachte weitere Erinnerungen zurück. In ihrem Bauch vermischten sich Nostalgie und die Gedanken an verpasste Gelegenheiten zu einem seltsamen Gefühl, aber sie versuchte, sich auf die Geräusche der Stadt zu konzentrieren: Autos und Hupen und Sirenen drangen von einer belebten Straße in der Nähe herüber. Das hatte sie nicht vermisst. Das Stadtleben konnte hektisch sein. Sie dagegen liebte die Ruhe in Pleasant Shores.
Da war der Park mit den Spazierwegen, neben dem kleinen See, auf dem sie im Winter Schlittschuh gelaufen waren. Hier hatten sie und Drew ihren Mädchen das Radfahren beigebracht.
Sie atmete tief ein und dann wieder aus, während sie die Tränen zurückhielt. Das war der Grund, warum sie es vermied, nach Baltimore zu kommen. Herzlichen Dank, Drew, dafür, dass du mich wieder in ein Häufchen Unglück verwandelst.
Denn genau das tat Drew. Wenn sie ihn sah, erinnerte sie sich an all die guten Zeiten; verbrachte sie aber auch nur eine Stunde mit ihm, kehrte die Frustration zurück, und sie wusste wieder, warum sie sich getrennt hatten.
Sie hielt an der gleichen Tankstelle, an der sie immer getankt und Getränke gekauft hatten.
»Ria! Bist du das?«
Ria drehte sich um, und da stand Sheila Ryan, eine der anderen Mütter, mit denen sie jahrelang zu tun gehabt hatte. Sie mochten sich gegenseitig nicht wirklich, aber sie taten so, als ob, denn das machte man eben für seine Kinder.
»Hi, Sheila. Wie geht’s?« Ria betete, dass Sheila ihr nicht die gleiche Frage stellen würde.
Sheila begann, von der großartigen Karriere ihrer dreizehnjährigen Tochter zu erzählen, von ihrem Aufstieg in der Rangliste der Cheerleader, von ihrer Aufnahme in die Liste der besten Schüler und von ihrem ehrenamtlichen Engagement im Tierheim.
»Und wie geht es Sophia und Kaitlyn?«, fragte sie.
»Oh, einfach prima. Uns gefällt das Leben an der Küste so gut.«
»Es tut mir leid, das mit deiner Scheidung. Das muss eine große Umstellung sein für dich und für die Mädchen.« Sheilas Worte waren freundlich, aber ihr Blick war ein wenig zu übereifrig und neugierig. Was auch immer Ria sagte, es würde seinen Weg in die Gerüchteküche finden.
Sie atmete tief ein und wieder aus und zwang sich zu einem Lächeln. »Danke. Es ist definitiv eine Umstellung. Aber ich betreibe ein kleines Motel, und das macht Spaß.« Außer, dass es ständig pleitezugehen droht. »Und die Mädchen lieben ihre neue Schule.« Zumindest Sophia, also stimmte das wenigstens zur Hälfte.
Sie entschuldigte sich hastig und ergriff die Flucht. Erst als sie am Auto ankam, merkte sie, dass sie vergessen hatte, das Getränk zu kaufen, für das sie eigentlich angehalten hatte. Sie war noch nie gut in diesen Konkurrenzkämpfen unter Müttern gewesen. Sie fühlte sich dabei immer ziemlich unwohl.
Als sie den Rest der Strecke zur Polizeiwache fuhr, fragte sie sich, ob es den Mädchen damals auch so ergangen war. Hatten sie auch diese Atmosphäre der Konkurrenz gespürt, die in dem Viertel der oberen Mittelschicht geherrscht hatte? Sie und Drew hatten sich damals so sehr angestrengt, um sich ihr kleines Sandsteinhaus leisten zu können.
Aber diese Machtspielchen sind bedeutungslos, ermahnte sie sich selbst. Es war jetzt wichtig, dass sie Kaitlyn half.
Auf dem Polizeirevier wurde sie von weiteren Erinnerungen heimgesucht. Sie war über die Jahre so oft hierhergekommen – um Drew abzuholen, um ihm etwas zu bringen, das er vergessen hatte, oder einfach nur, um Hallo zu sagen –, als die Mädchen noch klein waren und sie noch Hausfrau und Mutter war.
Jetzt gehörte sie nicht mehr hierher. Die neue Rezeptionistin kannte sie nicht und konnte ihr aus Datenschutzgründen nichts über Drew sagen. Zum Glück entdeckte sie seinen Freund Michael und flehte ihn an, ihr Drews neue Adresse zu geben.
»Er hätte den Kontakt zu dir nicht abbrechen dürfen, Ria«, sagte Michael. »Aber er hat eine harte Zeit hinter sich. Wenn du willst, kann ich versuchen, ihn anzurufen, und ihn wissen lassen, dass du ihn sehen möchtest.«
»Danke, aber wo ich schon mal da bin …« Dann erst begriff sie, was er gesagt hatte. »Er arbeitet nicht mehr hier?«
»Er hat es dir nicht gesagt?«
»Was hat er mir nicht gesagt?«
Michael musterte sie und schüttelte langsam den Kopf. »Er ist auf einem … ähm, er macht eine Auszeit«, sagte er.
»Geht es ihm gut?« Ihr Herz pochte wie wild.
Michael öffnete den Mund, um etwas zu sagen, schloss ihn aber wieder und nickte. »Da bin ich mir ziemlich sicher«, sagte er. »Ehrlich gesagt habe ich schon seit ein paar Wochen nicht mehr mit ihm gesprochen.« Er sah aus, als ob er noch etwas sagen wollte, aber jemand rief aus dem hinteren Flur nach ihm. Er berührte Rias Schulter und ging.
Irgendetwas war auf jeden Fall im Gange. Und sie würde herausfinden, was es war. Es war nicht richtig, dass Drew sie dermaßen aus seinem Leben ausgeschlossen hatte. Nicht dass sie alles wissen musste – sie waren schließlich geschieden –, aber sie hatten gemeinsame Kinder, Kinder, die ihn brauchten. Ihre Wut mischte sich mit Sorge, denn Drew war normalerweise so verantwortungsbewusst. Hatte er sich so sehr verändert?
Sie fuhr zu der Adresse, die Michael ihr gegeben hatte. Das Viertel war nicht annähernd so schön wie das, in dem sie früher gewohnt hatten. Obwohl sie es eigentlich gar nicht wollte, durchströmte sie Mitgefühl. Drew überwies regelmäßig großzügige Unterhaltszahlungen, die es ihr ermöglichten, mit den Mädchen in Pleasant Shores zu leben. Er hatte anscheinend seinen eigenen Lebensstandard eingeschränkt, im Gegensatz zu vielen anderen geschiedenen Vätern, und das wusste sie zu schätzen.
Sie bog an einem Häuserblock ein und wollte gerade einen Parkplatz suchen, als sie Drew auf der anderen Straßenseite sah.
Mit einer Frau.
Eine stilvoll gekleidete, lachende, große, schlanke Blondine. Sie schien sehr lebhaft mit Drew zu reden, der einfach nur geradeaus schaute. Sie waren beide groß genug, sodass Ria sie über die Reihe der geparkten Autos hinweg beobachten konnte. Sie fuhr schief in eine Parklücke und rammte dabei fast das Auto, das vor ihr parkte. Schwer atmend blieb sie sitzen.
Er hatte sie ersetzt; er hatte sie wirklich einfach ersetzt.
Sie hätte nie gedacht, dass ihr das mal passieren würde. Nicht wirklich, nicht im tiefsten Inneren. Ihre Brust zog sich um das Loch zusammen, das sich genau dort aufgetan hatte, wo ihr Herz gewesen war.
Es stimmte also. Er liebte Ria nicht mehr. Sie war zu stressig gewesen, hatte sich zu sehr auf ihre Mutterrolle anstatt auf die Ehe konzentriert, und sie war zu fett geworden. Sie hatte es vermasselt und zu viele Fehler gemacht, darunter einige, von denen Drew noch nicht einmal etwas ahnte. Natürlich würde ein Mann eine wie sie verlassen.
Die kleine Flamme der Hoffnung, die in ihrem Herzen gebrannt hatte, dass sie vielleicht eines Tages wieder zusammenkommen würden, erlosch.
Drew geriet ein wenig ins Wanken, und die Frau trat näher an ihn heran und schien ihn zu stützen. So hatte Drew noch nie geschwankt. Hatte er getrunken? Am helllichten Tag?
Was hatte diese Frau mit ihm gemacht, dass er hier betrunken herumstolperte? Empörung trieb sie aus ihrem Auto. Sie schloss leise die Tür und schlich auf die andere Straßenseite, um die beiden von hinten zu beobachten. Die Frau warf einen Blick zurück, und Ria wartete darauf, dass Drew dasselbe tun würde, aber er tat es nicht. Er konzentrierte sich auf den Weg vor ihm. Seine Schritte waren ein wenig behäbig, nicht sein üblicher souveräner Gang. Jedoch konnte sie jetzt erkennen, dass sein Straucheln nicht das eines Betrunkenen war.
War er etwa verletzt?
Irgendetwas war seltsam an der Art, wie die blonde Frau sich bewegte, sie ging stets leicht versetzt hinter Drew. Ria schlich sich um einige geparkte Autos, bis sie die beiden überholt hatte, und überquerte die Straße, damit sie nicht bemerkt wurde. Ihr Herz blieb fast stehen, als sie den Stock erkennen konnte, den Drew in seiner Hand führte. Er war weiß, mit einem schwarzen Griff, einem roten Abschnitt an der Unterseite und einer rollenden Kugel an der Spitze. Er tastete mit dem Stock hin und her, während er die Straße hinunterging. Die Wahrheit traf Ria wie eine Ohrfeige.
Drew war blind.
2. KAPITEL
Drew Martin tastete mit seinem Stock nach der Bordsteinkante und neigte den Kopf zur Seite, um die Verkehrsgeräusche besser wahrnehmen zu können. Du gehst geradeaus, also achte auf die parallel fahrenden Autos. »Ist es …?«, wollte er Meghan gerade fragen, dann schüttelte er den Kopf. »Warte, ich kann es selbst herausfinden.«
»Okay.« Sie wartete neben ihm. Er holte einmal tief Luft und machte sich dann auf den Weg über die belebte Straße.
»Ein bisschen weiter nach links«, sagte sie leise hinter ihm, und er schaute nach unten. Mit seiner geringen verbliebenen Sehkraft konnte er an einem hellen Tag wie heute erkennen, dass er leicht vom Zebrastreifen abgekommen war. Nach einer kleinen Kurskorrektur meisterte er den Weg auf die andere Straßenseite und die steile Bordsteinkannte hinauf mit relativer Leichtigkeit.
»Das war großartig«, jubelte Meghan, als sie weiter die Straße hinuntergingen. Drew fühlte einen leichten Anflug von Stolz.
Etwas lächerlich kam es ihm aber doch vor, er hatte schließlich eigentlich nur eine Straße überquert.
»Drew?«
Drew erstarrte. Er kannte den Klang dieser Stimme besser als den seiner eigenen. Er hatte diese Stimme schon so oft gehört. Er wusste, wie sie zornig während eines Streits klang, gequält bei den Geburtswehen und heiser vor Leidenschaft. Und er wusste, wie sie klang, wenn sie »Ja, ich will« zu ihm sagte.
Er wollte nicht, dass Ria ihn so sah. Er wandte sich ab und ging in die entgegengesetzte Richtung zurück.
»Drew! Warte!«
Meghan packte einen seiner Arme, und Ria – es musste Ria sein; es duftete nach ihr und fühlte sich an wie sie – packte den anderen.
»Hey, du wärst beinahe in den Straßenverkehr gelaufen«, sagte Meghan. »Das weißt du doch besser.«
Aber er konnte ihr nicht zuhören, während die sanfte Stimme seiner Frau sich in seinen Verstand und sein Herz bohrte. »Drew. Ich bin’s, Ria.«
»Ich weiß«, sagte er. Er wünschte sich verzweifelt, ihr Gesicht sehen zu können, er wollte erkennen, wie sie auf ihn in seinem jetzigen Zustand reagierte. Andererseits war er sich nicht sicher, ob er das wirklich wissen wollte. »Wie hast du mich gefunden?«
»Oh, ihr kennt euch!« Meghan klang glücklich, und er wusste, warum. Sie machte sich Sorgen um ihn, sie fürchtete, er könnte vereinsamen. Nicht dass es sie irgendetwas angehen würde; sie war nur seine Orientierungs- und Mobilitätstrainerin. Aber sie war sehr fürsorglich. »Das ist perfekt. Unsere Sitzung ist gerade zu Ende. Ich bin Meghan«, sagte sie, offensichtlich zu Ria.
»Ria.« Seine Ex-Frau klang verständlicherweise ein wenig verdutzt. Sie hatte gerade erst erfahren, dass der Vater ihrer Kinder blind war. Aber warmherzig wie immer griff sie über ihn hinweg und schüttelte Meghans Hand. »Brauchst du Hilfe, um in deine Wohnung zu kommen, Drew?«, fragte Meghan.
Was sollte er sagen? Er brauchte zwar immer noch ein wenig Hilfe, aber vor Ria wollte er das nicht zugeben.
»Ich werde ihm helfen«, sagte Ria, und das war für ihn noch schlimmer.
»Großartig!« Meghan erinnerte ihn noch an ihren nächsten Termin und verschwand. Nun stand er allein auf der Straße. Sein Herz schlug schnell, Gesicht, Nacken und Ohren wurden unerträglich heiß.
»Willst du … meinen Arm nehmen oder so? Ich bin rechts von dir.« Ria berührte ihn sanft. »Du wohnst in dem Backsteingebäude, stimmt’s? Apartment, was war es, 3B?«
»Mhm.« Widerstrebend ergriff er ihren Ellbogen und sog ihr Parfüm ein, ein Duft, der ihm so vertraut war wie das Leben. Ihre Hüften stießen aneinander, als sie die Treppe zu seiner Wohnung hinaufgingen, und er war so überrascht, dass er ein wenig stolperte. Schweiß rann seine Brust hinunter.
Mithilfe seiner Wegbeschreibung kamen sie schließlich vor seiner Wohnung an. Natürlich brauchte er vier Versuche, um die Tür aufzusperren.
Navy bellte zur Begrüßung und drückte ihre Nase in seine Hand. Die freundliche Begrüßung durch den ehemaligen Polizeihund, der nun zu seinem Haustier geworden war, sorgte dafür, dass er sich etwas beruhigte und sein Blutdruck nach unten ging.
»Navy!« Ria klang glücklich – anscheinend freute sie sich mehr darüber, den Hund zu treffen, als ihn. Er neigte den Kopf leicht zur Seite, um ein wenig sehen zu können. Er konnte ungefähr erkennen, wie sie auf dem Boden kniete und den gelben Labrador streichelte, den sie so liebte.
»Komm rein«, sagte er und hoffte, dass seine Bude kein allzu großer Saustall war. In den letzten Wochen hatte er sich nicht gerade viel um den Haushalt gekümmert. Unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hatte er an einem zweimonatigen stationären Reha-Programm teilgenommen. Und seit er wieder zu Hause war, bestand seine hauptsächliche Sorge darin herauszufinden, wie er sich in der großen Welt da draußen nun zurechtfinden sollte.
Leider hatte er keine Ahnung, wie er mit dem Überraschungsbesuch seiner Ex-Frau umgehen sollte.
»Setz dich«, sagte er und wies auf sein kleines Wohnzimmer. »Möchtest du etwas trinken?«
»Klar«, sagte sie. »Hast du eine Cola?«
»Ich denk schon.« Er machte sich auf den Weg in die Küche und lehnte sich in die offene Kühlschranktür hinein in der Hoffnung, sich ein wenig abzukühlen. Er untersuchte die Sammlung von Dosen, die er sich angelegt hatte, denn er hatte in letzter Zeit nicht groß gekocht. Er fand eine, von der er einigermaßen sicher war, dass es sich um Cola handelte. Er schnappte sich die Cola und ein Bier aus seinem Bierregal – wo das war, würde er nie vergessen, und er wusste auch, dass er jetzt dringend eins brauchte – und brachte beides ins Wohnzimmer. Er tastete sich zur Couch und setzte sich hin. Schlagartig wurde ihm bewusst, dass er sich viel zu nah neben sie gesetzt hatte. Er rutschte sofort ein Stück weg von ihr und merkte, dass sie im selben Moment das Gleiche tat.
»Dein Freund Michael hat mir gesagt, wo du wohnst. Sei bitte nicht böse auf ihn – ich musste es einfach wissen. Drew, was ist passiert?« Ihre Stimme klang neugierig und mitfühlend, aber nicht mitleidig. Den feinen Unterschied zwischen beidem hatte er in den letzten drei Monaten sehr gut kennengelernt.
»Kopfverletzung«, sagte er. Navy schmiegte sich unten an seine Füße.
»Ist der Sehverlust dauerhaft?«
»Das wissen sie nicht.«
Sie saßen einige Minuten lang schweigend da. Er fragte sich, wieso sie ihn unbedingt hatte ausfindig machen wollen. Er hoffte irgendwie, dass sie ihn vermisste, doch das bezweifelte er. Wie auch immer, in diesem Zustand war es nun noch unwahrscheinlicher, dass er ihre Ehe retten könnte.
Schon ihre Hochzeit damals war irgendwie gezwungen gewesen. All die langen Stunden in der Reha hatten ihm Zeit zum Nachdenken gegeben, und er war zu der Einsicht gelangt, dass sie sich nie wirklich von ihrem holprigen Start erholt hatten.
»Hör zu, Drew, die Mädchen vermissen dich. Sie brauchen dich.«
Noch eine Sache, an der er gescheitert war: Er wurde seinem eigenen Ideal eines Vaters nicht gerecht. »Ich werde sie besuchen und es wiedergutmachen, sobald ich mit dieser Situation …«, er machte eine vage Handbewegung, »… einigermaßen zurechtkomme. Wie geht es ihnen denn?«
Die Wahrheit war, dass er seine Töchter ganz fürchterlich vermisste.
»Sophia geht es gut wie immer.« Sie hielt inne und fügte dann hinzu: »Sie vermisst dich sehr.«
Seine erstgeborene Tochter, wunderschön, talentiert und klug. Seine Kehle schnürte sich zusammen, als er daran dachte, dass er seine Kinder vielleicht nicht mehr wieder sehen würde, zumindest im Moment nicht, vielleicht nie wieder. »Und was ist mit Kaitlyn?«
»Ihr geht es nicht so gut.«
Eine eiskalte Hand packte Drews Herz. Natürlich liebte er beide Mädchen gleichermaßen, aber Kaitlyn war sein Nesthäkchen. Sie hing ganz besonders an ihm, und wann immer Ria und Sophia losgezogen waren, um zu shoppen oder andere Frauensachen zu machen, war Kaitlyn meistens bei ihm zu Hause geblieben. Als sie noch klein gewesen war, hatte sie stundenlang dagesessen und geplappert, während er im Haus herumhantiert hatte. Er hatte das geliebt.
»Was stimmt nicht?«, fragte er.
»Ich dringe einfach nicht zu ihr durch.«
»Ist das alles?« Erleichterung durchströmte ihn. Bloß Mutter-Tochter-Zeug. »Du machst wahrscheinlich zu viel Druck.«
Ria holte hörbar Luft. »Ich wurde dieses Jahr schon dreimal in die Schule gerufen. Sie hat irgendwelche Probleme mit den anderen Kindern.«
»Mobbing? Prügeleien?«
»Sie hat sich einmal in eine Schlägerei reinziehen lassen, aber meistens schwänzt sie einfach den Unterricht und versteckt sich auf dem Klo.«
Das hörte sich nicht nach Kaitlyn an. »Warum?«
»Ich hab keine Ahnung!« Sie stieß einen Atemzug aus. »Wie ich schon sagte, ich dringe nicht zu ihr durch. Sie will einfach nicht mit mir reden.«
»Vielleicht komme ich mal nach Pleasant Shores.« Im selben Moment, als er es aussprach, kamen ihm die vielen Probleme in den Sinn, die mit so einem Besuch verbunden sein würden. Er konnte nicht fahren. Er würde lernen müssen, sich in einem Hotelzimmer und in einer neuen Umgebung mit unbekannten Geschäften und Straßen zurechtzufinden. Er kannte die Stadt ein wenig durch die Besuche bei Rias Mutter, aber mit seiner Blindheit war das natürlich noch mal eine andere Geschichte.
»Vielleicht kommst du? Wenn dir danach ist, oder was?« Ria schnaubte verärgert. »Toll, Drew. Wie wichtig dir deine Kinder sind.«
»Aber wir wissen natürlich, dass du die perfekte Mutter bist!«, warf er ihr an den Kopf. Sein Blut kochte. Konnte sie die Dinge nicht ein einziges Mal aus seiner Perspektive betrachten?
Aber er kannte die Antwort darauf. Sie kamen aus verschiedenen Welten und hatten es nie geschafft, die Kluft zwischen ihnen zu überwinden. Und sie hatte recht – egal, welche Probleme er hatte, die Kinder waren das Wichtigste.
»Gib dir keine Mühe. Ich komm schon klar.«
Er hörte, wie sie aufstand.
»Das machst du immer!«, sagte er. »Gib mir wenigstens eine Minute zum Nachdenken!«
»Oh, lass dir Zeit«, sagte sie. »Letztendlich geht es ja nur um dein Kind.« Er hörte ihre Schuhe über den Boden klacken, und dann fiel die Tür ins Schloss.
Navy winselte ein wenig.
Er ließ den Kopf in die Hände sinken. Ja, er hatte auf so vielen Ebenen versagt, und ja, er gab sich selbst die Schuld daran. Aber Ria hatte immer noch die Fähigkeit, ihn total auf die Palme zu bringen.
Am nächsten Freitag ging Ria in die letzte Suite am Ende des Ganges, um die Reinigungsarbeiten zu überprüfen, die von einem neuen Mitarbeiter erledigt werden sollten. Sie öffnete die Tür, ging hinein … und erstarrte.
Warum stand ihr Ex-Mann im kleinen Sitzbereich der Suite herum?
Sie verdrängte das warme Gefühl der Vertrautheit, das ihren Körper durchströmte, doch das schlechte Gewissen darüber, wie sie in Baltimore mit ihm geredet hatte, konnte sie nicht ignorieren. Sie hatte ja grundsätzlich nicht unrecht – Drew hatte definitiv seine Pflichten als Vater vernachlässigt –, aber sie hätte wegen des Umstands, dass er sein Augenlicht verloren hatte, etwas nachsichtiger sein können. Das musste furchtbar gewesen sein, und sie hatte keinerlei Mitgefühl gezeigt.
Sie war einfach daran gewöhnt, Drew als stark und kompetent wahrzunehmen, auch wenn sie nun ganz deutlich mit seiner neuen Behinderung konfrontiert wurde. »Wer ist da?«, fragte Drew. Er tastete mit seiner Hand nach Navy, die bellte und mit der ganzen hinteren Hälfte ihres Körpers zu wedeln schien. Drew sprach leise mit der Hündin, die hechelnd hinter der Sitzgruppe vorkam und dabei zu lächeln schien.
»Ich bin es«, sagte Ria, als sie ihre Stimme wiedergefunden hatte. Sie kniete sich nieder, um Navy zu streicheln, die wiederum versuchte, Rias Gesicht abzuschlecken.
»Tut mir leid, dass ich so hereinplatze, aber … Was macht ihr beiden hier?«
»Ich bin hier, um Kait zu sehen und den Problemen auf den Grund zu gehen«, sagte er. »Und Sophia natürlich auch. Geht es ihnen gut?«
Noch bevor sie sich von ihrer Überraschung erholt hatte, hörte sie hinter sich ein lautes Klopfen. Ihre Mutter rief etwas hinter der Tür. »Oh nein«, sagte Ria. »Du warst schneller als ich.«
Ria warf ihrer Mutter, die inzwischen hereingekommen war, einen bösen Blick zu. »Was für eine Überraschung«, sagte sie.
»Ich hätte dich anrufen sollen oder so«, sagte Drew. »Aber es war einfach jede Menge zu tun, ich musste Termine absagen und die Fahrt hierher organisieren. Du weißt schon, wegen dieser Sache.« Dabei deutete er auf seine Augen. »Und nach deinen Äußerungen, Julie, wollte ich Navy auch mitbringen.«
»Ich dachte, es wäre gut für Kaitlyn«, sagte ihre Mutter zu Ria.
»Die einzige Mitfahrgelegenheit, die ich bekommen konnte, kam früher als geplant«, erklärte Drew, »und sie haben mir den Schlüssel an der Rezeption gegeben.«
Damit verschwand für Ria jede Möglichkeit, wütend auf Drew zu sein, denn wie konnte sie sich über jemanden ärgern, der sich so viel Mühe gab, mit seinen neuen Herausforderungen zurechtzukommen? Stattdessen wandte sie sich an ihre Mutter, die ganz offensichtlich Bescheid gewusst hatte über Drews Ankunft.
»Können wir uns mal kurz unterhalten?«
»Aber natürlich, Schatz. Drew, wir sind gleich wieder da und helfen dir mit dem Gepäck.«
Ihre Mutter führte sie zu den altmodischen Metallstühlen außerhalb der Suite.
Ria war zu aufgewühlt, um sich zu setzen. Stattdessen lief sie nervös hin und her.
»Was hast du getan? Warum ist er hier?«
»Er hat einen Platz zum Schlafen gebraucht. Es ist nur für eine Woche. Und er muss Kontakt zu seinen Kindern haben, um wieder eine Verbindung zu ihnen aufbauen zu können.«
»Okay, das stimmt. Aber noch vor ein paar Tagen schien er kein Interesse daran zu haben. Und jetzt ist er auf einmal hier in meinem Motel, und niemand sagt mir irgendwas?« Ihre Stimme überschlug sich, und sie warf ihrer Mutter einen weiteren bösen Blick zu.
»Er hat mich angerufen.«
»Er hat dich angerufen und nicht mich?« Hitze schoss durch ihren Körper. »Warum?«
»Er macht sich Sorgen um Kaitlyn, Schatz.« Julie strich sich mit der Hand durch die Haare. »Und ich wollte das nicht über deinen Kopf hinweg entscheiden, aber … ich bin auch beunruhigt.«
»Ich auch!« Ihre Brust zog sich zusammen, als sie einen Blick auf das zweistöckige weiße Schindelhaus neben dem Motel warf. Manchmal wünschte sich Ria, auf der anderen Seite der Stadt zu leben, damit sie hin und wieder Abstand zum Motel und all ihren Verantwortungen nehmen könnte. Aber an Tagen wie heute wusste sie, dass es das Beste für ihre Familie war, direkt neben dem Motel zu wohnen.
Sie konnte von hier aus das Fenster von Kaitlyns Schlafzimmer sehen. Kaitlyn hatte über Krämpfe geklagt und war deswegen heute nicht zur Schule gegangen. Und Ria war sich nicht sicher, ob es eine gute Entscheidung war, ihr das zu erlauben.
Vielleicht würde Drews Anwesenheit helfen. Sie betete dafür. Aber warum war er neulich so widerwillig gewesen? Warum war er ohne Vorwarnung zu ihr ins Motel gekommen?
»Wusstest du, dass er blind ist?«
Ihre Mutter nickte. »Sehbehindert ist ein besserer Ausdruck, denke ich. Er hat mir gesagt, dass er noch eingeschränkt etwas erkennen kann. Aber er wird Hilfe und Unterstützung benötigen, und das ist der einzige Grund, warum ich vorgeschlagen habe, dass er hier im Motel bleibt. Es tut mir leid, Schatz. Ich weiß, ich hätte mich nicht einmischen sollen, aber …« Sie presste die Lippen aufeinander, während sie ebenfalls in die Richtung von Rias Haus blickte. »Kaitlyn hat mir erzählt, dass Drew vielleicht kommen will. Sie hat so gestrahlt dabei. Es war das erste Mal seit Langem, dass ich sie hab lächeln sehen.«
Ria hatte schon den Mund geöffnet, um ihrer Mutter weitere Vorwürfe zu machen, doch diese Worte ließen sie verstummen.
Julie war wirklich eine großartige Mutter, sie hatte ein sehr gutes Gespür dafür, was Kinder brauchten. Ria, andererseits, hatte so viele Fehler gemacht, vor allem einen ganz fürchterlichen, von dem noch niemand wusste. Sie musste sich dem Rat ihrer Mutter fügen, um Kaitlyns willen.
»Ich werde Drew so gut wie möglich helfen«, sagte ihre Mutter. »Ich wollte kurz reinkommen und etwas aufräumen und sauber machen, die neue Putzkraft ist noch nicht dazu gekommen. Er wirkt ein wenig … exzentrisch.« Sie deutete mit dem Finger auf das Ende des Flurs, wo ein langhaariger Mann im Batik-Shirt zur Musik in seinen Kopfhörern tanzte, während er wild mit einem Handtuch herumwedelte.
Ria seufzte hörbar. Noch eine Sache, über die sie sich den Kopf zerbrechen musste, aber natürlich nichts im Vergleich zu den Sorgen, die sie sich wegen ihrer Tochter machte.
Ihre Mutter legte einen Arm um ihre Schultern und drückte sie sanft an sich. »Ich weiß, wie schwer das für dich sein muss. Ich flitze schnell rein und mach das Bett zurecht, helfe ihm, sich etwas zu orientieren, dann muss ich weg. Mary hat einen Notfall, und ich muss in den Buchladen, um sie zu vertreten.«
»Geh nur. Ich werde ihm schon helfen zurechtzukommen.« Ria wollte ihrer Mutter nicht die ganze Arbeit überlassen. Sie tat schon so viel für alle, vor allem für sie und ihre Kinder.
Doch als sie Julie umarmte, stieg Angst in ihr auf. In Drews Nähe zu sein, während er Kaitlyn besuchte, würde schwierig werden. Natürlich war sie froh, dass er wegen Kaitlyn gekommen war. Sie fragte sich sogar, ob eine Woche überhaupt ausreichen würde, um ihrer Tochter wirklich zu helfen. Für sich selbst konnte sie aber nur hoffen, dass die Woche schnell vorbeiging. Denn auch wenn sie noch einen kleinen Rest an Zuneigung für ihn im Herzen trug, Drew war nicht das, was sie wollte. Sie wollte jemanden, der sie so lieben und akzeptieren konnte, wie sie war.
»Hör zu«, sagte Drew, als sie ihn begrüßte, »du musst nicht extra aufräumen. Das schaff ich schon selber. Ich könnte nur eine kleine Führung gebrauchen, damit ich mich zurechtfinde.«
Ria sah sich um. Das Zimmer war nicht dreckig, aber – sie warf einen Blick in Schlafzimmer und Bad – sie brauchten frische Wäsche. »Warum packst du nicht schon mal aus, und ich beziehe das Bett und hole wenigstens ein paar frische Handtücher und Bettzeug.« Dann zögerte sie. »Das heißt … Kannst du selber auspacken?«
»Ich kann auspacken«, sagte er mit knirschenden Zähnen.
»Sorry! Ich weiß einfach nicht … Du sagst mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ja? Ansonsten gehe ich einfach davon aus, dass du klarkommst. Und das gilt für die ganze Dauer deines Besuches.« Während sie redete, ging sie ins Schlafzimmer und zog frische Wäsche aus dem Schrank.
Er kam ebenfalls ins Schlafzimmer, und sie beobachtete ihn dabei, wie er langsam die Möbel abtastete. Es war seltsam, diesen großen, stolzen Mann so zu sehen, für den früher normales Gehen schon zu langsam gewesen war, der es bevorzugt hatte, mit großen Schritten vorwärtszuschreiten. Wie vorsichtig und zögerlich er sich jetzt bewegte …
»Ich hab ein intensives Orientierungs- und Mobilitätstraining gemacht«, sagte er, als er sich an die Seite des Bettes tastete, das sie gerade mit frischen Laken bezog. »Und ich hab immer noch ein bisschen Sehkraft. Ich komme ganz gut zurecht.«
»Was wird mit Navy passieren?«, fragte sie und fürchtete bereits die Antwort, denn sie wusste, wie sehr Drew seinen Hund liebte.
»Ich darf sie behalten. Es gibt einen Zuschuss für das Department, damit können neue Diensthunde angeschafft werden, sodass Beamte mit Behinderung ihre Hunde behalten dürfen.« Er zuckte zusammen und begann, Kleidung aus einem alten Seesack zu nehmen und in den Schubladen zu verstauen. Nur nach Gefühl. »Beamte mit Behinderung. Ich hasse diesen Ausdruck.«
Ria beobachtete ihn heimlich, während sie das Bett bezog. Er war immer noch unglaublich gut aussehend. Ihr Körper erinnerte sich daran, wie wundervoll es war, in seinen starken Armen zu liegen, wie sich seine kraftvolle Brust anfühlte, während sie sich an sie schmiegte, und an die Wärme seiner Lippen …
Sie seufzte abermals und wandte sich ab. Mangel an gegenseitiger Anziehung war nie das Problem zwischen ihnen gewesen, auch wenn sie einiges an Selbstvertrauen verloren hatte, was Intimität anging. Ihr letzter Streit war sehr hitzig verlaufen, und als er sie frustriert an der Schulter gepackt hatte, hatte sie ihn unendlich begehrt, und sie hatte in seinen Augen gesehen, dass es ihm genauso ging.
Aber der körperliche Aspekt war nicht genug. Sie waren nie gut darin gewesen, miteinander zu kommunizieren, und je mehr sich der Beziehungsschmerz auf beiden Seiten aufgestaut hatte, desto stärker war ihre Fähigkeit verkümmert, einander zu verstehen. Er wollte unbedingt noch ein weiteres Kind, sie war sich dabei aber nicht so sicher, und sie konnten nicht über das Thema reden, ohne dass es unangenehm wurde. Dazu waren noch seine langen Arbeitszeiten gekommen, der Druck, den die Erziehung von zwei Teenagern mit sich brachte, und ihre eigenen Unsicherheiten bezüglich ihres Körpers. Das alles hatte dazu geführt, dass sie mehr und mehr die Hoffnung verloren hatte. Als sie den Gedanken an eine Trennung zur Sprache gebracht hatte – eigentlich nur, um zu sehen, wie er darauf reagieren würde –, hatte er kalt und abweisend reagiert. Ihre Ehe war unter der zunehmenden Last auseinandergebrochen.
Wenn andere Leute – sogar gute Freunde – sie fragten, was mit ihrer Ehe passiert war, konnte sie darauf nie eine gute Antwort geben. Es lag nicht an Untreue, Alkohol oder Übergriffigkeit, das gab es zwischen ihnen alles nicht. Letztendlich war ihr Alltag nur immer eintöniger geworden.
»Erzähl mir von Kait«, sagte er, als er zur Tür ging. »Was war in den letzten Tagen so los?«
»Da weiß ich auch nicht mehr als du, sie will einfach nicht mit mir reden.«
Sie hielt einen Moment inne, dann gab sie zu: »Es ist gut, dass du gekommen bist, Drew. Eventuell kannst du zu ihr durchdringen, vielleicht redet sie mit dir.«
»Wann kann ich sie sehen?«
»Jederzeit. Sie ist heute nicht zur Schule gegangen.«
»Du hast sie zu Hause bleiben lassen?« Drew erkundete weiter ruhelos das Zimmer. »Warum?«
Sie biss sich auf die Lippen. »Sie hat gesagt, sie hat Krämpfe.«
»Das ist keine akzeptable Entschuldigung. Dagegen gibt es doch Medikamente, oder nicht?«
»Ja, schon, aber …«
»Du streitest mit ihr und gibst dann nach. Das ist keine gute Strategie.«
»Ich gebe mein Bestes. Alleine!« Sie strich sich mit den Fingern durch das Haar. »Glaub mir, ich zweifle jeden Tag an mir selbst, aber ich muss eben Entscheidungen treffen, damit es weitergehen kann. Sie sah heute Morgen so unglücklich aus, da habe ich ihr erlaubt, zu Hause zu bleiben.«
»Sie wird ihre Probleme nicht durch Weglaufen lösen können.«
»Du aber auch nicht«, schnauzte sie ihn an. »Schau, ich verstehe ja, dass diese Sache mit der Blindheit eine große Herausforderung für dich ist …«
Ein seltsames Geräusch kam aus seiner Kehle.
Ihr Verstand warnte sie, nicht unsensibel zu werden, aber sie ignorierte ihn.
»Aber das entbindet dich nicht von deiner Verantwortung und gibt dir nicht das Recht, meine Entscheidungen infrage zu stellen. Kaitlyn ist mehr, als ich zurzeit allein bewältigen kann, Drew, darum hoffe ich, dass du etwas Gutes bewirken kannst mit deinem Besuch.«
Sie drehte sich auf dem Absatz um und wollte gehen, blieb dann jedoch wie erstarrt stehen. In der Tür stand Kaitlyn, deren völlig entgeisterter Blick zwischen ihr und Drew hin- und herwanderte.
3. KAPITEL
Später am Nachmittag stieg Drew aus dem Auto seiner ehemaligen Schwiegermutter und zog seinen Blindenstock auf volle Länge aus. Der Geruch von brackigem Wasser und die entfernten Rufe der Hafenarbeiter erfüllten seine Sinne.
Wenn sie früher Rias Mutter gemeinsam mit den Mädchen besuchten, hatte ihm dieser Teil der Stadt immer ganz besonders gut gefallen. Die Beach Street verlief eine halbe Meile entlang der Küste, und neben der Bucht befand sich ein breiter Radweg, daneben einladende grüne Bänke, von denen aus man gut über das Wasser blicken konnte. Im Sommer war es dort immer überlaufen von Menschen, jede Menge Radfahrer, Jogger und Leute, die an den Strand wollten. Doch jetzt, Anfang Oktober, war es dort sehr ruhig.
Er erinnerte sich an die kleinen Geschäfte, Cafés und Restaurants auf der anderen Straßenseite, aber die meisten waren wegen des Endes der Urlaubssaison geschlossen. Der Eisladen, den sie ansteuerten, Goody’s, hatte jedoch das ganze Jahr über geöffnet und war bei den Einheimischen äußerst beliebt.
Er lauschte, konnte aber nicht hören, dass die Beifahrertür geöffnet wurde. »Kommst du, Kait?«
Es kam keine Antwort, obwohl sie die Tür öffnete und ausstieg. Sie war sehr still gewesen, seit sie heute Morgen Ria und ihn beim Streiten im Motel erwischt hatte. Sie war weggelaufen und Ria ihr hinterher, aber nach allem, was Ria ihm danach mitgeteilt hatte, wollte Kaitlyn nicht über den Streit reden.
Sein Besuch stand bis jetzt unter keinem guten Stern.
»Danke, Julie«, sagte er. Sie war extra rechtzeitig von ihrem Job im Buchladen nach Hause gekommen, um sie hierher zu chauffieren.
Er versuchte gerade zu lernen, Hilfe anzunehmen. Aber das fiel ihm nicht leicht. Die Abhängigkeit von anderen machte ihm sehr zu schaffen.
»Kein Problem. Ich bin in einer Stunde wieder da und hole euch ab. Kaitlyn, hilf doch mal deinem Vater.«
»Wie denn?«, fragte sie.
Drew wollte schon antworten, aber Julie schaltete sich ein.
»Er soll sich einfach an deinem Arm festhalten. Du musst ihn vor Bordsteinen und anderen Hindernissen warnen.«
Kaitlyn schlug die Autotür zu und stellte sich neben ihn.
»Ich bin hier.« Sie puffte ihren Ellbogen seitlich in seinen Arm. Als er sich an ihr festhielt, stieg ihm ein fruchtiges Parfüm in die Nase. Das war eigentlich eher Sophias Stil, Kait hatte über so etwas früher die Nase gerümpft. Liebe und Traurigkeit durchfluteten ihn. Was hatte er alles verpasst, während er sich nur egoistisch um seine eigenen Probleme gekümmert und seine Töchter ignoriert hatte?
Er musste herausfinden, was falsch lief, um es dann in Ordnung bringen zu können. Wie gerne hätte er sie gesehen, aber er konnte es nicht. Sie gingen in den Laden und bestellten sich Eis an der Theke. Als er mit seinem Geld herumfummelte – sein System, die Geldscheine so zu falten, dass er sie auseinanderhalten konnte, war noch nicht sehr ausgereift –, hörte er Kaitlyn seufzen.
»Hier entlang, Dad«, sagte sie, als er es endlich geschafft hatte und seinen Eisbecher entgegennahm. Sie führte ihn zu einem kleinen Tisch und setzte sich ihm gegenüber.
»Danke, dass du mir geholfen hast«, sagte er und fühlte sich dabei unbehaglich, aber er musste es einfach loswerden. »Ich weiß, es ist bestimmt nicht leicht, deinen Vater so zu sehen.« Sie antwortete nicht, aber er konnte hören, wie ihr Löffel gegen die Eisschale klimperte.
»Also, was hast du heute Morgen mitbekommen?«
»Oh, nichts«, sagte sie.
»Mom meinte, du hättest vielleicht gehört, wie wir über dich gesprochen haben. Wir machen uns nur Sorgen um dich und wollen dir helfen.«
»Schon klar.« Noch mehr Geklimpere.
Er probierte sein Eis, und trotz seiner sorgenvollen Stimmung war er plötzlich überwältigt von dem intensiven Schokoladengeschmack und den Brownie-Stücken. »Wow, ich hatte schon fast vergessen, wie gut das Eis hier ist.«
»Ja, schon, oder?« So lebhaft hatte Kaitlyns Stimme während seines ganzen bisherigen Besuchs noch nicht geklungen. »Alle Sorten hier sind lecker.« Sie genossen ihr Eis ein paar Minuten lang schweigend. Dann versuchte Drew es erneut. »Und, wie geht’s dir?«
»Gut.«
Er wünschte sich, ihr Gesicht sehen zu können. »Mom sagt, du hattest Ärger«, sagte er.
»Warum hast du mir nicht gesagt, dass du blind bist?« Die Worte schienen auf einmal aus ihr herauszusprudeln.
»Das ist eine gute Frage.« Er legte seinen Löffel beiseite. »Ich wollte erst einmal selber damit klarkommen, bevor wir uns treffen. Ich wollte niemandem zur Last fallen oder dich und deine Schwester um Hilfe bitten müssen.« Er hielt inne und wartete auf eine Antwort, die nicht kam. »Ich hatte gehofft, meine Sehkraft würde zurückkommen, was übrigens immer noch passieren könnte. Zumindest teilweise. Aber es war falsch von mir, dich, Sophia und Mom nicht miteinzubeziehen.«
»Ich wollte dich diesen Sommer gerne einen Monat lang in Baltimore besuchen kommen. Ich dachte, das wäre so geplant gewesen. Und dann hast du einfach abgesagt.«
Schuldgefühle packten ihn; es fühlte sich an, als würden ihn eine Million Nadeln stechen. Er hatte ihr geschrieben und sie angerufen und ihr halbgare Entschuldigungen und noch halbgarere Ausreden unterbreitet. Sie hatte ein Recht darauf, wütend zu sein. Aber zumindest redete sie jetzt mit ihm.
»Das tut mir leid. Ich hab mich verletzt, und ich schätze mal … Ich konnte mich nur noch auf mich konzentrieren.«
Sie seufzte schwer. »Ist schon gut.«
Aber das war es nicht. Das konnte er an ihrer Stimme erkennen.
Er sehnte sich zurück zu der Zeit, als sie und ihre Schwester noch Kinder waren, seine Beziehung zu Ria noch stabil war. Einigermaßen stabil.
»Hast du Probleme mit dem Schulstoff?« Er glaubte nicht wirklich, dass das das Problem war. Sie war intelligenter, als er es jemals sein könnte. In dieser Hinsicht kam sie ganz nach ihrer Mutter.
»Nein, da ist alles in Ordnung.«
»Ist irgendwas mit den anderen Kindern?«
Sie antwortete nicht. Er hörte, wie sie ihren Teller von sich wegschob. Um sie herum wurde es in der kleinen Eisdiele immer lauter. Ein Gewirr aus Kinderstimmen, Reden und Lachen. Jemand rempelte gegen seinen Stuhl und murmelte »Entschuldigung«.
»Sind deine Klassenkameraden gemein? Ärgern sie dich wegen irgendwas?«
»Mach dir darum keine Sorgen.«
Das war keine wirkliche Antwort, aber er vermutete, dass er auf eine heiße Spur gestoßen war. »Tu einfach so, als wär es dir egal, als würde es dich nicht stören. Damit zahlst du es ihnen zurück.«
»Dad, du hast Eiscreme auf deinem Hemd.«
Hitze stieg in seinem Nacken auf. »Wo?«
Sie langte über den Tisch und berührte eine Stelle auf seiner Brust. »Genau da. Hey, lass uns gehen.«