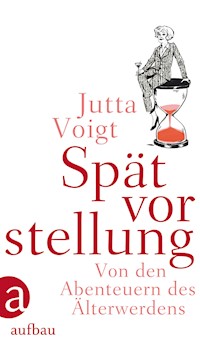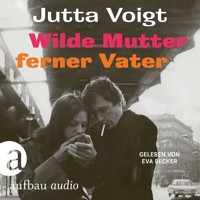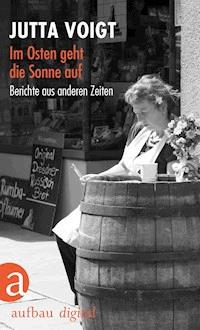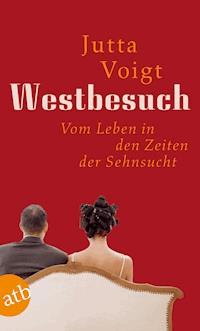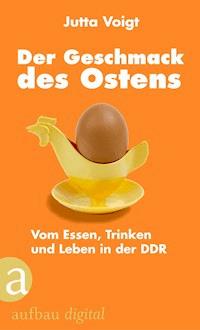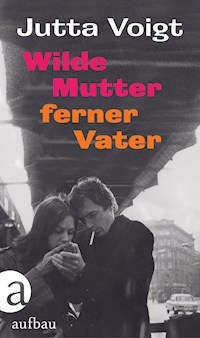
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jutta Voigt erzählt die Geschichte ihrer Familie zwischen Krieg und Frieden, Diktatur und Bohème, Vergebung und Vergessen – ihr bislang persönlichstes Buch.
Margit, die wilde Mutter, war achtzehn, als sie den blonden, hochgewachsenen Willi traf. Drei Wochen nach Judys Geburt überfiel Hitler die Sowjetunion, und das Kind sah den fernen Vater erst wieder, als es sieben Jahre alt war. Die hoffnungsvollen fünfziger Jahre enden im tiefen Fall: Willi erliegt dem Alkohol, weil er den Krieg und was er tat vergessen muss. Judy schafft als Einzige in der Familie den Aufstieg: Sie trifft Henri, den genialen Regisseur und Brecht-Schüler, und wird eine erfolgreiche Feuilletonistin. Aufbruch und Scheitern der Nachkriegszeit wiederholen sich in der zweiten historischen Zäsur, die Judy erlebt: der Wende. In Jutta Voigts neuem Buch sehnt sich die Vergangenheit nach der Gegenwart. Sie will nicht begraben sein, sondern wird zum bizarren Muster, vor dem wir uns erkennen.
»Berührend, verstörend und unfassbar gut erzählt.« MARION BRASCH.
»Jutta Voigts Erinnerungen verdichten acht Jahrzehnte deutscher Geschichte auf wenigen Quadratkilometern Berlin, vom Krieg über die DDR bis in die offene Gegenwart: kitschfern, realitätstrunken und mit reflektierter Poesie.« CHRISTOPH DIECKMANN, DIE ZEIT.
»Großartig geschriebene Zeitgeschichte(n).« DIETER KOSSLICK.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Margit, die wilde Mutter, war achtzehn, als sie den blonden, hochgewachsenen Willi traf. Drei Wochen nach Judys Geburt überfiel Hitler die Sowjetunion, und das Kind sah den fernen Vater erst wieder, als es sieben Jahre alt war. Die hoffnungsvollen fünfziger Jahre enden im tiefen Fall: Willi erliegt dem Alkohol, weil er den Krieg und was er tat vergessen muss. Judy schafft als Einzige in der Familie den Aufstieg: Sie trifft Henri, den genialen Regisseur und Brecht-Schüler, und wird eine erfolgreiche Feuilletonistin. Aufbruch und Scheitern der Nachkriegszeit wiederholen sich in der zweiten historischen Zäsur, die Judy erlebt: der Wende. In Jutta Voigts neuem Buch sehnt sich die Vergangenheit nach der Gegenwart. Sie will nicht begraben sein, sondern wird zum bizarren Muster, vor dem wir uns erkennen.
Über Jutta Voigt
Jutta Voigt, geboren in Berlin, Studium der Philosophie an der Humboldt-Universität, Redakteurin, Essayistin und Kolumnistin bei den Wochenzeitungen Sonntag, Freitag, Wochenpost und Zeit. 2000 erhielt sie den Theodor-Wolff-Preis.
Im Aufbau Verlag sind bisher erschienen: „Der Geschmack des Ostens. Vom Essen, Trinken und Leben in der DDR“, „Westbesuch. Vom Leben in den Zeiten der Sehnsucht“, „Spätvorstellung. Von den Abenteuern des Älterwerdens“, „Stierblutjahre. Die Boheme des Ostens“ und „Verzweiflung und Verbrechen. Menschen vor Gericht“.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Jutta Voigt
Wilde Mutter, ferner Vater
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Endliche Erzählungen
Margit, die Mutter
Willi, der Vater
Judy, die Tochter
Henri, Judys Mann
Du bist so schön
Hier war es
Krieg kann so leicht sein
Eigentlich habe ich noch gar nicht gelebt
Der Krieg ist aus
Der Zauber des Nachkriegs
Meine Heimat ist der Krieg
Eine Art Glück
Der Großvater und die Prinzessin
Böser an Süße
Hast Du etwas Sehnsucht nach mir?
Das Feuergefecht – Bericht eines blutjungen Soldaten
Die Grüne Stadt
Feuer auf der Spree
Vulkanfiber
Präsentkorb oder Papierblume
Halbzart
Weltenwechsel
Die Liebe ist ein seltsames Spiel
Judy darf alles
Heimliche Hochzeit
Auf Wiedersehen, Mäuschen
Kalte Ente, kaltes Ende
Kornblumenblaue Dielen in Berlin
Fontäne des Denkens
Kommt uns nicht mit Fertigem!
Wir nannten sie die Mississippi-Post
Kunst und Leidenschaft
Nichts als Lotte
Der Rückzug von der Bedeutung
Weil nicht alle Blütenträume reifen
Himmelfahrt
Utopien sind größenwahnsinnig
Lady Madonna
Hast du davon gewusst, Mama?
Ich hab heut Nacht Paris gesehn
Dasein im Halbschlaf
Fröhliche Nachbarn
Eine Vision von Welt
Der 9. November 1989 war ein Donnerstag
Vorwärts und Vergessen
Vergessene Versuche
Frühstücksflirt
Der Eigentümer
Epilog – Die verletzte Taube
Dank an Franziska Günther
Dank an Fritz-Jochen Kopka
Impressum
Für Peter, Maria, Charlotte, Dschingis, Jimmy, Emilie
Liebe heißt, im anderen sich selbst erobern.
Friedrich Hebbel
Endliche Erzählungen
Der Dialog mit den Toten darf nicht abreißen, bis sie herausgeben, was an Zukunft mit ihnen begraben worden ist. (Heiner Müller)
Margit, die Mutter
Ich sah gerade einen Film mit Mario Adorf, als mein Herz stehen blieb. Am Nachmittag beim Friseur war noch alles gut, auch die Haarfarbe war schön goldblond.
Johnny, mein später Geliebter, pflanzte eine Birke auf mein Grab. Jetzt liege ich hier, und die Erde schmeckt mir nicht mehr. Dabei habe ich nach dem Krieg so gerne Erde geschnüffelt. Ich habe meine Nase in jeden Blumentopf gesteckt und gierig die Erde eingesogen. Ich hatte das Gesicht voller schwarzer Krümel, wie eine Verrückte, aber ich war ganz normal.
Schauspielerin wäre ich gerne geworden, aber ich habe mich nicht getraut. Dabei konnte nach dem Krieg jeder werden, was er wollte, jedenfalls im Osten. Warum habe ich mich nicht in einer Schauspielschule angemeldet?
An dem Abend, als ich starb, hatte ich mich auf morgen gefreut. Und wie ich mich freute. Ich wollte endlich nach Bayern fahren, weil ich noch nichts von der Welt gesehen hatte.
In meiner Jugend war ich eine dumme Person, unbeherrscht und ungerecht, auch meiner kleinen Tochter gegenüber. Sie sah alles ein, meine Kleine, ich hatte nur sie. Und zwei Abtreibungen. Als Judy erwachsen war, war ich stolz auf sie. Sie machte das Abitur und studierte sogar. Und sie heiratete einen Künstler, Henri, der gefiel der ganzen Familie.
Willi, mein Mann, war acht Jahre im Krieg. Als er zurückkam, hatte ich einen anderen. Wir lebten dann doch wieder zusammen, man muss sich ja treu bleiben. Willi tröstete sich. Mit Alkohol und Doris. Ich war eifersüchtig, obwohl ich froh war, nicht mehr die Verantwortung für ihn zu haben. Mein schöner Mann liebte eine andere. Und starb einfach so.
Willi, der Vater
Was will ich in diesem Grab mit lauter fremden Leuten. Es ist ein Familiengrab, aber es ist nicht meine Familie, ich kenne die doch gar nicht. Außer Doris, die lieb war und hübsch und die ertragen musste, dass ich mitten auf dem Asphalt starb, Lungenembolie. Am Himmelfahrtstag. Ich war erst siebenundvierzig und sah aus wie Mitte dreißig.
Von Margit hatte ich mich getrennt und sie sich von mir, sie konnte meinem Absturz nicht länger zusehen. Wie konnte das mit mir passieren, das Leben fing doch erst an. Ich war ein vielversprechender Kader. Da war ich Ende zwanzig, galt als Talent und glaubte an eine bessere Welt. Und die Frauen mochten mich.
Die Nazi-Behörden hatten vergessen, mich zur Musterung einzubestellen, aber dann schnappten sie mich doch noch. Am Ende steckten sie mich in die Waffen-SS. Die Gardegröße hatte ich und die Augenfarbe auch. Aber nicht die Gesinnung, in meiner Familie waren alle Sozialdemokraten. Ich liebte das Vergnügen und die Pflicht, aber nicht die Pflicht zum Heldentod. Ich liebte mein Paddelboot und das Feiern mit Freunden, am meisten aber liebte ich Margit. Sie erschien nicht zu meiner Beerdigung, Judy, meine Tochter, auch nicht.
Doris legte mich in ihr Familiengrab. Mein Name steht nicht auf dem Grabstein, vielleicht hatte sie Angst, dass Margit mich hier wieder rausholt. Macht sie aber nicht. Ich habe nie einen Menschen totgeschossen, sagte ich zu Margit, als ich aus der Gefangenschaft heimkehrte. Ob sie mir das geglaubt hat?
Judy, die Tochter
Ich war ein dünnes, blasses Mädchen, das den Geruch nach Feuer und Rauch in sich trug. Das über mehr Angst als Mut verfügte, über mehr Melancholie, als es weglachen konnte. Meine Heimat war der Krieg, diese Heimat blieb mir treu. Das Heulen der Sirenen und das Aufgehobensein in der Angst gaben mir Geborgenheit, der Geruch nach Keller ist für mich noch heute der Duft von Leben. Die Angst begleitet mich durch mein Dasein, das Jaulen einer einzigen Sirene reicht, um ein Bataillon von Ängsten in Marsch zu setzen und durch meine Seele zu hetzen.
Mein ferner Vater kam mir näher, je länger er tot war und ich seine verzweifelten Briefe an Margit, seine Frau und meine Mutter, gelesen hatte. Ich entdeckte, dass ich ihm ähnlicher war als meiner Mutter, ich fühlte Empathie mit dem schweigsamen Mann. Ein Leben lang war ich auf der Suche nach der Leichtigkeit des Seins. Ich habe sie gefunden, mein Vater fand sie nur im Rausch.
Ich war die Aufsteigerin der Familie, mein Aufstieg verstand sich von selbst, schließlich lebte ich in einem Arbeiter- und Bauernstaat. Ich glaubte an den Sozialismus, jedenfalls an die sozialistische Utopie; was daraus wurde, steht auf einem anderen Blatt. Ich war nie in einer Partei, Kämpfe gegen Dogmatiker kann man auch ohne Partei führen.
Ich war eine freie Frau. Die Idee, dass dies anders sein könnte, kam mir gar nicht erst. Auch die nicht, dass Männer klüger sein könnten als Frauen oder schlagfertiger oder sensibler. Anders sind sie, und das ist gut so.
Mit Liebe begann auch die Geschichte zwischen Margit und Willi, doch der Krieg war immer dabei. Meine Eltern wurden nicht glücklich.
Die Ehe mit Henri war lang und überwiegend heiter, sie bestand aus Leiden und Lachen. Das Lachen überwog. Henri war mir nicht treu, ich ihm auch nicht. Es war Liebe.
Henri, Judys Mann
Am Ende sollte ich keine Treppen mehr steigen, ich müsse zu Hause bleiben, sagte der Arzt. Das hielt ich nicht aus, ich war doch ein Leben lang in Bewegung.
Nach fünf Tagen ging ich runter auf die Straße, es war ein Donnerstag, der 12. März, mein Todestag. Ich schickte Judy letzte Nachrichten per SMS:
12:57 Uhr: TREPPAB. Einkauf bei Edeka. Kekse, Schokolade und Erbsen im Glas. Im Zeitungsladen den »Spiegel« gekauft.
13:49 Uhr: MENU im 1900. Vorweg prima Salat. Maronengnocchi mit Rosenkohl und Champignons.
15:24 Uhr: AUFSTIEG.
Das war meine allerletzte Nachricht. Ich schaffte es noch bis in unsere Wohnung im dritten Stock. Auf dem Korridor legte ich mich hin, mit Mantel und Schal. Ich war müde und starb.
Eine Viertelstunde später kam Judy. Dann Simone, Sophie und David. Jimmy wollte mich nicht tot sehen, er war erst vierzehn und fuhr lieber seine kleine Schwester spazieren.
Sie tranken an meinem Totenbett Moët & Chandon und stießen auf mein Leben an, Judy hat mir mit dem Champagner Stirn und Wangen eingerieben. Ich glaube, ich war glücklich. Das Leben war schön. Filme machen, Brecht lesen, Mozart dirigieren, mit Judy lachen. Mein Verstand war bei Brecht, mein Gefühl bei Mozart. Das waren die zwei Seiten in mir. Ich weiß nicht, welche stärker war.
Nach meiner Beerdigung waren alle beim Italiener gegenüber vom Friedhof. Judy schrieb in die Todesanzeige für die »Berliner Zeitung«: »Danke für das schöne Leben«. Das stand da mit ihrer Unterschrift.
Von meinem Grab aus kann ich Brechts Fenster sehen, da hat alles angefangen, da hört alles auf. Oder auch nicht. Mach weiter, lach weiter, Judy! Bring mir weiße Lilien ans Grab! Tanze nach dem Schostakowitsch-Walzer Nr. 2. Ich bin da.
Du bist so schön
Die Liebe ist manchmal das Traurigste, oft das Schönste, aber immer das Wichtigste im Leben. (Unbekannt)
Los, Margit, such den Herrenmenschen, fang ihn! Willi rennt die Treppen hoch zum Stierbrunnen und versteckt sich in einer Höhle unter der Brunnenschale. Los, fang den Herrenmenschen, groß, blond, blauäugig!, ruft er lachend.
Verliebte Kinder, die ineinanderstürzen.
Du bist so schön, flüstert sie.
Du bist so süß, flüstert er. Willi breitet sein Pfeffer-und-Salz-Jackett über den roten Stein. Um drei Uhr am Morgen zeugen sie Judy.
Es war September, es war 1940. Margit und Willi waren tanzen.
Wenn ich Sie wäre, sagte Margit beim ersten Foxtrott mit Willi, wenn ich Sie wäre, so groß, so blond, so blauäugig, würde ich mich freiwillig melden.
Willi erstarrte: Wissen Sie überhaupt, was Krieg bedeutet? Die haben vergessen, mich zur Musterung zu bestellen, ich melde mich nicht freiwillig. Wenn sie mich holen, und wenn ich falle, bin ich nicht gern gefallen für Volk und Vaterland, das sollten Sie wissen.
Margit schwieg und versank rettungslos in Willis blauen Augen. Aber Sie sind doch ein Herrenmensch, hauchte sie.
Willi brachte Margit nach Hause. Eine Sommernacht, sie liefen durch die Leipziger Straße, über den Alexanderplatz, vorbei am Märchenbrunnen, durch den Friedrichshain, wo Knallerbsen an Büschen wuchsen. Margit pflückte ein paar davon, warf sie auf die Erde und trat mit ihren hohen Absätzen drauf, bis sie knallten.
Je älter Judy war, desto größer wurde ihr Mitleid mit den Eltern, diesen beiden Achtzehnjährigen, denen der Lauf der Geschichte ihre Jugend stahl, sie hatten nur ein halbes Leben. Manchmal ist ihr, als wären Margit und Willi die um ihr Leben betrogenen Kinder und sie, Judy, ihre Mutter. Wenn sie heute einen ihrer Enkel umarmt, hat sie das Gefühl, es ist ihr Vater, groß, dünn und achtzehn Jahre alt. Und morgen muss er zur Musterung und übermorgen in den Krieg.
Als sie sich im Haus Vaterland kennenlernten, war Margit siebzehn und Willi achtzehn. Die Ideen für den Glitzerbau am Potsdamer Platz stammten aus den Zwanzigerjahren. Haus Vaterland war geplant als »Symphonie des Lebens«, die den in der Hauptstadt weilenden Gästen »ein Heim, das Freude und Unterhaltung bietet, ein Amüsiertempel, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat«.
Künstliche Wolkenbrüche mit Blitz und Donner im Restaurant Rheinterrassen, Cowboys in der Wildwest-Bar, für die brandenburgischen Bauern hielt die Eisenbahn direkt vor dem Bierkeller Teltower Rübchen. Es gab noch den Palmensaal mit der auf Stahlfedern gelagerten Tanzfläche, das türkische Café, die spanische Bodega. Allezeit, ob mit Verdunklung oder ohne, war die Stimmung nicht vorwiegend patriotisch, sondern vorwiegend weltoffen. Am Ende eines Abends wurde manchmal der längst verbotene Swing gespielt, das jedenfalls erzählte Margit ihrer Tochter.
Jeder Gast, ob schwarz, weiß oder gelb, sollte im Haus Vaterland zu Hause sein – das war die mondäne Devise, die auch noch galt, als die Weltoffenheit längst vom schmutzigen Lappen der Geschichte weggewischt worden war. Im November 1943 wurde das pompöse Gebäude von Fliegerbomben getroffen und mutierte zum Wehrmachtsheim für durchreisende Soldaten, mit Lebensmittelkarte und Verdunkelung.
Die Blonde, die Willis Cousin Berthold an jenem Abend in die Wild-West-Bar im Haus Vaterland mitbrachte, war übermütig, sie flirtete mit beiden Männern. Mein Bruder hat auch so goldene Haut, sagte sie mit Blick auf Willi. Das kommt vom Paddeln, erklärte er verlegen und bestellte zwei Schnäpse für die Herren und zwei Liköre für die Damen. Die Blonde hieß Miriam, sie plauderte frei heraus, dass sie eine Greiferin sei, dass sie Juden, die illegal in Berlin leben, um der Deportation zu entgehen, an die Gestapo verrate. Und dass sie selber eine Jüdin sei. Das tat dem lustigen Abend keinen Abbruch, im Gegenteil, der Tanz auf dem Vulkan wurde umso abenteuerlicher. Nach zwei Runden hatte Margit sich in Willi verliebt. Du bist ein Kind der Liebe, sagte sie später öfter zu Judy, ein Kompliment, das sie sich selber machte.
Hier war es
Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe höret nimmer auf. (1. Korinther 13)
Nachdem Haus Vaterland abgebrannt war, tanzte Margit, nur mit einem schwarzen Hemdröckchen bekleidet, auf dem Korridor der elterlichen Wohnung und sang dazu »Es war einmal ein Räuber, der lebte tief im Wald«. Wenn dabei ihre Brüste schaukelten und die Pfennige von den Strumpfbändern sprangen, erschien sie ihrem blassen Kind nicht geheuer. Die Tanzlust kam über sie wie Heißhunger – ein Schlager im Radio, ein Hauch Frühling, ein spontanes Auf-die-Probe-Stellen ihrer Kondition, und Margit steppte, swingte, walzte, bis ihr die Puste ausging.
Judy sah ihrer Mutter zu, sie lachte, und sie fürchtete sich. Denn in derselben Aufmachung – Strumpfband und Hemdröckchen – stellte Margit den Kohlenklau dar, die Reichspropagandafigur, die dem deutschen Volk Gas und Kohlen stahl. Es machte ihr Spaß, Judy Angst einzujagen und sie dann in den Arm zu nehmen und zu trösten. Sie war selber noch ein Mädchen, voller Lebenslust und Übermut. Abends, wenn sie ihr Kind halb angezogen – damit sie bei Alarm schnell mit ihm in den Keller laufen konnte – ins Bett gebracht hat, mit dem Teppichklopfer auf der Bettdecke, damit die Kleine Gevatter Tod wegjagen kann, stellte sich Margit ans verdunkelte Fenster und rauchte.
So hatte Judy ihre Mutter am liebsten. Wenn von ihr nur noch die glimmende Zigarette zu sehen war, das kleine rote Glühen. Dann fühlte sie, dass alles gut wird. Bis die Sirenen heulten und Margit mit Judy zum Bunker rannte. Wenn man draußen jemandem begegnete, den man kannte, rief man ihm zu »Bleib übrig!« Heute sagt der Nachrichtensprecher im Fernsehen jeden Abend: »Bleiben Sie zuversichtlich!« Und er meint damit, dass es irgendwann wieder ein Leben ohne Corona geben wird.
Judy steht vor dem Stierbrunnen am Arnswalder Platz. Hier war es. Gegenüber ist die Friedeberger Straße, wo Margits Eltern wohnten, wo Margit wohnte und später auch Judy. Zu Füßen der fünf Meter hohen Stiere ist eine stolze Mutter mit prallem Kind platziert, der Fischer mit dem Netz, die Schnitterin mit dem Ährenbündel – starke Stiere, starke Menschen. Ambivalente Monumentalität, was wuchtig wirkt, hat Macht, so scheint es.
»Die Friedeberger Straße wurde beim Wiederaufbau nach dem Krieg nicht wiedereingerichtet«, so ist es unter »Verschwundene Straßen« in der Stadtgeschichte dokumentiert. »Es verblieb ein unbenannter Fünfzigmeter-Stumpf rechtwinklig zur Hans-Otto-Straße …« Ein unbenannter Stumpf – das hört sich nach Amputation an. Weg, aus, vorbei auf ewig.
Judy sucht immer wieder den »unbenannten Fünfzigmeter-Stumpf« auf, sie vermisst die Friedeberger Straße. Die Leere bleibt, aber es ist dasselbe Pflaster, es berichtet vom vergangenen Leben dieser Straße, von eiligen Schritten unter dem Heulen der Sirenen, von der Angst vor dem Bombenhagel, von Kinderfüßen, die bei Fliegeralarm nachts über das Pflaster tapern, kleine Gestalten, die vor Müdigkeit schwanken. »An der Oberfläche des Asphalts treffen die Ewigkeit und das Jetzt aufeinander, die Ewigkeit des Felsens und die Gegenwart des Lebens, das sich auf ihm abspielt. Dazwischen gibt es nichts.« So sah es ein Pflasterfachmann.
Das Pflaster weiß von den aggressiven Tritten der SS. Von den schweren Stiefeln der Roten Armee. Von Menschen, die auf dem Pflaster gestorben sind. Von Margits Angst, als sie mit Judy auf dem Arm zum Bunker rennt und stürzt. Mutter und Kind schaffen es knapp, alle Luken sind geschlossen, es ist lebensgefährlich, noch Leute reinzulassen, und dennoch öffnet jemand eine Luke und zieht Mutter und Kind in den Bunker.
Auf Berlin fielen in diesem Krieg mehr Bomben als auf jede andere deutsche Stadt, und doch wollte Margit sich nicht evakuieren lassen, sie glaubte, dass Berlin sie und ihr Kind beschützen würde. Margit lebte in ihrem ganzen Leben in keiner anderen Stadt, Berlin war ihre Religion.
Der Luftschutzbunker im Friedrichshain galt als bombenfest, wer es bis dorthin schaffte, hatte die Chance, zu überleben. Der Bunker war sozusagen um die Ecke, die Friedeberger nur zehn Minuten entfernt vom rettenden Ziel. Abertausende Menschen passten da rein. Im kleineren Bunker nebenan war die Kunst untergebracht, ungefähr vierhundert Gemälde aus Berliner Galerien waren dort versteckt, gemalt von Michelangelo, Botticelli, Raffael und Rubens. Nach dem Krieg waren sie verschwunden, verbrannt, verloren, unauffindbar, auch die sowjetische Trophäenkommission fand nichts heraus, bis heute nicht.
Tamara Danz, die Diva der Gruppe Silly, besang den großen Bunkerberg, den man nach dem Krieg Mont Klamott nannte. »Lass sie ruhn, die Väter dieser Stadt, die sind so tot seit Deutschlands Himmelfahrt«, hatte die alte Frau gesagt, mit der Tamara Danz auf dem Bunkerberg gesprochen hatte. »Auf ’m Dach von Berlin sind die Wiesen so grün – Mont Klamott / Lass sie ruhn, die Väter dieser Stadt … Die Mütter dieser Stadt hab’n den Berg zusammengekarrt.«
Judy war ewig nicht hier oben, irgendwas hat sie jahrzehntelang davon abgehalten. Die Sonne scheint, es ist klar und kalt. Die Rodelbahn, genannt Todesbahn, wird gerade instand gesetzt, Spaziergänger sonnen sich, von Geschichte kaum eine Spur. Von den beiden Bunkern ist nichts, gar nichts mehr zu sehen. Sie wurden 1946 mit einer gewaltigen Detonation gesprengt, die Betonriesen fielen erst beim zweiten Versuch um, sie hatten kaum Kriegsschäden, aber drei Meter dicke Betonwände. Später wurden die Bunker von den Trümmerfrauen mit dem Schutt der zerbombten Stadt zugeschüttet. Ein mystischer Vorgang; die Frauen räumten auf mit der Geschichte.
Judy geht wieder und wieder an die Stelle, wo einmal die Friedeberger war, sie füllt die Leere mit Erinnerungen. Holt sich ein hohes Stück Rhabarberkuchen und einen Kaffee im Pappbecher bei Bäcker Bisewski, der seinen Laden seit Jahrzehnten an dieser Stelle führt und schon immer guten Kuchen gebacken hat. Sie setzt sich auf eine Bank zwischen Kastanien und starrt auf den Stierbrunnen. Eine schon lange nicht mehr junge Frau, groß und schmal, mit kurzen blonden Haaren – Judy. Wenn das Pflaster noch da ist, sind auch die Seelen noch da, die Atemzüge. Hingehauchtes, Benutztes. Gelebtes. Spuren, die spüren können.
Eine Kindergruppe mit russischsprachigem Erzieher tobt auf dem Platz, der Erzieher ruft einen Jungen zur Ordnung, Nikolai, Nikolai, bleib stehen!
Russen am Arnswalder Platz, das gab es doch schon mal, da hieß der Platz noch Hellmannplatz, nach dem Nationalsozialisten Fritz Hellmann.
Nikolai, Nikolai! Komm zurück! Der Kleine rennt um das Rondell, dem Erzieher in die Arme.
Judy hat den hölzernen Küchenschrank mit den vielen Fächern und Schubkästen vor Augen, auch ihre Zelluloidpuppe im blauen Strickkleid war im brennenden Haus zurückgeblieben. Und der Teppichklopfer, den Judy jede Nacht auf der Bettdecke zu liegen hatte, um Gevatter Tod zu vertreiben. Gevatter Tod, das war, so dachte Judy, Franklin D. Roosevelt, über den die Mutter und die Großmutter in der Küche viel redeten.
Alles verbrannt, die kleine Friedeberger endete im großen Trümmergrab, heute kennt sie keiner mehr. Auf dem Stierbrunnen brennen viele rote Lichter, liegen Blumen im Gedenken an die Toten der Corona-Pandemie.
Auf der Bank neben Judy telefoniert eine Frau, sie wiederholt jeden Satz, die Lautstärke steigert sich: Du musst dir das auf-schrei-ben, Mama, wir kommen am Donnerstag. Am Don-ners-tag! Nein, nicht auf einen Zettel, du musst das in deinen Ka-len-der schreiben: Nein, nicht Dienstag, Donnerstag, Mama, Donnerstag kommen wir! Diese Mama könnte ein Kriegskind gewesen sein.
Krieg kann so leicht sein
Wenn sich die späten Nebel drehn
Werd ich an der Laterne stehn
Wie einst Lili Marleen. (Hans Leip)
Willis Freund Werner schickt einen Brief aus dem im Schnelldurchlauf besiegten Frankreich: »Wir trinken hier nur noch Champagner, die Fl. kostet 25–35 Francs, das sind nach unserem Geld 1,25–1,75 Reichsmark – was für ein Leben!«
»In Berlin geht alles seinen gewohnten Gang«, antwortet Willi, der Daheimgebliebene, »die englischen Luft-Gentlemens haben eine Anzahl Brand- und Sprengbomben abgeworfen. Der Überfall forderte Gott sei Dank keine Todesopfer und verursachte geringen Sachschaden.«
Ach, Krieg kann so leicht sein. Siegestaumel. Trompeten, Trommeln, Pferde. Vor den Pariser Cafés sitzen deutsche Offiziere. In einem Schwarz-Weiß-Film sieht man die Franzosen durch ihre Straßen laufen wie Fremde, ein alter Mann schluchzt.
Berthold, der Cousin, schreibt am 14. August 1940 an Willi: »Ich bin erstaunt, dass Du noch in der Öffentlichkeit bist, lieber Willi, ich habe angenommen, man hat Dich polizeilich holen lassen, weil Du nicht wie Deine gleichaltrigen Kameraden zur Musterung warst. Es tut jetzt wirklich Not, dass Du Dich mit Deinen geistigen wie sportlichen Fähigkeiten zur Wehrmacht, wenn nötig, freiwillig meldest. Tue also Deine verdammte Pflicht!«
Von allen Seiten bekommt Willi nachdrückliche Aufforderungen. Er hält dem Druck nicht stand und meldet sich irgendwann zur Musterung, er geht zur Flak, lernt, mit Flugabwehrkanonen umzugehen, schließlich hat er eine Lehre als Versicherungskaufmann bei der Lufthansa absolviert.
Die Zeit vergeht, man weiß, dass sie vergeht, aber man vergisst, wie sie vergeht. Sie haut einfach ab, klammheimlich, ihre Kontinuität ist gestört, dieser ununterbrochen gleichmäßige Fortgang, der lückenlose Zusammenhang, er ist verloren gegangen. Die Zeit, die früher so sanft wehte, hat ihre überlegene Ruhe verloren. Die Zeit hat sich verändert, sie fließt nicht mehr, sie stolpert.
Auf die Welt gekommen ist Judy, das Kind des Stierbrunnens, auf dem Wohnzimmersofa. Ihre achtzehnjährige Mutter aß nach der Geburt heißhungrig zwei Mohnschnecken, die Großmutter weinte, der Großvater murmelte was von Prinzessin, die Nachbarn brachten Kornblumen, denn es war Sommer.
»Ein ideales Sommerwetter beschert den Menschen im Juni 1941 fast 271 Sonnenstunden. Bei geringen Regenmengen liegt die Temperatur im Durchschnitt um 1,1 Grad höher als normal«, hieß es im aktuellen Wetterbericht.
Das Baby Judy betrat die Bühne des Lebens dick und rund. Als hätte es sich Reserven angeschafft für das kommende Dasein in Angst und Schrecken. Ein Baby der Reserve. Der neunzehnjährige Vater bekam Urlaub vom Flakdienst, um sein Kind zu sehen. Und was sagte er?
Na, du kleine Sau, sagte er mit zärtlichem Blick auf die volle Windel, das verzieh Margit ihm nie, sie erzählte es oft auf Familienfeiern, mit ansteigender Empörung.
Je länger es her ist, desto mehr versteht Judy ihren Vater, der versuchte, mit den Widersprüchen des Lebens zurechtzukommen: So ein süßes, marzipanrosa Baby und dann das.
»Und wenn unser Herz uns zu weich werden will in den Sentimentalitäten, denen wir ausgeliefert sind, dann werden wir laut ordinär«, wird Wolfgang Borchert einige Jahre später in seinem »Manifest« schreiben, »alte Sau sagen wir dann zu der, die wir am meisten lieben …«
Sie holten ihn vom Himmel, den britischen Piloten. Sein Tod lastete lebenslang auf Willis Gewissen. Willi und seine Flak-Kameraden hatten ihn abgeschossen. Sid lag auf einem Feld in Schleswig-Holstein, die Arme weit ausgebreitet, einen Brief an seine Verlobte in der Jackentasche:
»Betty, my Darling, today is my last mission. Soon, my dear, we can get married. So get your wedding dress out of the cupboard and tell mother to bake a cake. God bless you. In joy Your Sid.« Betty, Liebling, das ist mein letzter Einsatz. Dann heiraten wir. Also hol Dein Hochzeitskleid aus dem Schrank und sag Mutter, sie soll einen Kuchen backen. Gott segne Dich. In Vorfreude, Dein Sid.
Willi und seine Kameraden teilten sich Sids Sachen: die Fliegerjacke, die Schuhe, die Fallschirmseide. Jemand drückte ihm die Augen zu.
Er wäscht sich nicht, er spricht nicht, in seiner Freizeit liegt er nur im Bett, er verkommt, flüstern die Wirtsleute der jungen Ehefrau zu, die ihren Mann besucht. In der schmalen Kammer der dörflichen Unterkunft nicht weit vom Meer ist es kalt. Willi funktioniert wie eine kaputte Maschine, das Wort Depression kennt er nicht, aber er fühlt das Dunkel. Seine Augen sehen ins Leere.
Deine Augen sind so grau, die waren doch immer so blau, sagt Margit.
Nicht einmal vom Bahnhof hat er sie abgeholt. Und als sie Lili Marleen für ihn singt, reagiert er nicht. Das Lied war doch der Wächter ihrer Liebe gewesen, sie hatten sogar ihre Tochter nach Lili Marleen benannt: Judy Madleen, Klang und Rhythmus der Namen ähneln sich.
»Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund / Hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund / Wenn sich die späten Nebel drehn, werd’ ich bei der Laterne stehn / Wie einst, Lili Marleen / Wie einst Lili Marleen …«
Lili war der Kosename der Freundin eines Freundes von Textdichter Hans Leip, Marleen hieß eine Hilfsschwester im Reservelazarett, so entstand der Name Lili Marleen. Die Schicksalsmelodie sendete Radio Belgrad jeden Abend um zehn Uhr. Britische Truppen in Nordafrika sangen mit. Wenn die Deutschen es spielten, riefen die englischen Soldaten zu den deutschen Schützengräben rüber: Louder please, comrades!
Lale Andersen, die das Lied als Erste sang, wurde gefragt, wie sie sich erklärt, dass »Lili Marleen« so berühmt wurde.
Kann man denn erklären, warum der Wind zum Sturm wird?, antwortete sie.
Dieser Schlager wird nicht nur den deutschen Landser begeistern, sondern möglicherweise uns alle überdauern, prophezeite der Führer, diesmal behielt er recht.
Der Schöpfer von »Lili Marleen« sei der einzige Deutsche gewesen, der während des Krieges der ganzen Welt eine Freude bereitet habe, bemerkte General Eisenhower.
Margit sang das Lied ein zweites Mal in der kalten Kammer. Willi sagte wieder kein Wort. So hatte Margit sich den Besuch bei ihrem Mann nicht vorgestellt. Die Fremdheit zwischen dem jungen Paar stand im Raum wie eine Eisbombe. Traurig lief Margit zum Zug nach Berlin; ob sie auf der Fahrt nachgedacht hat, über Willi, den Krieg und Betty aus England?
»Schön war die Zeit, als wir uns so geliebt haben«, wird Margit im November 1950 auf die Rückseite von Willis Foto schreiben; er trägt darauf die Luftwaffenhelfer-Uniform und sieht frisch gewaschen aus. Sein Mund ist jung, die Lippen noch kindlich aufgeworfen. Der Kragen der Uniformjacke steht offen, das ist nicht korrekt. Was er hinter sich hatte und was ihm bevorstand, ist dem Foto nicht anzusehen.
In Margits Formulierung verbirgt sich Enttäuschung, denn die schöne Zeit ist vorbei: »Schön war die Zeit, als wir uns so geliebt haben« – im Präteritum steckt das ganze Elend ihrer Ehe und der Zeit, in der sie leben mussten. Der Fluss der Geschichte hat sie ins Dunkle gespült.
Eigentlich habe ich noch gar nicht gelebt
Du sollst nicht töten. (Fünftes Gebot)
Wenige Tage nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion entstand die Hymne »Der Heilige Krieg«, sie wurde jeden Morgen im sowjetischen Rundfunk gesendet.
»Steh auf, steh auf, du Riesenland! / Heraus zur großen Schlacht! / Den Nazihorden Widerstand! / Tod der Faschistenmacht! / Es breche über sie der Zorn / Wie finstre Flut herein. / Das soll der Krieg des Volkes / Der Sieg der Menschheit sein.«
1942 schreibt ein unbekannter junger Mann namens Otto an seine Familie: »Hier in Stalingrad verteidigen wir einen Schutthaufen. Lebt wohl, grüßt alle und vergesst mich nicht. Eigentlich habe ich noch gar nicht gelebt. Euer Otti.« Welch verzweifelte Wahrheit!
Judy denkt an den Jungen, der an einem trüben Februarnachmittag des Jahres 1943 über den Schularbeiten am Schreibtisch seines Vaters im Herrenzimmer saß. Dort fasste er einen Entschluss: Der heutige Tag, dieser eine, der ereignislos wie alle anderen vorüberzugehen scheint, der soll nicht vergehen wie alle anderen. So wollte es der neunjährige Henri. Er schrieb mit seinem Federhalter das Datum dieses Tages auf den blumengemusterten Seidenschirm der Tischlampe. Die Trauermusik im Radio galt der Vernichtung der 6. Armee bei Stalingrad. Deshalb weiß Henri heute, welchen Tag er damals auf der Tischlampe verewigt hatte, es war der 2. Februar 1943. Der Junge wurde siebzehn Jahre später Judys Mann. Willi, ihr Vater, war nur zwölf Jahre älter als Henri, verstrickt in diesen Krieg, verstrickt in dieses Schicksal.
Henri tat sein Leben lang, was er wollte, Willi musste sein Leben lang tun, was er nicht wollte. Er musste mit vierzehn den Tod seiner Mutter hinnehmen und auch, dass alsbald eine Stiefmutter ins Haus kam. Er musste über sich ergehen lassen, dass Verwandte und Freunde ihn dazu drängten, sich freiwillig der Musterung zu stellen. Er ließ sich gegen seinen Willen in die SS zwingen.
Sein Wille wurde gebrochen, immer wieder. Er musste an einem Krieg teilnehmen, den er nicht wollte. Nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft musste er sich damit abfinden, dass seine Frau einen anderen liebte. Er musste sich in der DDR der Fünfzigerjahre auf zahlreichen Lehrgängen wie einen Schuljungen abkanzeln lassen, er durfte am Wochenende kein Bier trinken gehen, weil das unmoralisch war. Er tat es doch und wurde als »Lebemann« denunziert, was man in seiner Kaderakte vermerkte. Er musste. Was er wollte, spielte keine Rolle. Er war ein gebrochener Mann.