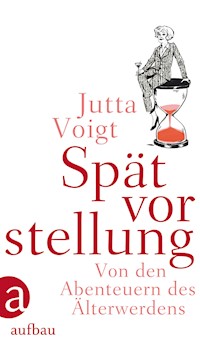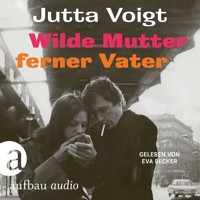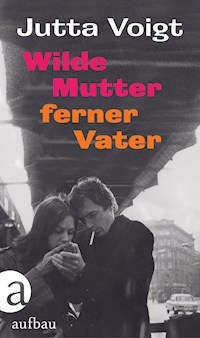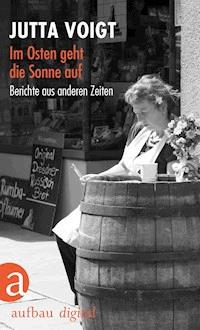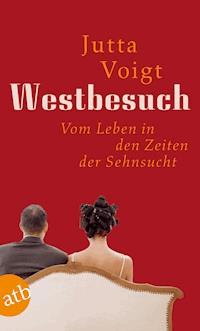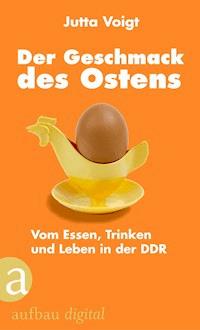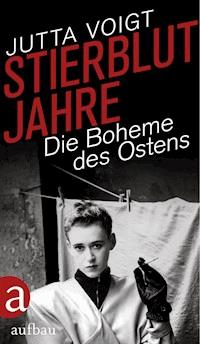
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwischen Distanz, Skepsis und Hedonismus: »Die Boheme des Ostens«. Ein neues Meisterwerk der brillanten Feuilletonistin Jutta Voigt: Klug und unterhaltsam erzählt sie von der Sehnsucht nach einem anderen Leben in der DDR. Künstler, Bohemiens, am realexistierenden Sozialismus Gescheiterte – sie alle suchten das richtige Sein außerhalb der Kontrolle des falschen Systems. Im Mittelpunkt des neuen Buches von Jutta Voigt steht eine Boheme, die ein elementares Interesse verfolgte: das andere Leben. In den frühen DDR-Jahren mit rebellischem Elitebewusstsein und Aufbruchspathos, zunehmend kritisch und reformerisch in den Siebzigern, distanziert bis gleichgültig in den Achtzigern. Die Künstler – von Brecht bis Müller, von Hacks bis Wawerzinek, von Berlau bis Krug, von Thalbach bis Schlesinger – wollten nur eins: als Individuen existieren, unkontrolliert sie selber sein dürfen. Besonders in den zerfallenden Mietshäusern des Prenzlauer Berg in Berlin, aber auch in Leipzig, in Dresden-Loschwitz und in der Altstadt von Halle entwickelte sich eine subkulturelle Szene zwischen Distanz, Skepsis und Hedonismus. Jutta Voigt wird in diesem Meisterwerk zur Chronistin derer, die das richtige Leben suchten. Radikal, humorvoll, oft betrunken und immer leidenschaftlich. „Wo hört das Journalistische auf und fängt das Literarische an? Fließende Übergänge gibt es allenfalls bei den großen Namen wie Tucholsky, Kisch und Djuna Barnes – auf diese Empore gehört auch der Name Jutta Voigt.“ NDR „Ein Bohemien ist ein Mensch, der aus der großen Verzweiflung heraus, mit der Masse der Mitmenschen innerlich nie Fühlung gewinnen zu können, ... drauf losgeht ins Leben, mit dem Zufall experimentiert, mit dem Augenblick Fangball spielt und der allzeit gegenwärtigen Ewigkeit sich verschwistert.“ Erich Mühsam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Zwischen Distanz, Skepsis und Hedonismus: »Die Boheme des Ostens«.
Ein neues Meisterwerk der brillanten Feuilletonistin Jutta Voigt: Klug und unterhaltsam erzählt sie von der Sehnsucht nach einem anderen Leben in der DDR. Künstler, Bohemiens, am realexistierenden Sozialismus Gescheiterte – sie alle suchten das richtige Sein außerhalb der Kontrolle des falschen Systems.
Im Mittelpunkt des neuen Buches von Jutta Voigt steht eine Boheme, die ein elementares Interesse verfolgte: das andere Leben. In den frühen DDR-Jahren mit rebellischem Elitebewusstsein und Aufbruchspathos, zunehmend kritisch und reformerisch in den Siebzigern, distanziert bis gleichgültig in den Achtzigern. Die Künstler – von Brecht bis Müller, von Hacks bis Wawerzinek, von Berlau bis Krug, von Thalbach bis Schlesinger – wollten nur eins: als Individuen existieren, unkontrolliert sie selber sein dürfen. Besonders in den zerfallenden Mietshäusern des Prenzlauer Berg in Berlin, aber auch in Leipzig, in Dresden-Loschwitz und in der Altstadt von Halle entwickelte sich eine subkulturelle Szene zwischen Distanz, Skepsis und Hedonismus. Jutta Voigt wird in diesem Meisterwerk zur Chronistin derer, die das richtige Leben suchten. Radikal, humorvoll, oft betrunken und immer leidenschaftlich.
»Wo hört das Journalistische auf und fängt das Literarische an? Fließende Übergänge gibt es allenfalls bei den großen Namen wie Tucholsky, Kisch und Djuna Barnes – auf diese Empore gehört auch der Name Jutta Voigt.« NDR
»Ein Bohemien ist ein Mensch, der aus der großen Verzweiflung heraus, mit der Masse der Mitmenschen innerlich nie Fühlung gewinnen zu können, … drauf losgeht ins Leben, mit dem Zufall experimentiert, mit dem Augenblick Fangball spielt und der allzeit gegenwärtigen Ewigkeit sich verschwistert.« Erich Mühsam.
Jutta Voigt
Stierblutjahre
Die Boheme des Ostens
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Vorwort
Die Jedermann-Boheme
Die Kinder des Lampion
I. AUFBRUCH UND STOPP – DIE FÜNFZIGER UND SECHZIGER JAHRE
Die Spur der Boheme
Boheme und Beton
Wenn die Lichter leuchten in der Friedrichstadt
Gaul Geschichte, du hinkst!
Tür ins goldene Leben – das Pressecafé
Da sind wir Künstler komisch
Stierblutjahre – die Möwe
Zeitansagen
Zeitansage 1. Peter im Paradies
Zeitansage 2. Theas Trenchcoat
Zeitansage 3. Gigi über Leichtsinn und Liebe
Liebling, was haben die bloß gegen dein Stück?
Das volkseigene Lachen
Staub und Spiele
II. AUF DER SUCHE NACH DEM ANDEREN LEBEN – DIE SIEBZIGER UND ACHTZIGER JAHRE
SOS Boheme
Schaumbad vor dem Espresso
Die Liebe zu den Schlössern
Ein Schritt vor, zwei zurück
Der Kuss von Paris
Zeitansage 4. Trolles Turnschuhbande
Zeitansage 5. Krüger, Gipfelstürmer, Dadaist
Zeitansage 6. Bayer wollte ausschlafen
Der Glanz der Gullys
Unerhörte Vorfälle
Der Prenzlauer Berg war eine Haut
Stimmen aus alten Straßen,
Flucht in die Operette
Die Boheme war eine Braut auf Zeit
Der Weg aus der Ordnung
Das Wiener Café 1985 – schon vergessen?
Zeitansage 7. Katja Lange-Müller trinkt Cola
Zeitansage 8. Robert, Seelenkamerad
Zeitansage 9. OL guckt, wo keine Gardinen dran sind
Zeitansage 10. Papenfuß Rebell
Wilfriedes wahnsinnig weite Seele
Paradiesvögel
Nachspiel
Dank
Verwendete Literatur
Bildnachweis
Über Jutta Voigt
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Für Peter
Der Himmel bewahre euch vor den großen Haufen der Durchschnittsmenschen, vor denen (…), die kalten Herzens und kalten Verstandes sind, die weder rauchen noch trinken noch fluchen, die keiner kühnen Tat der Leidenschaft, der Liebe und des Hasses fähig sind, weil ihre schwachen Nerven nie den Stachel, das Feuer des Lebens spürten, dieses Feuer, das sie über alle Grenzen hinaustreibt und teuflisch und kühn macht.
Jack London
Vorwort
Es war einmal ein Land, in dem Lampen ohne Fransen und Kaffeetassen ohne Blümchen die Parteitage beschäftigten. Ein Land, in dem Filme, Opern und Tänze verboten wurden, weil sie ein paar alten Männern nicht gefielen. Ein Land, aus dem man nicht raus konnte, nicht nach Paris, nicht nach Venedig, auch nach Andalusien nicht. Können Sie sich vorstellen, dass es in diesem Land ein Leben gab, das leicht war und bunt, verzweifelt und verspielt zugleich – das Leben der Boheme?
Die Geschichte der Boheme des Ostens ist eine von Aufbruch und Enttäuschung, von Avantgarde und Gleichgültigkeit. Aber auch eine von der Lust des Spiels und der Macht des Übermuts. Spiel ist Freiheit, Übermut bedeutet Selbstbewusstsein. Es gab diese Boheme von Anfang an. Ihre Opposition über Jahrzehnte war das Anderssein, das andere Leben jenseits der Konformität, es war die Behauptung des Individuums, die Suche nach dem verlorenen Ich in einer Gesellschaft des wortbrüchigen Wir. Von dieser Suche wird erzählt, subjektiv, wie sonst. Entschwundene Orte, vergessene Namen, verblasste Leidenschaften – ich habe versucht, sie an unseren Tisch zu holen, bevor es kalt wird in Deutschland. Die Boheme des Ostens rauchte Kette und trank Rotwein, am liebsten Stierblut, das Beste, was es gab, Egri Bikavér aus Ungarn. Der Wein ist heute besser denn je, aber das wissen nur wenige. Kann sein, dass nicht alles so war, wie ich es beschreibe. Die Erinnerung vermischt Wirklichkeit und Traum, sie macht aus Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft einen einzigen Strom des Lebens, und zuweilen erbleicht sie vor ihrer eigenen Untreue.
Jutta Voigt, im Juli 2016
Die Jedermann-Boheme
Als der Kalte Krieg vorbei war und Mercedessterne auch am Himmel über Köpenick glitzerten, öffnete sich zwischen dem Müll von Mitte und dem Mythos von Prenzlauer Berg das Paradies – zwischen verlassenen Bunkern, Banken und leeren Wohnungen, deren offene Türen man nur aufzustoßen brauchte, um einzuziehen und sich einzurichten. Im Chaos der Verhältnisse erhob sich die Chance eines anderen Lebens auf einem klassenlosen, mauerfreien Terrain, wo der Technosound tobte und die Lebenslust. Veränderung war der Zustand der Stunde. Um auch die Gunst der Stunde zu nutzen, strömten junge Abenteurer aus Hamburg, Hannover, Wanne-Eickel, Leipzig, Dresden und Zwickau nach Berlin, genauer nach Ostberlin: Du bist so wunderbar, Berlin! Die Utopie eines einzigartigen, unverwechselbaren, freien Lebens raste auf historischem Boden, der niemandem gehörte als dieser hedonistischen Jugend, die sich unter dem weiten Mantel der Geschichte versammelte, sich berauschte an den ungeahnten Möglichkeiten einer fröhlichen Anarchie.
Ohne die jungen Wahnsinnigen aus Ostberlin hätte das alles nicht funktioniert, sagte eine Clubbetreiberin im Rückblick, das war nicht Deutschland, das war etwas anderes. Im Tresor, im Tacheles, im Eschloraque, im Oxymoron, in Hunderten stillgelegter Fabriketagen und Clubwohnungen zertanzte die Partyboheme die Engstirnigkeit der Provinz, die Spießigkeit der Eltern und die alltäglichen Forderungen des gewöhnlichen Kapitalismus: Geld verdienen, Pflicht erfüllen, Karriere machen. Hier und jetzt war jeder ein Künstler, ein Galerist, ein Designer, ein DJ, jeder war ein Bohemien in dieser schmutzigschönen Welt aus Einschusslöchern, Mauerresten und den Versprechungen eines anderen Lebens. Die Utopie war der Moment, in dem die Kinder der Katakomben glaubten, etwas Neuem entgegenzugehen. Das Gefühl einer unendlichen Freiheit, die morgen zu Ende sein könnte.
Die Jedermann-Boheme wuchs über sich hinaus, um nach ein paar Jahren, zurückgestutzt auf ihr angeborenes Maß, ein gewöhnliches Leben zu bevorzugen. Im Hintergrund des Undergrounds lauerte schon der Verrat, der Goldrausch. Während die einen bis zur nächsten Party weiterschliefen, waren andere, mit denen man nachts noch getanzt hatte, womöglich schon dabei, das Gebäude zu kaufen, in dem die Party stattgefunden hatte, so beschrieb es die Künstlerin Natascha Sadr Haghighian. Die Kinder des Kapitalismus trugen ein Gen in sich, das sich nach kurzer Irritation zurückmeldete – das Eigentumsgen.
Schöner grüner Mond von Mahagonny, leuchte uns/Denn wir haben heute hier/Unterm Hemde Geldpapier/Für ein großes Lachen deines/großen dummen Munds.
Bertolt Brecht
Die alten Ostbohemiens erreichte der lustige Lärm der Durchgangsboheme nicht mehr. Was die Jungen aus Ost und West da draußen trieben, ging sie nichts an, das Neue interessierte sie nur mäßig, sie träumten anders.
DER LAMPION, FOTO: RAINER AHRENDT
Die Kinder des Lampion
Sie lieben die schönsten und jüngsten Weiber, trinken die besten und ältesten Weine, und ihre Fenster sind nicht groß genug, um durch dieselben das Geld wegzuwerfen. Erst dann, wenn das letzte Fünffrankstück ausgegeben ist, kehren sie zur table d’hôte des Zufalls zurück, wo stets ein Plätzchen für sie gedeckt ist.
Henri Murger
Ein dünner kleiner Mann saß allein vor einem Glas Leitungswasser und redete vor sich hin, russisch. Seine Schwester, die in Amerika einen Rabbi geheiratet hatte, schickte ihm öfter ein paar Dollars. Irgendwas hatte den Dichter verwirrt, auf sensible Gemüter wirken gesellschaftliche Umwälzungen destruktiv. Einmal hatte er vom Telefon des Lokals die Polizei angerufen und behauptet, dass man ihm zwei Zeilen seines neuen Gedichts gestohlen habe. Die Polizisten erschienen und zogen ratlos wieder ab. Ein anderes Mal fuhr er mit dem Taxi vor sein Stammlokal und schickte den Fahrer rein, dass der sich vom Wirt das Taxigeld geben lassen sollte. Der zahlte tatsächlich. Als Wirt verhängte er Hausverbot über den Dichter, jeder konnte es auf einem Zettel über dem Tresen lesen; als Mensch bereitete ihm das Lokalverbot schlaflose Nächte, er wusste, wie unberechenbar das Leben sein konnte. Nach einer Woche hob er das Verbot für den einsamen Dichter wieder auf.
Der Ort, an dem sich das zutrug, existierte von 1991 bis 2003 in der Knaackstraße am Kollwitzplatz, die winzige Kneipe hieß Lampion. Der Lampion, die Resterampe der Ostboheme, ist Legende.
Das Künstlerlokal im Prenzlauer Berg war ein Refugium, das Licht am Ende des Tunnels, der Schimmer in der Finsternis des Nichtbescheidwissens. Dort trafen sich die per Revolution versprengten Reste der östlichen Boheme, sie suchten Schutz vor den Zumutungen der neuen Zeit, wo sie doch mit der alten noch nicht fertig waren. Steuererklärungen, Renten, Versicherungen, Bausparverträge, Dänische Bettenlager und Aktien; dazu die Befürchtung, die Miete nicht mehr bezahlen zu können – aus dieser absurden Fremdheit gab es einen Ausweg, der ein Eingang war. »Winzigkleines Wanderpuppentheater Lampion« stand an der Schaufensterscheibe.
Eine enge Treppe führte durch die mit Weinlaub berankte Tür in eine von Seidenlampions illuminierte Höhle. Der Tresen war klein und vollgestellt, ein Glas mit Soleiern stand da und eine Glasglocke für belegte Brote, dazu eine Vase mit Rosen und die gerahmten Porträtfotos verstorbener Stammgäste. Vier Barhocker – oder waren es drei –, irgendwo dazwischen war noch Platz für einen weiteren und ein Brett für drei Gläser. Da waren zwei Treppchen, die eine der Aufstieg zu einer Art Chambre séparée, die andere führte zur Werkstatt des Puppenspielers, wo sich drei lachende Ratten unter einer gelben Federboa versteckten. Begrenztes Territorium, jeder Zentimeter eine Plattform, an manchen Abenden vierzig Gäste auf fünfundzwanzig Quadratmetern, oder dreißig, lange her.
Ausgefallene Zeiten erfordern ausgefallene Entscheidungen. Der Puppenspieler hatte sich entschlossen, seine bescheidenen Räume der Geselligkeit zur Verfügung zu stellen, Trost zu spenden und Geborgenheit, kurz, eine Kneipe zu eröffnen für Freunde und Leidensgenossen, geteiltes Leid ist halbes Leid, Laufkundschaft kam selten auf die Resterampe der Boheme. Allerdings trieben regelmäßige Gewissenbisse regelmäßig Tränen der Reue in die blassblauen Augen des großen, blonden Menschenfreundes. Ich habe meine Puppen an den Kommerz verraten, ich bin doch kein Kapitalist, schluchzte er, goss sich Wodka nach und verstrickte sich in ungenaue Gespräche über Sieger und Verlierer.
Unausgesprochen beherrscht ein Bewusstsein moralischer Überlegenheit die meisten Dispute: Wer hier sitzt und redet, gibt damit zu erkennen, dass ihm all die entfremdeten, korrumpierenden Mechanismen der karrieristischen Angestellten-Existenz nichts anhaben können. Er behauptet sein Selbst in einem durchreflektierten Müßiggang.
Wolfgang Kil über den Lampion
Fünf Sambuca für die Loser! Flambiert!, dröhnte der Bariton des Architekten Pieper, ein melancholischer Sunnyboy mit einem Lachen, dem ein moderater Überbiss ein hohes Maß an Optimismus verlieh. Er trug Sakkos, die seiner Figur Fasson gaben, und benutzte gebügelte Stofftaschentücher, niemals Papiertücher. Ein Architekt, der jahrzehntelang mit Bauleitern trinken musste, um sie von Mann zu Mann zur Einhaltung von Terminen zu bewegen und ihnen zu demonstrieren, dass Bauleiter nicht weniger wert waren als Architekten. Seine Werke waren sämtlich der neuen Zeit zum Opfer gefallen. Das erste Chinarestaurant im Osten der Stadt – weg. Das Kaffeehaus am Alexanderplatz – weg. Das fast fertige Hotel in der Friedrichstraße, »ein Valutahotel mit allen Schikanen« – abgerissen. Und so weiter und so fort. Ein Talent wurde gedemütigt, war nicht persönlich gemeint, sorry. Nun baute er Einfamilienhäuser für Unternehmer, reine Erwerbstätigkeit. Da hat er doch lieber die Lampions für den Lampion entworfen. Fünf Sambuca für die Loser!, dröhnte er. Flambiert! Der vom Schicksal Gebeutelte tanzte im Trenchcoat, allein.
Jetzt wachen nur mehr Mond und Katz/Die Menschen alle schlafen schon/Da trottet übern Rathausplatz/Bert Brecht mit seinem Lampion, deklamierte währenddessen der Gelegenheitsdichter Plath: Ihr denkt, das ist von mir, aber das ist von Brecht; der wusste schon in seiner Augsburger Dachkammer, dass er mal so berühmt werden würde wie Goethe. Der umtriebige Plath in seiner prekären Existenz verkaufte Gedichte, das Stück für zehn Mark. Im Lampion fand er nicht viel Anklang, aber draußen vor den Cafés lief das Geschäft gut. So mancher Tourist wollte was mitnehmen von einem echten Prenzlauer-Berg-Dichter, wo es doch hier so aufregend subversiv zugegangen sein soll. Man sollte sehen, dass der Künstler sich neuerdings was leisten konnte. Er hatte seine Schuhe neu besohlen lassen. Man sah es, wenn seine Füße vom Barhocker baumelten; er wurde seitdem Ledersohle genannt.
Der Lampion erinnerte an die Höhlen von Achtjährigen, die eine Decke zwischen Tisch und Sessel spannen, eine Taschenlampe anknipsen und sich geborgen fühlen, ein Kinderzimmer. Der Wirt stand hinter dem winzigen Tresen wie hinter seinem Puppentheater, nur dass er zuweilen nicht mehr alle Fäden in der Hand hatte; die Kinder des Lampion machten, was sie wollten. Ein bislang unauffälliger Gast erschien eines Tages in einem langen weißen Büßerhemd, mit fanatischem Blick und einem Holzkreuz um den Hals. Das Kreuz hielt er dem Wirt unter die Nase und verlangte »ein großes Bier«. Als der ihm das Bier verweigerte, wurde der Heilige Geist böse: Willst du in der Hölle schmoren!, drohte er dem Wirt. Der gab ihm trotzdem kein Bier: Zahl erst mal deine Schulden, Harald, und zieh dir was Anständiges an, riet er dem ehemaligen Offsetdrucker, denn der Puppenspieler war ein Menschenfreund, seine Barmherzigkeit war irdisch.
Ach, Kinderchen, seufzte er, hatte Mitleid mit allen und jedem. Es fiel ihm schwer, die Verwirrten und Irritierten des Lokals zu verweisen. Ein kahlköpfiger Grafiker mit gelbem Schal und gelber Baskenmütze wurde lange geduldet. Doch dann vollführte der selbst ernannte Prometheus ungewisse, weit ins Nichts weisende meditative Bewegungen und hörte nicht auf, zu schreien: Wer die Sonne angreift, greift mich an. Er musste gehen, weil er so schrie im kleinen Lampion, und weil irgendwann alles rausgeschrien war und seine Mission erfüllt schien.
Winziger Lampion – Zufluchtsort für aus dem Nest gefallene Vögel, die niemals flügge hatten werden müssen. Die Welt war freier geworden und kälter, in märchenhaftem Leuchten sendete der Lampion seine Botschaft der verlorenen Illusionen. Der bunte Traum währte zwölf Jahre. Selbstironie und Selbstmitleid schaukelten sich gegenseitig hoch auf der Wippe der Verunsicherung. Kopfstehen konnte immer einer, auf dem Asphalt vor dem Lampion oder auf dem abgenutzten Holzboden drinnen. Die hierher kamen, Maler, Bildhauer, Dichter, Schauspieler, Filmregisseure und Journalisten, berühmte und nicht berühmte, waren in einem Alter, wo man sich vor Veränderungen fürchtet, selbst wenn sie einen positiven Verlauf versprechen. Sie hatten nie gelernt, sich selbst als Ware zu begreifen, sich zu verkaufen, nicht nur ihre Werke. Allein eine Keramikerin, oder war sie Malerin, jedenfalls eine Frau mit lockigem Haar, hatte was begriffen von der neuen Zeit. Sie arbeitete seit kurzem in einem nahegelegenen Bordell und plauderte ab und an mit dem Dramatiker Jochen Berg über ihre abwechslungsreiche Tätigkeit als Hure. Das hat was von Freiheit, meinte sie.
Sonnige Gemüter waren selten im Lampion. Der blonde Engel mit dem Holzbein, der die meiste Zeit des Jahres auf Hiddensee malte, oder Mozart, der Graffiti in U-Bahnen abwusch und die Welt außerhalb des Bahnwesens als absurdes Theater sah, waren Ausnahmen. Die meisten im Lampion sahen schwarz, wenn sie nicht blau waren, der Absturz war immer eine Option. Ich bin eine verkrachte Existenz, ich esse nur noch Tütensuppen von Knorr, nuschelte Mühle, der keine Zähne hatte und erhebliche Gleichgewichtsstörungen, dafür ein heiteres Naturell und einen einfallsreichen Geist. Seine Gehschwankungen kämen nicht vom Alkohol, sondern von einer Kriegsverletzung, erzählte er gelegentlich und gab die Silberplatte an seinem Kopf zum Betasten frei; natürlich war er Flieger, die Alten waren alle Flieger gewesen im Krieg. Der Zeichner und Messestandbauer Kurt Mühle war klein und schmal, sein dünnes, dunkles Haar hatte er zu einer Art Brechtschnitt nach vorn gekämmt, die wachen schwarzen Augen blickten aus einem verwelkten Kindergesicht, zerknittert wie sein silbergraues Sakko, unter dem stets ein frisches, blütenweißes Hemd strahlte. Er hatte keine Feinde, es fand sich immer jemand, der ihn nach Hause brachte, damit er nicht fiel auf dem Weg, und es fanden sich immer Frauen, die sich wünschten, dass Mühle sie nackt zeichnete, oder jedenfalls nichts dagegen hatten. Zum siebzigsten Geburtstag schenkten ihm seine Gläubiger ein Fest im Palais der Kulturbrauerei, der Jubilar präsidierte auf einem eigens für ihn gebauten goldenen Thron.
Als Mühle starb, hinterließ er nichts, kein Geld, kein Werk, keine Angehörigen. Der Lebenskünstler und Stierblut-Trinker wäre still ins Armengrab gesunken, hätte er nicht doch etwas hinterlassen – eine Menge Freunde. Die konnten es sich nicht antun, dass da einer ihrer Art sang- und klanglos von dieser Welt verschwindet. Ganz im Gegenteil – mit Glanz und Gloria begruben sie den kleinen schiefen Mühle auf dem berühmtesten Friedhof der Stadt, dem Dorotheenstädtischen in der Chausseestraße, gleich neben Brechts Wohnhaus. In drei Kneipen zwischen Schönhauser Allee und Wasserturm war Geld gesammelt worden, fünftausend Mark für Mühles Grab. Seine Lebensgefährtin, die er »die Chinesin« nannte, weil sie Sinologie studiert hatte, führte zusammen mit dem Puppenspieler das Beerdigungskomitee an. Die Frauen, die er aktgezeichnet hatte mit Sepia, Rotwein oder Tee, legten Sonnenblumen auf den Weg zum Grab. Die Klezmer-Kuzinen machten diese Musik, die einem fröhlich das Herz zerreißt, um es in Trauer wieder zusammenzufiedeln. Wie ein schwarzer Schmetterling war der Senior der Ostberliner Boheme durch sein zweckfreies Leben geflogen, er hatte sich immer da niedergelassen, wo es gesellig zu werden versprach. Welchen Nerv hat er getroffen, der kleine Sachse, der nichts vom Leben wollte als leben.
Das wäre zeitlebens ein guter Witz gewesen: Mühle auf dem Dorotheenstädtischen, dem Olymp der Berliner Elite. So ist es gekommen, genau so. Schinkel und Schadow ruhen da, Brecht und Heiner Müller auch. Nun liegt Mühle neben Ruth Berlau, jener Frau aus Skandinavien, die Brecht verzweifelt hörig war und irgendwann in einem Klinikbett der Charité verbrannte. Und seit Mühle neben Ruth Berlau gebettet ist, berichtet er ihr, dass die DDR untergegangen ist, berichtet es ihr immer wieder, wie die Toten tun, und wird von ihr wütend als Lügner beschimpft, jedes Mal, denn für die Dänin war die DDR die Wahlheimat gewesen. Lügner! Nazi! Und Mühle nuschelt in deutlich sächsischem Idiom zu ihr rüber: Nimms nich so schwer, Kleene!
Da sitzen sie – die Bohemiens und die sich dafür halten. Was sie tun? Sie trinken schwarzen Kaffee oder auch Absinth, rauchen Zigaretten, reden über Ästhetik und Weiber, stellen neue Lehren auf und paradoxe Behauptungen, schimpfen über den Staat und die Banausen, pumpen sich gegenseitig an und bleiben die Zeche schuldig.
Erich Mühsam
Sie saßen da wie Kinder, die nach einem Laternenfest nicht nach Hause gefunden haben. Saßen im milden Licht der Lampions, trugen olivgrüne Jacken mit vielen Taschen, längere Haare, manchmal eine Baskenmütze. Frauen in dekolletierten T-Shirts und Lederjacken machten, obwohl nicht mehr jung, einen mädchenhaften Eindruck; wie Weichzeichner legte sich der milde Schein der karmesinroten Lampions auf ihre Gesichter. Eine Zigarette in Mundwinkel oder Hand hatten die Männer alle, natürlich, sie lebten ja noch in der Zigarettenzeit, der blauen Epoche, als das Rauchen noch als Symbol verwegener Männlichkeit galt, Requisit einer Heldeninszenierung – ein Mann ohne Zigarette war kein Mann.
Gefallen Ihnen rauchende Männer?, fragte Madleen zwanzig Jahre später, in den Zeiten der Askese, die durchtrainierte junge Serviererin in einem Nichtrauchercafé am Kollwitzplatz. Ab und an gefällt mir so ein Cowboy schon, sagte die Rothaarige sinnend, als habe sie den blauen Dunst der tödlichen Romantik und den dazugehörigen Mann direkt vor Augen.
Die Geduld der Lampion-Frauen war grenzenlos. Erotische Unverschämtheiten, von enthemmten Männern feucht ins Ohr geflüstert, nahmen sie hin und lächelten resigniert, sie fühlten sich überlegen. Conny Brinkmann übertraf die Männer an Drastik und spielte ihnen eine Marilyn Monroe volkseigener Provenienz vor, eine Marilyn aus Eisenhüttenstadt, ihr tanzender blonder Körper war ein Sonnenaufgang in der Nacht.
Madleen, in mittlerem Alter und von mittlerer Schönheit, bei einer Zeitung angestellt, genauer gesagt bei einer nach der anderen, so waren die Zeiten, Madleen tauchte in den Lampion ein wie in einen Mutterleib, in dem es keine Pflichten gab, keine Verantwortung und keine Deadline. Sie war froh, dass sie ihr ramponiertes Make-up nicht aufzufrischen brauchte, bevor sie aus der Redaktion in den Lampion aufbrach, denn das Licht im Lokal war nachsichtig wie ein Mond, der sich gesonnt hatte. Die neue Zeit machte Madleen keine sonderlichen Probleme, sie arbeitete wie bisher, gesamtdeutsch nun. Die Streitereien mit den Kollegen aus dem Westen machten Spaß, wenn zu Spaß auch Wut gehört. Die Kneipen ihrer Gegend hatten sich verzehnfacht, der Wein war besser denn je, der gute alte Stierblut Vergangenheit. Der Prenzlauer Berg bot jetzt fast so viel Weltläufigkeit wie Saint-Germain-des-Prés, jedenfalls solange das Chaos nicht aufgebraucht war.
Madleen hatte ihre erste Buchpremiere im Lampion gefeiert, mit Ostfreunden und Westverleger, ihre Tochter hatte Summertime gesungen. Manfred Krug riet der blutjungen Sängerin, sie solle erst mal eins zu eins singen, bevor sie improvisiere. Ich singe nicht eins zu eins, hatte die blutjunge Sängerin empört geantwortet, ich singe, wie ich singe. Madleen hatte sich nicht getraut, selber aus ihrem Buch vorzulesen, und den Architekten Pieper gebeten, es für sie zu tun, schließlich hatte er mal Schauspieler werden wollen. Er verfügte über eine tragende Stimme und boxte im Verein mit dem Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase, dem Schauspieler Eberhard Esche und zwei ausgebufften Profis, er hatte Madleen in die Welt des Boxens eingeführt. Nun stand er auf der Treppe zur Puppenspielerwerkstatt und las ihren Text vor: »Einfache Männer mit einfachen Gesichtern und einfachen Worten hatten sich im Plaza-Hotel getroffen. Mit ihren runden Köpfen, ihren bulligen Körpern und den breiten Nasen ähnelten sie einander …« Irgendwie passte Boxen zur Zeit. Lucky Punch!
Gegen halb eins erschien Hassan aus dem Morgenland in der Tür, mit roten Rosen, Eintagsschöne, die keine Stunde länger lebten als bis zum nächsten Morgen. Alle für zwanzig!, bot der dunkle Mann in der Tür und hielt seine Ware hoch. Er hatte Glück, ein Fotograf aus Hannover kaufte alle und schenkte sie einem rothaarigen Mädchen: Für dich, Maria! Große Gesten kamen häufig vor im Lampion. Ein paar Wochen zuvor war Hassan von Skinheads zusammengeschlagen worden; sie hatten ihm sechzig Rosen und alles Geld weggenommen, das er verdient hatte.
Die meisten hier waren zwischen vierzig und fünfzig, eine Generation, die in den sechziger Jahren einen Aufbruch erlebt hatte, da waren sie zwanzig gewesen und hatten an das Neue geglaubt, an die Gleichheit aller Menschen. Vorbei, ihr Verstand hatte verstanden, ihre Seelen hatten Risse. Thomas Leinkauf von der Berliner Zeitung sang zur Gitarre »Bella ciao« und »Avanti popolo«, manche summten mit, bandiera rossa trionfera. Ach, Kinderchen, seufzte der Wirt, was soll bloß aus uns werden!
Nach langen Lampionnächten packte er am nächsten Morgen seine Puppen in den Kleinbus, fuhr nach Frankfurt an der Oder und nach Ilsenburg und spielte das Märchen von den Wölfen und den unschuldigen Kindern. Er klatschte in die Hände, hielt den Kopf schräg und richtete den Blick nach oben. Ach, Kinderchen, das klang wie die Jesusworte Lasset die Kindlein zu mir kommen, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Der traurige Wirt, dessen Augen aussahen wie überlaufende Brandenburgische Seen, goss Pinot Grigio in große Gläser und jonglierte die beladenen Tabletts durch das Lokal mit den voll besetzten Treppchen. Dreh lauter, Klaus!, kreischte die Kaufhallenkassiererin, die Sängerin werden wollte, was umso unwahrscheinlicher schien, je länger sie mitsang: An jenem Tag, mein Freund, da haben wir gemeint, die Welt bleibt stehn allein nur für uns zwei. Wenn es zu schwermütig werden sollte, wir haben russischen Wodka im Angebot, rief der Puppenspieler, und wir haben die guten Soleier; seine Kinderchen sollten essen, damit sie den Wein, das Bier und den Schnaps vertrugen. Auch Thüringer Kümmelkartoffeln auf dem Blech trug er zu den Tischen: Ihr müsst sie heiß essen!
Hans-Otto Schmidt hatte gerade seine Prenzlauer-Berg-Bilder unter dem Titel »Traum vom Fliegen« in einer Galerie am Savignyplatz ausgestellt. Die grauen Häuserzeilen mit den roten Dächern, die stillen Straßen und stummen Fenster, diese seltsame Sinfonie aus Schiefergrau, Morgenrot und Neapelgelb. Schmidt hatte in der feinen Galerie gestanden wie ein Bauer auf fremdem Feld, das er dennoch zu beackern verstand. Er hatte gut verkauft, der Prenzlauer Berg war damals noch ein Mythos, ein Ort des Begehrens, sein Stern leuchtete noch. Der Nimbus aus Rebellion und Verstrickung, Patina und Aufbruch, verlebten Fassaden und verrückten Gedichten war noch nicht ausgereizt. Nichts aber, schwärmte der Maler spätabends auf der Treppe zum Chambre séparée, nichts sei so schön wie auf einer Jawa durch die von Lindenbäumen bestäubten Straßen der Uckermark zu rasen und auf die Musik des Motors zu hören. Dann tanzte Schmidt, Männer tanzten öfter allein im Lampion. Zimmertheater für Charakterdarsteller, Rückzugsort der Heimatlosen. Wenn man in den Lampion ging, wusste man, was einen erwartete, nichts Fremdes, nichts Unbekanntes, nichts Überraschendes. Vertrautes war gefragt, Gewohntes, Laufkundschaft war selten. Die Lampionisten sahen jede Veränderung mit Skepsis.
Jenni hat ’ne Braut im »Lampi«/Die hat’s hintern Ohren dick/Trabt ’n Kerl vorbei mit Hengstblick/Hat sie schon mal Zeit für’n Ritt. So heißt es in »Als ob nichts gewesen wär« von Renft. Frühling‚ Sommer‚ Herbst und Winter/Mancher lacht schon lang nicht mehr/Lachend aber sind wir Kinder/Als ob nichts gewesen wär. Lampi war der Kosename für den Lampion, Jenni der für Klaus Renft, den alten Rocker.
Ach, die Mädchen!, rief Renft, als Madleen mit ihrer Kollegin Fritzi den Lampion betrat. Er saß mit seinen wetterfesten Gesellen am runden Tisch auf der Empore. Als sie angefangen hatten, ihre Musik zu machen, das war in den Sechzigern, waren sie die sächsischen Rolling Stones gewesen. Bei den Konzerten kreisten die Stierblutflaschen und nach den Gigs die Groupies, erzählte Renft, es sei das wildeste Leben gewesen, das man sich vorstellen kann, die Mädchen sollen sich die Kleider vom Leib gerissen haben vor Entzücken. Einmal spielte die Renft-Combo im Lampion. Unter anderen ein Lied aus alten Zeiten, das »Gänselieschen«, arglos und zärtlich: Unsre LPG hat hundert Gänse/und ein Gänselieschen, das ist meins./Jeden Morgen ziehn sie auf die Wiese/hundert Gänse und die Hunderteins.
Ach, die Mädchen, hat Renft gerufen? Nicht doch, ach, die Medien! hatte der Nuschelsachse gerufen, man musste nur genau hinhören. Fritzi erinnert sich noch heute daran, dass Klaus Renft sie am nächsten Vormittag in der Redaktion anrief: Du hast mir mein Herz gestohlen. Er soll es ganz ernst gesagt haben, die Kollegin war sprachlos und hörte tagelang Renft-Songs.
Ein Bohemien ist ein Mensch, der aus der großen Verzweiflung heraus, mit der Masse der Mitmenschen innerlich nie Fühlung gewinnen zu können, … drauf losgeht ins Leben, mit dem Zufall experimentiert, mit dem Augenblick Fangball spielt und der allzeit gegenwärtigen Ewigkeit sich verschwistert.
Erich Mühsam
Gegen elf kam der Bohemien an und für sich und bestellte einen Kaffee schwarz. So sehen Genies aus, sie stottern, tragen ausgeblichene Jacketts und leben so vor sich hin. Er sah aus wie ein zerzauster Wissenschaftler, Insektenforscher hatte er mal werden wollen. Monatelang trug er das selbe Cordsakko, den selben Pullover vermutlich auch, seine Schuhe zeigten langjährige Gebrauchsspuren. Abends fuhr er mit dem Fahrrad die Cafés des Viertels ab, der Lampion war eine Station unter anderen. Er trank nie Alkohol, das hatte er hinter sich, ein für alle Mal, den letzten Nordhäuser Doppelkorn trank er am Theater in Anklam, bei Castorf damals. Der Bohemien an und für sich kam immer erst am späten Abend. Sein Tisch sah nach zwanzig Minuten aus, als wäre er schon Stunden hier, nasse Teebeutel, leere Kaffeetassen, Zigarettenschachteln, Kippen, Aspirin, manchmal das Schachbrett.
Er schrieb seit vielen Jahren an seinen Geschichten über die fünfziger Jahre, »Briefe an Onkel Karl«, einfach so, ohne Verlag, ohne Vertrag, denn von Terminen bekam er Kopfschmerzen. Als Harmoniumspieler auf Begräbnissen verdiente er eine Zeitlang richtig gut. Einmal einen Termin nicht eingehalten, schon war der Job weg. Er war um sechs Uhr früh aus dem Café gekommen, hatte den Wecker auf viertel neun gestellt und geträumt, dass er im Schauspielhaus neben einer schönen Frau mit übereinandergeschlagenen Beinen sitzt und eine Zigarette raucht. Mittags halb eins ist er aufgewacht, da waren alle Totenmessen gelesen.
Ich bin wie eine Luftblase im Wasser, die den Gegenständen ausweicht, die auf sie zukommen, bemerkte der Bohemien an und für sich, während er seinen vierten Kaffee trank. Wenn die Sonne scheint oder das Bassin bunt ist, dann schillert sie, die Luftblase. Er fühle sich von Terminen nicht nur gestört, sondern der Freiheit beraubt, er hasse Termine. Und Reisen. Trotzdem hatte er sich an diesem Abend für eine Fahrt nach Holland verabredet. Als er seinen Bekannten wartend am Tresen stehen sah, dachte er plötzlich: Mensch, die ganze Nacht durchfahren und dann in Holland müde sein. Wenn du hierbleibst, kannst du morgen bis zwölf ausschlafen, schön gemütlich wach werden, Zigarre rauchen und ein bisschen lesen. Er könne leider doch nicht mitfahren, teilte er seinem Reisegefährten kurz entschlossen mit, er müsse nach Hause, weil er seine Socken eingeweicht habe. Ich verreise niemals, sagte er, höchstens auf dem Notenblatt, da fühle ich mich wie ein Fernfahrer, der durch eine fremde Kleinstadt fährt, jede Note sehe ich als Fußgänger, die Akkorde als Fußgängergruppen; wenn Schwierigkeiten auftauchen, spiele ich langsamer.
Auf der Fensterbank saßen drei Polen. Conny wollte, dass sie die Warszawianka singen, sie bot drei Flaschen Wodka, für jeden eine. Niemals, sagte der erste Pole, Sozialismus Scheiße, sagte der zweite, scheene Frisur, sagte der dritte und lächelte Conny an. Madleen unterhielt sich weiter mit dem Bohemien an und für sich, sie bewunderte ihn für etwas sehr Spezielles: Er redete, obwohl er stotterte, ganz ohne Redundanz. Sie schätzte diese Eigenschaft ungemein, denn als Redakteurin schlug sie sich ihr Leben lang mit Autoren herum, deren Texte aus nichts als Redundanz bestanden. Du musst unbedingt einen Roman schreiben, ich weiß auch schon den Titel: »Der Stotterer«, sagte Madleen zum Bohemien an und für sich. Der winkte ab: Da müsste ich ja Termine einhalten. Er gehe jetzt nach Hause und lese weiter in der Schiller-Biographie, Schiller sei reinigend wie Wofasept, wie eine Seuchenmatte vor dem Schmutz der Zeit. Madleen erzählte einer Lektorin von Schönfelds Talent und fügte hinzu: Er ist leider ein bisschen unzuverlässig. Und ich habe dafür leider keine Zeit, sagte die Lektorin, es reicht schon, dass er stottert, das allein schon dauert zu lange.
Ich fühle mich gedemütigt durch meine eigene Gegenwart, schrie Graf Kiedorf ins Lokal, er erwartete ein Echo und bekam es. Wenn nüscht mehr übrigbleibt, kannste nur noch angeben, lallte sein Tresenkumpan Max Stock, dessen Bilder in den Landhäusern seiner Gläubiger hingen. Mann, bin ich eine monumentale Persönlichkeit! – Kiedorfs Stimme klang herrisch auf Gutsbesitzerart. Er schnallte seinen rotbraunen, schmalschultrigen Lackledermantel auf – ich knarre wie ein Damensattel – und stampfte mit seinem silbernen Gehstock, von dem er behauptete, dass er aus dem Besitz des Großfürsten Esterházy sei, des Gönners von Ludwig van Beethoven. Bring Wodka, Dewuschka!, befahl er dem Puppenspieler. Dann erklärte er seine Tischgenossen, zwei stille Herren aus Lübeck, zu seinen Leibeigenen. Einen nannte er Wanja, den anderen Akaki Akakijewitsch. Küss mir die Hand, Bursche!, verlangte er donnernd.
Sie haben alle gespielt, die einen mehr, die anderen weniger. Manche waren still. Wie der Bildhauer, dessen Blicke eine zentrale Botschaft sendeten: Lasst mich in Ruhe! Seine ganze Ausdruckskraft hat er an die Formung seiner Figuren verschwendet, ohne Scheu vor Harmonie. Seine Plastiken sind unverschämt schön, entrückt, vollendet im Sinne von Kolbe und Lehmbruck, da darf man verstummen. Der Bildhauer war andererseits so vorausschauend, zusammen mit seinen Mitbewohnern zur rechten Zeit in der neuen Zeit das Mietshaus zu kaufen, in dem sie alle wohnten. »Dieses Haus kaufen wir« stand auf einem weißen Tuch über der Haustür. Dreiundzwanzig eindeutig dem Musischen zugeneigte Gestalten hatten sich zu diesem Zweck mit einem silbernen Fotokoffer, in dem zweihunderttausend D-Mark Anzahlung gestapelt waren, vom Prenzlauer Berg aus zu einer Bankfiliale am Kurfürstendamm begeben. Der Sinn für das Schöne und der für das Praktische müssen einander nicht ausschließen.
Übrigens: Wenn die Schauspielerin mit der Tänzerinnenfrisur auftauchte, guckte der Bildhauer freundlicher. Das gab sich schnell wieder, denn die Schauspielerin verließ öfter den Lampion, als wäre ein Feuer ausgebrochen, jemand war gegangen, dem sie dringend nachgehen musste, ihre Handtasche ließ sie zurück. Als sie nach zwei Stunden wiederkam, lag die Handtasche samt Portemonnaie und Gage noch am selben Platz, die Schauspielerin hatte es nicht anders erwartet. Und wenn – sie hätte dem, der gegangen war, um jeden Preis folgen müssen –, was ist ein Blick gegen eine Handtasche, was eine Eingebung gegen fünfhundert Westmark.
Ich komme gerade aus Griechenland – die leise Stimme von Peter Fritz, dem Landschaftsmaler. Madleen hatte ihm vor etlichen Jahren Modell gesessen, zusammen mit ihrer besten Freundin, vor einer Landschaft mit Sonnenuntergang. Es war ein Abschiedsbild in Öl, ein Auftragswerk, die Freundin ging in den Westen, Madleen, die Zurückgebliebene, hängte sich das Ölgemälde ins Wohnzimmer, als Erinnerung. Der Landschaftsmaler trug stets einen gefüllten Einkaufsbeutel bei sich, wenn er den Lampion betrat. Er hatte eine Frau, die aus Gründen der friedlichen Revolution zeitweilig in der Politik aktiv gewesen war und aus diesem Grund keine Zeit zum Einkaufen hatte. Er war der neuen Zeit zunächst sehr zugetan gewesen, später relativierte sich das, er hatte dann auch eine andere Frau. In Griechenland ist alles ganz anders, sagte er träumerisch.
G., der einsame Wassertrinker, saß nicht mehr allein. Anja war bei ihm, die dunkelhaarige Chorsängerin, hübsch und traurig, sie erzählte ihm von ihren Enttäuschungen in der Liebe. Sie wusste nicht, dass G. bald sterben und dass der Puppenspieler sein gerahmtes Porträt zu den anderen Toten an die Wand neben dem Tresen hängen würde, dass dieser verwirrte kranke Mensch, den die meisten für ein armes Schwein gehalten hatten, ein subtiler Stasivernehmer gewesen war. »Einer von uns«; er wusste, wie die Seinen dachten und wie man mit ihnen reden musste, damit sie einen Freund verrieten, denn er war ja mal einer von ihnen gewesen. Lange nach seinem Tod hatte Madleen die Vernehmungsprotokolle von Jürgen Fuchs gelesen, in denen der inhaftierte Schriftsteller mit literarischer Kraft über einen seiner Stasivernehmer schrieb, Vernehmer Nummer V. Der fahrige kleine Intellektuelle, das künstlerisch angehauchte Funktionärskind kommunistischen Glaubens, wird dort mit seinem Namen genannt. Letztendlich war er tatsächlich ein armes Schwein, das, als alles vorbei war, inmitten seiner arglosen Freunde apathisch vor einem Glas Leitungswasser saß.
Heute Abend hatte er eine Aufgabe, er tröstete die Choristin: Du musst nicht traurig sein, Lilja, Ossip liebt dich, auch wenn er dich nicht begehrt. Du hast doch noch Wolodja, der liebt dich mehr als sein Leben, der große Majakowski. »Von der Schnute bis zur Rute, dein Kläff«. Hat er dir doch geschrieben, Lilja! Er verlor sich ins Russische, und die Choristin blieb allein mit ihrem Kummer. Ich heiße nicht Lilja, und Majakowski ist tot, murmelte sie und setzte sich woanders hin.
Scholle und Dorsch trinken forsch. Und der Aal säuft anormal. Und zwei fetten alten Quallen kann das alles nicht gefallen – Wawerzinek machte das oberste Treppchen zur Bühne und dichtete Stegreif: Scholle und Dorsch trinken forsch. Und der Aal säuft anormal. Und zwei fetten alten Quallen kann das alles nicht gefallen. Er bellte das Ganze fünf Mal in den Schankraum, man könne es bis zu dreizehn Mal wiederholen, drohte das nach Anerkennung süchtige Naturtalent. Die Sängerin sah ihm begeistert zu. An jenem Abend, irgendwann in den Neunzigern, wusste der in der Prenzlauer-Berg-Szene als Schappy bekannte Performance-Dichter noch nicht, dass in Erfüllung gehen würde, was er sich so sehnlich wünschte. Er wusste nicht, dass er in zwanzig Jahren berühmt sein würde, ein richtiger Schriftsteller, Boheme heißt auch Sehnsucht. Im November 2014 steht in der Zeitung, dass der preisgekrönte Autor Peter Wawerzinek ab sofort in einem Glaspavillon neben der Volksbühne sitzt und schreibt, denn der Künstler wolle sich nicht weiter in seiner Schreibbude verkriechen, sondern »bei der Arbeit genauso sichtbar sein wie ein Busfahrer«. Das klingt verdammt nach Bitterfelder Weg: Greif zur Feder, Kumpel!
Mancher Lampiongast war in seinem früheren Leben regelmäßig ins Wiener Café in der Schönhauser Allee gegangen, auch Graf Kiedorf. Damals liebte er Victoria, konnte aber den Alkohol nicht lassen und die Frauen auch nicht. Victoria war eine Schulfreundin von Madleen gewesen, sie hatten sich nach vielen Jahren in der S-Bahn getroffen, und Victoria erzählte ihr mit strahlenden Augen, dass sie jetzt mit Kiedorf zusammen sei, worüber sich Madleen gewundert hatte. Einmal saß Manfred Kiedorf im Wiener Café und weinte, weil Victoria ihm, als er wie so oft zu spät und zu betrunken nach Hause kam, kalt ihren nackten Rücken zugedreht hatte. Madleen reichte ihm, großzügige Geste in Zeiten der Mangelwirtschaft, ein Tempotaschentuch, und er revanchierte sich mit einer Zeichnung.
Damals hätte keiner gedacht, dass dieser Kiedorf eines Tages ein bedeutendes Lebenswerk vorlegen würde, denn die meisten hielten ihn für einen Nichtsnutz. Dass er schon damals, gemeinsam mit seinem Jugendfreund Gerhard Bätz, ganze Königreiche en miniature entwarf und mit Pinzette und Lupe aus Pappe, Papier und Draht die Kleinststaaten Dyonien und Pelarien schuf, die Schlösser Pyrenz und Perenz sowie einen Hofstaat mit klitzekleinen Prinzessinnen, Hofdichtern, Königen, Soldaten und Barbieren, Rokoko im Maßstab eins zu fünfzig – das hätte keiner bei Kiedorf vermutet.
Am Anfang war das Spiel. »Prunk« nannten die zwei Dekorateur-Lehrlinge aus der Spielzeugstadt Sonneberg ihr Werk, das sie unter der Schulbank begonnen hatten, mit Halmasteinen, die irgendwann ganze Armeen bildeten. Dass sich zwei Provinzjünglinge von sehr unterschiedlicher Körperlänge so eine großartige Kleinigkeit ausdenken und ein halbes Jahrhundert lang mit Leidenschaft daran arbeiten, ohne einen Pfennig damit zu verdienen, damit rechnete niemand. Mitten im Arbeiter-und-Bauern-Staat eine Monarchie zu erschaffen, zwei Fürstentümer zu gründen, ist schon unerhört, eine freche, verspielte Unterwanderung der herrschenden Verhältnisse. Bekannt wurden die beiden Monarchisten natürlich erst nach dem Abgang des Arbeiter-und-Bauern-Staates: Die hätten uns für verrückt erklärt, wenn rausgekommen wäre, was wir da machen. Nach der Jahrtausendwende kaufte die Heidecksburg in Rudolstadt die winzigen Königreiche an, Hunderttausende haben sie gesehen; eine Kneipe in Rudolstadt heißt jetzt »Kiedorf«. Zudem wurde Graf Kiedorf zum Ritter geschlagen: Ich war ein Nichtsnutz, jetzt bin ich Chevalier. Der Vorteil des Ritterkreuzes – man kann mich angemessen aufbahren, man möchte schließlich auch als Leiche was darstellen, sagte er.
Hallo Max, was machst du denn hier? Gestern führte ich die ganze Nacht Selbstgespräche, da konnte ich wieder nicht einschlafen, antwortete Max, der Maler. Deine Selbstgespräche sind gebührenpflichtig, beschied Kiedorf. Als Schöpfer ist man ja Gott, fuhr er fort, mein Reich ist der Planet Centus, der zehnte Planet, es ist ein wunderbares Gefühl, Gott zu spielen. Horst Sagert war gestern hier, da warst du nicht da, teilte ihm sein Tresenfreund Max unvermittelt mit, der Sagert saß oben auf der Treppe, ich habe mich ihm zu Füßen gesetzt und zu ihm aufgeschaut. Der Sagert ist ein Genie, das sage ich dir, hast du damals seinen Urfaust gesehen, da hat er nicht nur Bühnenbild und Kostüme gemacht, da hat er auch Regie geführt. Weißte, was er geantwortet hat, als ihn einer nach seinem Beruf fragte? Ich bin von Beruf Sagert, Horst Sagert, hat er gesagt. Dazu fiel Kiedorf nichts ein als: Ich will in meiner Schrankwand beerdigt werden, das wäre mein größtes Glück.