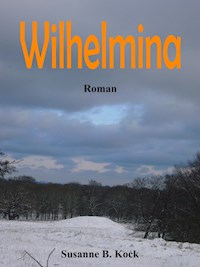
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Marthe nach dem plötzlichen Tod ihrer wohlhabenden Tante Wilhelmina deren herrschaftliche Villa in Kopenhagen erbt, glaubt sie damit, ihre finanziellen Probleme ein für alle Mal gelöst zu haben. Doch das Erbe, das in Marthes Phantasie bereits die solide Grundlage für eine sorgenfreie Zukunft bildet, erweist sich bei näherem Hinsehen als ein sehr viel aufwändigeres und vielschichtigeres Projekt als sie sich vorgestellt hat. Marthe erkennt schnell, dass das alte Haus Überraschungen bereithält, die über eine unerwartet kostenträchtige Renovierung weit hinausgehen. Beim Lesen ihrer Tagebücher entdeckt Marthe das fürchterliche Geheimnis ihrer Tante, die sich trotz harter Zeiten in Kriegs- und Nachkriegszeit nicht hat unterkriegen lassen und selbst die schwersten Schicksalsschläge äußerlich unbeschadet bewältigt hat. Während Marthe sich, hilfreich unterstützt vom ebenso loyalen wie charmanten Anwalt ihrer Tante, durch den zähen Prozess von Renovierung und Hausverkauf hindurchkämpft, räumt sie dabei nicht nur im Nachlass ihrer Tante auf, sondern schafft es gleichzeitig, in ihrem eigenen, chaotischen Gefühlsleben eine lange überfällige Entscheidung zu treffen, die ihr endlich den Weg in eine selbst bestimmte Zukunft ermöglicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne B. Kock
Wilhelmina
Roman
Imprint
Susanne B. Kock Wilhelmina
Copyright: © 2017 Susanne Kock published by: epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de
Coverdesign & Konvertierung: Sabine Abels | www.e-book-erstellung.de
1.
Die Luft im Abteil war stickig geworden. Wilhelmina legte ihr Buch zur Seite und erhob sich, um das Fenster einen Spalt zu öffnen. Sie blickte auf die schlafende Gestalt des jungen Mannes in der Ecke der Sitzbank. Der leicht zurückgebeugte Kopf war an die Polsterung gelehnt, die linke Schulter hochgezogen als fröstele er. Das kurz geschnittene dunkelblonde Haar sah aus als hätte eine Windböe es aufgeplustert und die kräftigen, braungebrannten Hände lagen seltsam leblos mit halb nach außen gekehrten Handflächen auf dem Sitz. Seine breite Brust hob und senkte sich regelmäßig und ab und zu gab er einen Laut von sich, der wie ein stiller Seufzer klang. Sie besann sich eines Besseren und beschloss, auf dem Gang etwas frische Luft zu schöpfen. Vorsichtig zog sie die schwere Abteiltür hinter sich zu, die willig und lautlos auf der Messingschiene glitt und mit einem leise klickenden Geräusch ins Schloss fiel. „Jetzt bloß nicht Gerhard wecken“, dachte sie, dann wäre es vorbei mit dem ungestörten Träumen, dem planlosen Blättern im illustrierten Reiseführer. Sie lehnte sich aus dem offenen Fenster, blickte auf die vorbeiziehende Landschaft und sog mit einem tiefen Atemzug die mit dem Duft von frisch gemähtem Gras gewürzte Abendluft ein. Zwei alte Männer in speckig glänzenden Lederhosen und groben Hemden, die runzeligen nussbraunen Gesichter halb unter einem tief in die Stirn gezogenen Filzhut versteckt, traten in ein Gespräch vertieft mit geschulterten Sensen aus einem Waldstück hervor und überquerten mit federnden Schritten die Wiese in Richtung Dorf. Wilhelmina sandte ihnen einen sehnsüchtigen Blick. Ihr Rücken schmerzte vom langen Sitzen, die Füße in den eleganten Pumps waren geschwollen und fühlten sich an als hätte sie Gewichte um die Fesseln gebunden. Am liebsten wäre sie einfach hier im Dorf ausgestiegen und auf Gutdünken herumgewandert. Hätte sich die Häuser mit den bunten Wandmalereien angeschaut, wäre barfuss über die blumenübersäten Bergwiesen gewandert und irgendwo in einen der einladend glitzernden Seen gesprungen, um sich abzukühlen. Sie sah auf die Uhr, noch anderthalb Stunden galt es auszuhalten. Auf Zehenspitzen schlich sie zurück ins Abteil und ließ sich mit einem ergebenen Seufzer zurück ins weiche Polster gleiten. Sie konnte konstatieren, dass ihre Bedenken, den Schlaf ihres Gatten zu stören, übertrieben gewesen waren. Gerhard schlief tief und ließ sich weder durch die schrille Dampfpfeife des Lokomotivführers noch durch den geschäftigen Lärm beim Aufenthalt des Zuges auf dem Bahnhof stören. Wilhelmina hatte das Interesse am Reiseführer verloren, legte das Buch achtlos zur Seite und betrachtete stattdessen abwechselnd die vorbeihuschende Sommerlandschaft mit den fremdartigen Zwiebelkirchtürmen, den gewaltigen Bauerhäusern, von deren dunkelbraunen Holzbalkons sich farbenstrahlende Blütenkaskaden ergossen und das gebräunte Gesicht des Schlafenden. Die entspannten Gesichtszüge und der halbgeöffnete Mund verliehen Gerhard Mathiesen einen ungewohnt weichen, fast einfältigen Gesichtsausdruck. Wilhelmina fiel es schwer, die kantigen, männlichen Züge, die es ihr bereits bei ihrer ersten Begegnung so angetan hatten, wieder zu finden. In seinem linken Mundwinkel hatte sich eine Speichelblase gebildet, die rhythmisch beim Ein- und Ausatmen auftauchte und wieder verschwand. Wilhelmina fühlte sich plötzlich wie eine auf frischer Tat ertappte Voyeurin. Abrupt wandte sie sich ab und sah aus dem Fenster auf die immer dunkler werdende Silhouette der Berge am Horizont, die sich wie ein Scherenschnitt gegen das kräftige Rosaviolett des Abendhimmels abhob.
Sie war zufrieden mit der Entwicklung der Dinge. Endlich war all das, wovon sie seit ihren Backfischjahren geträumt hatte, in Erfüllung gegangen und jetzt saß sie hier im bequemen 1.Klasse Abteil auf dem Weg in die Flitterwochen. Weit weg vom vertrauten Elternhaus, Freunden und Familie. Gerhard war ihr seit 36 Stunden rechtmäßig angetrauter Ehemann, übermorgen würden sie durch Venedig bummeln, sie hatten ganze drei Wochen alleine und ungestört in Italien. Ohne die Firma, die ihn viel zu stark beanspruchte, ohne wohlgemeinte elterliche Ratschläge oder lästige Verpflichtungen. Wilhelmina streckte sich wohlig, strich ein paar widerspenstige Haarsträhnen zurück, die sich aus dem kunstvoll arrangierten Nackenknoten gelöst hatten und glättete energisch den Rock ihres hellgrauen Reisekostüms. Sie war 21 Jahre alt, acht Jahre jünger als Gerhard, ihre Zukunft war gesichert, Gerhard würde irgendwann die väterliche Firma übernehmen - das Geschäft mit Schiffsausrüstung hatte sich durch alle Krisenzeiten bewährt und als lohnend erwiesen - gemeinsam würden sie auf dieser soliden finanziellen Grundlage ein Heim schaffen, eine Familie gründen. Errötend dachte sie an Probst Mayers Worte: „Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde.” Das ganze Leben lag vor ihnen und sah viel versprechend aus. Wilhelmina sandte dem leise schnarchenden Gerhard, dessen schlafende Gestalt noch weiter in der Fensterecke zusammengesunken war einen zärtlichen Blick, in dem gleichzeitig ein Anflug von Triumph lag. Sie, Wilhelmina Twiete, hatte es geschafft. Sie hatte die absolut nicht unbedeutende weibliche Konkurrenz aus dem Felde geschlagen und saß nun zur Belohnung für den ausdauernden Einsatz hier mit ihrer Siegestrophäe. Sie hatte getan, was man von ihr erwartete, hatte sich nicht in einem Augenblick des Zweifels verwirren und hinreißen lassen, sondern war hart geblieben und hatte ihr Versprechen gehalten. Alle waren zufrieden und stolz auf sie. Gerhard hatte sich in sie verliebt, er hatte um ihre Hand angehalten, genauso romantisch und formvollendet, wie sie es sich erträumt hatte. An einem wunderschönen Märznachmittag, dessen warme Sonnenstrahlen schon einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Frühling gaben. Mit einem Verlobungsring, der selbst ihrer besten Freundin Amalie, die die Kunst beherrschte, ein Schmuckstück blitzschnell auf seinen Wert hin zu taxieren, einen anerkennenden Pfiff entlockte. „Wille, Mädel, mit soviel Karat meint der es aber wirklich ernst, da gibt es doch wohl nichts mehr zu überlegen!“
„Wilhelmina Ottilie Mathiesen geborene Twiete“ murmelte sie leise und ließ die Namen der Reihe nach langsam und genussvoll auf der Zunge zergehen. Auf die gleiche Art, in der sie die dunkelherbe Schokoladenumhüllung bei Pralinen in Erwartung der süßen Füllung auf der Zunge schmelzen ließ. Sie öffnete den Messingbügel ihrer grauen Lederhandtasche, deren Farbton perfekt mit dem seidigen Grau des Kostüms harmonierte und zog ein Heft mit steifem schwarzem Einband hervor. Mit einer fast liebevollen Geste strich ihre sorgfältig manikürte Hand über die erste jungfräulich weiße Seite und mit konzentriertem Gesichtsausdruck, die Zungenspitze gegen die obere Zahnreihe gedrückt, nahm sie die erste Eintragung vor. „17. August 1937. Heute haben Gerhard und ich uns in der Heiligen Geist Kirche zu Kiel das Jawort gegeben“, schrieb sie mit ihrer ordentlichen, steilen Handschrift. Und nach einer kurzen nachdenklichen Pause. „Alles verlief wie geplant“.
2.
Der kleine Junge im Anorak mit den blauweiß gestreiften Osh-Kosh Latzhosen rutschte ungeduldig auf dem Sitz herum und baumelte deutlich gelangweilt mit den Beinen, die in neuglänzenden Gummistiefeln steckten. Marthes Schätzung nach konnte er nicht viel älter als 3 Jahre sein. So in etwa. Bei der altersmäßig korrekten Bestimmung ihrer Mitmenschen hatte sie meistens Schwierigkeiten, eine Schwäche, die ihr regelmäßig giftige Blicke und spitze Bemerkungen einbrachte. Was sie dagegen ohne Probleme konstatieren konnte war, dass der Junge erkältet war. Seine runden braunen Augen glänzten fiebrig, er schniefte lautstark, hustete und nieste und stippte wieder und wieder seinen kleinen nassglänzenden Zeigefinger in den klaren Schleim unter der Nase. Danach leckte er den Finger geräuschvoll ab. Seine Mutter auf dem Nebensitz war in die neuesten Ausgabe der freundin versunken und kommentierte die Vorgänge mit einem ebenso regelmäßigen wie fruchtlosen „Andi Süßer, lass das, putz dir die Nase“, ohne dabei die Aufmerksamkeit vom Heft abzuwenden oder ihren Sprössling mit einem Taschentuch zu versehen. Nach dem dritten breit gefächerten Sprühregen vom gegenüberliegenden Sitz, kramte Marthe mit einem aufgebenden Seufzer ein fast sauberes Tempo aus der Tasche und reichte es dem Kleinen mit einem auffordernden Lächeln. „Sag danke zu der Tante,” klang es vom Nebensitz, die freundin senkte sich einige Zentimeter, ein freundliches Lächeln wurde in Richtung Marthe entsandt, woraufhin der mütterliche Kopf erneut hinter so viel versprechenden Überschriften wie Scheidung - was nun? Entschlacken, entwässern, entspannen - sanfter Kampf den Kilos! verschwand. Marthe lehnte sich soweit wie möglich in ihrem Sitz zurück, um dem nächsten Virennebel auszuweichen und starrte mangels Lektüre aus dem Fenster, direkt in die Finsternis des U-Bahntunnels. Das war jetzt das dritte Mal in diesem Monat, dass der Wagen nicht ansprang, der Weg in die Werkstatt war wohl unumgänglich. Ob sich das Rumreparieren überhaupt noch lohnte? Vielleicht sollte sie doch lieber einen Neuen kaufen, damit sie endlich Ruhe vor diesen ewigen unerwarteten Rechnungen hatte. Rechnungen! Marthe schloss die Augen und visualisierte den letzten Kontoauszug. Wenig aufmunternd oder wie Hamann bei unzureichenden Prästationen seiner Mitarbeiter mit lispelndem Sprühregen auszustoßen pflegte einfach un-ttsssu-frieden-ssstellend! Mein Gott Hamann, die niederträchtige alte Schlange. Wenn sie ihn auch in dem für morgen anberaumten Gespräch nicht zu einer passenden Gehaltserhöhung bewegen konnte, dann musste sie sich wohl ganz ernsthaft nach einer neuen Firma umsehen, um mehr Geld zu verdienen. Beförderungen waren in Ordnung, aber Beförderungen ohne entsprechende gehaltliche Konsequenzen waren unakzeptabel. Und die Gehaltserhöhung, die mit ihrer Ernennung zur Bereichsleiterin Marketing erfolgt war, konnte wirklich nur als Witz bezeichnet werden. Zum x-ten Mal malte sie sich das Gespräch mit Dr. Frode Hamann, ihrem Boss und dem technischen Leiter der Medinex AG aus. Er würde wieder mit seinem jovialen ich-wollte-ich-könnte Ihnen-in-dieser-Sache-entgegenkommen-Lächeln im ergonomisch korrekten dreh- und wippbaren lederbezogenen Schreibtischstuhl sitzen, die Fingerspitzen gegeneinander pressen und seine vollen Lippen zu einem spitzen Kussmund formen, der Marylin Monroe neidisch gemacht hätte. Oder seine plumpe, teigigweiße Hand mit den manikürten Fingern liebkosend über das dichte, pechschwarze und garantiert gefärbte Haar fahren lassen. Ab und zu würde er mit Daumen und Zeigefinger die Spitzen seines affigen Schnurrbartes bearbeiten und ihr dabei interessiert-betrübt in die Augen schauen. Sie hingegen würde auf dem designmäßig korrekten, aber unbequemen Besucherstuhl hocken und sich wie immer zusammennehmen müssen, um ihm nicht den Plastikbecher mit dem bitteren Kaffee ins Gesicht zu schleudern. „Sie kennen ja unsere finanzielle Situation Fräul… ähh Frau Twiete, mir sind da einfach die Hände gebunden.” Marthe kannte die finanzielle Situation der Firma und wusste, dass die paar Tausend mehr im Jahr, die für die Firma nichts, aber für sie sehr viel bedeuteten, aus Prinzip abgelehnt wurden. Er wollte sie dazu bewegen, selbst zu kündigen. Frode Hamann hatte mit allen Mitteln versucht, ihre Beförderung zu verhindern, hatte dabei aber beim alten Schneider, Direktor von Gottes und eigenen Gnaden wie ihn die Mitarbeiter nannten, auf Granit gebissen. „Sie ist tüchtig, sie ist effektiv, sie hat die Abteilung im Griff und was am wichtigsten ist - die Kunden lieben sie. Und außerdem Hamann”, hatte Schneider mit einem pfiffigen Grinsen hinzugefügt, „wir müssen ja hier auch mit der Zeit gehen, können doch auf Dauer nicht mit einer einzigen Frau im Personalbereich leben, nicht wahr. So jetzt mal nicht so negativ, ihr rauft euch schon zusammen, sie ist ja immer noch eine Etage unter dir.” Schneider hatte Hamann aufmunternd zugenickt und demonstrativ zur Lesebrille gegriffen. Das war's, die Unterredung war beendet und Hamann hatte sich geflissentlich entfernt, mit dem verbindlichen Lächeln intakt, unter dem er in der Firma die vielen Gefühlsregungen, die sich trotz aller Anstrengungen seinerseits nicht gänzlich unterdrücken ließen, verbarg. „Eine Etage unter mir”, schnaubte er, als er sich außer Hörweite des Chefbüros wähnte. „Wenn's nach mir ginge, wäre die im zweiten Deck der Tiefgarage … als Parkscheinentwerter, hahaha.“ Hamann musste lachen, so gut fand er seinen eigenen Witz. Schade, dass er ihn gerade niemandem weitererzählen konnte.
Die Wärme der vollaufgedrehten Heizung, das Vibrieren der Elektromotoren und die müde Stille der vornehmlich lesenden Mitpassagiere im Wagen ließen Marthe dösig werden. Eigentlich gar nichts so schlecht mit der U-Bahn, einfach reinsetzen und fahren lassen. Entspannender als mit dem Auto im Stau zu stehen. Sie lehnte den Kopf gegen die Wand und schloss erschöpft die Augen. Vielleicht sollte sie sich selbst und Hamann den Gefallen tun und kündigen. Wenn sie es sich recht überlegte, hatte sich der Nervenkrieg mit Hamann allmählich negativ auf die meisten Bereiche ihres Lebens ausgewirkt und das hatte sie gründlich satt. Morgens stellte sich immer seltener das beschwingte Gefühl ein, mit dem sie in der ersten Zeit zur Arbeit gefahren war. Statt positiver Adrenalinstösse Überproduktion von Magensäure. Sie hatte sich bereits ein paar Mal dabei erwischt sich vorzustellen, auf welche Weise sie ihm ihre Kündigung präsentieren würde.
Phantasievorstellungen dieser Art waren geistige Lachsbrötchen, Balsam für ihr lädiertes Ego, brachten sie in der Realität jedoch keinen Schritt weiter. Aber von irgendetwas musste sie ja schließlich leben und sie hatte keine Ahnung, wie lange es dauern würde, eine neue Stelle zu finden. Die Wirtschaft klagte über fehlende Aufträge, stagnierende Umsätze. Aber das hatte sie eigentlich schon immer getan, egal ob die Konjunktur gut oder schlecht war. Sie würde ihre Firma nicht groß vermissen und ihre Firma würde sie ebenfalls kaum lange vermissen. Im Feld der umtriebigen männlichen Endzwanziger mit den großen Armbewegungen und dem richtigen Aftershave dürfte es kaum Schwierigkeiten bereiten, schnell ihren Nachfolger finden. Die naive Vorstellung, dass die Firma am persönlichen Wohl ihrer Mitarbeiter interessiert war, sie förderte, nach individuellem Einsatz und Verdienst beurteilte, hatte Marthe bereits nach dem ersten Jahr gründlich revidieren müssen. Wenn man nach oben wollte, eine Karriere anstrebte, dann erforderte das einen guten Draht zur Leitung und hier waren gemeinsamer Hintergrund oder gemeinsame Interessen mit dem Vorgesetzten ausschlaggebender als fachliche Kompetenz. Manchmal stand die fachliche Kompetenz sogar dem Aufstieg direkt im Weg, weil sie seitens des Vorgesetzten als potentielle Bedrohung für die eigene Stellung angesehen wurde. Mitgliedschaften im richtigen Tennis- oder Segelklub, diskretes Namedropping in den unformellen Gesprächen zu Firmenfeiern und bei den großen Events. Das waren die Erfolg versprechenden Strategien. Und natürlich das unablässige Verbinden des eigenen Namens mit geglückten Projekten. Egal ob jährlicher Firmenausflug oder internationale Fachmesse, das Ziel war erst erreicht, wenn man seinen Namen mit diesem Projekt verknüpft und bei den richtigen Leuten in Erinnerung gebracht hatte. Später galt es natürlich gegenüber denen, die einem behilflich gewesen waren, die gute Botschaft weiterzuverbreiten, Dankbarkeit und Loyalität zu zeigen. Selbstverständlich nur bis zu einem gewissen Grad. Spätestens, wenn man sich daran machte, den Stuhl seines Mentors zu erobern, war es angeraten - natürlich unter Einhaltung eines gewissen Fairplay - von Dankbarkeit auf Wettbewerb umzuschalten. Anfänglich so diskret, dass alle außer dem Opfer selbst es bemerkten, je subtiler desto besser.
Als Marthe 1984 an einem sonnigen Aprilmorgen im dezenten, neuerworbenen Hosenanzug, bestückt mit kräftigen Schulterpolstern, die ihrer schmalen weiblichen Schulterpartie etwas von der Robustheit eines Rugbyspielers verliehen, ganz im modischen Trend zu ihrem ersten Arbeitstag in der Vertriebsabteilung der Medinex AG antrat, wusste sie von allen diesen Dingen gar nichts. In der Rückschau eine unbegreifliche Naivität. Damals war Marthe
sicher, dass man sie unter den zahlreichen Mitbewerbern aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz ausgewählt hatte und dass sie sich eben zum richtigen Zeitpunkt bei der richtigen Firma beworben hatte. Ganz einfach. Die Medinex AG produzierte elektronische Überwachungsgeräte für Krankenhäuser. Herzfrequenz, Blutdruck und Blutgaswerte, alle lebenswichtigen Parameter waren in Form vom informativen Kurven auf dem Monitorschirm ablesbar. „Wir produzieren die Kästen, die auf den Stationen dafür sorgen, dass es piepst und blinkt“, pflegte Marthe zu sagen, wenn sie Uneingeweihten ihre Branche, in die sie rein zufällig und völlig unkritisch reingerutscht war, beschreiben wollte. Der Markt schrie nicht unbedingt nach Geisteswissenschaftlern, als sie an einem eiskalten Februarmorgen endlich mit ihrer Magister-Urkunde in der Tasche auf den Vorplatz des Universitätssekretariats trat und sich in euphorischer Freude darüber, dem akademischen Prüfungsstress ein für alle mal entronnen zu sein, eine Zigarette anzündete. Und Marthe schrie eigentlich auch nicht nach einem Job. Am liebsten hätte sie ihr behaglich freies Studentenleben fortgesetzt. Fester Freund, billige Wohnung, niedrige feste Ausgaben, ein bisschen Bafög, gutbezahlte Ferienjobs, monatelange Reisen in den Semesterferien. So hätte es alles ihrer Meinung nach gerne weitergehen können. Ihre Berufsvorstellungen waren diffus - irgendetwas mit Schreiben. Oder PR-Arbeit. Oder vielleicht Journalistin? Die Bewerbungen um eine Praktikantenstelle bei den großen Tageszeitungen, bei der ARD und oder dem ZDF waren erfolglos. „Die geburtenstarken Jahrgänge, Sie wissen schon, bei uns kommen auf jede freie Stelle so viele qualifizierte Bewerber – es tut uns wirklich leid. Aber probieren Sie es in ein paar Monaten doch ruhig noch mal.“ Wie oft hatte Marthe das schon gehört. Insgeheim fiel ihr bei jeder neuen Absage aus Regionen südlich der Elbe jedes Mal ein Stein vom Herzen. Was sollte sie denn auch in Süddeutschland? Nach Frankfurt, unter Menschen mit diesem scheußlichen Dialekt. Oder noch schlimmer zu den Narren nach Mainz. Allein die Vorstellung, warme Sommerabende an verschlammten Baggerseen zubringen zu müssen statt mit Surfen und Schwimmen an der Ostsee! Nein, dann doch lieber etwas ganz anderes hier im Norden machen. Sie hatte ja Zeit, konnte einfach als Postbotin weiterjobben, auf die richtige Anzeige, die richtige Stellung warten. Marthe ließ sich Zeit. Las bergeweise Bücher teilweise zweifelhafter Observanz, ohne auch nur den leisesten Gedanken an Sekundärliteratur oder Quellenkritik zu verschwenden, strich die Wohnung, bepflanzte die Blumenkästen auf dem geräumigen Balkon, spielte Hausfrau. Kaufte ein, kochte, wusch und bügelte für Thomas, der jeden Morgen frischrasiert, gekämmt und wohlduftend in seinen Anzug schlüpfte, sich in den Golf setzte und in der Devisenabteilung seiner Bank mit Geldan- und Verkäufen viel Geld verdiente. Nach dem Stress des letzten Unijahres, in dem sie manchmal schweißnasse Alpträume von vergessenen Fußnoten geträumt hatte, genoss Marthe die Rückkehr in ein relativ zwangfreies Leben. Geldverdienen, Reisen, sich mit Freunden in der Stammkneipe treffen, keine lästigen Verpflichtungen. Bei Bedarf ein Mann zum Anlehnen und Kuscheln. Kein Stress, kein Grund dieses perfekte Leben zu ändern. Thomas hatte da eine etwas andere Auffassung und verliebte sich von einem Tag auf den anderen in eine ambitiöse Kollegin und ein anderes Leben. Die Wohnung stand in seinem Namen und wies, was letztlich ausschlaggebend war, einen geräumigen, voll begrünten Südbalkon auf. Ideal für Babys Mittagschlaf an der frischen Luft, zum Trocknen der vielen Kilo Babywäsche und natürlich der abendlichen Entspannung der jungen Eltern über einer Tasse Kaffee .
Marthe stand alleingelassen, ohne Dach über dem Kopf, dafür aber mit einem fast fertigen Norwegerpulli, den sie für Thomas zum Geburtstag gestrickt hatte. Nach 24 Stunden wütenden Heulens und Schluchzens wischte sie sich die Tränen ab, verstaute ihr weniges Hab und Gut in fünf Umzugskisten und zog als bezahlende Untermieterin zu einer Bekannten nach Wilhelmsburg. Auf einer der dort abgehaltenen Wochenendfeten, die irgendwann im Laufe des Freitagnachmittags ihren Anfang nahmen und sich mit wechselnder Besetzung bis Montagmorgen hinzuziehen pflegten, traf sie Manfred, der als Softwareentwickler bei Medinex arbeitete und ihr vorschlug „bewirb dich doch mal, die haben gute Sozialleistungen.” Manfred war nach einem ebenso kurzen wie heftigen Aufenthalt aus Marthes Leben verschwunden und nach Kalifornien ausgewandert. Sein lapidarer Kommentar: „Ich brauch also echt mal Luftveränderung, Deutschland sucks, also echt, für Leute wie mich liegt da drüben die Zukunft.” Die Medinex AG mit guten Kollegen, interessanten Arbeitsaufgaben und einem köstlichen Salatbuffet war geblieben und beanspruchte den größten Teil von Marthes wacher Zeit. Sie liebte ihre Arbeit, fühlte sich wichtig, tüchtig und unentbehrlich. Deshalb hatte sie sich weder über die schnelle Beförderung zur Projektleiterin noch wenig später zur Bereichsleiterin gewundert. Sie hatte das freundliche Interesse und die lobenden Bemerkungen ihres Chefs rein professionell gedeutet, denn sie war ja tüchtig, effektiv, hatte gute Ideen und konnte mit Kunden umgehen. Dr. Frode Hamann war ein glücklich verheirateter älterer Herr um die 50 mit attraktiver Ehefrau, drei Kindern und Dalmatiner im Endreihenhaus. Marthes überrascht-empörte Zurückweisung seiner handgreiflichen Zudringlichkeiten im Rahmen des seinerseits offenbar allzu wörtlich genommenen get-together-meetings auf der jährlichen Vertriebskonferenz war echt gewesen. Sie hatte Hamann nicht benutzt. Ihre Beförderung war verdient und beruhte ausschließlich auf Leistung. Hamann hatte nur das für einen Chef Natürliche getan und sie als die bestqualifizierte Kandidatin vorgeschlagen. Sie schuldete ihm nichts, außer sich in ihrer neuen Rolle zu beweisen. „Mein Gott du Schaf, wie kann man bloß in deinem Alter noch so naiv sein”, hatte Margrit sie gefragt, nachdem sie der Freundin - um solidarisches Verständnis heischend - den Verlauf des Abends geschildert hatte. „Du kannst dich genauso gut nach was anderem umsehen, in der Firma wirst du nichts mehr.” Einfach aufgeben und kampflos verschwinden, obwohl es nicht ihre Schuld war, sondern seine? Das wäre doch der Gipfel der Ungerechtigkeit, meinte Marthe. Nein, sie würde es diesem Ekelpaket mit den klammen Fingern schon zeigen, wer der Stärkere war. Und blieb. In diesem Punkt waren Marthe und Hamann sich zu 100 Prozent einig. Hamann blieb auch. Seit dem kühlen Frühlingsabend in Düsseldorf, an dem Marthe resolut Frode Hamanns kräftige linke Hand von ihrer rechten Brust entfernt und dem verdutzten, alkoholisierten Angreifer in einer instinktiven Abwehrreaktion und unter Ausdruck verbaler Empörung den Arm auf den Rücken gedreht hatte, besaß sie einen mächtigen Feind in der Firma. Und Hamann ließ sie so oft wie möglich merken, wer der Stärkere war.
Der Lautsprecher knitterte Unverständliches, der Zug bremste und fuhr kurz darauf leicht ruckelnd in die nächste Station ein. Marthe öffnete die Augen halb. Hoheluftbrücke. Eigentlich hätte sie nichts dagegen gehabt, sich noch ein bisschen so weiterfahren zu lassen und ungestört ihren Gedanken nachzuhängen. Stattdessen zog sie den Reißverschluss ihrer Jacke hoch und griff nach Tasche und Handschuhen. Die lesende Mutter mit dem schniefenden Sohn stand bereits an der Tür, wo sie ihm in farbenfrohen Einzelheiten schilderte, wie man aussähe, wenn man aufgrund unreglementierten Aussteigens aus dem noch fahrenden Zug unter die Räder käme. Der Kleine war sichtlich beeindruckt und klammerte sich an die mütterliche Hand. Er musste ungefähr das Alter von Thomas Jüngstem haben. Dessen Geburtsanzeige war gleichzeitig Thomas letztes Lebenszeichen gewesen. Kurz danach war er mit seiner Familie nach Süddeutschland gezogen. Wegen der Karriere, oder dem Geld nach, wie er sich ausdrückte und seitdem hatte sie nicht einmal mehr die obligatorischen Weihnachtskarten mit den austauschbaren Texten bekommen. Wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn wir uns damals nicht getrennt hätten, dachte Marthe. Würde ich dann mit zwei rotznäsigen Kleinkindern in einem Dorf auf der Alb sitzen und eine Müttergruppe gründen? Allein der Gedanke ließ sie erschauern. Nein, wohl kaum. Kinder waren süß, sie liebte ihre knuddeligen Nichten und Neffen, aber im Moment hatte sie absolut kein Bedürfnis. Sie fühlte sich noch viel zu jung für die Mutterrolle, dafür hatte sie noch viele Jahre Zeit. Jetzt galt es erstmal, das Leben in vollen Zügen zu genießen und das ging am besten zu zweit und ohne Kinderwagen. Marthe floss mit dem Menschenstrom in Richtung Rolltreppe und tauchte aus der glitzernden Helle des U-Bahn Schachts in die dunkle Kälte der Oberwelt, wo sie fröstelnd an der roten Ampel wartete. Der Duft von Grillwürstchen und gebrannten Mandeln aus den kleinen Buden eines intermistischen Marktplatzes behauptete sich selbst gegenüber der kräftigen Abgaswolke der anfahrenden Autos. Marthe lief das Wasser im Mund zusammen. Der Kühlschrankinhalt war soweit sie sich erinnerte ziemlich unattraktiv, und sie beschloss beim Chinesen vorbeizugehen. Und zur Sicherheit auch gleich noch beim Zeitschriftenhändler Lotto zu spielen. Wahrscheinlichkeitsrechnung hin oder her, einer musste ja gewinnen und sie könnte einen warmen Regen wirklich gut gebrauchen.
Die Plastiktüte mit der süßsauren Ente entsandte köstliche Düfte und Marthe kramte hektisch in ihrer Handtasche nach dem Haustürschlüssel. Das Mittagessen in der Kantine hatte sie ausfallen lassen und jetzt kam zur Strafe der Heißhunger. Sie stemmte ihre Schulter gegen die schwere Holztür, balancierte Handtasche, Plastiktüte und rechten Handschuh in der linken Hand und tastete nach dem Lichtschalter. Das Treppenhauslicht erwachte mit einem satten Klick zum Leben und fast gleichzeitig stieß Marthe einen spitzen Überraschungsschrei aus. Emilie Finkenstein, Hausbesitzerin und uneingeschränkte Herrin über neun Mietparteien stand stumm und regungslos im gleißenden Licht auf dem Treppenabsatz zum ersten Stock und sah anklagend aus. Was an und für sich nichts Überraschendes war, da Frau Finkenstein seit dem Tod ihres Mannes während der 63er Sturmflut konstant einer lebenden Anklage glich. „Stellen Sie sich mal vor, der Mann hat einen Lungendurchschuss, Stalingrad, die Jahre beim Russen und die TB überlebt und dann ertrinkt er mitten im schönsten Frieden, weil er eine Katze retten will!" Diesen Satz pflegte Frau Finkenstein mit einem vehementen, durch die Nüstern ihrer schmalen Nase gepressten verächtlichen Schnaufen lautmalerisch zu unterlegen. In Marthes Augen war die Episode mit der Katze eigentlich ein sehr sympathischer Zug an diesem Herrn Finkenstein, dem sie nur als streng blickenden, uniformierten Soldaten im Silberrahmen auf Frau Finkensteins Fernseher begegnet war. Aber das sagte sie natürlich nie laut, so wie sie überhaupt versuchte, mit ihrer Vermieterin auf gutem Fuß zu stehen, auch wenn das normalerweise das Äußerste ihrer begrenzten diplomatischen Fähigkeiten erforderte. Zentral gelegene Mietwohnungen in Hamburg waren rar. Bezahlbare, zentral gelegene Mietwohnungen im schönsten Jugendstil mit Parkettfussboden und 4,20 m Deckenhöhe waren Gold wert. Sie hatte diese Perle in der Isetrasse über die Bekannte einer Kollegin gefunden und sich bereits beim Betreten des stilvoll restaurierten Treppenhauses mit Mosaikfussboden und hochglanzpoliertem Treppengeländer geschworen alles zu tun, um ihr Zimmer in Wilhelmsburg mit diesem Domizil zu vertauschen. Wenn es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick zwischen Wohnungen und Menschen gab, dann hier zwischen Marthe und diesen stuckverzierten Quadratmetern. Letztlich hatte es Marthe auf der Vermieterseite einen riesigen Blumenstrauß, eine Schachtel Pralinen und mehrere Gespräche, deren Inhalt hauptsächlich aus massiven Schmeicheleien bestand, gekostet. Auf der Vormieterseite war es etwas teurer gewesen. 6.000 DM Abstand für altrosa Veloursvorhänge mit Quasten und ehemals beige Spannteppiche mit undefinierbaren bräunlichen Flecken. Aber Marthe wollte einfach hier wohnen und zahlte. Die Vorhänge waren an die Theater AG einer ihrer Freundinnen gegangen, die an einem Gymnasium in Olsdorf unterrichtete und Materialien für das Bühnenbild der Mutter Courage benötigte.
Der Spannteppich war trotz verhaltener Proteste seitens Frau Finkenstein „ist doch schade drum, ist doch reine Wolle“, direkt in den Sperrmüll gewandert.
Marthe wusste sofort, warum man ihr zu dieser späten Stunde in Häkelweste und plüschigen, kunstpelzverbrämten Hausschuhen auflauerte. Und Frau Finkenstein wusste ebenfalls, dass Marthe es wusste. „Ich weiß, dass Sie eine vielbeschäftigte, berufstätige junge Frau sind, aber das entbindet Sie nicht von der Putzpflicht!“ Marthe hatte diese Woche Treppendienst. Eigentlich hätte sie schon gestern die Treppe wischen und das Geländer polieren sollen. Aber da war sie so beschäftigt damit gewesen, die 5. Version des Marketingbudgets fürs nächste Jahr zu bearbeiten, dass sie diese Tätigkeit erst verschoben und danach verdrängt hatte.
Marthe seufzte, lächelte Frau Finkenstein entschuldigend an und gelobte das Versäumte umgehend nachzuholen. Mit Diskutieren kam man hier nicht weiter, das wusste sie aus bitterer Erfahrung. „Mach ich, mach ich noch heute Frau Finkenstein, gleich nach dem Abendbrot.” Marthe wedelte mit der wohlduftenden Plastiktüte, und schob sich mit einem „schönen Abend noch" so schnell wie möglich am Zerberus vorbei.
Auf den letzten Stufen, hörte sie bereits das Telefon klingeln. Stefan! Er hatte offenbar doch noch die letzte Maschine bekommen. Dann konnte der ganze missglückte Tag zumindest noch einen netten Abschluss bekommen. Marthe wurde ganz warm vor Freude, sie nahm die noch fehlenden Stufen im Galopp und ließ alles, was sie in den Händen hatte im Flur fallen. Leicht keuchend nahm sie den Hörer ab. „Twiete!" „Ja sag mal, wo hast du denn wieder die ganze Zeit gesteckt, ich hab schon den ganzen Abend versucht, dich zu erreichen, du könntest ja auch ruhig mal zwischendurch anrufen, aber dazu bist du natürlich wieder viel zu beschäftigt, ich könnte hier umfallen, keines meiner Kinder würde es bemerken.” Marthe wendete den Blick himmelwärts und schluckte einen enttäuschten Fluch stumm hinunter. Die Vorfreude auf einen unverhofften romantischen Abend erlosch genauso schnell wie sie entstanden war. „Hallo Muttchen”, seufzte sie mit flacher Stimme in den Hörer, aus dem sich in unverminderter Stärke und im üblichen leicht indignierten mütterlichen Tonfall ein Schwall von Fragen und Insinuationen in Marthes Ohr ergoss. Während Marthe mit strategisch eingestreuten mmhhs, ach wirklich oder sag bloß den Redefluss ihrer Mutter kommentierte, versuchte sie die Ente mit dem rechten Fuß aus der stabilen Seitenlage in eine aufrechte Position zu bringen. Ihr Magen knurrte so laut, dass sogar ihre Mutter es hören musste. Leicht verspätet fand sie die übliche Antwort auf die übliche mütterliche Frage. „Ich musste Überstunden machen.” Aber diesmal hatte ihre Mutter die obligatorische einleitende Runde mit rhetorischen Fragen schneller abgeschlossen als erwartet und ging nun unmittelbar zum wirklichen Grund ihres Anrufs über. „Tante Wilhelm ist tot. Verkehrsunfall. Zu schnell in die Kurve und da lag schon Eis.” Der leise Anflug von Genugtuung in der mütterlichen Stimme war nicht zu überhören. „Bitte lasse sie jetzt nicht die ganze Litanei abrasseln, sonst schrei ich”, betete Marthe im Stillen und ihr Gebet wurde erhört. Frau Twiete begnügte sich mit der kurzen Version: „Na, war ja auch nicht anders zu erwarten. Selbst in ihrem Alter hat sie sich ja immer noch aufgeführt wie eine Wilde. Allein der Wagen. Konnte ja wieder alles nicht groß und teuer genug sein.” Soweit Marthe sich erinnerte, war einer der Favoriten ihrer Tante das bordeauxrote Jaguarcabriolet gewesen. Der einzige Wagen, den sie nach dem Tode ihres Mannes behalten und über die Jahre regelmäßig durch das neueste Modell ersetzt hatte. Tante Wilhelm war eine gute Autofahrerin, die Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsregeln einhielt, wenn sie Zeit dazu hatte. Da sie jedoch meistens in Eile und in Gedanken schon beim nächsten Punkt auf ihrer langen Aufgabenliste war, produzierte sie regelmäßig Schrammen, Beulen und Blechschäden. „Na, sollte eben in ihrem Alter keine Autorennen mehr fahren und schon gar nicht in angetrunkenem Zustand”, kam es spitz durch die Leitung. Der angetrunkene Zustand war das Sahnetüpfelchen. Marthe konnte hören, wie sich ein triumphierender Unterton in die mütterliche Indignation mischte. Tante Wilhelm hatte die Angewohnheit sich ein Glas ordentlichen Rotwein zu den Mahlzeiten zu gönnen und als Inhaberin eines ansehnlichen Vermögens, hatte sie bei der Beschaffung gehobener Qualitätsweine nie Probleme gehabt. „Besser und billiger als Vitaminpillen”, erwiderte sie stets lachend, wenn ihre Familie mit mehr oder weniger deutlichen Hinweisen auf ihren regelmäßigen Alkoholkonsum zu sprechen kam. „Man bekommt gute Laune und gesund ist es auch noch.” Marthe konnte das mütterliche „das hat sie nun davon, ich hab ja schon immer gesagt, dass das mal ein schlimmes Ende nehmen wird“, förmlich durch die Leitung fühlen. Normalerweise hätte sie jetzt irgendetwas in Richtung „wie furchtbar oder die Ärmste, das tut mir aber leid“, sagen müssen. Bei dem äußerst kühlen Verhältnis zwischen ihrer Mutter und deren Schwägerin „warum tut die denn auch bloß immer so extravagant, immer muss es bei ihr was anderes sein als bei Nachbarns“, hätten derlei Bemerkungen jedoch denselben Effekt gehabt wie Öl ins Feuer zu gießen. Mit dem neutralsten Tonfall, der ihr zur Verfügung stand beschränkte Marthe sich daher auf ein „hat sie noch sehr leiden müssen?”
„Nein, sie war sofort tot, hat sich wohl beim Überschlagen das Genick gebrochen. Wir wurden ganz offiziell von ihrem Familienanwalt oder wie man diesem Herren nennen soll, informiert. Du weißt schon, dieser arrogante Schnösel, den sie zu Papas Beerdigung mitgeschleppt hat." Theresa Twiete machte eine bedeutungsvolle Pause. Sowohl aus rein praktischen Gründen, um Luft zu holen als auch um der Beerdigung vor nun bald sechs Jahren angemessen Rechnung zu tragen. Seit dem plötzlichen Tod ihres Mannes, der im Alter von 62 Jahren ganz unpassend in den Armen seiner Verkaufsleiterin und Geliebten einem Schlaganfall erlegen war, hatte Theresa Twiete sich eine passende Geschichte zur Erklärung und zwecks mentaler Nachbearbeitung bereitgelegt, die sie über die Jahre mit ständig neuen Details erweiterte und verbesserte und die mittlerweile so überzeugend wirkte, dass sie selbst daran glaubte. Theresa Twiete, geliebte Ehefrau und Mutter von vier Prachtkindern „der Apfel fällt ja bekanntermaßen nicht weit vom Stamm“, wird nach 34-jähriger glücklicher Ehe „stellen Sie sich mal vor, genau an unserem Hochzeitstag fällt er mir um, das hat ja schon fast was Symbolisches,” brutal aus dem ehelichen Idyll gerissen, steht ganz alleine und hilflos da, ist oft am Ende ihrer Kräfte, gibt aber nicht auf, sondern kämpft sich durch. „Um der Kinder willen, auch wenn sie schon alle aus den Windeln raus sind.“ Glockenhelles Lachen. „Und weil Heinrich es so gewollt hätte.” Marthe hatte diese mütterlichen Phantasiegeschichten, in der die Realität soweit wie möglich ausgeklammert oder bis zur Unkenntlichkeit geschönt wurde, anfänglich gehasst und fühlte sich jedes Mal peinlich berührt, wenn sie bei Geburtstagen und an Fest- und Feiertagen Zeuge der mütterlichen Geschichtsbereinigung wurde. Besonders, weil sie wusste, dass die meisten der Anwesenden die Wahrheit kannten oder zumindest die Gerüchte, die kursierten. Ihre Mutter mit glühenden Wangen „ach nein danke, bloß keinen Kaffee mehr, bin schon ganz überdreht", im Kreise ihres Fanklubs, in dem nur ein paar gleichaltrige Damen mit Witwenstatus aktiv versuchten, mit ihren eigenen, bei weitem weniger spektakulären Todesfällen etwas von der Aufmerksamkeit zu erheischen, die Frau Twiete gerne 100% für ihre Person beanspruchte. Der Rest des Publikums interessiert lauschend, den Kuchenteller balancierend, und zwischen zwei Bissen Torte mit aufmunternden Kommentaren wie „nein wirklich und er sah ja auch immer so gesund aus, grausam so mitten aus dem schaffenden Leben gerissen", oder „Sie Ärmste, gerade wo sie endlich mal Zeit für sich selbst gehabt hätten, mit den Kinder aus dem Haus." Irgendwann befolgte Marthe Markus brüderlichen Rat, der ihre giftigen Bemerkungen über das zweifelhafte mütterliche Gedächtnis mit einem trockenen „was willst du eigentlich, andere rennen zweimal in der Woche zum Psychiater, unsere Mutter macht ihre Traumenbearbeitung selbst, dazu noch gratis und wie man sieht mit Erfolg“, kommentierte. „Wenn das ihre Methode ist zu verdrängen, dass unser Vater jahrelang eine andre Frau gevögelt hat, kann sie von mir aus dichten und erfinden soviel sie will, Hauptsache sie ist glücklich dabei.”
3.
„Und hätten wir der Liebe nicht”, Pastor Neumanns tiefer Bariton drang problemlos von der Kanzel bis in die letzte Reihe der deutschen Kirche vor, die, ungewöhnlich für einen Dienstagvormittag, brechend voll war. Außer der nächsten Familie in den beiden vorderen Reihen, kannte Marthe fast niemanden aus der großen Schar der Trauernden, in der augenscheinlich alle Alters- und Sozialklassen vertreten waren. Leicht eingetrocknete ältere Damen mit lila Dauerwelle eingehüllt in perfektes Make-up und elegante Pelzmäntel begleitet von befrackten Herren mit kräftigem Bauchansatz und dünnem Haarschopf, durch den leberfleckige Kopfhaut schimmerte. Solide, leicht übergewichtige Mittvierzigerinnen in praktischen Windjacken über Röcken, deren elastischer Bund maximale Bewegungsfreiheit garantierte und mit kräftigem Schuhwerk mit geländegängiger Profilsohle. Männer in unspektakulärem Bürooutfit, das sich oft nur in der Wahl der Schlipsfarbe von dem des Banknachbarn unterschied. Zu Marthes großem Erstaunen war auch eine Gruppe Teenager in abenteuerlichen Gewändern, farbenfrohen Frisuren und alternativem Make-up erschienen, die wahrscheinlich aus irgendeiner der zahlreichen sozialen Organisationen stammte, in der ihre Tante sich mit Spenden oder persönlich engagiert hatte. Der Gottesdienst hatte gerade erst begonnen, aber Marthe putzte sich schon zum dritten Mal diskret die Nase. Kirchliche Amtshandlungen, egal ob Hochzeit, Taufe oder Beerdigung übten stets einen unfehlbaren Effekt auf ihre Tränendrüse aus. Ihr Schniefen hatte nur wenig mit Trauer um ihre verstorbene Tante zu tun, sondern kam als spontane physische Reaktion so wie beim Löffeln von heißer Suppe. Auch wenn Marthe sich das nie eingestanden hätte. Eigentlich fühlte sie sich wohl, ja fast zufrieden und abgeklärt hier in der festlich geschmückten warmen Kirche mit dem überwältigenden Blumenduft, den die im Mittelgang arrangierten Sträuße und Kränze aussandten. Endlich mal wieder ein guter Anlass, um in Ruhe ein bisschen zu heulen. Das hatte sie zuletzt vor ein paar Monaten bei irgendeinem schmalzigen Liebesfilm getan, an dessen Titel sie sich nicht mehr erinnern konnte. Durch die klaren hohen Fenster des Kirchenschiffes konnte sie die vorbeiziehenden dicken, grauen Wolken am zerfetzten Novemberhimmel und das Kommen und Gehen der Graupelschauer verfolgen, die ab und an wie Kieselsteine gegen das Glas prasselten. Während draußen der erste Wintersturm über die Stadt fegte und Regen, Blätter, Plastiktüten und gelegentlich lose Dachpfannen durch die Luft jagte, herrschte im von riesigen Messingkronleuchtern erhellten Kirchenschiff Andacht und Frieden. Der vor dem Altar aufgebahrte Sarg, der unter einem dichten Teppich aus roten und weißen Blumen fast verschwand, wurde beidseitig von jeweils drei Logenschwestern als Ehrenwache flankiert. Marthe schätze die beiden ältesten unter ihnen auf Ende siebzig und bewunderte ihre Standhaftigkeit. Sie mussten ihre Tante wirklich sehr gemocht haben, wenn sie das hier so steifbeining über sich ergehen ließen. Und Tante Wilhelm musste ihrerseits Marthe sehr gemocht haben, sonst hätte sie ihr wohl kaum das Haus hinterlassen, an dem sie selbst so gehangen hatte. Alle waren in irgendeiner Weise testamentarisch bedacht worden, ihre Geschwister, ihre Mutter, die Familie ihres verstorbenen Mannes, Organisationen und Institutionen. Alle hatten eine Scheibe vom Kuchen, der sich als sehr viel größer als vermutet erwiesen hatte, abbekommen. Tante Wilhelm war mehr als nur wohlhabend, Tante Wilhelm war reich gewesen. Sogar Theresa Twiete, die sich aufgrund des äußerst gespannten Verhältnisses zur Schwägerin keinen Illusionen über eine eventuelle Erbschaft hingegeben hatte, konnte sich eines positiv überraschten „na ja, zwar 35 Jahre zu spät, aber immerhin", nicht enthalten, als sie blitzschnell ihren eigenen Erbanteil in harte D-Mark umrechnete.
Solange Marthe sich erinnern konnte, hatte man bei ihr zuhause von Tante Wilhelms Wohlstand gesprochen. Zu einer Zeit Anfang der 50er Jahre, als die meisten Deutschen nur sehr langsam mit dem, was die Nachwelt gemeinhin als Wirtschaftswunder bezeichnete in Berührung kamen und ein großer Teil der arbeitsfähigen Bevölkerung wirtschaftlich nur bescheidene Fortschritte machte, Wohnraum noch rationiert war und Autofahren für den Durchschnittsdeutschen, wenn überhaupt, im Taxi stattfand, sprach man fast andächtig über Tante Wilhelms großes Haus in Kopenhagen, ihre Haushälterin, teuren Autos und Auslandsreisen. Aus ihren Kinderjahren erinnerte Marthe sich an die absolut nicht für Kinderohren bestimmten und daher umso interessanteren abendlichen Gespräche und Auseinandersetzungen zwischen ihren Eltern. An Theresa Twietes Vorwürfe, weil Heinrich Twiete sich weigerte, seine Schwester um Geld anzupumpen. Stattdessen lieber teure Kredite aufnahm, die die empfindliche Balance von Einnahmen und Ausgaben im Twieteschen Haushalt nachhaltig störten. „Ich bin erwachsen, bin mein eigener Herr und habe nicht vor, mich an den Rockzipfel meiner großen Schwester zu hängen”, pflegte ihr Vater in diesen immer nach den gleichen Muster ablaufenden Gesprächen in erkämpft ruhigem Ton zu antworten, woraufhin ihre Mutter stets mit verächtlichen verbalen Hieben konterte. Sein wahrlich nicht imponierendes Einkommen, seine Mittelmäßigkeit und seinen fehlenden Ehrgeiz beklagte. Marthe erinnerte sich eigentlich mehr an den abfälligen Ton als an den Inhalt dessen, was Theresa ihrem Gatten in diesen abendlichen Auseinandersetzungen mit einer gewissen Regelmäßigkeit vorzuwerfen pflegte. Fast alle Diskussionen endeten mit der mütterlichen Standardanklage, dass ihr Vater nicht in der Lage sei, seine Familie anständig zu versorgen. Auf jeden Fall nicht ausreichend, um ihr - Theresa Twiete - ein Leben auf dem Niveau zu bieten, das ihr zustand. Dass es eigentlich nur ihrer Sparsamkeit und Opferbereitschaft zu verdanken war, dass man nicht am Hungertuche nagte. Im Laufe der Zeit lernte Marthe, die verschiedenen zum Kampf eingesetzten Elemente zu erkennen und zu unterscheiden. Sie konnte anhand der mütterlichen Stimmlage beurteilen, in welcher Phase sich die elterlichen Streitgespräche gerade befanden und kannte die Patt-Situationen, die stets in einem mehrtägigen Schweigen auf beiden Seiten resultierten. Irgendwann hatte Marthe aufgehört, sich Sorgen über eine eventuelle Scheidung ihrer Eltern zu machen und stattdessen beschlossen, Auseinandersetzungen und bittere Vorwürfe dieser Art als natürlichen Teil des elterlichen Ehealltags zu akzeptieren. Einer Sache war sie sich damals ganz sicher: Sie würde niemals heiraten, das gab nichts als Ärger. Nein, lieber wollte sie für sich alleine in einer der schönen hellen Neubauwohnungen mit modernen Möbeln leben, so wie ihre Lieblingstante Uschi, die jüngste Schwester ihrer Mutter. Die arbeitete in einem Anwaltsbüro, lachte viel, ging tanzen, schminkte sich, hatte eine elegante Garderobe und war mindesten einmal in der Woche beim Friseur. Wenn Marthe sie besuchte und manchmal an einem Wochenende bei ihr übernachten durfte, gab es exotische Gerichte wie Spaghetti mit geriebenem Parmesankäse, dessen Geruch Marthe immer ein bisschen an Erbrochenes erinnerte und sie durfte alle Tante Uschis Lippenstifte ausprobieren. Tante Uschi hatte viele Freundinnen und Bekannte und einen festen Freund, der auch oft bei ihr war, wenn Marthe sie besuchte. Er war viel älter als ihr Vater, arbeitete bei der Volkszeitung und brachte stets Blumen, Bücher, Schallplatten oder eine Schachtel Pralinen mit, wenn er sie besuchte. Tante Uschi und Onkel Joachim konnten stundenlang heftig über Politik, Zeitungsartikel oder neue Bücher streiten, ohne sich dabei jemals so in die Haare zu geraten wie Marthes Eltern. Marthe liebte diesen Onkel Joachim, weil er sie im Gegensatz zu den meisten anderen Erwachsenen einschließlich ihrer eigenen Eltern ernst nahm. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Erwachsenen offen seine eigenen Unzulänglichkeiten und Fehler einräumte. Manchmal lud er Uschi und Marthe sonntags zum Essen in ein Restaurant in der Stadt ein oder in ein Cafe, wo Marthe die teuerste Torte bestellen durfte und Kakao mit Sahnehaube. Wenn Tante Uschi ihn bei solchen Gelegenheiten manchmal ein glückliches „Achim, du verwöhnst uns aber wieder nach Strich und Faden”, zuflüsterte, bekam er oft diesen merkwürdigen Blick, tätschelte ihre Hand und murmelte irgendetwas, was sich wieKarpfen anhörte und sich bei späterem Nachfragen als carpe diem erwies. An einem solchen Wochenende beschloss Marthe, dass ihr Freund einmal so sein sollte wie Onkel Joachim und ihre Beziehung auf keinen Fall so wie die ihrer Eltern.
Marthe hatte keine Vorstellung davon, was ihr das gewaltige Erbstück bei einem schnellen Verkauf einbringen konnte. In ihren Augen handelte es sich um ein malerisch mit Wein und Efeu überwuchertes Märchenschloss in einem herrlichen, verwunschenen Park, eine pompöse Patriziervilla in einem exklusiven Viertel, die in Hamburg ein Vermögen einbringen würde. Entsprechend hoch waren ihre Erwartungen. Vielleicht war sie schon Millionärin. Sie schloss überwältigt die Augen und stellte sich vor, wie viele Jahre sie bei Medinex würde arbeiten müssen, um eine Million netto zu verdienen, wurde aber rasch in die Realität zurückgerufen, als die Trauergemeinde sich unter Räuspern und Füssescharren erhob. Die Orgel setzte brausend ein und Marthe lief es kalt den Rücken hinunter, als der geschmückte Sarg mit den sterblichen Überresten Wilhelmina Rastrups, geb. Twiete, verw. Mathiesen aus der Kirche getragen wurde.
„Ja, wirklich ein schönes Stück, so recht was für Liebhaber des Originalen.” In der kalten Begriffswelt des Immobilienmaklers wurde Marthes Millionen-Märchenschloss blitzschnell auf ein schwer verkäufliches, stark renovierungsbedürftiges Liebhaberobjekt reduziert. Makler Sørensen kniff seine rotgeränderten Schweinchenaugen leicht zusammen und ließ seinen professionellen Blick kritisch an der Fassade auf und ab gleiten, während er rastlos mit dem Schlüsselbund in der Hosentasche klimperte. „Sieht man jetzt ja dutzendweise auf dem Markt, diese großen alten Häuser. Seit Jahren nicht mehr ordentlich gepflegt, unmodern, undicht, eiskalt im Winter, die reinen Energiefresser und das bei den heutigen Ölpreisen.” Er nickte Marthe, die frierend neben ihm im Schneeregen stand, aufmunternd zu. „Aber natürlich Charme, das haben sie ja, diese Häuser. Für den Do-it-yourself-Käufer oder jemanden mit richtig guten Handwerkerverbindungen, also schwarz.“ Er zwinkerte ihr verschwörerisch zu. „Sie verstehen, Handwerker und dann noch in dieser Größenordnung, wer kann sich das in diesen Zeiten schon leisten.” Sørensen zog einen Kugelschreiber, der sich als verkleideter Zeigestock erwies, aus der Manteltasche und begann mit fechtenden Bewegungen Punkt für Punkt mit der Desillusionierung: Putz der Außenfassade mit feuchten Partien und starkem Algenbefall - stark renovierungsbedürftig, Fundament mit Mauerrissen, vielleicht Setzschäden, altmodische Doppelfenster am besten durch moderne Thermofenster zu ersetzen, fehlende Hohlraumisolierung, Auswechseln der beschädigten Dachpfannen - besser noch Totalrenovierung des Daches. Totalrenovierung war überhaupt Makler Sørensens Lieblingsausdruck. Ausbessern des Mauerwerks über den Fensterbögen, Reparatur der verglasten Holzveranda, Marthe wartete hier eigentlich auf das Stichwort Totalrenovierung, aber es kam noch schlimmer. Abriss wäre wohl am sinnvollsten, heutzutage hätte niemand mehr die Zeit für derart aufwendige Arbeiten und überhaupt, wer konnte und wollte denn schon so etwas Unisoliertes aufwärmen. Sockelisolierung aufgrund von Feuchtigkeit in Teilbereichen des Kellers, Modernisierung der altersschwachen elektrischen Installationen usw.usw. Sørensen kam bei seiner Aufzählung mehr und mehr in Fahrt, schlug den Mantelkragen hoch und rieb sich tatkräftig die Hände als wollte er auf der Stelle mit der Umsetzung seines imaginären Aktivitätsplans beginnen. „Tja, äußerlich ist da ja wirklich so einiges zu tun", trompetete er vergnügt und stapfte auf die Eingangstür zu. „Dann wollen wir doch mal sehen, wie das Innenleben unserer alternden Diva aussieht.” Marthe, bereits leicht entnervt, zog die linke Augenbraue hoch und murmelte spitz „wahrscheinlich muss ich noch zuzahlen, um es loszuwerden.” Sie spürte, dass sich die Nässe des matschigen Rasens bis zu ihren dünnen Strümpfen vorgearbeitet hatte und folgte ihm gerne in die warme Eingangshalle. Aber irgendwie entwickelte sich die Situation nicht so ganz, wie sie erwartet hatte.
Es war eigentlich eine Lüge oder zumindest nur die halbe Wahrheit gewesen und Marthe hatte deswegen anfänglich ein schlechtes Gewissen gehabt. Sie hatte Stefan in der Firma angerufen und ihm mitgeteilt, dass sie aufgrund unvorhergesehener Probleme unbedingt noch einige Tage länger in Kopenhagen bleiben musste. „Der ganze Papierkram mit dem Haus und so, du weißt schon, das zieht sich hin." Sie hatte seine Enttäuschung fast körperlich gespürt, als er murmelte, dass sie offenbar eine abrissreife Bruchbude seiner Gesellschaft vorzog. Stefan hatte unter Aufbietung all seines nicht unbeträchtlichen Charmes versucht, sie zu überreden, doch zumindest für eine Nacht zu kommen. Seine Frau und Tochter waren gerade bei Freunden in München. Marthe war hart geblieben, und hatte sich anschließend gewundert, wie leicht ihr das gefallen war. Sie hatte jetzt soviel mit all den praktischen Dingen um die Ohren, war so beschäftigt mit gänzlich neuen Problemstellungen, zu denen sie sich verhalten musste, dass sie manchmal den ganzen Tag nicht an Stefan dachte, völlig vergaß ihn zu vermissen und sich nach ihm zu sehnen. Abends fiel sie erschöpft in Tante Wilhelms luxuriöses Gästebett und umgehend in einen tiefen, traumlosen Schlaf, aus dem sie erfrischt und voller Tatendrang in der Morgendämmerung durch das Frühkonzert der Amseln im Garten erwachte. Infolge ihrer Freundin Margit war ihre Reaktion ein gutes Zeichen. Ein Indikator dafür, dass ihre blinde Verliebtheit auf den Rückzug und ihr gesunder Menschenverstand auf dem Vormarsch war.
Marthe goss den frischgebrühten Kaffee in die zierliche, blaubemalte Porzellantasse, lehnte sich wohlig seufzend im tiefen Ohrenklappsessel zurück und begann den letzten Gruß ihrer Tante, den sie zusammen mit allen möglichen Papieren bisher nur hatte überfliegen können, noch einmal in Ruhe zu lesen. „Wenn du diese Zeilen liest, bin ich schon tot und sitze hoffentlich im Himmel auf einer bequemen Wolke mit Aussicht. Auch wenn mich viele in meiner Umgebung lieber zum Teufel als nach hier oben gewünscht hätten. Aber den Gefallen werde ich ihnen nicht tun.“ Typisch Tante Wilhelm, lächelte Marthe, ertastete unter dem Berg von Papier, Zeitungen und leeren Kekstüten, Zigaretten und Feuerzeug, pustete ein paar verirrte Tabakkrümel vom Papier und las, was Wilhelmina Rastrup im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte am 22. August 1985 geschrieben hatte. Marthe sah auf das Datum und rechnete zurück. Das war drei Wochen, nachdem beide Tante Wilhelms Söhne bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen waren. Sie war tief gerührt, dass ihre Tante damals an sie gedacht hatte, ihre Nichte mit der sie, so wie auch mit dem Rest der Familie, seit Jahren keinen engen Kontakt gepflegt hatte.
Die Nachricht vom gewaltsamen Tod ihrer Söhne, hatte Wilhelmina sehr schwer getroffen. Schwerer als der Tod ihres Mannes, der im Alter von über 80 Jahren an einem warmen Spätsommertag friedlich in seinem Gartenstuhl eingeschlafen war. Ihre Söhne waren viel zu jung, um zu sterben, hatten das ganze Leben noch vor sich. Wilhelmina war nach dem Verlust ihrer Söhne nie wieder ganz die Alte geworden. Sie, die Gott und Kirche stets leicht abfällig als trügerische Krücke für schwache Seelen bezeichnet hatte, begann sich plötzlich mit befreundeten Geistlichen über biblische Rache und den Zorn Gottes zu unterhalten. Obwohl sie selbst keine Kinder hatte, konnte Marthe sich vorstellen, wie furchtbar es für ihre Tante gewesen sein musste, auf einen Schlag beide Kinder zu verlieren. Tante Wilhelm hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Söhnen gehabt, auch wenn beide in den USA lebten, wo sie gemeinsam einen vom Konkurs bedrohten Verlag aufgekauft, effektiv rationalisiert und im Laufe der folgenden Jahre in ein blühendes Unternehmen verwandelt hatten.
Die Begabung, aus dem Nichts ein solides Vermögen zu schaffen, war in der Familie ihres Vaters anscheinend nur in der weiblichen Linie vererbt worden, musste Marthe mit Bedauern feststellen, als sie an die weit weniger erfolgreichen unternehmerischen Vorhaben ihres Vaters dachte. Im Gegensatz zu seiner älteren Schwester hatte er nie richtig mit Geld umgehen können. Oder wie ihre Mutter es auszudrücken pflegte „kein Händchen dafür gehabt, ein Vermögen zu schaffen.“ Heinrich Twiete hatte stets dafür gesorgt, dass sein Geld zirkulierte, wie er es selbst ausdrückte. Oder „es mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen“, wie ihre Mutter sein Verhalten bezeichnete, wenn ihr Heinrich mal wieder mit einem neuen Wagen vorfuhr und ihr gleichzeitig mitteilte, dass sie auf das Haushaltsgeld für die kommende Woche noch warten müsse.
Tante Wilhelm hatte sich in den Jahren nach dem Tod ihrer Söhne noch intensiver in der Sozialarbeit engagiert, hatte Initiativen für Frauenhäuser und Obdachlosenherbergen unterstützt und kräftig gespendet. Ihr Haus hatte sie jedoch nicht irgendeiner ihrer wohltätigen Stiftungen oder dem Tierschutzverein vererbt, sondern ihrer Nichte. „Weil du mich damals als Baby so an meine kleine Elisabeth erinnert hast. Du hattest ihre Augen und ihr habt beide auf die gleiche Art und Weise eine Schnut ziehen können, dass man einfach lachen musste. Nimm es als sentimentalen Anfall einer alten Frau, aber ich habe einfach das Gefühl, dass mein Haus und alles, was darin steht, bei Dir in den besten Händen ist. Ich will nicht, dass Fremde meinen Besitz durchwühlen, schätzen, sortieren und verkaufen, wenn ich erst einmal nicht mehr bin.“
Marthe konnte sich gut an ihre Cousins Malthe und Haucke erinnern, die sie aufgrund des großen Altersunterschiedes immer wie freundliche Onkel behandelt hatten. Bei ihren seltenen Besuchen hatte es stets große Geschenke und haarsträubende Geschichten gegeben und in Marthes Augen führten die beiden das interessanteste Leben, das man sich überhaupt vorstellen konnte. Immer unterwegs, gewohnt auf internationalen Messen aufzutreten und sich mit größter Selbstverständlichkeit in luxuriösen Hotels einzuquartieren - Marthe war tief beeindruckt von soviel Weltläufigkeit. Von Tante Wilhelms Tochter wusste sie nur, dass sie schon als kleines Baby an irgendeiner Kinderkrankheit gestorben war. Damals in der schlechten Zeit, als es weder etwas zu essen gab noch wirksame Medizin. Sie hatte ihre Tante nie darüber sprechen hören und konnte bei näherem Nachfragen am Tonfall ihrer Mutter hören, dass das bestimmt kein Thema war, was man anzuschneiden wünschte. Wie alle Tantes schriftlichen Mitteilungen, war auch dieser letzte Brief an ihre Nichte in Sütterlinschrift verfasst, deren Entschlüsselung Marthes volle Konzentration erforderte. Marthe sandte einen dankbaren Gruß an Frau Meyer-Wüns, ihre alte Volksschullehrerin, die mit Argusaugen darüber gewacht hatte, dass ihre Schüler das verhasste hellblaue Brauseübungsheft mit säuberlichen Sütterlinbuchstaben füllten. „Ihr werdet es mir noch einmal danken, Kinder”, war ihre Standardantwort auf das vereinzelte Murren und Aufbegehren derjenigen Schüler gewesen, die bereits beim Erlernen des lateinischen Alphabets an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gestoßen waren und diese altmodische Krakeleien aus ganzem Herzen verabscheuten. Auf sechs soliden, cremefarbenen Bögen Büttenpapier mit Wasserzeichen und geprägtem Briefkopf erklärte Wilhelmina Rastrup ihrer Nichte in steiler, formvollendeter Schrift die Dispositionen, die sie in ihrem Testament vorgenommen hatte. „Auf gut Deutsch, weil ich mir nicht sicher bin, dass dieser Winkeladvokat es richtig wiedergeben kann, wenn ich erst mal unter der Erde bin.“ Auch das war typisch für ihre Tante, ein gesundes und mit zunehmendem Alter wachsendes Misstrauen gegenüber Anwälten, Steuerberatern und anderen, die in ihren Augen primär davon lebten, dass der Alltag für den Normalverbraucher so kompliziert geworden war, dass man ihn ohne fachmännische Hilfe dieser Art nicht mehr bewältigen konnte. „Vielen Dank Tantchen, besser hättest du diese Erbschaft überhaupt nicht timen können." Marthe hob ihre leere Kaffeetasse und prostete in Richtung Kaminsims, auf dem zwischen dem Wirrwarr von Kinderporträts in Sepiabraun bis Kodakcolor in einsamer Majestät das Hochzeitsbild von Wilhelmina und Laurids Rastrup herausragte.
Ein schönes Paar, dachte Marthe. Wilhelmina musste auf dem Bild Anfang dreißig, Laurids um die vierzig gewesen sein. Mit seinem jungenhaften Blick, dem leicht ironischen Lächeln und dem Grübchen am Kinn, erinnerte er Marthe an einen sehr schlanken Cary Grant und ihre Tante mit dezentem Make-up und elegant gestylter Frisur hätte ohne Probleme auf der Vorderseite einer Modezeitschrift posieren können. „Match made in heaven, ich hoffe ihr trefft euch da wieder.“ Marthe stemmte sich aus Sessel hoch und ging in die Küche, um Kaffeewasser aufzusetzen. Sie musste sich eine richtige Kaffeemaschine besorgen, der Kaffee aus dieser gläsernen Stempelkanne war immer lauwarm, wenn sie endlich zum Trinken kam. Während sie darauf wartete, dass das Wasser kochte, zündetet sie sich eine Zigarette an und sah in den Garten, in dem sich die kahlen Obstbäume filigran vom grauen Himmel abhoben. Zwei Amseln pickten in friedlichem Einvernehmen an einer Apfelmumie, Blaumeisen hingen am Kopf einer Sonnenblume, pickten die letzten fetten Kerne zwischen den leeren braunen Hülsen heraus und fraßen sich Winterspeck an. Kater Gustav, zerrauft wie immer und leicht hinkend, trottete über den Rasen und steuerte zielsicher auf die Katzenluke in der Küchentür zu. Es war so still, dass sie das Läuten der Kirchenglocken hörte, die den Feierabend ankündigten. Welch ein paradiesischer Frieden! Kein brummender Verkehr, kein hysterisches Hupen, kein klingelndes Telefon, nicht einmal ein Radio - einfach nur Ruhe. Dazu der ungewohnte Luxus, verschwenderisch mit dem Platz umgehen zu können. Laut Plan waren hier 380 m2 Wohnfläche - zuzüglich Schrankzimmer, Keller und Boden. Und dann war da natürlich der Garten. 2500 Quadratmeter gärtnergepflegtes Grün, wo man selbst um diese Jahreszeit noch die Blütenpracht erahnen konnte, die hier im Sommer herrschen musste. Eigentlich keine schlechte Alternative zu ihren zentral gelegen 80 Quadratmetern im dritten Stock mit Bushaltestelle in 50 Meter Abstand.
Nach der ersten Nacht alleine im Haus, in dem sie sich verloren und einsam gefühlt hatte, nicht hatte einschlafen können, weil alle Sinne angestrengt auf die fremden Geräusche, das Knirken von Dielenbrettern und das Blubbern der Luftblasen in den Heizungsrohren konzentriert waren, hatte sie ernsthaft überlegt, zurück ins Hotel zu ziehen. Zurück in anonyme, überschaubare Räume, unter Menschen, einem Frühstücksbüffet, wo der Kaffee am gedeckten Tisch serviert wurde. Doch bereits am Nachmittag, als die Sonne sich durch die graue Wolkendecke kämpfte und Licht durch die hohen Fenster strömte, das sich in den geschliffenen Scheiben der Flügeltüren, den Kristallspiegeln und dem großen Kronleuchter in allen Regenbogenfarben brach, begann sie entgegen aller Vernunft und Absicht das Haus in Besitz zu nehmen. Nach dem Frühstück machte sie es sich mit einem Buch in einem der geräumigen Korbsessel in der von Makler Sørensen verschmähten Glasveranda gemütlich und genoss dort Wärme und Nichtstun. Sie hatte ein paar Stücke von Tante Wilhelms schlimmstem Kitsch „alles königliches Porzellan Kind, unter Sammlern ein Vermögen wert“, in den Keller gestellt, ein paar Möbel verrückt, die zahlreichen Vasen mit Blumen vom Straßenhändler gefüllt, der seine bunte Pracht erstaunlich billig anbot und ihr sogar noch einen besonderen Rabatt gewährt hatte. „Frauen sollten ihre Blumen nicht selber kaufen! Sie sollen sie von ihrem Liebsten geschenkt bekommen“, hatte er beim Überreichen des Straußes proklamiert. Seit sie herausgefunden hatte, auf welche Weise sich der Abzug im Kamin ohne Kraftanstrengung öffnen ließ, hatte sie sich mit einem offenem Kaminfeuer verwöhnt, was für Marthe, die normalerweise über fünf gelblich gestrichenen Standardheizkörper verfügte, den Inbegriff von Luxus darstellte. Selbst der betagte Kühlschrank und die geräumige Speisekammer enthielten mehr kulinarische Attraktionen als in ihrer Hamburger Wohnung. Wenn sie sich abends mit einer Tasse Kaffee im riesigen Badezimmer in der alten Emaillebadewanne räkelte, las und rauchte, stellte sie sich vor, dass das hier der Beginn eines neuen und glücklicheren Lebens gemeinsam mit Stefan werden könnte. Wenn er wollte. Auf der anderen Seite: Was sollte sie hier mit einer fremden Sprache, ohne Job, ohne Freunde, in einem Riesenhaus alleine mit einem alten, fusselnden Kater. Würde Stefan sein warmes Nest in Blankenese verlassen und mit ihr gemeinsam hier ein neues Leben anfangen? Es war das erste, was ihr eingefallen war, als sie ihr Erbe mit all seinen schnörkeligen Details gründlich inspizierte. Das hier würde selbst ihrem anspruchsvollen Geliebten als passender Wohnsitz genehm sein. In gründlich renoviertem Zustand natürlich. In den letzten Tagen war ihr aufgegangen, wie vieles in ihrem Leben sie von Stefans Entscheidung abhängig gemacht hatte. Recht besehen ihre gesamte Zukunft. Ihre ewigen Vorbehalte beim Akzeptieren von Einladungen bei Freunden, um nicht eines der seltenen gemeinsamen Wochenenden mit ihm zu riskieren, das abendliche Warten auf eventuelle Gute-Nacht-Anrufe, das Glücksgefühl, wenn er sonnabendmorgens zu ihr kam und die Traurigkeit wegen der bevorstehenden Trennung, die sich schon beim späten sonntäglichen Frühstück einstellte. Eigentlich bestand ihre derzeitige Lebensplanung hauptsächlich darin, Rücksicht auf sein Leben und seinen Kalender zu nehmen. Pläne, über die sie nie offen sprachen, sondern die sie sich aus seinen Bemerkungen, seinem Verhalten, seinen Antworten selbst zusammenreimte.





























