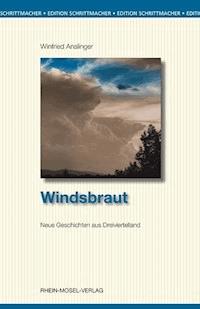
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Schrittmacher
- Sprache: Deutsch
Die Pfalz in den Sechzigern Ludwigshafen am Rhein. Die Schornsteine des Chemieriesen BASF speien tagtäglich giftig aussehende Nebelschwaden aus – 'an und für sich' unschädlich für die Anwohner, so wird ihnen versichert. In den Wohnblocks neben der 'Anilin' wachsen Kinder auf, die sich in Gartenlauben ihre eigene kleine Welt einrichten. Mit ihren Müttern machen sie Ausflüge in den nahe gelegenen Käfertaler Wald, wo auch noch zwanzig Jahre nach dem Krieg Amerikaner stationiert sind. Winfried Anslinger richtet den Fokus auf das Leben der kleinen Leute in der westdeutschen Provinz. Im Zentrum seiner Geschichten stehen Kinder, die man zum Bravsein und Duckmäusertum zu erziehen versucht. Hintergründig und phantasievoll blickt er hinter die heil aussehende Fassade einer Gesellschaft im Wandel und erzählt von der Zerbrechlichkeit der demokratischen Werte, von Verrat und Unwissen, von Vorurteilen und von Schuld. Aber auch von den Freuden Heranwachsender, ihren kleinen Fluchten und vor allem von ihren Träumen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Printausgabe gefördert durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz
Die Edition Schrittmacher wird herausgegeben von Michael Dillinger, Sigfrid Gauch, Arne Houben und Gabriele Korn-Steinmetz.
© 2010 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel.: 06542-5151, Fax: 06542-61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-784-8 Lektorat: Gabriele Korn-Steinmetz Titelbild: Peter Bohot/pixelio.de
Winfried Anslinger
Windsbraut
Neue Geschichten aus Dreiviertelland
Edition Schrittmacher Band 26
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Inhalt
Im Käfertaler WaldUngezieferDer Tag, als John F. Kennedy starbReise nach MesanesienWindsbraut
Im Käfertaler Wald
Mein erstes Kaugummi bekam ich von einem Amerikaner. Während eines Spaziergangs durch einen Kurpark im Schwarzwald tauchten plötzlich Männer auf, die waren vollkommen schwarz, so schwarz, dass man meinen konnte, sie wären durch einen Schornstein gefallen.
Ich war zutiefst erschrocken und wollte mich hinter dem Rock meiner Mutter verstecken.
Einer von ihnen kam auf mich zu, bleckte seine schneeweißen Zähne und gab mir etwas Flaches, rotgrün Bedrucktes in die zittrige Hand. Er grinste mich gutmütig mit breiten, rotvioletten Lippen an und machte dazu die lustigste Vogelschnute, die ich je gesehen hatte. Neugierig strich ich ihm über den Handrücken.
Ich wollte seine Mohrenhaut wegwischen, doch das Schwarze blieb haften. Meine Mutter tadelte mich und ich zog schnell die Hand zurück. Darüber mussten alle Erwachsenen lachen.
Die Männer sprachen in freundlichem Tonfall, doch ihre Stimmen klangen fremd und sie verwendeten Wörter, die ich nie gehört hatte. Der Schwarze, der mir das Kaugummi geschenkt hatte, zeigte darauf und machte Kaubewegungen. Die Mutter nickte mir lächelnd zu. Da wickelte ich den flachen Streifen mit spitzen Fingern aus und steckte ihn in den Mund. Ein scharfer Pfefferminzgeschmack stieg mir heftig in Mund und Nase, mir war, als hätten sie mich unter einen der Springbrunnen im Park gestellt.
Das war irgendwo im Schwarzwald passiert, während einer Kaffeefahrt, und lag damals schon Jahre zurück.
Amerikaner sah man nicht oft bei uns, und wenn, dann meist aus der Ferne. In unserer Stadt gab es nur Polizisten, Feuerwehrleute und den Schütz, der mit Flinte und grünem Rock die Anlagen bewachte. Diese sahen zwar den Amerikanern ähnlich, waren aber keine richtigen. Nur wenn man an Sonntagen in die Straßenbahn einstieg und über die Rheinbrücke fuhr, nach Mannheim hinüber, gab es richtige zu sehen. Sie trugen Uniformen. Dunkelgrün mit Messingknöpfen und Schulterstücken, schwarzen Stiefeln und Mützen, die wie Papierschiffchen über ein Meer aus gekräuselten Haaren fuhren oder schief auf kurzen, blonden Stoppelhaaren hingen, jedenfalls saßen sie nie gerade auf dem Kopf, wie die Schirmmützen unserer Polizisten.
Die meisten Amerikaner wohnten im Käfertaler Wald, wo es Kasernen gab. Wenn man mit der Straßenbahn das Mannheimer Stadtzentrum und die Außenbezirke hinter sich ließ, tauchte einige Haltestellen später der Anfang dieser Kasernen auf: Reihen großer, hoch gestockter Gebäudeblöcke, gelb gestrichen mit roten Sockeln und Fensterlaibungen, ähnlich einer Schule, nur waren statt der Kinder eben Soldaten drin. Hinter den Mannschaftsblocks gab es viele weitere Gebäude auf dem Terrain, die man von außen nicht sehen konnte: Schuppen und Hallen für das militärische Gerät, Geschäfte, Parkplätze, Sportanlagen, eine Kirche. Das gesamte Kasernengelände mit all seinen Einrichtungen sei wie eine eigene Stadt, hieß es. Dort sei alles viel großzügiger als bei uns, eben amerikanisch.
Auch der Käfertaler Wald war groß. So groß und so tief, dass kleine Leute wie wir sich leicht darin verlaufen konnten, um dann für Stunden oder Tage nicht wieder aufzutauchen. Endlos zogen sich Alleen und holprige Spazierwege durch Dickicht und hallenartige Buchenbestände. An manchen kerzengeraden Durchgängen schien das Blätterdach von den Seiten her am Horizont zusammenzuwachsen. Kleine, krumme Pfade führten durch Gebüsch und über Wurzelwerk, an Ameisenburgen und krautigem Unterholz vorbei. Manche Wege endeten auf einer verwunschenen Lichtung, als hätte jemand den Wanderer in die Irre führen wollen, oder als sei dies ein Platz, auf dem die Zeit stillstand, sobald ein Mensch sich dort einfand.
Ein Jäger aus Kurpfalz könnte hier mit seiner Meute entlanggeprescht sein, um einen Hirschen mit schwerer Büchse daherzuschießen, grad wie es ihm gefällt.
Das Lied hatten wir in der Schule gelernt und ich konnte mir gut vorstellen, wie die Treiber mit Hunden und lautem Radau das Wild aufscheuchten, dem Jäger vor die Flinte.
Manchmal träumte ich davon, Tarzan zu sein, plötzlich hoch oben auf einem Ast zu erscheinen, mit Jane an der Hand; erst hielt ich Ausschau, dann holte ich tief Luft, dann rief ich das Aaaeeiiiouuu.
Ich war gern im Wald, vor allem mit meinen Kameraden, und obwohl die Erwachsenen nicht immer Lust dazu hatten, verbrachten wir unsere Frühlingssonntage häufig im Grünen, weil wir sie zu überreden verstanden.
An einem dieser hellen, sonnigen Maiwochenenden waren wir wieder einmal in die Straßenbahnlinie vier gestiegen und bis zur Endhaltestelle in Käfertal gefahren: Frau Meyerlink mit ihrer Tochter Heidi, Bob, ein Klassenkamerad, meine Mutter und ich. Mit Bob, der in der Schule eine Bank vor mir saß, verbrachte ich viele Nachmittage. Er überragte mich um Kopfeslänge, weil er kräftig gebaut und in der dritten Klasse sitzen geblieben war. Sobald die Lehrer uns den Rücken zukehrten, gab er den Ton an, denn weder auf dem Fußballplatz, noch mittags beim Rollschuhhockey konnte ihm jemand was vormachen. Fast alle Jungs wollten Bob zum Freund. Heidi ging in die parallele Mädchenklasse, wir akzeptierten sie bei unseren Waldabenteuern notgedrungen, weil deren Mutter immer mit meiner Mutter zusammensteckte. Folglich war Heidi bei diesen Ausflügen oft dabei.
Als wir in der Mittagshitze den Pfauenschrei hörten, wussten wir, dass bald zwischen den Buchenhecken eine weiß gestrichene Veranda auftauchen würde und der steil aufragende Spitzhut eines mit kühnem Schwung darüber gespannten blaugrünen Daches, unter dem sich Buffet, Küche und die wettersicheren Plätze des Sterncafés befanden. Die Pfauen kündigten das Café an wie eine Kirmesorgel den Jahrmarkt.
Unter Ahorn, Eichen und Lindenbäumen luden weiß gestrichene Gartenstühle vor runden Tischchen zum Verweilen ein, doch klebten die meisten vom Lindensaft, der nach Windstößen in winzigen Tröpfchen herabregnete.
Sobald wir Platz genommen hatten, vertieften sich die Mütter in ihre wichtigen Gespräche und beachteten uns nicht mehr.
Im wogenden Halbschatten der hohen Bäume beobachtete ich eine kleine Spinne, die über dem Nebentisch an einem glitzernden Faden schwebte. Sie schien unentschlossen zwischen Bierglas und Eisbecher zu pendeln, die zu einem bronzefarbenen Uniformierten und zu einem grell kostümierten Fräulein mit Ponyfrisur und Seidenschal gehörten. Ein zweiter Mann saß mit am Tisch, der strich mit dicken Fingern über seine kräftige Kinnlade und verzog den Mund zu einem breiten Grinsen. Er hielt dem Fräulein ein Päckchen Zigaretten hin. Sie legte den Kopf leicht zur Seite, spitzte die rot bemalten Lippen, nahm eine Zigarette heraus und zündete sie am Feuerzeug des Anderen an.
Es gab manches hier, was meine Aufmerksamkeit erregte. Unter den Tischen trippelten Perlhühner und Spatzen auf dem Kies, die nach Kuchenkrümeln suchten, welche von den Tischen herunterfielen, oder die ihnen Kinder hinwarfen. Da Obstkuchen und Bienenstich hier meist etwas läpsch schmeckten, bekam die gefiederte Gesellschaft viel ab. Ans Freigelände schloss sich ein kleiner Zoo mit Wieselkäfigen und Volieren an. Daneben, auf einem Holzschuppen, dösten zwei Katzen in der Sonne. Hinter dem Maschendraht zwitscherte laut eine Schar bunter Sittiche und Finken, während nebenan das Wiesel zwischen Futternapf, Versteck und Kletterbaum hin- und herflitzte. Das größte Gehege aber gehörte den Pfauen.
Plötzlich fiel Heidis Kakaotasse um, das braune Getränk ergoss sich über den Blechtisch und auf ihr Kleid.
»Herrgott, kannste nich aufpassen?«, bellte Frau Meyerlink, bevor sie ihr eine schallerte. Dann riss sie hektisch ein Tempo aus ihrer Tasche und versuchte, die lauwarme Flut einzudämmen.
»Dat Kleid hat neundundzwanzig Mark jekostet.«
»Ma zieht dene Kinner do besser kä nei Zeig on«, sagte meine Mutter und half, so gut es ging, Heidis Schürze trockenzutupfen. Fleckig war sie jetzt, nicht mehr so wie eine Mädchenschürze aussehen sollte, und das Fleckige legte sich auch auf die Gesichter der Frauen. So konnte man sich doch nicht zeigen. Wie sah das denn aus? Jeder hätte gedacht, bei uns ging es zu wie bei Leuten, die ihre Kinder nicht recht erzogen, so dass sie unbedachte Bewegungen machten, altklug in die Gespräche der Großen hineinplapperten, um den Tisch herumtobten. Mit solchen Familien pflegten unsere Mütter keinen Kontakt.
In unseren Kreisen tunkten Kinder mit verschwimmendem Blick Kuchenscheiben in Porzellantassen und schwiegen. Im Beisein der Großen wurde Bravsein von uns erwartet und das Bravsein leitete sich von Dankbarkeit her. Dankbar mussten wir sein für den Haferschleim am frühen Morgen, der zäh vom Löffel rann. Für die Schule, auch wenn dort in der Ecke drohend ein langer Holzstock auf uns wartete. Für den gedeckten Tisch am Mittag, wo der Teller stets leer zu essen war. Dankbarkeit war eine zwiespältige Tugend voller Gehorsam und eine langsame Tugend voller Rücksichtnahmen, die nach Kölnisch Wasser roch, das jedoch überlagert war vom Schweißbukett vornehmer, älterer Damen.
Frau Meyerlink und meine Mutter waren immer noch dabei, Heidis Kleid trockenzutupfen. »Wer weiß, ob dat noch man rausjeht …«
Das Fräulein am Nachbartisch warf einen spöttischen Blick zu uns herüber und sprach leise mit ihren Begleitern. Meine Mutter beugte sich zu Frau Meyerlink und begann zu flüstern. Die sagte daraufhin: »Ja nu, muss sie selber wissen. Sind ooch Menschen.«
Meine Mutter meinte schulterzuckend: »Wann so ä jung Ding halt meent, sie kriegt kenn annerer mehr ab.«
Bob war inzwischen aufgestanden und zu den Volieren gegangen. Von dort gab er Heidi und mir Zeichen. Unsere Mütter waren so vertieft in ihr Gespräch, dass sie nicht bemerkten, wie wir leise aufstanden und uns davonmachten. Bob stand schon am Pfauengehege, wo er den Ruf des Männchens nachzuahmen versuchte und dabei Grimassen schnitt, damit es sein Rad schlug. Doch heute blieb der Federnstrauß unten. Die Tiere liefen lustlos herum und wirkten in der Mittagshitze schläfrig. Wir bemerkten die offenstehende Tür erst, als ein Weibchen gerade hindurchlief und weghuschte.
Aufgeregt rannten wir um die Gehege herum. Vielleicht bot sich jetzt Gelegenheit, diesen stolzen Vogel einmal anzufassen, zu streicheln oder gar wieder einzufangen. Die Cafébesitzer würden uns dafür bestimmt mit Extraeis und Schokoladentorte belohnen, was uns besser schmeckte als der Bienenstich. Aber schon war das Weibchen weg. Wir rannten hinterher, durchstreiften Gebüsch und Unterholz. Doch jedes Mal, wenn wir uns ihm näherten, machte es einen Satz und war mit ein paar Flügelschlägen wieder unerreichbar. So ging es eine Weile kreuz und quer durch den Wald, bis uns die Lust auf Pfauenjagd vergangen war.
Bob blieb stehen und wischte sich übers verschwitzte Gesicht. Heidi pulte einen Stein aus ihrem Schuh.
»Habt ihr die zwee Amis gesehe?«, fragte sie.
»Habe Zähn wie aus de Kukidentreklame«, prustete Bob. Seine Kulleraugen leuchteten im kaffeebraunen Gesicht, während er sich die Hand vor den Mund hielt. Seine Handinnenflächen erschienen heller als die übrige Haut.
»Mitte im Wald gibt’s ganz viele Amis«, belehrte er uns, »die habe do aach Panzer un Kanone, sogar Flugzeuge!«
Obwohl Bob bestimmt viel seltener in Mannheim gewesen war als wir anderen, wusste er am besten über die Amerikaner Bescheid und was mit ihnen zusammenhing.
Ich hatte schon erwogen, ob sein Vater vielleicht ein Ami sein konnte, er sah ja anders aus als wir. Gefragt hatte ich ihn nie.
Bob wohnte allein mit seiner Mutter in der Rheinfeldstraße über einer Sattlerei, einen Mann hatte ich nie dort gesehen. Frau Lehmann bediente im Bürgerbräu. An Nachmittagen, wenn nichts los war, durften wir sie dort besuchen. Dann hockten wir an einem Nebentisch hinter dem Tresen, wo es zur Garderobe ging und die Kellner zur Küche eilten, verschlangen Bratwürste mit Kartoffelpüree, Sauerkraut oder was sonst noch übriggeblieben war und überlegten, was wir mit dem Rest des Tages anfangen sollten. Danach gingen wir meist ins San Remo, wo neben blinkenden und rotierenden Spielautomaten eine Musikbox stand. Mit ein paar Münzen konnte man eine Urwaldkapelle mit Affen und Negern in hektische Bewegungen versetzen, wobei ein Jazzstück erklang. Die Affen hatten Knopfaugen und dicke Lippen, die Neger Kraushaar und ein Affenfell. Alle trugen sie bizarre Kostüme aus Silberpapier, bunten Stofffetzen, Blumengirlanden und Bananenketten, die an Fäden aufgereiht um ihre dicken Bäuche hingen. Die Saxophone und Trompeten schwenkten im Takt, der Schlagzeuger trommelte und warf dabei den Kopf so wild umher, dass man meinte, er werde gleich einen Artgenossen ergreifen und auf der Stelle verschlingen. Irgendwie kam mir dabei der unbekannte Vater von Bob in den Sinn und ich stellte mir vor, dass er auf diese Art auch den Bob gemacht haben könnte. Mit diesem Hecheln und Schieben, dem gehetzten Hin und Her zur wilden Jazzmusik. Der kohlpechrabenschwarze Mann in die schneeweiße Frau, Schwarz in Weiß und Weiß in Schwarz, das fühlte sich irgendwie seltsam an. Vor allem, wenn die Mutter vom Bob Lehmann damit zu tun haben sollte, die mir alles andere als wild und jazzmäßig vorkam, wenn sie im Bürgerbräu Essen auftrug oder die Gäste abkassierte.
Das Pfauenweibchen war weg und wir standen mitten im Wald, und der Wald war tief, so tief und grün und so wunschvergessen wie ein Wald nur sein konnte.
Wir lauschten und hörten tausend Stimmen ringsum. Kein Pfauenschrei. Bestimmt waren wir sehr weit vom Café entfernt. Mitten drin im Käfertaler Wald, irgendwo. Bei der Pfauenjagd hatte keiner auf den Weg geachtet. Wie sollten wir jetzt zurückfinden? Heidi schlug vor, in Richtung der Nachmittagssonne zu laufen. Im Café habe sie auch so gestanden, daran könne man sich orientieren.
Heidi Meyerlink sah aus wie aus dem Heimatfilm und war das genaue Gegenteil von Bob: Dicke, blonde Zöpfe hingen ihr über die Schultern, Sommersprossen verteilten sich gleichmäßig über Nase und Wangen. Ihre Kleidung war normalerweise ordentlich und sauber, die Schürze gestärkt. Wenn sie sich aufregte, konnte ihre Gesichtsfarbe ins Tiefrote umkippen. Sie wohnte mit Eltern und Oma in einem Häuschen mit Garten, der Vater war Vorarbeiter bei Gerüstbau Nachbauer. Sie führte nie das große Wort. In den Mädchenklassen ging es ohnehin viel ruhiger zu als bei uns Jungs, wo es auf Kraft und Stimme ankam und auf eine Prise Kühnheit.
Bei den Mädchen zählten andere Dinge. Trotzdem waren Bob und ich gern bei Meyerlinks. Wenn unsere Mütter sich nachmittags auf deren Terrasse bei Kaffee und Frankfurter Kranz trafen, kochten wir Kinder im Garten Suppen aus Brunnenwasser, Sand, zerquetschten Raupen und Sauerampfer, wobei Heidi den Kochlöffel führte. Hierbei hatten wir nichts zu melden. Anschließend stürmten wir ins Wohnzimmer, weil dort der einzige Fernsehapparat stand, den es in unserem Viertel gab. Heidis Vater fuhr oft auf Montage und verdiente gut. Wir profitierten davon indirekt, indem wir zweimal die Woche im Nachmittagsprogramm die Serien aus Amerika anschauen durften. Wenn an den Migränetagen meiner Mutter eine Folge für Bob und mich ausfiel, hielt uns Heidi auf dem Laufenden.
Panzer und Flugzeuge. Weit weg waren wir jetzt von unseren Gluckenmüttern, weit weg von den Daunen ihrer Fürsorge, mit der sie am liebsten die ganze Welt überdeckt hätten. Jetzt lockte das Abenteuer. Wir stapften den sandigen Weg entlang, wo hohe Kiefern über uns im Wind kreisten.
Auf einer kleinen Lichtung erhob sich ein Strommast zum Himmel, Drähte sirrten, helle Popcornwolken zogen darüber hin.
»Jetzt komme mer bald an die Prärie«, flüsterte Bob geheimnisvoll. »Wann de Wald uffhört, fangt Amerika an.«
Wie die jungen Birken hier standen und das hohe Gras, wirkte das tatsächlich, als sei man am Moore Creek unterwegs oder in den Blue Hills von Kentucky. Es hätte mich nicht gewundert, wenn plötzlich Lassie oder Rin Tin Tin aus dem Gebüsch gesprungen wären.
»Eh Mom, Jimmy’s Pferd ist in ein Loch gefallen. Wir müssen Hilfe holen.«
Amerika … Mitten im Wald begann vielleicht die Prärie und irgendwo dahinter mussten die Kasernen liegen. »Klein Amerika« nannten die Leute diesen eigentümlichen Ort. Von dort aus kamen sie zu uns in die Städte, in die Parks und zu den Fräuleins, weiße, schwarze und braune Soldaten, solche mit Bürstenschnitt oder Kraushaar, in grünbunten Uniformen, lachend und Kaugummi kauend.
Und die Kiefern, die sich mit knorrigen Wurzeln in den Sandboden krallten, standen in Wirklichkeit am Moore Creek, wohin Lassie Jeff und Timmy geführt hatte, als sie die Pferde suchten …
»Oh Gott, Jeff, das schaffen wir nie! Noch zwanzig Meilen bis Thornton City, Mummy wird uns suchen.«
Als geübte Waldläufer folgten Bob und ich jetzt der Stromtrasse und Heidi hielt zu unserem Erstaunen gut mit. Wir schlugen uns durch niedrigen Aufwuchs, umgingen stachelige Brombeerhecken.
»Do – en Hochsitz, nix wie druff!«, rief Bob plötzlich.
Schnell waren wir die grobe Holzleiter hinaufgeklettert. Von oben konnte man die Schneise bis zur nächsten Biegung überblicken, wo die Drähte sich in den Kronen der Nadelbäume verloren. Wie Storchennester hockten sie auf rötlichbraunen, nackt abblätternden Stämmen. Amerika musste dahinter liegen, aber es waren weder Prärie noch Kasernen zu sehen.
»In Amerika is halt alles größer. Do muss mer länger laafe«, vermutete ich.
Heidi war die wacklige Aussicht nicht geheuer, wir stiegen hinunter und schlugen uns weiter durch, von Mast zu Mast.
Neben einem Holunderbusch fiel mein Blick auf etwas Buntes. Als ich näher kam, erkannte ich einen Koffer im Dickicht. Aufgeschlagen, mit Kleidungsstücken, Kamm und Bürste drin. Eine weiße Bluse, Unterwäsche sowie zerbrochene Schminksachen lagen im Unterholz. Heidi entdeckte einen hellblauen Faltenrock, der halbhoch im Holunderbusch hing, daneben auf dem Waldboden lag ein Soldatenkäppi. Das hob ich auf und steckte es ein.
»Dess do hat eener Fraa geheert.« Heidi zeigte auf den Koffer.
»Wer schmeißt dann sein Koffer mitte in de Wald?«
»Die Fraa is bestimmt ermord worre!«, rief Bob.
Die Wäschestücke schienen schon länger hier zu liegen, im Koffer stand eine kleine Wasserpfütze.
»Hier verschwinde manchmal Fraue«, sagte Heidi, »die werre oft viel später gefunne imme Busch un sinn dann als schunn ganz verwest.« Nun roch ich es. Etwas seltsam Fauliges stieg mir in die Nase. Unter dem Holunderbusch war es nicht geheuer. Vielleicht alles Einbildung, denn ein aufgeschlitzter Autositz lag auch dabei und ein verrosteter Kinderwagen. Ich hätte besser nachgeschaut.
»Des war bestimmt en Ami!« Heidi sah sich ängstlich um.
»Die Ami machen viel Schweinereie«, bestätigte Bob. »Am Kaufhof hot eener mol zwee Kinner dotgefahre. Vollgesoffe. Dem is hinterher nix passiert. Wann die was anstellen, werre se änfach in ä anderes Land versetzt un schunn is alles erledigt.«
Wie auf Kommando rannten wir los, Zweige zerkratzten unsere Beine und verfingen sich in den Kniestrümpfen, rissen kleine gekräuselte Fäden heraus. Wir liefen, bis uns die Luft weg blieb. Als wir endlich innehielten, schloss ich die Augen. Sterne flogen an mir vorbei, ich musste mich erschöpft auf den Knien abstützen.
Vor meinen geschlossenen Lidern sah ich zwei Männer, wie sie eine Frau festhielten, die zappelte und schrie. Ein dritter rammte ihr etwas Schwarzes in den Bauch, etwas Schwarzes, das sie kaputt machte, weißer Schaum quoll aus ihr heraus. So wie damals aus dem dicken Erwin bei der Messerstecherei auf dem Hemshof. Ich sah wieder, wie er sich auf dem Boden krümmte und ein hohles Stöhnen hervorpresste, dann wieder dieser weiße Schaum. Schwarze, schwarze Männer, die stechen in einen schneeweißen Bauch, die schneeweiße Mutter, die schreit, dass es durch den Wald hallt, aber es ist Nacht, niemand kann sie hören.
Langsam gingen wir weiter. An einer Hainbuche summte und schwirrte es: Maikäfer! Die ersten in diesem Jahr. Sie brummten wie kleine Hubschrauber, beschrieben eckige Flugbahnen und schwerfällige Kurven, landeten mit abgespreizten Flügeln auf den Zweigen. So viele Krabbeltiere auf einmal hatte ich noch nie gesehen. Bei uns in der Stadt war seit Jahren kein einziger mehr aufgetaucht. Wahrscheinlich wegen der großen Fabrik und deren Chemiegestank, das bekam weder Mensch noch Tier. Aber die Fabrik war nötig, sonst hätten wir nichts zu essen gehabt. Sagte man uns. Auch dafür musste man dankbar sein.
Früher soll es so viele Maikäfer gegeben haben, dass die Kinder sie in Schuhkartons gesammelt haben. Und noch früher, als die Großeltern klein waren, soll es eine richtige Plage mit ihnen gegeben haben. Ganze Bäume hätten sie an einem einzigen Tag kahl gefressen. Eimerweise verbrannten die Leute sie hinter Scheunen, bis ihnen von dem beißenden Qualm die Augen tränten.
»Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg«, sang man dabei, »die Mutter ist im Pommerland, und Pommerland ist abgebrannt.«
Panzer und Flugzeuge, Kasernen und Amis, Wald und Maikäfer, alles hatte irgendwie mit dem Krieg zu tun, sogar die harmlosen Käfer erinnerten an abgebrannte Länder. Der Krieg schien allgegenwärtig, obwohl schon lange Frieden herrschte. Vielleicht lebten wir in einer Zwischenkriegszeit, wo man sich erholte und Kräfte sammelte für den nächsten Waffengang.
Wahrscheinlich war das zu allen Zeiten so. Schon der Großvater hatte ja ins Feld gemusst, Bob und ich würden es wohl auch einmal müssen. Man sagte zwar, die Welt wäre seit fünfundvierzig anders geworden, doch das stimmte nur, soweit es um Kaugummi ging und Coca-Cola, um die Jazzmusik und die Fernsehserien, das Neue war einfach nur hinzu gekommen ohne das Alte zu ändern.
Mit Ausnahme meines Vaters. Der war verändert aus dem Krieg zurückgekehrt mit nur einem Bein, und einem Stumpen, an dem er sich die Hose mit einer Klammer hoch steckte. Angeblich war das an der Ostfront passiert. Ich stellte mir vor, wie er viel Mühe gehabt hatte beim schweren Handwerk des Friedhofmachens im Krieg, beim Füllen von Soldatengräbern. Diese Mühe muss einen anderen aus ihm gemacht haben, einen, der keine Geduld mit den Leuten mehr aufbrachte, der immer gleich brüllen musste, wenn etwas schief ging. Leider kannten ihn aus der früheren Zeit nur die Älteren. Der Großvater sagte einmal zu mir, ich müsse dankbar sein, überhaupt noch einen Vater zu haben: »Zwee Kamerade, die nebe ihm gelege hawwe, die hotts verrisse.«
Dieser Gedanke erschien mir unlogisch. Kinder ohne Vater, das gab es doch gar nicht. Wäre der Vater ebenfalls zerrissen worden, hätte ich vermutlich einen Vater bekommen wie der Bob, einen mit gekräuselten Haaren vielleicht und einer Schiffchenmütze auf dem Kopf, die immer schief saß, der mir Kaugummi schenkte und eine rotviolette Vogelschnute machen konnte.
Ich klaubte zwei Maikäfer, die sich gerade paaren wollten, von einem Blatt. Ihre Beine kitzelten auf den Händen. Heidi schüttelte sich und schlug um sich, als einer auf ihrem Kopf landen wollte.
Ein Ami als Vater, dachte ich, wäre so schlecht nicht. Für mich jedenfalls. Nur für den Großvater wäre es schade, denn der würde dann ja meine Mutter nicht kennen und müsste am Heldengedenktag zum Denkmal mit den Sandsteinsoldaten gehen. Wie die Müllers, deren beide Söhne dort auf einer Bronzetafel standen. Aber er müsste sich dafür nicht ärgern über eine Schwiegertochter, die mit dem Haushaltsgeld nicht auskam und behauptete, er trinke zu viel.
Mir könnte das gleich sein, weil ich einen anderen Großvater in Amerika besuchen dürfte, jemanden, der auf einem Pferd ritt und mit dem Lasso Rinder fing. Wir säßen dann am Lagerfeuer und er erzählte mir Geschichten vom wilden Westen, als es dort noch Büffel und Indianer gab.
Hier im Wald gab es wenigstens noch Maikäfer. Nach ihnen war vielleicht die ganze Gegend benannt: Maikäfertal. Man konnte sie von den Zweigen pflücken wie Stachelbeeren, sie rochen nach Frühling und der Wald roch nach ihnen.
Aber da war plötzlich noch ein anderes Brummen in der Luft. Ein mechanisches, mit einem rhythmischen Flügelschlag drin. Es wurde immer lauter und schließlich so beängstigend, dass wir die Köpfe einzogen.
»Die Amis!«, schrie Bob und ging in Deckung. Ein schwarzer Raubvogelschatten erschien über uns, rückte in die Schneise vor, peitschte unsere Trommelfelle mit platzendem Knattern wie ein Maschinengewehr, blieb für ein paar betäubende Augenblicke über uns stehen und verschwand dann wieder im Geäst. Als das Gedröhn verebbte, waren wir alle drei bleich um die Nase.
»Die Ami«, stieß Bob hervor, »dess sinn richtige Gangster.«
Auf der Ponderosa fragte Johnny:
»Macht es dir etwas aus, dass Milly ab morgen bei uns arbeitet?«
Er lehnte sich an die Scheunenwand, zwischen Wagenrad und Holzpflug. Buck steckte die Hände in den Gürtel und sagte schnaufend: »Ich meine, wir hätten bis nach der Hochzeit warten sollen. Den Millers ist nicht zu trauen. Das waren immer schon Viehdiebe. Der Vater wurde deswegen in Laremy gehenkt.«
In der »Bonanza«-Serie wurde man bereits für einen Diebstahl an den Galgen gehängt.
Als Wolfgang der Marianne in der Schule einen Anorak geklaut hatte, musste er bloß nachsitzen und vierzig Mal schreiben: »Du sollst nicht stehlen.« So war es bei uns. Doch zu welchem Land gehörte der Wald, in dem wir uns gerade befanden? Wenn Amerika mittendrin anfing, konnte das gefährlich werden. Vielleicht waren wir schon über der Grenze – und ich hatte das Käppi bei mir! Käme ich dann auch unter so einen Steinbogen, wie sie in Laremy vor den Haciendas standen? Man wurde mit gefesselten Händen auf den Rücken eines Pferdes gestellt, bekam die Augen verbunden und eine grobe Seilschlinge um den Hals gelegt. Dann sprach einer mit rauchiger Stimme: »Hast du uns noch etwas zu sagen, Fremder?« Er schaute dabei in die Ferne, hinüber nach New Mexico, und machte ein Gesicht, als hätte er saure Fruchtbonbons im Mund. Aus einer Mundharmonika erklang ein einsamer Ton, dann bekam das Pferd ein scharfes Kommando und man baumelte wie ein Strohsack im Gegenlicht der Sonne, die blutrot über den Squaw Hills unterging.
Schnell warf ich das Käppi ins Gebüsch.
Nachdem über uns alles wieder zur Ruhe gekommen war, setzten wir unseren Streifzug fort, durch hohes Gras, unter jungen Buchen und Akazien. Ich fragte mich: Wie konnte eine Frau sich hierher verlaufen haben? Es war doch sehr einsam in diesem Wald. Wären wir nicht zu dritt, ich würde mich fürchten, obwohl ich ein Junge war. Vielleicht hatte man sie erst im Nachhinein hierher gebracht, versteckt im Kofferraum eines Amischlittens.
Ich schloss für Momente die Augen und sah ein Auto über die Sandwege fahren, das hielt an einer Lichtung. Zwei Männer stiegen aus, öffneten den Kofferraum und hoben einen Sack heraus. Wie einen Gegenstand packten sie ihn an und schleiften ihn ins Unterholz. Den Koffer warfen sie hinterher. Einer verlor dabei sein Käppi.
Möglich, dass sie immer noch hier lauerten. Sie würden uns von hinten anrufen mit ihren rauchigen Bassstimmen, Bob und mich kaltblütig niederstrecken wie der Jäger das Wild, jeden von uns mit einem einzigen, gezielten Blattschuss. Heidi würden sie übrig lassen, um diese schmutzigen Sachen mit ihr zu machen. Alle drei kämen wir danach unter den Holunderbusch.
Bob brach einen Zweig ab und machte daraus eine Art Machete, mit der man sich einen Weg freischlagen konnte. Der Stock pfiff in der Luft, riss und fetzte am Blattwerk. Ich las Steine auf und brach mir eine Astgabel passend zurecht. Wenn sie kämen, mussten wir uns damit verteidigen oder sofort auseinander rennen. Dann kriegten sie nur einen oder zwei von uns zu fassen und der dritte konnte Hilfe holen.
Es gab jedoch weder einen Hinterhalt, noch kam uns jemand entgegen. Stattdessen fanden wir zwischen jungen Tannen einen Ameisenhaufen. Wild stocherten wir mit unseren Stöcken hinein, dass große Schollen herausbrachen und das Innere frei lag. Wie mühsam hatten die Tierchen ihre Behausung gebaut, unzählige Tannennadeln zusammengetragen und mit Erde verbacken. Jetzt rannten sie aufgeregt durcheinander und suchten ihre weißen Puppen in Sicherheit zu bringen. Sie wimmelten über den Boden, kletterten an den Stöcken hoch, erklommen unsere Beine, wo es gleich brennend zu jucken begann. Erstaunt stellte ich fest, dass es in ihrem Bau richtige Straßen gab, in denen tote Raupen und Fliegen transportiert wurden. Sie führten zu Höhlen, in denen auch ihre Larven lagen, kunstvolle Kavernen und Schächte, vielleicht hielten sie mehr auf Ordnung als wir. Wir beeilten uns, weiter zu kommen. Das hätte nicht sein müssen. Aber es gab so manches, was nicht hätte sein müssen.
Die Lincoln-Brothers beispielsweise. Warum mussten die plötzlich in der Stadt auftauchten?





























