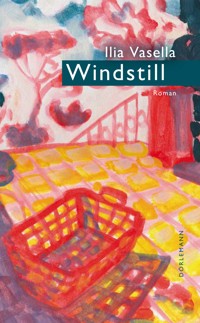
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein heißer drückender Sommermorgen in Südfrankreich. In einem leicht verfallenen Schloss verlebt eine zusammengewürfelte Schar von Gästen entspannte Ferientage. Sie kochen gemeinsam, trinken auf der Terrasse Wein und genießen den Blick auf die blaue Bergkette in der Ferne.Dann passiert das Unfassbare: Marie rutscht aus und stürzt. Sie ist auf der Stelle tot. Die Anwesenden bahnen sich einen Weg durch die ersten Stunden nach ihrem Tod – Dorothea faltet Maries Wäsche, Odile setzt sich ans Klavier, Stephan flüchtet mit den Kindern in den Garten. Bei jedem hinterlässt Maries Tod andere Spuren, bleiben andere Erinnerungen zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ilia Vasella
Windstill
Roman
DÖRLEMANN
Die Autorin dankt dem Kanton Zürich für den Werkbeitrag, der sie bei der Arbeit an diesem Buch unterstützte. Der Verlag bedankt sich bei der Stadt und dem Kanton Zürich für die Unterstützung der Publikation.
Alle Rechte vorbehalten © 2021 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung einer Illustration von Anna Albisetti Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-087-4www.doerlemann.com
Inhalt
Für Matildaund alle unsere Toten
Als Marie mit dem Wäschekorb vor der Brust die Treppe zur Terrasse hinaufkommt, ist es beinahe windstill. Marie hält den Korb mit beiden Händen, sie schaut auf die hastig von den Klammern gezogenen Kleidungsstücke, nah ihren Augen, unüblich nah schlingern Buchstabenfragmente auf dem Gummiband einer Unterhose, Franz trägt sie nicht oft, geschwungene Buchstaben, blau auf schwarzem Grund, sie bemerkt sie zum ersten Mal, stellt Marie schlaftrunken fest, sie sucht das Wort, einen Sinn, und ihre Gedanken schweifen weg, zu den Dingen, die im Haus verstreut liegen, zu den Koffern, die sie packen wird für die Weiterreise, die Weiterreise mit Franz; und sie riecht den Kaffee vermischt mit dem trägen Duft des Feigenbaums. Ihr Blick rutscht nach oben, sucht Orientierung, aus dem Augenwinkel sieht sie die Katze, wie sie dem Geländer entlangstreicht, und dann Franz, wie er mit der Kaffeekanne im Türrahmen steht, als sie ausrutscht, weil etwas sich bewegt, auf das sie tritt, sich schnell wegbewegt und Marie das Gleichgewicht verlieren lässt, sie fällt nach hinten, mit einem kleinen, überraschten Schrei, ein scharfes Aufseufzen, der Korb entgleitet dem Griff ihrer Hände, Marie fällt, ihr Kopf trifft auf das metallene Rohr des steinernen Schirmfußes. Marie in ihrem schnell übergeworfenen, leicht zerknitterten Sommerkleid, Marie ist auf der Stelle tot.
In den Sommermonaten summt und surrt das Haus an allen Ecken und Enden, die Schwellen zwischen dem rissigen Gips der Zimmerwände und dem dickwandigen Grün der Umgebung lösen sich in den Geräuschen auf. Spielzeuggefährte rollen durch den Gang zur Terrasse und Stimmen schwirren auf und ab, denn die Mauern sind dick und aus Stein, aber die Böden voller Ritzen, durch welche man da und dort in die unteren Zimmer blicken kann. Das Haus mit dem grünen Herzen saugt Menschen auf und spuckt sie am Tag ihrer Abreise wieder aus, auf dem Landweg, den Gebüschen und Bäumen entlang fahren sie zum Zug, ins Dorf, zur Autobahn. Beinahe täglich wird durch die Gänge ein neues Netz gewoben, in den Knoten verfangen sich Kinder. Die Kinder springen an einem hoch, wenn sie eine Weile im Haus verbringen, und bilden ihr eigenes verwickeltes Geflecht, sie sind von Statur kleiner und halten den Winden gleichmütiger stand. Der Wind kommt unerwartet und zerrt an den Nerven der Gäste, er lässt Fenster und Türen zuschlagen im Haus auf der Hügelkuppe, in der Nacht fährt er in die Bäume, so dass ein Rauschen in den Schlaf dringt wie von Regen. Eigentlich ist das Haus ein Schloss.
Wie sie aufgebahrt liegt, Marie, in der bestickten Bluse, ihr Gesicht erstarrt, verstörend in seiner Anwesenheit, und wie ihre Hände braungebrannt bleiben auf dem hellen Überwurf, daran wird Dorothea sich erinnern wie an eine hyperrealistische und in den Details trotzdem unscharfe Malerei. Sie wird sich an das unmittelbare, oder war es ein langsames Abdämpfen der Geräusche im Haus erinnern, und an ihre erstaunte Erkenntnis, dass Geräusche so etwas wie Unbeschwertheit verlieren können. Am schärfsten gezeichnet ist ihre Vorstellung davon, wie Marie, der sie vor wenigen Tagen zum ersten Mal begegnet ist, an jenem Morgen im August aus dem Zimmer schlüpft, barfuß und erleichtert, niemandem zu begegnen, da ihre Glieder schwer und ihr Atem noch bettwarm sind, und an den Kinderstimmen und dem Geklapper von Geschirr, das aus der Küche plätschert, vorbeihuscht; wie Marie den leeren Wäschekorb unter den Arm nimmt und beinahe ohne ein Geräusch durch den Gang auf die Terrasse tappt, in der Hoffnung, auch hier noch niemanden anzutreffen. Ihr Blick streift den gedeckten Frühstückstisch und die hinter dem Geländer sich ausbreitende Landschaft, Marie nimmt die Katze wahr, so vervollständigt Dorothea das Bild, die graue Katze, die durch ein Blumenbeet streicht, und das Kräuseln an ihren nackten Fußsohlen, als sie von den Fliesen der Treppe auf den morgenfeuchten Rasen tritt.
Es ist mitten im Hochsommer, fünf der sechs Gästezimmer sind belegt, drei Erwachsene mit ihren Kindern nehmen das Haus mit einer lärmigen Ferienfröhlichkeit ein, und Nick, schlaksig und noch nicht erwachsen, von der Mutter hergeschickt, um Französisch zu lernen, der aus seinem Zimmer in einem abgelegenen Winkel des Hauses auftaucht, wenn die Familien bereits beim Mittagessen im schattigen Hof sitzen. Und Franz und Marie, es ist ihre erste gemeinsame Reise seit langem, vor wenigen Tagen angekommen, sind sie auf dem Weg an die Atlantikküste, mit ihrem kleinen roten Auto; Marie hat sich gefreut, auf das Stimmengewirr im Haus, die reifen Feigen im Garten, Franz auf die Weiterfahrt zu zweit und die belegten Brötchen in den Bars der Kleinstadt am baskischen Meer. Marie und Franz, seit über zwanzig Jahren ein Paar, kinderlos, etwas ist immer wichtiger gewesen, für Franz oder für Marie, dann ist die Zeit abgelaufen, und sie fügten sich, beinahe ohne Wehmut, sind nicht kompliziert geworden und auch nicht kinderscheu, Marie hat zwei Patenkinder und Franz ist sich selbst genug. Franz kommt seit vielen Jahren in das Schloss unweit der Gebirgskette zwischen den Meeren, manchmal beruflich, um an einer Komposition zu arbeiten, seltener mit Marie, um Ferien zu machen.
Der Schlossbesitzer bewegt sich zwischen den auf- und abwippenden Geräuschen des Hauses wie ein graues, schlankes Tier und meistens wortkarg, ganz im Besitz der Fäden, die die Gäste durch das Haus spannen, wenn auch scheinbar unbehelligt davon, ja unbeteiligt. Die Gäste bewundern Pierre für seine stilsichere Eleganz und seine kantige Schönheit, weil er Schlangen mit der bloßen Hand fängt und weil er dieses Schloss besitzt. Ein leicht vergammeltes Landschloss, bestückt mit zusammengewürfeltem Mobiliar vom Flohmarkt und vom Abbruch, das scheinbar zufällig, von Pierre jedoch peinlich genau inszeniert, einen losen Charme ausstrahlt. Pierre bewohnt die herrschaftlichen Räume über der Terrasse, den hellsten nutzt er als Atelier, wie aus einem Bilderbuch der Kunstgeschichte liegt es viele Monate bewegungslos, um im Sommer den Geruch nach frisch gespitzten Bleistiften und Ölfarbe auszuatmen. Dann werden die hochwertigen Kartons aus Pierres Lehrzeit aus den Schubladen gezogen, auf dem Kaminsims arrangierte Fundstücke hinterlassen kleine, staubfreie Flächen auf dem Marmor, wenn sie zusammengeschoben werden, um Platz zu schaffen für einen getrockneten Hirschkäfer oder einen seltsam gewachsenen Zedernzapfen. Schnipsel aus Illustrierten drängen sich zwischen die schnell hingeworfenen Bleistiftskizzen an den Wänden, und es kommt vor, dass Kinder unterschiedlichen Alters auf dem Boden herumrutschen und zeichnen, meistens aber gebannt vor Pierres Laptop sitzen. Geduldig legt Pierre seine Pinsel zur Seite, selten macht er eine Bemerkung, zu einem langjährigen Gast vielleicht, dass er nicht zum Malen komme. Ende August fährt er zurück in die Schweizer Kleinstadt nördlich der Alpen, wo er seine Bilder einem ausgewählten Publikum verkauft und sein Sohn Gian den Kindergarten besucht, in dessen Nähe sich Pierre eingerichtet hat, nach der Trennung von Gians Mutter, eingerichtet in einer Wohnung mit zwei Zimmern und Gasheizung, und einem Job als Barkeeper. Marie hat Franz von den Blicken erzählt, die sie auffängt, wenn sie sich für ein Feierabendbier an die Theke setzt, Blicke von Frauen jeden Alters, die hinter Pierre herwandern, wenn er eine Flasche vom Regal holt mit einer tänzerischen Geste, das Trinkgeld entgegennimmt. Doch Pierres Aufmerksamkeit gilt seinem Sohn und der Malerei, die Zeit, die verbleibt, investiert er in das verblassende Anwesen, an dem er hängt, obwohl er es kaum halten kann, wie an einem Teil seiner selbst, mit einer Zähigkeit, die auch Verzweiflung sein könnte, wäre er zur Verzweiflung fähig. Nicht ohne Schärfe stellt die Mutter seines Sohnes nach der Trennung fest, die Zeichen ihrer verwickelten Beziehung sind überall sichtbar, im zugigen Schloss am Pyrenäenrand, dass kein Ort Pierres Einzelgängertum vollendeter beheimaten kann als das von ihm wie eine Biografie seines Schaffens bespielte, maßlose Haus. Aus den Tischgesellschaften auf der Terrasse verschwindet Pierre unbemerkt, Betty Davis oder Zigeunerjazz schwebt dann aus den Fenstern des Ateliers und über das Terrassengeländer in die Blätter.
Der Blick Richtung Berge ist weit und sanft, er gleitet über Hügel und kleine Senken, auf den Kuppen stehen da und dort Häuser und Ställe, auch Wäldchen, Laute von Kühen und anderen Tieren dringen kulissenhaft zum Haus hinauf. Bänder aus Gebüsch, undurchdringlich und brombeerüberwuchert, begrenzen das trockene Gelb der Weizenfelder, die sich in dunstigen Hügelketten verlieren. Nichts hält den Blick auf, bis er die Berge erreicht, die sich in einem schmalen Streifen erstrecken, feine, ferne Farbverläufe.
Wolkenlos blau steht der Himmel, stehen Sekunden still, es verstummt das Summen der Hummeln und Bienen und Fliegen, das Bewegen der Flügel und Blätter. Maries Gesicht liegt weiß, weiß und etwas zerknittert auf den Steinplatten, wie absichtlich hingelegt, im hellen Licht des sommerlichen Morgens. Dorothea, die beim Frühstück auf der Bank sitzt, denkt unwillkürlich an eine Fotografie mit übersteuerten Farben. Aus Franz kommt ein trockener Laut, ein erschrecktes Lufteinziehen und ein Atemanhalten. Später kann er sich auch mit größter Anstrengung nicht erinnern, wie und wo er die Kaffeekanne abgestellt hat. Später wird der Anblick von Marie in seiner Erinnerung verschwimmen, nicht aber das Gefühl, aus der Zeit gehoben zu werden. Dorothea fasst ihre Tochter Rosa am Arm, drückt sie zurück auf die Bank, als sie mit dem Butterbrot in der Hand zu Marie laufen will, Stephan nimmt Franz die Kaffeekanne aus der Hand, ein Vogel zwitschert, flattert. Marie liegt bewegungslos, die Locken wirr, ein Bein weit gestreckt, ein Bein angewinkelt unter ihrem Körper. Franz geht neben Marie auf die Knie, ein Arzt, schnell, seine Stimme flirrt. Franz legt die Hände an Maries Schläfen, bedeckt mit den Fingern ihre geschlossenen Lider. Dorothea hat ihre beiden Kinder an sich gezogen, sie sitzt wie versteinert, Rosa und Emil starren auf den reglosen Körper, über den Tisch hinweg, in der Umklammerung ihrer Mutter. Stephan steht gelähmt, die Kanne in der Hand. Franz legt den Kopf auf Maries Brust, nimmt ihre Hand in die seine, hektisch, hektisch und abwesend zugleich, drückt sie, versucht den Puls zu fühlen, legt seine Wange an die ihre, Marie, Marie, Marie. Leise, eindringlich, flüsternd, panisch, streicht ihr mit der flachen Hand übers Gesicht, über die Brauen, den Mund, so wie er es tut, wie er es immer tut, wenn sie aufgeregt ist.
Ein Spalt öffnet sich, eine Erdspalte, ein Bergkamm, ein Felsmassiv, saugt ihn weg, sein Blick rutscht in die Tiefe, zieht ihn mit, ist es kalt, oder glühend, ein Krater, kühler Humus, Franz sieht die harten grauen Kieselsteine in der Erdmasse. Hat er noch Gewicht, einen Körper, Haut.
Marie hatte Kopfschmerzen bekommen, unerwartet starke Kopfschmerzen und keine Tabletten dabeigehabt, als sie unter den Tannen hervortraten, auf Alpweiden und Geröllfelder hinaus, sie waren erst wenige Monate ein Paar. Ihre erste gemeinsame Wanderung bis über die Waldgrenze, Franz hatte die Route vorgeschlagen, das Wochenende sorgfältig geplant. Von einer angespannten Vorfreude erfasst, ging er hinter Marie, passte seine Schritte den ihren an, ihrem Atem an, ließ sie den Aufstieg bestimmen, das kurze Innehalten, wenn ein Tritt den Ausblick ändert, ihre Armreifen klirrten aneinander; ob Marie, wie er, verstummen würde und hinaushorchen, sich einhüllen ließe vom schwerelosen Blick über Grate und Gipfel. Marie hatte sich die Stirn gekühlt, sie saßen an einem Tümpel, gelbe Gräser trieben an der Oberfläche, Marie tauchte ihr Kopftuch ins dunkelblaue Wasser und wollte umkehren. Sie brachen den Ausflug ab, und als seine Enttäuschung verebbt war, stellte sich bei Franz eine Gereiztheit ein, die ihn seltsam berührte, er war sehr verliebt in Marie und ertrug es kaum, dass ihn der Gleichmut verärgerte, mit dem sie die eigene Unpässlichkeit und gleichermaßen deren Folgen entgegennahm. Sie gingen den Weg zurück und verbrachten den Nachmittag im Aufenthaltsraum der kleinen Pension. Franz wurde den gekränkten Missmut nicht los, und Marie ergab sich dem sprachlosen Vorwurf. Für Franz reihte sich der Nachmittag wie eine erstarrte Miniatur in die Erzählung ihrer gemeinsamen Geschichte, die holzgetäferte Stube, die Föhren an den schroffen Hängen, der eingefrorene Zwischenraum.
Über dem Frühstückstisch beugt sich Pierre aus dem Fenster, Gian drängt sich neben ihn, steckt den Kopf weit vor und fragt, mit seiner hohen Kinderstimme, fragt in die gedehnten Minuten, was hat sie. Als würde sich ein Stillleben aus der Erstarrung lösen, kommt Bewegung in Stephan, der die Kaffeekanne auf dem Frühstückstisch abstellt, neben Franz niederkniet, atmet sie noch, er hält die flache Hand an Maries Hals, Franz reagiert nicht, Franz legt den Kopf auf Maries Brust, schnell, schnell, jetzt schreit er. Gleichzeitig ist Dorothea aufgesprungen, in welche Richtung, zum Telefon, Marie helfen, Franz, die Kinder. Sie stürzt ins Haus, Pierres Schritte polternd über ihr, Rosa und Emil folgen ihr verängstigt. Bleibt hier, Dorotheas enge Stimme im Dunkel des Gangs, ihre fahrigen Hände in den Haaren der Kinder, sie hört, wie Pierre das Telefon erreicht, ein Kissen, fährt es ihr durch den Kopf, Marie stützen. Am Tisch allein gelassen, schreit Lara, scharf und durchdringend, Papa; echte Bedrängnis, auf die Stephan in Sekundenschnelle reagiert, und zu ihr stürzt, sie flüsternd besänftigt, als wäre sie es, Lara, sein Kind, das einer Gefahr ausgesetzt ist, einer hereinbrechenden Bedrohung. Ein Arzt, Arzt, Franz wiederholt das Wort, eine Beschwörung, ein drängender, gepresster Schrei. Dorothea kniet sich neben Marie, mit dem Kissen, ein Blumenmuster, eine aufwändige Stickarbeit, blaue Kornblumen und gelbe Narzissen, die blühen doch gar nie gleichzeitig, der Gedanke bleibt einen Moment bockig in ihrem Kopf sitzen, als sie das Kissen neben Maries Locken auf die Steinplatten legt.
Sie kommen, Pierre spricht niemanden an, zieht die wenigen Silben in die Länge, er steht unter dem Türbogen, Gian taucht an seiner Seite auf, drückt ihm den Kopf an die Hüfte. Pierre ist die geschwungene Treppe hinuntergestürzt, er hat seinen Sohn, mit hängenden Mundwinkeln, auf dem obersten Absatz stehen lassen und mit der örtlichen Ambulanz telefoniert. Aber wann, Franz lässt zum ersten Mal den Blick von Marie, seine Hand hält die Verbindung, die Fingerkuppen suchend in ihrem Gesicht, halten nur kurz inne, Franz dreht sich zu Pierre, wann, seine Augen zwei brennende Seen. Pierre ist mit einem Satz bei ihm, auch er fühlt den Puls, legt die Hand an die Halsschlagader, schweigt. Gewissheit breitet sich aus, eine alles durchdringende, messerscharfe Gewissheit, wie ein dumpfer, wie ein farbloser Ton. Die Hektik auf höchster Alarmstufe, waren es drei, waren es zehn Minuten, ist einer Zeitlupenstille gewichen, die eng ist, wie zusammengeschnürt, Äste knacken in den Platanen, in der Ferne winseln Hunde. Emil und Rosa drängen sich neben Gian, Emil reibt sich rote Streifen auf den Arm, während ihn Rosa bedeutungsvoll anblickt, mit zusammengepressten Lippen. Lara hängt in Stephans Arm, das Gesicht in seinem Hemd verborgen, er zieht sie vom Stuhl, lässt sie zu Boden gleiten, und mit einer entschiedenen Handbewegung bedeutet Stephan den Kindern ihm zu folgen, zur Treppe, auf die Wiese hinunter und in den Garten; Lara geht an ihn gedrängt, die andern dicht hinter ihm, vorbei an den stummen Erwachsenen und der bewegungslosen Marie. Gian verfällt in ein hüpfendes Rennen, sobald er sich an Marie vorbeigeduckt hat, Emil dreht sich um, vorn an der Treppe, und sucht die Augen seiner Mutter, den Oberkörper gekrümmt, wieselhaft, Dorothea antwortet mit einem unsicheren Winken, ihr Blick verfängt sich in Maries Ohrmuschel, als sie wegschaut.





























