
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oetinger Taschenbuch
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Auf der Fährte der Schlittenhunde. Es ist kalt und dunkel im Norden Kanadas, wo Jeremy lebt, und in den Straßen streunen Hunde. Als Jeremy einem der Hunde zu einem alten Mann folgt, erzählt dieser ihm von früher, von der Kultur ihrer Vorfahren, von den Hundeschlitten und der engen Bindung zwischen Mensch und Hunden. Fasziniert beschließt Jeremy sein eigenes Schlittenteam aufzubauen. Eines Tages fahren er und sein Freund Justin auf den zugefrorenen See hinaus, doch dann zieht ein Sturm auf …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Auf der Fährte der Schlittenhunde
Jeremy lebt weit oben im Norden Kanadas, wo die Winter lang und kalt sind und Hunde durch die Straßen streunen. Bei einem dummen Streich verletzt Jeremy einen der Hunde. Von schlechtem Gewissen geplagt, freundet er sich mit dem Hund an und lernt so dessen Besitzer kennen – einen alten Mann, der voller Geschichten ist. Er erzählt Jeremy von seinem Leben in der Wildnis und den Abenteuern mit seinen Schlittenhunden. Jeremy ist fasziniert und beschließt, sein eigenes Hundeteam aufzubauen. Eines Tages fährt Jeremy mit seinem Freund auf den zugefrorenen See hinaus, ohne den Sturm zu bemerken, der sich hinter ihnen zusammenbraut …
Spannend, authentisch und mitreißend – die Geschichte einer abenteuerlichen Freundschaft
Für Nico, der den echten Acimosis noch kennengelernt hat
Kapitel 1
»Hey, Jeremy! Wetten, dass du dich nicht traust, den Hund da am Schwanz zu ziehen?« Justins Grinsen lässt keinen Zweifel zu: Er denkt, ich würde es nicht tun. Um ehrlich zu sein, will ich es auch gar nicht. Nicht, weil ich Angst habe. Obwohl der Hund schon recht groß ist. Sein sandfarbenes Fell ist zerzaust, und er sieht nicht gerade freundlich aus. Dass Justins kleiner Bruder vor ein paar Tagen von einem Streuner gebissen wurde, der nicht mal halb so gefährlich aussah wie der hier, hilft auch nicht besonders. Wäre sein Fell grau und nicht sandfarben, könnte man ihn glatt mit einem Wolf verwechseln.
»Na mach schon, Jeremy, oder glaubst du, ich will den ganzen Tag hier rumstehen?«
Justin tut so, als ob er das Interesse verloren hätte. Er schlendert die Schotterstraße entlang, als sei ich nicht mehr da. Und trotzdem fühlt es sich so an, als ob sein Blick mich immer noch durchbohrt, scharf wie die Spitze eines Messers.
Ich versteh einfach nicht, was Justin für ein Problem mit Hunden hat. Zugegeben, ein paar Steine nach den Streunern werfen, das haben wir alle schon mal gemacht. Aber irgendwas hat sich in letzter Zeit verändert. Ich weiß nicht, ob Justin gemeiner geworden ist oder ob es mir einfach keinen Spaß mehr macht, die Köter zu ärgern. Aber es macht schon einen Unterschied, ob man einen Hund aus der Ferne mit einem Stein trifft und der Hund in die Luft beißt, ohne zu wissen, was ihn eigentlich getroffen hat oder ob man einen am Schwanz zieht, und der Hund ganz genau weiß, dass du es warst …
Ich schiebe den Gedanken schnell beiseite und quetsche mich durch den Lattenzaun. Der Zottelhund schläft auf der halb verfallenen Treppe vor der Haustür. Meine Güte, ist das Haus verwahrlost. Ich meine, keines der Häuser in Poplar Point würde jemals auf der Titelseite von »Schöner Wohnen« erscheinen oder in irgendeiner der anderen Zeitschriften, die meine Mutter liest. Keine Ahnung, warum sie die überhaupt kauft, aber darum geht’s nicht. Was ich sagen will: Dieses Haus sieht so richtig alt aus. Die Fenster sind entweder zugenagelt oder mit Plastikfolie abgedeckt. Die meisten Häuser in der Gegend haben bunte Vinylfassaden, aber dieses hier ist aus Holz gebaut. Die Baumstämme der Blockhütte sind grau und verwittert, so wie das Treibholz, das im Sommer immer an den Strand gespült wird.
Ich versuche, mich an den Hund anzuschleichen. Keine Chance. Sobald ich in seine Nähe komme, macht er die Augen auf. Er steht auf. Langsam und bedächtig. Und dann starrt er mich an. Der Blick aus seinen dunklen Augen geht durch mich hindurch, so als ob er versucht herauszufinden, wer der Schwächere ist; wer das Raubtier und wer die Beute ist. Ich hebe ein paar Steine auf – man weiß ja nie. Doch dann passiert etwas Merkwürdiges: Der Hund wedelt zaghaft mit dem Schwanz. Warum denn das?
Ich merke, wie sich meine Muskeln anspannen. Schnell weg, bevor er mich angreift, denke ich. Aber der Hund wirft sich auf den Rücken wie ein Welpe, der am Bauch gekrault werden will. Ich gehe in die Hocke und strecke meine Hand aus. Ist doch viel einfacher, als ich dachte. Jetzt nur schnell am Schwanz ziehen, und dann nix wie weg. Der Zottelhund sieht mich mit seinen großen, braunen Augen an, und ich bringe es nicht über mich. Ich streichle vorsichtig seinen Bauch und werfe einen Blick über meine Schulter. Justin beobachtet mich vom Zaun aus.
»Tut mir echt leid«, flüstere ich dem Hund zu und zieh ihn am Schwanz. Der Hund jault auf, als ob er in ein Wespennest getreten wäre. Er rappelt sich auf und versucht, in seinen eigenen Schwanz zu beißen. Enger und enger dreht er sich im Kreis; sein Schwanz hängt leblos zwischen seinen Hinterbeinen. Ich beiße mir auf die Lippe. So stark habe ich doch gar nicht gezogen, oder?
Ich höre Justins Lachen von der anderen Seite des Zaunes. Es hört sich weit weg an, so, wie wenn man gerade aus einem Traum aufwacht. Nur, dass das hier kein Traum ist.
»Mann, ich dachte schon, du wärst zu feige.« Justin gibt mir einen freundschaftlichen Klaps auf den Rücken und grinst mich an, so wie er es immer tut, wenn ich mich seiner Freundschaft würdig erweise. Aber heute macht es mich nicht stolz. Im Gegenteil.
»Sag mal, du heulst doch nicht etwa?« Justins Stimme ist voller Verachtung. »Ich glaub’s ja nicht.«
»Red’ keinen Quatsch! Hab bloß Staub im Auge.« Ich schubse Justin aus dem Weg und geh davon. Das Jaulen des Hundes hallt noch immer in meinen Ohren.
Kapitel 2
Seit letzter Nacht schneit es in dichten, weißen Flocken, und Poplar Point verwandelt sich in eine Märchenlandschaft. Selbst die Schule sieht freundlicher aus mit den großen, verschneiten Fichten hinter dem Spielplatz. Es ist erst November, aber die Sonne ist schon nah am Horizont, wenn die Schule endlich aus ist. Der Schnee knirscht unter meinen Füßen, und kalte, frische Luft füllt meine Lungen.
»Autsch!« Ein Schneeball trifft mich am Hinterkopf und reißt mich aus meinen Gedanken.
»Hey, Jeremy, warum hast du es denn so eilig?« Justin.
Ich bin ihm in der Schule aus dem Weg gegangen, und auch jetzt habe ich keine Lust, mit ihm zu reden.
»Haste Bock, heute Abend Xbox bei mir zu spielen? Mein Cousin kommt auch.«
»Okay«, sage ich, obwohl ich schon weiß, dass ich nicht hingehen werde. Zumindest nicht heute.
»Bis später dann.« Justin winkt mir zu, aber ich winke nicht zurück.
Erst als ich bei unserem Haus ankomme, drehe ich mich um. Justin ist längst nicht mehr da. Gut. Ich gehe weiter, bis ich bei dem Hügel am Ende von Poplar Point ankomme.
Der Hund schläft auf schmutzigen Decken in einer umgekippten Regentonne. Rauch steigt aus dem Schornstein der alten Hütte. Wer hier wohl wohnt? Schon komisch, dass mir das Haus bis gestern noch nie aufgefallen ist. Die Hütte steht zwar ein bisschen abseits und schon fast im Wald, aber so groß ist Poplar Point ja nun auch wieder nicht.
Mir ist ein bisschen mulmig dabei zumute, einfach in den Hof von einem Fremden zu gehen, aber der Gedanke an den Hund lässt mir einfach keine Ruhe.
So leise, wie es geht, quetsche ich mich durch den Zaun. Der Hund kriecht tiefer in die Regentonne und knurrt mich an. Mein Magen krampft sich zusammen. Klar, ich hatte nicht erwartet, dass er überglücklich wäre, mich zu sehen, aber dass er solche Angst vor mir hat … Ich wollte ihm wirklich nicht wehtun. Ehrlich. Ich wünsche mir, er wüsste das.
»Na komm. Ist schon okay«, sage ich beruhigend und mache einen Schritt näher heran. Das Knurren wird lauter, ich ziehe mich zurück. Was, wenn er sich jetzt an mir rächt? Ich stell mir vor, wie seine Reißzähne sich in mein Fleisch bohren, aber dann dränge ich den Gedanken schnell beiseite.
»Es tut mir echt leid, okay? Ich werde das nie wieder tun. Versprochen. Egal, was Justin sagt.« Ich weiß, dass er mich nicht versteht, aber irgendwie hilft es mir, mit ihm zu reden. Als ob ich mir selbst das Versprechen geben würde.
Ich krame in meiner Schultasche herum, bis ich mein Sandwich finde, und strecke es ganz langsam dem Hund entgegen. Er hört auf zu knurren, aber er nimmt das Sandwich nicht aus meiner Hand. Ich lege es vorsichtig vor ihn hin. Er rührt es nicht an. Mist. Jetzt liegt es im Dreck. Ich fühl mich noch schlechter. Weil es nämlich Justins Hälfte ist, die jetzt im Dreck liegt.
Justin macht sich immer darüber lustig, dass meine Mutter mir immer noch Pausenbrote macht, obwohl ich schon dreizehn bin. Trotzdem sagt er nie Nein, wenn ich ihm die Hälfte anbiete. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass seine Mutter ihm jemals Sandwiches gemacht hat. Jedenfalls nicht seitdem wir Freunde sind, und das sind wir schon ewig.
»Was gibt’s heute zum Mittag?«, hat Justin mich in der großen Pause gefragt. Ich habe ihm gesagt, ich hätte mein Mittagessen zu Hause vergessen. Ich wollte das ganze Sandwich für den Hund aufheben, aber dann hatte ich so einen Hunger, dass ich heimlich die Hälfte auf der Toilette gegessen habe.
»Ich hab so einen Kohldampf, dass ich ’nen ganzen Elch verdrücken könnte«, hat Justin gewitzelt, als ich vom Klo wiederkam. Ich konnte ihm nicht in die Augen sehen, also habe ich stattdessen auf meine Füße gestarrt. Ein Ketchupfleck von meinem Elchfleisch-Sandwich war auf meinem Stiefel.
Ich kann ein Seufzen nicht unterdrücken. »Ich hab’s extra für dich aufbewahrt«, erkläre ich dem Hund und schiebe das Sandwich tiefer in die Tonne. Der Hund drückt sich in die hinterste Ecke. Sein Atem ist flach und schnell. Zu schnell. Er zittert am ganzen Körper. Ich geh ein paar Schritte zurück, und er entspannt sich ein bisschen.
»Hab keine Angst«, sage ich und gehe noch ein paar Schritte mehr zurück.
Der Hund schnüffelt an dem Sandwich, dann pickt er vorsichtig das Fleisch heraus. Die meisten Hunde, die hier rumlaufen, hätten alles in einem Biss verschlungen: Fleisch, Brot und meine Hand. Wer auch immer in der Hütte wohnt, kümmert sich anscheinend um den Hund. Ich habe ihn auch noch nie mit den anderen Straßenkötern gesehen, obwohl er nicht angebunden ist.
Das mit den frei laufenden Hunden ist echt ein Problem. Ganze Hundebanden rennen hinter läufigen Hündinnen her, kämpfen um Essensreste und jagen den kleinen Kindern Angst ein. Aber Zottelhund gehört nicht dazu.
Ich setze mich vor die Regentonne und rede sanft mit dem Hund. Es dauert eine Weile, aber dann streckt er den Kopf hervor und schnüffelt vorsichtig an meiner Hand. Als ich versuche, ihn zu streicheln, duckt er sich und knurrt leise. Trotzdem bin ich glücklich. Das Sandwich war doch eine gute Investition.
»Bis demnächst«, sage ich und überrasche mich damit selbst. Ich hatte nicht vor, wiederzukommen, aber versprochen ist versprochen.
Meine Mutter ist schon von der Arbeit zurück, als ich zu Hause ankomme. Ich muss mehr Zeit bei dem Hund verbracht haben, als ich dachte.
»Wie war es in der Schule, Jeremy?«
»Gut.« Gleiche Frage, gleiche Antwort. Jeden Tag. Ich mach mich auf den Weg in mein Zimmer.
»Justin war gerade hier und wollte wissen, wo du bist.« Mom guckt mich an, als ob es ihre Frage wäre und nicht Justins. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will ihr nichts von dem Streit mit Justin erzählen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob wir wirklich streiten. Und von dem Hund will ich erst recht nichts erzählen. Wie denn auch? Ach, ich habe nur mal eben das Sandwich, das du heute Morgen für mich gemacht hast, an einen zotteligen Hund verfüttert, der aller Wahrscheinlichkeit nach nie mehr mit dem Schwanz wedeln wird. Irgendwie glaube ich nicht, dass sie das so einfach ohne weitere Fragen hinnehmen würde. Aber ich will sie auch nicht anlügen.
»Ach, so was«, fange ich an, und plötzlich rutscht es so schnell aus mir heraus, dass ich selbst fast glaube, es sei die Wahrheit, »ich war gerade bei Justin und habe nach ihm gesucht.«
»Dann musst du ihn ja auf dem Weg getroffen haben?«
Oh, oh. Kaum mit dem Lügen angefangen, und schon muss man sich noch mehr Lügen ausdenken, um die erste nicht auffliegen zu lassen. Oder besser nachdenken. Oder noch besser: lieber nicht lügen.
»Jep, ich hab ihn getroffen. Wollte nur schnell noch ein Sandwich machen. Haben wir noch Elchfleisch? Das Sandwich von heute Morgen war echt lecker.«
Mom holt Margarine und Fleisch aus dem Kühlschrank, und ich mache mir hastig ein Sandwich.
»Iss nicht so viel vor dem Abendbrot. Ich habe Eintopf und Bannock gemacht.«
Na klar. Heute ist Freitag. Mom hat freitags immer früher frei, und dann kocht sie für die ganze Woche. Eintöpfe, Suppen und andere Sachen, die die ganze Woche über halten. Wenn es doch nicht reicht, dann gibt’s Fertiggerichte und KFC.
»Warte nicht auf mich, kann später werden«, rufe ich, als ich schon in der Tür stehe mit meinem Sandwich in der Hand.
»Komm nicht zu spät, okay?«
Es ist mehr eine Bitte als ein Befehl. Meine Mutter lässt mich machen, was ich will. Vielleicht, weil ich keinen Vater habe. Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen, kurz vor meinem dritten Geburtstag. Ich kann mich nicht an ihn erinnern, und Mom redet nie über ihn.
Oder vielleicht vertraut sie mir einfach. Ich fühl einen plötzlichen Stich ungefähr da, wo mein Herz sein sollte. Ich hätte sie nicht anlügen sollen. Ich wollte einfach nur … Ach, ich weiß auch nicht. Ich wollte mich einfach nicht rechtfertigen müssen. Noch weniger allerdings wollte ich Justin sehen.
Justin sitzt draußen auf den Holzstufen vor seinem Haus. Obwohl es kalt und schon fast dunkel ist, sitzt er ohne Handschuhe da und schießt lustlos mit seiner Schleuder auf die Raben. Der Müllwagen muss mal wieder kaputt sein. Die Tonnen quellen über, und der Abfall liegt überall auf der Straße. Ein Paradies für Raben und streunende Hunde.
Justins Haus ist genauso groß wie unseres – drei Schlafzimmer, winzige Küche, noch kleineres Wohnzimmer, aber bei Justin wohnen ständig irgendwelche Verwandte, und ich kann noch nicht mal sagen, ob die Windeln, die die Raben zerfetzen, zu seinem kleinen Bruder, seiner Cousine oder zu seinem Neffen gehören. Ist schon komisch, sich Justin als Onkel vorzustellen. Wie er da so zusammengesunken sitzt und halbherzig auf die Raben zielt, sieht er viel jünger aus als vierzehn. Plötzlich muss ich an den Hund denken, nachdem ich ihn am Schwanz gezogen hatte. Er sah so betrogen aus, so verletzt, verängstigt. Am liebsten würde ich weglaufen, bevor Justin mich bemerkt. Aber ich kann ihm ja nicht für immer aus dem Weg gehen.
»Wie viele hast du gekriegt?«, frage ich ihn, nur um überhaupt was zu sagen.
Justin springt auf, als er mich sieht. Er richtet sich auf; sein Blick wird hart wie seine Stimme.
»Wovon redest du?«, fährt er mich an und reibt sich die gerötete Wange.
»Raben.« Ich nicke zu zweien hinüber, die sich um eine labberige Pommes streiten. »Wie viele hast du getroffen?«
»Ach so«, sagt Justin lässig. »Habe nicht gezählt.« Er steckt seine Schleuder in die Hosentasche.
»Lass uns reingehen und Xbox spielen«, schlage ich vor.
»Nee, lass uns lieber draußen bleiben.«
Wie auf Kommando höre ich, wie zwei Erwachsene sich drinnen anschreien. In Situationen wie dieser bin ich fast froh, nur einen Elternteil zu haben.
»Lass uns abhauen.« Justin ist schon auf dem Weg zur Straße. Als wir an der Ostseite vom Haus vorbeikommen, sehe ich, dass sein Schlafzimmerfenster zerbrochen ist.
»Was ist denn da …?«
»Nix«, Justin unterbricht mich, bevor ich die Frage zu Ende gestellt habe.
Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, also krame ich mein Sandwich aus der Tasche und reiche es Justin. »Hier.«
»Nee, danke«, Justin schüttelt den Kopf.
»Ich habe nach einem Elch Ausschau gehalten, aber alles, was ich gefunden habe, war dieses alte Brot, das ich heute Morgen vergessen habe.« Ich breche das Sandwich in zwei Hälften, und Justin nimmt sich eine.
»Selbst wenn du den Elch gefunden hättest, hätte dir das nichts genützt«, grinst Justin zwischen zwei Bissen. »Du warst schon immer ein lausiger Jäger.«
»Wer muss denn heute noch jagen gehen«, gebe ich zurück. »Wir haben doch KFC.«
Justin verdreht die Augen, aber er lacht dabei, und es ist fast so wie vor der Sache mit dem Hund. Fast.
Wir gehen zum Schulhof. Nicht, weil da was los wäre, sondern einfach, weil uns nichts Besseres einfällt. Wäre es Sommer, dann würden wir alle mit unseren Skateboards hier rumhängen, Tricks üben und – in Justins Fall – versuchen, die Mädels zu beeindrucken. Im Winter passiert hier gar nichts.
Die einzigen anderen Lebewesen außer uns sind zwei Hunde, die gerade dabei sind, Welpen zu produzieren. Als ich zum ersten Mal zwei Hunde dabei gesehen habe, dachte ich, jemand hätte die Schwänze der Hunde zusammengebunden, weil sie Hinterteil an Hinterteil wie erstarrt standen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Justin mir eine Lektion in Sexualkunde erteilt hat. Zuerst hat er mich über die Hunde aufgeklärt, dann folgte Menschenkunde. Ich hatte das Gefühl, er war besser über das Hundeleben informiert. Ich merke, wie ich plötzlich rot werde. Gut, dass es beinahe dunkel ist.
Plötzlich durchdringt ein ohrenbetäubendes Jaulen die Stille der Dämmerung. Die Hündin knurrt und beißt in die Luft, aber sie kann sich nicht von dem Rüden losreißen. Wie wild schnappt sie nach ihrem eigenen Hinterteil, aber sie hat keine Wahl, als abzuwarten, bis die Paarung vorbei ist. Ich frage mich, ob ich zu ihr gehen kann und versuchen soll, sie zu beruhigen. Dann wird mir auf einmal klar, warum sie in die Luft schnappt: Justin schießt mit seiner Schleuder Steine auf die Hunde.
»STOPP! STOPP! STOPP!« Meine Stimme hört sich fremd an. Zu hoch, zu unkontrolliert. »Du tust ihr weh! Sie kann doch nicht weg!«
Justin lacht bitter und legt einen neuen Stein in die Schleuder. »Geschieht euch recht, ihr Köter. Das ist das Letzte, was wir hier gebrauchen können. Noch mehr Streuner, die kleine Jungen beißen.« Justin Stimme ist scharf und kalt und hört sich plötzlich viel älter an. Er geht zu den Weidenbüschen, die das Schulgelände umwachsen, und bricht einen fingerdicken Stock ab.
»Hör auf! Lass sie in Ruhe!« Ich hämmere mit meinen Fäusten auf Justins Rücken ein. Nicht, weil ich scharf auf eine Schlägerei bin, ganz im Gegenteil. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Justin dreht sich um und wirft mich in den Schnee. Ich wehre mich nicht. Als Justin mich loslässt, sind die Hunde verschwunden. Wir verlassen den Schulhof in entgegengesetzte Richtungen.
Ich versuche, nicht an Justin zu denken. Aber je mehr Mühe ich mir gebe, desto weniger klappt es. Es ist Wochenende, und ich kann mich an kein Wochenende erinnern, dass ich nicht mit Justin verbracht habe. Manchmal schleppt er seinen kleinen Bruder Isaac mit sich rum. Isaac ist erst fünf und eine echte Nervensäge, aber Justin ist richtig stolz auf ihn. Niemand darf Isaac piesacken, nur Justin selbst.
Justin hat mir das Schwimmen beigebracht, am Strand direkt neben der alten Holzkirche. Ich habe meinen ersten Fisch mit Justin vom Boot seines Vaters aus gefangen. Da war ich neun. Jetzt hört sich das alles nicht mehr so toll an, aber damals war es schon eine große Sache. Irgendwie vermisse ich ihn, obwohl es erst gestern war, dass wir uns zerstritten haben und ich richtig, richtig sauer auf ihn bin. Ich verstehe immer noch nicht, was gestern genau passiert ist. Es war, als ob er plötzlich nicht mehr er selbst war.
Dass er auf Raben schießt, kann ich ihm ja noch verzeihen. Das haben wir doch alle irgendwann mal gemacht. Beim ersten Mal, als ich gut genug zielen konnte, um auch zu treffen, habe ich ein Eichhörnchen getötet. Ich kann mich noch immer an seine kleinen, traurig-schwarzen Augen erinnern. So hübsch und so tot. Justin hat sich über mich lustig gemacht und mich Prinzessin genannt, weil ich das Eichhörnchen unter einer Birke beerdigt und ein kleines Holzkreuz für das Grab gebastelt habe. Einen Tag später habe ich einen Hund mit einem Eichhörnchen im Maul gesehen; sein Fell war ganz verschmutzt mit Dreck und Blut. Vielleicht war es ja nur Zufall und es war ein anderes Eichhörnchen, aber danach habe ich nie mehr versucht, Eichhörnchen oder Raben zu treffen.
Justin ist anders. Ich versteh schon, dass nicht jeder Hunde mag. Und einige sind ja auch wirklich fies, wie der, der Isaac gebissen hat. Aber gestern Abend, da war etwas mit Justin, das mir Angst eingejagt hat. Ich hätte niemals gedacht, dass er wirklich jemanden verletzen könnte. Seit gestern bin ich mir nicht mehr so sicher. Es war, als ob er noch nicht mal realisiert hat, dass es ein Hund war. Es hätte was auch immer sein können – oder wer auch immer. Und trotzdem: Irgendwie tat er mir leid. Er sah nicht so aus, als ob er Spaß dabei hatte. Es war eher so, als ob er es tun musste. Ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll.
Auf einmal muss ich an die Hündin denken und wie sie blindlings um sich gebissen hat, wegen der Schmerzen tief im Inneren, die sie sich nicht erklären und die sie nicht stoppen konnte.
Kapitel 3
Zottelhund ist nicht in seiner Regentonne. Ich komme mir ein bisschen blöd vor, wie ich so da stehe mit einer Wurst in meiner Hand. Was, wenn der Besitzer mich jetzt sieht? Ich werfe einen flüchtigen Blick zum Eingang des alten Hauses. Neben der Tür ist ein Holzklotz mit einer rostigen Axt. Im Schnee liegt frisch gespaltenes Feuerholz. Aber es ist niemand zu sehen.
Ich will mich gerade wieder auf den Nachhauseweg machen, als ich etwas Kaltes und Nasses gegen meine Hand stupsen fühle. Ich stehe ganz still und lass mich von dem Hund beschnüffeln. Ganz vorsichtig öffne ich meine Hand, und der Zottelhund nimmt sich die Wurst. Er marschiert aus meiner Reichweite, und dann verschlingt er seine Leckerei.
Ich schnappe nach Luft. Mir war gar nicht aufgefallen, dass ich den Atem angehalten hatte. Ich sehe ihm beim Fressen zu, und auch er lässt mich nicht aus den Augen.
»Hey Kumpel«, spreche ich ihn an und knie mich in den Schnee.
Zottelhund kommt langsam auf mich zu. Sein ganzes Hinterteil wackelt; nur sein Schwanz hängt immer noch leblos zwischen seinen Beinen. Ich strecke meine Hand aus und versuche, ihn zu streicheln, aber er duckt sich und zieht sich zurück.
»Mach dir keine Sorgen«, beruhige ich ihn. »Wird schon alles wieder gut.« Warum erzähl ich denn so einen Quatsch? Gar nichts ist gut. Weder mit Justin noch mit Zottelhunds Schwanz. Und trotzdem, wie ich so mit dem Hund rede, fühlt es sich an, als ob es stimmen würde, als ob alles wieder in Ordnung wäre – zumindest für einen kurzen Moment.
Der Hund schnüffelt an meiner Hand, und dann leckt er sie. Seine Zunge fühlt sich rau und kitzelig an, aber ich mag es trotzdem.
»Freunde?«, frage ich und kraule ihn vorsichtig unter dem Kinn. Sein Fell ist struppig und schmierig, doch das stört mich gar nicht. Zum ersten Mal seit Tagen fühle ich mich besser.
»Er ist ein ganz besonderer Hund, der da.«
Ich zucke zusammen. Ich habe niemanden kommen gehört, aber jetzt sitzt ein alter Mann auf den morschen Treppenstufen und beobachtet mich. Als Zottelhund die Stimme des alten Mannes hört, läuft er zu ihm hinüber. Der alte Mann streichelt ihn mit alterssteifen Händen. Er ist besonders behutsam nahe des Schwanzes, der noch immer reglos herunterhängt. Weiß er, was ich getan habe? Am liebsten würde ich einfach davonlaufen, aber wenn ich das jetzt tue, dann gibt es kein Zurück, und ich könnte Zottelhund nicht mehr sehen.
»Ihr Hund ist wirklich toll, Sir«, sage ich und komm mir gleich darauf ziemlich dumm vor, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Ich weiß auch gar nicht, warum mir das »Sir« herausgerutscht ist. Justins Cousin sagt es, wenn er nach der Schule bei Andy’s Tankstelle arbeitet. »Vielen Dank, Sir. Schönen Abend noch.« Wenn er es sagt, hört es sich cool an, wie in einem alten Film oder so. Aber hier passt es gar nicht. Der alte Mann sieht mich mit seinen braunen Augen durchdringend an. Sein Gesicht ist faltig und dunkelhäutig. Er könnte einer der Cree Elders sein, die immer zu uns in die Schule kommen, um uns traditionelles Wissen, das von Generation zu Generation weitervererbt wird, beizubringen. Die Elders wollen, dass wir sie moshōm oder kohkom nennen, Cree für Großvater oder Großmutter, aber ich tue mich immer schwer damit. Vielleicht, weil ich nie eigene Großeltern hatte. Unsere Lehrer nennen wir Mr Ratt oder Ms Charles oder wie auch immer sie heißen, aber ich kenne den Namen des alten Mannes nicht, und ich weiß auch nicht, wie ich ihn danach fragen soll. Also zeig ich auf Zottelhund, der es sich neben den Füßen des Alten bequem gemacht hat.
»Wie heißt er denn?«
»Acimosis.«
Die Ohren des Hundes stellen sich auf, als er seinen Namen hört, und sein Hinterteil wackelt.
»Acimosis?«, frage ich erstaunt. Ich spreche kein Cree, nur die paar Vokabeln, die ich im Cree-Kulturunterricht gelernt habe und das eine oder andere Wort, das ich von Justins kohkom aufgeschnappt habe. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass Acimosis »Welpe« heißt. Zottelhund ist aber nicht gerade das, was ich »Welpe« nennen würde. Das Fell um seine Schnauze ist mindestens so grau wie das Haar des Alten.
Ich will den alten Mann fragen, ob ich wiederkommen kann, um Acimosis zu besuchen, aber ich will nicht unhöflich erscheinen oder mich noch weiter blamieren. Als ich gerade beschlossen habe, zu gehen, kommt Zottelhund – ich meine Acimosis – und lehnt sich gegen meine Beine. Ich grabe meine Hände in sein langes Fell.
»Acimosis. So heißt du also. Und was macht dich so besonders?« Ich fühle, wie mir die Röte ins Gesicht schießt. Irgendwie finde ich es einfacher, mit dem Hund zu reden, was wahrscheinlich ziemlich merkwürdig ist. Ich werfe einen kurzen Blick auf den Alten, aber der scheint mich nicht wirklich zu beachten.
»Er sieht wie sein Vater aus, meinst du nicht?«, sagt der Alte und nickt zu mir herüber – oder nickt er dem Hund zu? Ich kann es nicht sagen. Dann tätschelt er seinen Hund. »Du wärst ein feiner otapewatim gewesen, nicht wahr?«
Ich weiß nicht, was otapewatim heißt, und ich weiß auch nicht, ob er mit mir oder mit dem Hund redet, aber ich krieg ein ganz komisches Gefühl, so als ob er mich irgendwoher kennt oder etwas über mich weiß, das ich nicht weiß. Unheimlich.
»Ich muss nach Hause. Meine Mutter wartet«, entschuldige ich mich.
Der Alte nickt. »All die Jahre, und trotzdem kannst du dich an ihn erinnern, nicht wahr?«
Mit wem redet er bloß? Mit mir? Dem Hund? Oder jemand anderem?
Mom rumort in der Küche herum, als ich nach Hause komme.
»Sag mal, wer wohnt denn eigentlich in der alten Hütte auf dem Hügel?«, frage ich so beiläufig wie möglich.
Mom wirft Spaghetti in den Topf mit sprudelnd heißem Wasser. »Welche Hütte?«
»Die alte Blockhütte ganz am Ende der Straße.«
»Warum willst du das wissen?« Die Stimme meiner Mutter hört sich plötzlich scharf an. Ganz anders als ihre normale, freundliche Stimme. Ich weiß nicht, was ich ihr antworten soll.
»Jeremy! Ich hab dich was gefragt.«
Auf einmal fühle ich mich, als ob ich irgendetwas falsch gemacht hätte. Nur was?
»Einfach nur so«, sage ich betont gleichmütig.
Mom nickt Richtung Küchentisch. »Abendessen ist fertig. Deck mal den Tisch. Und geh niemals zu der Hütte, verstanden?«
Nach dem Essen versuche ich, otapewatim im Cree-Online-Wörterbuch zu finden, aber ich habe kein Glück. Wahrscheinlich hab ich es falsch geschrieben. Wer weiß schon, wie man Cree richtig schreibt. Selbst unser Cree-Lehrer hat Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung. Seine Entschuldigung ist, dass Cree eine orale Sprache ist, die niemals dazu gedacht war, aufgeschrieben zu werden. Ich wünschte, Englisch wäre eine orale Sprache. Ich könnte nämlich gut ohne die ganzen Rechtschreibungsprüfungen leben.
Aber darum geht es hier ja nicht. Es macht mich irgendwie traurig, dass ich nicht verstehen konnte, was der alte Mann gesagt hat, obwohl wir in der gleichen Siedlung wohnen. In meiner Klasse sind nur zwei Schüler, die fließend Cree sprechen, dabei leben weit über die Hälfte im Reservat. Fast jeder spricht Englisch, die Alten, die nur Cree sprechen, werden immer weniger. Ich könnte einen der Elders fragen, was otapewatim bedeutet, oder noch einfacher: Ich könnte den alten Mann selbst fragen. Aber was, wenn er verrückt ist oder gefährlich oder beides? Ich könnte Justin fragen, ob er mitkommt. Der würde einfach einen Witz machen, wir würden lachen, und keiner hätte einen Grund, Schiss zu haben. Aber dann sehe ich ein, wie unmöglich das ist. Wie könnte ich Justin gegenüber zugeben, dass ich plötzlich mit Acimosis befreundet bin? So tun, als ob der Hund mich nichts angeht, geht erst recht nicht. Niemals könnte ich ihm antun, was ich ihm schon einmal angetan habe. Nee, nie wieder. Und wie soll ich Justin erklären, dass ich mit einem Alten sprechen will, den ich noch nicht mal kenne? Das kann ich mir ja nicht mal selbst erklären. Außerdem hieße das, ich müsste mit Justin reden. Wie kann ich jemals wieder mit ihm reden, nach unserem Streit am Freitag?
Kapitel 4
Es schneit so heftig, dass ich noch nicht mal von einem Strommasten zum nächsten sehen kann. Aber das ist gut so. So kann nämlich niemand sehen, wie ich mich zu dem Haus vom Alten schleiche.
Acimosis ist nicht im Hof, aber frische Pfotenabdrücke führen um die Hausecke herum. Ich folge den Spuren, und das Erste, was ich sehe, sind rostige Fallen, die an der Hauswand hängen. Sie haben verschiedene Größen, doch ich kann nicht sagen, welche für Marder und Biber sind und welche für Kojoten und Wölfe. Die Fallen sind alt, mit scharfen Zacken, die aussehen wie Zähne, die jeden Moment zuschnappen könnten, wenn man ihnen zu nahe kommt.
Das Nächste, was ich sehe, lässt mein Herz wie verrückt schlagen, und für eine Sekunde habe ich Angst, dass es mir aus dem Körper springt und davonläuft. Verstreut zwischen Haus und Waldrand sind Gräber, wie sie auf dem alten Friedhof gegenüber der Sägemühle zu finden sind. Die mit den Holzzäunen anstelle eines Grabsteines, meine ich. Die Gräber hier haben einen Zaun, der genauso gebaut ist wie die Hütte des Alten: aus aufeinandergestapelten Baumstämmen. Sie sind klein, wie für Kinder.
»Ich hatte sechs. Nicht mehr viel übrig von ihren Hütten, eh?« Der alte Mann steht im Hintereingang. Acimosis kaut neben ihm hingebungsvoll an einem Knochen. Das alles ergibt keinen Sinn. Der Alte redet mit mir, als ob wir uns schon ewig kennen würden. Als ob ich ein Freund wäre, der einfach mal zu Besuch vorbeischaut, und nicht ein Fremder, der gerade eben sechs Gräber im Hinterhof entdeckt hat. Ich will weg, so schnell wie möglich, aber meine Beine gehorchen mir nicht.
»Acimosis ist der Letzte, aber er ist nie im Team gelaufen«, erklärt der Alte.
Team? Jetzt endlich geht mir ein Licht auf. Na klar, atim heißt »Hund«. Könnte otapewatim »Schlittenhund« heißen? Der alte Mann hatte Schlittenhunde! Beinahe lache ich laut auf, als mir klar wird, dass ich nicht auf Gräber starre, sondern auf verfallene Hundehütten.
»Cool«, rutscht es mir heraus, und im gleichen Moment wünsche ich mir, ich hätte nichts gesagt. Der Alte sieht so einsam und verlassen aus inmitten der Hütten von Hunden, die längst nicht mehr da sind, dass es sich fast wie auf einem Friedhof anfühlt.
»Astam. Komm rein.« Der Alte geht ins Haus und lässt die Tür weit offen. Am liebsten würde ich draußen bleiben, wo der Hund ist, aber ich kann den Alten ja nicht einfach so ignorieren. Also folge ich ihm ins Innere der Hütte.
Es dauert eine Weile, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, aber als es so weit ist, muss ich mehrmals blinzeln, um ganz sicher zu sein, dass meine Augen mir keinen Streich spielen. Die Hütte ist voll mit Krempel, wie sie ihn im Poplar Point Trading Post, dem alten Laden für Fellhändler, verkaufen. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass das Zeugs heute noch jemand kaufen würde. Wer braucht schon Öllaternen und Kaffeekannen aus Emaille, Holzöfen aus Blech und Goldgräberpfannen? Aber hier ist all das! Okay, vielleicht keine Goldgräberpfannen, aber wer weiß? Immerhin gibt es noch ein paar dunkle Ecken, in die ich nicht sehen kann. Keine Ahnung, was da noch alles ist. Irgendwie komme ich mir wie in einem Museum vor – außer, dass sich in einem Museum alles immer so verstaubt und nutzlos anfühlt. Hier werden die Sachen alle noch benutzt.
Ich setze mich auf den dreibeinigen Hocker an dem Tisch beim Fenster, durch das milchiges Licht fällt. Der alte Mann wirft ein paar Teebeutel in den Kessel, der auf dem Holzofen vor sich hin blubbert. Das Wasser ist schon heiß; als ob der Alte mich erwartet hätte. Der Kessel kocht über, Tee spritzt auf den heißen Ofen und formt dunkle Perlen, die sich mit einem Zischen in Dampf auflösen.
Der Alte gießt Tee in eine mit altem Kaffee verklebte Tasse und reicht sie mir. Der Tee ist pechschwarz, und ein öliger Film schimmert auf der Oberfläche; mir dreht sich der Magen um, als ich die Tasse annehme. Ich schaufele löffelweise Zucker in meine Tasse – als ich damit fertig bin, schwimmt etwas Unidentifizierbares in meinem Zuckertee.
Der Alte schiebt ein Stück Bannock über den Tisch.
»Nein danke«, rutscht es mir heraus. Das war zu schnell, ich wollte den Alten nicht beleidigen. »Ich habe gerade erst gegessen«, schiebe ich hinterher, was normalerweise kein Grund für mich ist, Nein zu Bannock zu sagen, aber dieser Tag ist sowieso alles andere als normal.
Der alte Mann nippt laut schlürfend an seinem Tee, als ob er vergessen hätte, dass ich hier bin.
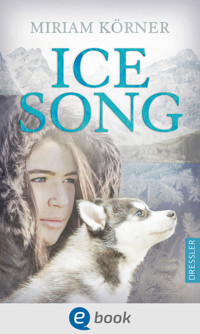













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














