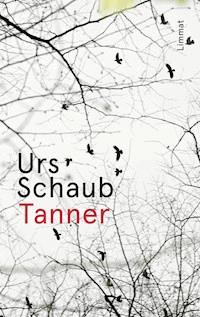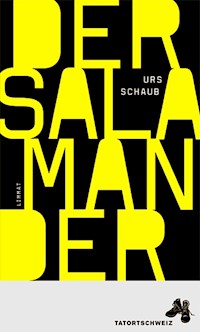Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Simon Tanner ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eines Morgens bedecken mit Katzenblut gemalte Zeichen die Türen eines Schweizer Dorfes. Es sind Schutzzeichen aus dem zweiten Buch Moses, mit denen Gott sein Volk vor dem Tod bewahrte. Doch warum tragen sieben der Häuser kein Zeichen an der Tür? Als die ersten Dorfbewohner spurlos verschwinden, muss Tanner handeln ... Der dritte Roman um den charismatischen Ermittler Simon Tanner erschafft Bilder von fast alttestamentarischer Kraft, atmosphärisch dicht und voller erotischer Spannung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In einem abgelegenen Schweizer Dörfchen sind eines Morgens alle Türen mit Zeichen aus Katzenblut bemalt. Bis auf sieben. Kurz darauf wird eine grausam verstümmelte Leiche gefunden, und ein Zwillingspaar verschwindet spurlos. Sie alle waren Bewohner der sieben Häuser ohne Blutzeichen an der Tür. Simon Tanner, der seit seinem freiwilligen Abschied aus dem Polizeidienst in dem nebelverhangenen Dorf wohnt, begibt sich auf die Spur. Zusammen mit seinem Freund und ehemaligen Kollegen Kommissar Serge Michel entdeckt er, dass es sich bei dem Blut an den Türen um alttestamentarische Schutzzeichen handelt. Missgunst, Ränkespiele und lang unterdrückte blutige Geheimnisse tun sich hinter der idyllischen Dorfkulisse auf. Erst die Erwähnung einer selten gewordenen Apfelsorte bringt Tanner auf die Spur einer längst vergessenen Gewalttat.
Urs Schaub, geboren 1951, arbeitete lange als Schauspiel-Regisseur und war Schauspiel-Direktor in Darmstadt und Bern. Als Dozent arbeitete er an Theaterhochschulen in Zürich, Berlin und Salzburg. 2003 bis 2008 leitete er das Theater- und Musikhaus Kaserne in Basel, 2006 bis 2010 war er Kritiker im «Literaturclub» des Schweizer Fernsehens. «Wintertauber Tod» ist der dritte von vier Kriminalromanen mit dem charismatischen Ermittler Simon Tanner. Urs Schaub lebt in Basel.Foto Yvonne Böhler
Wüsste man, wer diese Notizen macht.
ausMonsieur TraumRobert Pinget
JAHRE ZUVOR
Das Ganze begann mit einem Fehler.
Genau genommen gibt es in solchen Fällen natürlich keinen Anfang. Aber den Fehler gab es, und er war schlimm. Bemerkt hat ihn trotzdem keiner.
Am wenigsten der Mann, der ihn machte.
Wenn ein in der Regel zuverlässiger Beamter auf einem labyrinthisch weit verzweigten Rangierbahnhof die erste Weiche falsch stellt, was dann?
Der weitere Weg des heranrollenden Güterwagons wäre zwar falsch, aber dennoch klar vorgegeben. Mit unvorhersehbaren Folgen. Im besten Fall würde der Waggon an einem falschen Ort zu stehen kommen, im schlimmsten einen Unfall verursachen. Unabhängig davon, aus welchem Grund der Weichensteller den Fehler gemacht hat.
Aber man würde ihn bemerken. Den Fehler.
Vielleicht hat der Beamte am Stellwerk, wie seit Tagen, an diese elende Summe gedacht, die in seinem Sparbuch steht und die seine Zukünftige nach wie vor als zu bescheiden bezeichnet, um ihn zu heiraten. Vielleicht hat er sich deswegen verzweifelt über Möglichkeiten zur Vermehrung besagter Ersparnisse den Kopf zerbrochen. Und wer weiß, vielleicht hat ihn die sehnlichst erwünschte Geldsumme so sehr abgelenkt, dass er die Weiche, ohne es zu merken, falsch betätigte. Möglicherweise würden dadurch einige eilige Güter erst Tage danach wiedergefunden, dazu noch verdorben, und die Eisenbahngesellschaft würde eine Konventionalstrafe zahlen müssen, die das besagte elende Sümmchen des Weichenstellers um ein Vielfaches übersteigt. Wahrscheinlich würde er in der Folge seine Stelle verlieren, sich aus Verzweiflung dem Suff hingeben, denn das Einzige, was er in seinem Leben gelernt hat, ist Weichenstellen, und er würde fortan aus Verzweiflung … und so weiter.
Inmitten dieser Spekulationen bliebe eine Wahrheit unveränderlich: Der Güterwaggon stünde trotzdem am falschen Ort.
Manz wusste nichts von derart komplexen Gedankengängen.
Er fühlte sich einfach verpflichtet, die Leiche zuzudecken. Schließlich war es bitterkalt, und zudem sah der offene Bauch nicht gerade appetitlich aus. Er wollte keine Spuren beseitigen, tat es aber gründlich.
Wie durch ein Wunder war es das erste Opfer einer Gewalttat, mit dem er es in seiner Zeit als Polizist zu tun hatte. Zu seinem Alltag hatte bisher die Kontrolle der Polizeistunde und der Hotelmeldezettel gehört. Immerhin gab es in dem kleinen Straßendorf eine Dorfkneipe mit angeschlossenem Hotel, das vorwiegend von durchreisenden Vertretern frequentiert wurde; ein Restaurant, das gut dreihundert Meter neben dem Bahnhof lag, mit diesem eigentlich gar nichts zu tun hatte und trotzdem Bahnhofrestaurant hieß; sowie ein französisches Gourmetrestaurant mit Gästezimmern. Hier pflegten ab und zu Tänzerinnen zu übernachten, die in einem Nachtlokal auftraten, das zu den wenigen Attraktionen des nahe gelegenen Bezirksstädtchens gehörte.
Vor wenigen Jahren brannten in einer Nacht vier verschiedene Häuser gleichzeitig. Trotz aller Nachforschungen und Untersuchungen der Polizei aus dem Hauptort gelang es nicht, den Täter zu überführen. Das war eigentlich Manz’ schlimmster Fall, obwohl auch damals keine Menschen zu Schaden kamen.
Zu seinen weiteren Pflichten gehörte die Schlichtung unzähliger Nachbar- oder Familienstreitigkeiten (was sehr oft dasselbe bedeutete); die administrative Erfassung von Fahrraddiebstählen und einer Vielzahl weiterer kleiner Delikte, die vor allem eines mit sich brachten: einen unendlichen Fluss an Papieren und Formularen, der ihn mit dem Kommissariat in der Kantonshauptstadt wie mit einer Nabelschnur verband. Schließlich war er einer der letzten Dorfpolizisten im ganzen Land, eine Art Vorposten im Niemandsland zweier zusammentreffender Sprachregionen. Besser gesagt: ein Restposten in einem wirtschaftlich und politisch vergessenen Teil des Landes.
Ob dieser Landstrich deswegen so schön war? Der Dorfpolizist Manz hatte da so seine eigene Theorie. Davon wird viel später noch einmal die Rede sein. Wie auch immer: Nach seiner Pensionierung würde der Posten endgültig eingespart werden, ein Nachfolger war nicht vorgesehen. Das war längst beschlossene Sache. In seinen Augen wurde mit dieser Entscheidung das ganze Gebiet zur rechtsfreien Zone erklärt. Ganz zu schweigen von denen, die Hilfe benötigten!
Vor zwei Jahren hatte den Bahnhofsvorstand dasselbe Schicksal ereilt. Seither hielten am kleinen Bahnhof zwar nach wie vor im Stundentakt Züge, aber alles lief automatisiert ab und wirkte wie ferngesteuert, obwohl die Lokomotiven noch von leibhaftigen Menschen gesteuert wurden. Die Bahnhofsschalter waren mit Brettern vernagelt. Beim Billetkauf war jetzt Schluss mit dem beliebten Schwätzchen, das die Dorfbewohner mit Monsieur Veillon regelmäßig gepflegt hatten. Der Automat empfing per Tastendruck seine Befehle und spuckte leise scheppernd seine schäbigen Tickets aus. Die schönen Fahrkarten aus Karton, zum Teil zweifarbig, die man sammeln und zu ansehnlichen Häufchen hatte stapeln können, gab es längst nicht mehr. Brauchte jemand eine Auskunft, trat er an eine Infosäule, wo sich zu bestimmten Tageszeiten und meist nach langer Wartezeit schnarrend eine Stimme meldete. Der kleine Wartesaal war zum Depot eines Vertreters für Strumpfwaren verkommen.
In der Dienstwohnung des Bahnhofsvorstandes lebte jetzt eine kinderreiche Familie aus den ehemaligen Krisengebieten des Kosovo. Lange Zeit wusste man nämlich nicht, was man mit der leeren Wohnung anfangen sollte. Wer will schon in einem heruntergekommenen Bahnhof wohnen? Genauso ratlos war man gegenüber der Flüchtlingsfamilie, die durch eine administrative Panne der Kantonshauptstadt in dem Dorf gelandet war. Als man sie nicht mehr ab- oder zurückschieben konnte, brachte man sie aus lauter Verlegenheit im Gasthof Zum Hirschen unter. Dort, wo sonst vorwiegend Vertreter übernachteten. Ein paar Tage später erinnerte sich ein Schlauberger aus dem Gemeinderat, der wegen der laufenden Hotelkosten nicht mehr schlafen konnte, an die leere Bahnhofswohnung. Man ließ sich unter fadenscheiniger Begründung von der Heilsarmee einige Möbel schenken – und auch noch gratis liefern – und zwei unangenehme Probleme waren auf einen Schlag gelöst. Die geniale Idee des schlauen Gemeinderates wurde mit reichlich Weißwein begossen.
Kurz darauf – als handelte es sich um einen Virus – schlossen die Schalter des kleinen Postamtes. Demnächst würde, wie gesagt, den Polizeiposten dasselbe Schicksal ereilen, und im nächsten Sommer würde die genossenschaftseigene Käserei für immer dicht machen.
Den Reigen der Schließungen hatte vor einem Jahr ausgerechnet die Kirche begonnen. Die Obrigkeit der Diözese degradierte ohne Voranmeldung die kleine Kirche zu einer Filiale der Nachbargemeinde und suchte für den frühzeitig pensionierten Seelsorger nur noch pro forma einen Nachfolger. Natürlich fand man keinen. Damit war die Sache abgeschlossen, und die Mitglieder der kleinen Kirchgemeinde rieben sich die Augen. Ein frisch eingesetzter Priester aus dem größeren Nachbarort hielt seine Sonntagspredigt fortan also zweimal. Die wenigen Leute, die regelmäßig zum Gottesdienst kamen – es waren vorwiegend ältere Frauen –, meinten die Wiederholung der Worte zu fühlen und verschlossen sich immer mehr dem jungen Priester gegenüber, der sich redlich Mühe gab, den zum zweiten Mal vorgetragenen Predigtworten den Tau der Frische zu verleihen.
Aufgebackenes Brot bleibt aufgebackenes Brot!
So hörte man die alten Frauen zwischen ihren Gebeten murmeln. Als der Priester einmal aus Versehen in seiner Predigt auch noch die Namen der beiden Ortschaften verwechselte, lachten die Anwesenden böse auf, bekreuzigten sich und warfen sich bitter lächelnd Blicke der Bestätigung zu.
Manz hatte nun mittlerweile den Tatort so aufgeräumt, wie er glaubte, es tun zu müssen. Schließlich war er ein Mensch, der schon immer Wert auf Ordnung gelegt hatte. In den offenen Hauseingang war nämlich der Schnee hineingeweht worden, der draußen fast einen Meter hoch lag. Nachgemessen hatte er natürlich nicht, aber der Schnee lag auf jeden Fall höher als in all den Jahren zuvor, in denen der Polizist hier seinen Dienst verrichtet hatte. Bevor er den Leichnam zudeckte, fegte er also den Schnee gründlich nach draußen und sammelte einige Gegenstände auf, die ganz offensichtlich aus dem schmalen Vorratsschrank, der im Flur stand, herausgefallen waren. Wahrscheinlich hatten die Windböen die Schranktür aufgeweht, und so waren einzelne Gegenstände auf dem Leichnam zum Liegen gekommen. Es waren einige rote Bändel, diverse Schnüre, weiße Kerzenstummel und farbige Papierschnitzel, kurz, alles Dinge, die man durchaus in einem Schrank aufbewahrte, erklärte sich der Polizist den Sachverhalt. Geduldig sammelte er alles auf und verstaute es wieder fein säuberlich im Wandschrank. Einige herumliegende geschälte Äpfel, zum Teil blutverschmiert, legte er auf eine Handschaufel und entsorgte sie in den Abfalleimer, der hinter dem Haus stand. Über die Äpfel machte er sich keine weiteren Gedanken, die waren sicher auch aus dem Schrank gefallen, schließlich handelte es sich um einen dieser in alten Häusern üblichen Vorratsschränke, die für gewöhnlich im Flur standen. Die Bewohner dieser ärmlichen Häuser hatten oft gar keinen Kühlschrank oder nur einen ganz kleinen. So war man auf einen Vorratsschrank im unbeheizten Flur angewiesen.
Danach schloss er die Haustür hinter sich, holte einen Augenblick lang Atem und musterte die Umgebung. Das Nachbarhaus lag still und verschlossen da. Nichts rührte sich. Die Fenster schauten kalt und abweisend auf den Polizisten. So kam es ihm auf jeden Fall vor.
Er fragte sich in diesem Augenblick, ob die Mutter vom Müller Franz, dem Täter, der ja bereits in der hinter seiner Amtsstube liegenden Zelle saß, die er höchstens alle paar Monate als Ausnüchterungszelle brauchte und sonst zum praktischen Ablageort für jede Art von Akten umfunktionierte, ob sie also, die Schweigerin, wie man sie insgeheim im Dorf nannte, über die furchtbare Tat ihres einzigen Sohnes im Bilde war?
Als der untersetzte junge Mann, der bereits einen Bauchansatz hatte, vor zwei Stunden an der Tür des Polizeipostens geklopft hatte und dann still, fast scheu in die Amtsstube getreten war, um sofort und ohne Umschweife in ruhigen, ja geradezu gesetzten Worten seine Tat zu gestehen, hatte der Polizist zweimal nachfragen müssen, weil er die Geschichte einfach nicht glauben konnte. Und das, obwohl beide Hände von Franz voller schwarz-braunem, eingetrockneten Blut waren. Auch um den Mund herum war er verschmiert. Wahrscheinlich hatte er sich mit den blutverschmierten Händen über den Mund gewischt. Franz beteuerte im gleichen Atemzug, dass seine Mutter nichts davon gewusst und mit der Sache überhaupt nichts zu tun habe. Am besten wäre es, hatte er vorgeschlagen, wenn sie gar nichts davon erführe. Das sei natürlich nicht möglich, erwiderte der Polizist, aber darüber könne man nachher noch reden. Er solle jetzt sowieso am besten einfach schweigen. Er würde ihn fürs Erste in die Zelle sperren, vorher müsse er aber noch etwas aufräumen. Ob Franz so gut sei, einen Moment Platz zu nehmen? Vorher könne er sich aber, wenn er wolle, die Hände und das Gesicht waschen. Franz wusch sich die Hände und das Gesicht, war dann so gut und setzte sich. In aller Seelenruhe hatte der Polizist dann die Zelle leergeräumt, anschließend den Franzli, wie ihn im Dorf jeder nannte, hineinbefördert und die Gittertür zweimal abgeschlossen. Er hatte noch kurz überlegt, ob er die Zelle feucht aufnehmen solle, aber das schien ihm dann doch übertrieben. Den Schlüssel steckte er sorgfältig in die Hosentasche seiner Uniformhose. Bevor er seine Vorgesetzten in der fernen Kantonshauptstadt benachrichtigte, musste er selber an den Ort des Geschehens gehen. Er wollte sicher sein, dass Franzli die Wahrheit gesagt hatte. Glauben konnte er es immer noch nicht. Das Opfer kannte er natürlich, und auch das Haus.
Also stapfte er durch den Schnee. Zuerst die Hauptstraße entlang, dann den Weg hinunter zum alten Zollhaus. Noch zehn Meter vom Haus entfernt, konnte er sich immer noch nicht vorstellen, dass Margot Fuchs tot sein sollte. Ein paar Schritte weiter blieb ihm nichts anderes übrig.
Sie lag im offenen Hausflur am Boden, der Schnee war rot von ihrem Blut. Ihr Leib war von unten bis oben aufgeschlitzt. Manz musste sich an den Türrahmen lehnen. Aufgeschlitzte Leiber hatte er in der Fremdenlegion gesehen. Aber damals herrschte Krieg. Warum hatte der Franzli denn so eine Wut auf die Margot? Sie hat sich doch immer sehr lieb um ihn gekümmert. Manz schaute auf den übel zugerichteten Körper. Trotz ihres Zustandes konnte man immer noch sehen, dass Margot die schönste Frau weit und breit gewesen war. Wie oft hatte Manz nachts heimlich vor ihrem Haus gestanden und gehofft, er könne einen Blick auf sie erhaschen.
Einmal war ihm das Glück hold gewesen und er hatte sie nackt im Licht ihrer Küche stehen sehen. Sie trocknete sich gerade mit einem Tuch ausgiebig und gründlich die nassen Haare. Und da hatte er endlich gesehen, wovon die Männer im Dorf hinter vorgehaltener Hand sprachen: ihre wunderbar weißen Brüste, die so ungewöhnlich herausfordernd aufgerichtet standen, wo doch schon kleinere naturgemäß der Erdanziehung gehorchen mussten. Dies bisschen Sachwissen über die weibliche Anatomie hatte er sich beim verschämten Studium gewisser reich bebilderter Magazine angeeignet, die er sich per Nachnahme kommen ließ. Bei Margot handelte es sich in Manz’ Augen aber um ein Wunder der Natur. Da war sein Schwanz auf der Stelle ungeheuer angeschwollen und er selber zur Salzsäule erstarrt. Er hatte zum Himmel gefleht, dass der Augenblick ewig dauern möge.
Aber ewig gibt es möglicherweise da oben, aber ganz sicher nicht auf Erden.
Als sie sich mit dem Handtuch energisch die Haare frottierte, wippte ihr Busen wunderbar träge hin und her und auf und ab. Da überkam es ihn mit Macht und er öffnete seine Hose. Sie bürstete ihr wildes Haar und betrachtete sich noch eine Weile stumm im Spiegel. In diesem Augenblick war sie die Bild gewordene wollüstige Fantasie eines großen Künstlers.
Er spritzte aufstöhnend in den Eukalyptusbusch und hatte im selben Moment eine Vision von Gottes Herrlichkeit.
In der Fremdenlegion war ER ihm nämlich abhanden gekommen. Aber jetzt hatte er, Manz, SEIN schönstes Kunstwerk gesehen und sich in seiner höchsten Lust mit ihr und IHM vereinigt. Leider dauerte es wie gesagt nur eine kurze Ewigkeit und keine ganze. Aber die reichte, um ein Leben lang davon zu träumen und sich alle nur erdenklichen Hoffnungen zu machen. Gut, er war deutlich älter als sie, aber er hätte sie bis ans Ende ihres Lebens auf Händen getragen. Und wenn sie ihn geheiratet hätte, hätte sie ganz bestimmt nicht so ein schlimmes Ende genommen. Aber er war überzeugt, dass er ihr mit seinem Gehalt als Dorfpolizist sowieso zuwenig gewesen wäre. Wie oft hatte er vergebens über seinem abgegriffenen Sparheft gesessen und sehen müssen, dass der Betrag immer etwa gleich kümmerlich blieb, egal wie sparsam er lebte. So blieb er Junggeselle und sie sein ewiger Traum, ohne dass er je mehr als eine Handvoll scheuer Sätze mit ihr gewechselt hätte. Er tröstete sich damit, dass er eben mit seinem Beruf verheiratet war.
Manz seufzte, bekreuzigte sich und sprach ein kurzes Gebet für die tote Füchsin.
Danach dachte er nichts mehr, sondern konzentrierte sich aufs Aufräumen und Schneewischen. Erst ganz am Schluss konnte er sich nicht beherrschen und fasste sie an.
Ein einziges Mal ihren Körper berühren, so wie er sich das jahrelang erträumt hatte.
Er zog die Handschuhe aus und legte seine zitternden Hände auf ihre Brüste. Er zuckte aber gleich wieder erschrocken zurück, denn ihr Fleisch war so eiskalt, dass es ihn ängstigte und er nun am ganzen Körper schlotterte. Panisch machte er kehrt und rannte zurück auf seinen Polizeiposten.
Sieben Monate später wurde Franz Müller vom Gericht in der Kantonshauptstadt als voll zurechnungsfähig eingestuft und wegen Totschlags im Affekt (und weil er wegen einiger früherer Delikte vorbestraft war) zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Franzlis Mutter saß schmal und klein im Gerichtssaal.
Manz, drei Reihen hinter ihr, nahm mit Befriedigung zur Kenntnis, wie schnell und zuverlässig die Gerechtigkeit in diesem Land arbeitete. Er war zwar bereits seit drei Monaten pensioniert, fühlte sich aber immer noch als ein Teil dieses Ganzen.
EINS
Tanner liebte seit kurzem Spaziergänge. Jeden Morgen, egal bei welchem Wetter, machte er sich auf den Weg. Wie das kam, konnte er sich selber nicht erklären. Die Lust dazu war eines Tages plötzlich da gewesen.
Er lächelte, während er sich die Schuhe anzog.
Früher hatte er Spaziergänge gehasst, sie als die langweiligste Sache auf der Welt empfunden. Direkt qualvoll.
Jetzt wählte er bereits zwischen sechs Standardspaziergängen, die sich sowohl in Länge, Topographie als auch im Erlebnispotential deutlich unterschieden. Heute hatte er sich für die kürzeste, dafür aber meistens bei weitem erlebnisreichste Variante entschieden, nämlich die durchs Dorf. Die nächst längeren Spaziergänge führten entweder um das Dorf herum oder am See entlang bis zum Ringmauerstädtchen, wo man deutsch sprach und die besten Gipfelis weit und breit erhielt. Oder in die entgegengesetzte Richtung bis zum Städtchen auf dem Hügel mit seiner eindeutig französischen Ausprägung, wo man die besten Croissants weit und breit bekam. Diese beiden Spaziergänge erforderten jedoch eine Rückfahrt mit der Eisenbahn, denn wer geht beim Spazieren schon gerne denselben Weg zurück. Der längste Spaziergang führte um den See herum, was allerdings einen ganzen Tag in Anspruch nahm. Eine weitere Variante führte hinaus aufs melancholische Land, weg von Dorf und See. Dazu hatte er heute aber keine Lust, denn in der Nacht war der erste Schnee gefallen. Wiesen und Dächer waren weiß. Und es war ungewöhnlich still, denn noch waren die Straßen nicht geräumt.
Er war gespannt, wie sich das kleine Dorf präsentieren würde, da es hier laut Aussage der Einheimischen äußerst selten schneite. Auf jeden Fall nicht, seit Tanner in dem altehrwürdigen Maison Blanche Wohnsitz genommen hatte. Die Leute sagten, dass es vor Jahren einen Jahrhundertschneefall gegeben und auf den Straßen über ein Meter Schnee gelegen habe. Drei Tage sei das Dorf damals von der Außenwelt abgeschnitten gewesen. Neun Monate später seien dann übrigens überdurchschnittlich viele Kinder zur Welt gekommen. Diese Information hatte er von Solène erhalten, und sie lachte dabei ziemlich anzüglich. Seither soll hier kein Schnee mehr gelegen haben. Vielleicht mal ein bisschen Puderzucker. So nannten es die Leute, wenn ein bisschen Schneestaub die Landschaft bedeckte.
Das hier war kein Schneegebiet, es war eine Nebellandschaft.
Offiziell hätten eigentlich alle französisch sprechen müssen. Das Dorf lag exakt an der Sprachgrenze. Allerdings auf der falschen Seite.
Tanner schloss die schwere Haustür hinter sich und atmete die Schneefrische.
Gerade passierte sein Nachbar auf dem Schnee bedeckten Trottoir das offene Tor der Einfahrt. Er schleppte eine schwere Kiste und stieß über dem roten Wollschal, der seine Standeskleidung zierte, keuchend weiße Wolken in die Luft. Es handelte sich um keinen geringeren als den Chefkoch und Inhaber des französischen Nobelrestaurants, das in Sichtweite von Tanners Wohnsitz lag, ganz am Anfang des Dorfes. Sein Wohnhaus dagegen war in direkter Nachbarschaft, dicht neben Tanners Haus. Lediglich ein schmales Gartenband trennte die beiden Häuser voneinander.
Allo! Guten Morgen, Tanner! Gefallen Sie der Schnee? Ist mal eine Wechsel, oder?
Sein Deutsch war fließend, aber nicht immer ganz korrekt. Er war einer der wenigen im Dorf, die wirklich französisch sprachen. Sein Name war Claude Marnier. Die Bewunderer seiner Kochkunst nannten ihn Marnier le Grand. Die Anspielung auf den berühmten Liqueur war durchaus beabsichtigt.
Kommen Sie doch auf ein Glas Wein, wenn Sie eine Weile haben. Muss dringend eine Sache fragen, bitte.
Ja, ja. Ich komme zum Kaffee. Nach dem Spaziergang. Bis dann! Tanner verließ das Grundstück durch die Schnee bedeckte Einfahrt, ging aber in die andere Richtung als Marnier. Heute knirschte der Kies nicht unter seinen Füßen, denn der Schnee dämpfte alle Geräusche. Nur der Brunnen plätscherte unbeeindruckt seine ewige Melodie.
Dreihundert Meter weiter vorne, an der einzigen nennenswerten Kreuzung der Dorfstraße, wechselten in diesem Augenblick die Ampeln auf grün, und eine Reihe von Lastwagen und Personenwagen fuhr betont langsam und erstaunlich geräuscharm durch das Dorf. Tanner schüttelte den Kopf und steckte die Hände in die Taschen seines warmen Wollmantels.
Leider entsprach diese Situation ganz und gar nicht dem Alltag, hatte es die Gemeinde vor Jahrzehnten doch verpasst, sich anlässlich der nationalen Landesausstellung im Welschland vom Kanton eine Umfahrungsstraße schenken zu lassen. Man hatte damals Angst, dass kein einziger Gast mehr den Weg ins Dorf finden würde. Das heißt, die Gastronomen und Hotelbesitzer hatten Angst und das notwendige Gewicht im Gemeinderat. Also wurde das Geschenk und damit die entlastende Umfahrungsstraße abgelehnt.
Tanner ärgerte sich jedes Mal, wenn er an diese Dummheit dachte.
Seit nun vor ein paar Jahren die Autobahn gebaut worden war, hatte sich die Situation sogar noch verschärft, und das Dorf war heute doppelt gestraft. Viele der potentiellen Gäste rasten auf der Autobahn vorbei, ohne die Existenz des gastlichen Dorfes auch nur zu ahnen. Dafür donnerten die Lastwagen, die für die Güterversorgung des Bezirks zuständig waren, nach wie vor über die enge Dorfstraße. Unangenehm war das natürlich für alle. Für die Restaurants und das Hotel jedoch war es eine regelrechte Katastrophe. Früher hatten die vielen Welschlandreisenden hier gerne einen kürzeren oder längeren Zwischenhalt gemacht. Tatsächlich verband eine lange, gewachsene Tradition den Reiseverkehr mit dem Dorf. Zu Napoleons Zeiten war zum Beispiel das Haus, in dem Tanner wohnte, Herberge und Relaisstation für die Postkutschen aus und nach Paris gewesen. Solche Dinge prägten den Charakter eines Dorfes nachhaltig und waren nicht beliebig ersetzbar.
Der Hotelparkplatz hinterm Hirschen war praktisch leer. Hingegen parkten auf dem weiter vorne gelegenen Kneipenparkplatz einige Autos, zwei Traktoren und ein Jeep.
Keine gute Saison für das Hotel, dachte Tanner. Für die notorischen Dorfsäufer war allerdings immer Hochsaison. Die Fahrzeuge kannte er bereits alle, denn die standen praktisch jeden Tag hier.
Er grüßte den Besitzer der Autowerkstatt, der mit einem überdimensionierten Reisigbesen den Platz vor der Werkstatt vom Schnee befreite. Den alten Ford hatte Tanner hier ohne weitere Bedenken zur Wartung und zur Reparatur gebracht. Von seinem neuen Wagen allerdings hätten die mit Sicherheit nichts verstanden. Also brachte er ihn lieber nicht hierher, was ihm natürlich etwas übel genommen wurde. Trotzdem grüßte der Werkstattbesitzer freundlich zurück. Gelästert wurde auch in diesem Winkel der Erde ausschließlich hinterm Rücken.
Tanner überquerte diagonal die Kreuzung und hielt auf den Eingang zum einzigen Laden des Dorfes zu. Aus Solidarität und Sympathie kaufte er dort so oft wie möglich ein. Schlimm, wenn dieser Laden auch noch dicht machen müsste. Zudem genoss er die kleinen Schwätzchen mit den attraktiven Zwillingsschwestern, die den Laden gemeinsam führten. Für die Dorfbewohner hatte das Geschäft ebenfalls einen doppelten Nutzen: Für sie stellten die Zwillinge und ihr Laden so etwas wie eine letzte dörfliche Informationsbörse dar. Am heutigen Morgen war viel los, und als Tanner eintrat, verstummten die Gespräche verdächtig schnell.
Tanner grinste.
Ach ja, stimmt. Ich bin ja ein Fremder.
Tanner machte sich da keine Illusionen und wusste, dass sich auch in hundert Jahren nichts an der Situation ändern würde. Um dazuzugehören hätten seine Vorfahren schon mindestens Fähnchen schwenkend Napoleon die Ehre erweisen müssen, als der mit seinem Achtspänner durch das Dorf donnerte und vor Schreck erstarrte Hühner überfuhr.
Er ließ sich also nichts anmerken und sprach laut und deutlich einen freundlichen Gruß in die Runde, den man entweder mit gar keiner Reaktion oder höchstens einem leichten Nicken beantwortete. Nur die beiden Schwestern machten das Spielchen nicht mit und begrüßten ihn herzlich. Sie waren eben gute Geschäftsfrauen. Und auch sonst waren sie mit den meisten Dorfbewohnern nicht zu vergleichen.
Andererseits konnte er es den Leuten nicht verdenken. Zu viele Gerüchte waren über ihn im Umlauf, und er hatte noch keines widerlegt. Man wusste zwar, dass er vor einiger Zeit, nach einem polizeilichen Dienst in Marokko, in dieser Gegend gestrandet war. Man wusste, dass er danach maßgeblich an der Aufklärung der schrecklichen Kindsmorde in der nachbarschaftlichen Gemeinde beteiligt gewesen war und sich dabei in Elsie Marrer, eine junge attraktive Mutter eines dieser ermordeten Kinder, verliebt hatte. Elsie war hier im Dorfe wohlbekannt – und auch wohlgelitten. Sie wurde dann – so munkelte das Dorf über Elsies Schicksal – nicht ganz ohne Tanners Schuld vom Mörder in einem Eiskeller grausam gefangen gehalten und sei nach über einem Jahr im Koma schließlich im Krankenhaus verstorben. Elsies andere Kinder lebten seither bei Verwandten. Dass er diese Kinder nicht adoptiert hatte, wenn er sich schon einmal mitschuldig gemacht hatte, war ein weiterer Punkt, über den man sich den Mund zerriss. Dann gab es natürlich noch Spekulationen über das Vermögen, das er angeblich angehäuft hatte. Auf jeden Fall war es für alle Dorfbewohner offenkundig, dass er nicht zu arbeiten brauchte. Auch fuhr er eines der elegantesten Autos in der Gegend. Woher kam nur all dieses Geld? Tanners Vergangenheit präsentierte sich folglich mit einer Fülle interessanter Fragezeichen. Dass es ihm offensichtlich vollkommen egal war, was die Leute dachten, machten sie ihm zum größten Vorwurf. Denn für alle anderen war doch genau das am wichtigsten. Die einfach gestrickte Beweisführung endete damit, dass Tanner sichtlich anders war als die Dorfbewohner oder – was auf das Gleiche hinauslief – gar nicht dazugehören wollte. Damit hatten sie sich in ihren Augen auch das Recht erworben, ihn abweisend zu behandeln.
Tanner füllte wie immer einen großen Einkaufskorb mit allerlei Leckereien und brachte ihn zur Kasse. Später würde sich ein Schüler oder eine Schülerin vom gegenüberliegenden Schulhaus ein wenig Taschengeld dazuverdienen und die Einkäufe in seinen Hausflur stellen. Solène, die um drei Minuten ältere Zwillingsschwester, saß an der Kasse.
Tanner, haben Sie eine Katze?
Nein, Solène. Ich habe keine Katze. Wieso? Haben Sie eine zu verschenken?
Also, erstens bin ich Solange. Solène steht dort hinten und räumt Regale ein. Dass Sie uns immer noch nicht unterscheiden können!
Sie schüttelte dramatisch ihren hübschen Kopf.
Daraus schließe ich, dass wir Ihnen immer noch so gar nichts bedeuten. Was machen wir bloß falsch?
Tanner war felsenfest davon überzeugt, sie richtig erkannt zu haben. Schließlich steckte in Solènes Schürze immer ein roter Kugelschreiber. Solange zog Bleistifte vor. Auch war ihr Gesicht deutlich schmaler, so dass die relativ hohen Backenknochen, die beide besaßen, bei Solange ausgeprägter wirkten. Außerdem gab es gut unterscheidbare körperliche Merkmale, auch wenn sich die beiden tatsächlich auf den ersten Blick wie ein Ei dem anderen glichen. Und selbst bei Eiern gibt es bekanntlich Unterscheidungskriterien. Doch die Zwei spielten für ihr Leben gerne dieses Verwechslungsspielchen und er – er machte gerne mit.
Oh, das tut mir leid, Solange. Ich muss euch einfach mal besser kennen lernen, dann werde ich euch auch nicht mehr verwechseln.
Tun Sie das, Monsieur, tun Sie das! Aber nicht immer nur darüber reden!
Schon allein diese Aussage bewies, dass es sich um Solène handelte. Nie und nimmer hätte Solange so frech geflirtet.
Die beiden Schwestern warfen sich durch die Regale hindurch einen Blick zu und lachten übermütig. Die Kundschaft blickte missbilligend, und Solène senkte ihre Stimme.
Ach ja, wegen der Katzen. Nein! Ich habe keine zu verschenken. Aber … im Dorf sind letzte Nacht offenbar alle Katzen verschwunden. Auf einen Schlag. Ist das nicht sonderbar?
Ach so. Jetzt verstehe ich.
Tanner blickte sie an und wartete, bis sie wieder zu lachen begann, aber sie meinte es ernst.
So, so, die Katzen sind also verschwunden? Vielleicht mögen sie einfach keinen Schnee und haben beschlossen auszuwandern. Sind wahrscheinlich alle unterwegs in den Süden. Im Gänsemarsch. Oder per Anhalter. Das sollten wir übrigens auch tun. Tanner lachte. Solène tat so, als hätte sie nicht verstanden.
Was? Was sollten wir tun?
In den Süden fahren. Wir drei. Wir müssten nicht einmal Autostopp machen, sondern könnten mit meinem Auto fahren.
Machen Sie sich nur lustig, Monsieur. Wenn Sie eine Katze hätten und die einfach so verschwinden würde, wären Sie sicher auch traurig.
Entschuldigen Sie, Solène. Haben Sie denn ebenfalls Ihre Katze verloren?
Diesmal protestierte sie nicht gegen die Namenszuteilung.
Nein, nein. Ich will kein Haustier. Ich finde es immer traurig, diese Tiere in den Wohnungen und so. Zudem habe ich ja meine Schwester. Das ist Abwechslung genug.
Da haben Sie sicher Recht. Ich hoffe, die Katzen kommen wieder zum Vorschein.
Ja, das hoffen wir auch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Spaziergang, Herr Tanner.
Danke und auf Wiedersehen, Solène.
Tanner verließ den Laden fröhlicher, als er ihn betreten hatte. So erging es ihm jeden Tag.
Das nenne ich erfolgreiche Kundenanbindung. So einen Laden muss man mir in der Stadt erst einmal zeigen. Es ist wie ein kleines Wunder. Aber wie sagt man so schön: Raum ist in der kleinsten Hütte.
Er lachte vergnügt und wiegte den Kopf.
Was machten zwei so attraktive Zwillingsschwestern in diesem Dorf? In diesem Laden? Ein Rätsel, über das Tanner mitunter gerne nachdachte, doch zu einer schlüssigen Antwort war er noch nicht gekommen. Er hatte zu seinem Vergnügen schon etliche Thesen durchdekliniert. Alle Arten von unglücklichen Liebesaffären, bis hin zur Vermutung, dass die beiden irgendwo ein Verbrechen begangen hatten und sich hier in dem kleinen, unscheinbaren Dorfladen eine Weile versteckt hielten. Auf alle bisherigen, geschickt eingefädelten Fragen hatte er nur ausweichende Antworten erhalten. Wie auch immer, die beiden gefielen ihm außerordentlich gut. Wieso wäre er sonst freiwillig jeden Tag einkaufen gegangen, manchmal sogar zweimal am Tag? Er konnte die beiden zwar mittlerweile gut unterscheiden, aber sich noch immer nicht entscheiden, welche der beiden ihm besser gefiel. Auf den ersten Blick war es sicher Solène. Ihre Attraktivität sprang einem gleichsam ins Gesicht. Man konnte sich ihr kaum entziehen. Solanges Geheimnis musste zuerst entdeckt werden. Dann aber …
Es war wie in der Musik. Manche Melodien gingen gleich ins Ohr, andere entfalteten sich erst nach mehrmaligem Hören.
Zufrieden mit diesem Vergleich überquerte er die Straße zum Schulhaus, wo im Parterre die Gemeindeverwaltung untergebracht war. Die Fenster des ganzen Gebäudes waren trotz des hellen Tageslichts erleuchtet. Erstaunlicherweise hörte man keinen Ton. Vielleicht hatten alle Schüler gemeinsam eine schriftliche Arbeit zu bestehen. Oder sie lauschten atemlos einer Geschichte des Lehrers.
Da hörte er jemanden vom Schulhaus her seinen Namen rufen. Im Parterre lehnte sich die Gemeindeschreiberin aus einem offenen Fenster.
Entschuldigung, Herr Tanner?
Guten Morgen, Frau Gruber. Was gibt’s?
Haben Sie auch eine Katze? Und ist die vielleicht auch verschwunden?
Nein, nein. Ich habe keine Katze. Danke der Nachfrage. Sind denn wirklich so viele Katzen verschwunden?
Es gelten an die fünfundzwanzig Katzen als vermisst.
Haben Sie dafür eine Erklärung?
Nein. Das ist es ja. Man hat noch nie von einer Massenflucht von Katzen gehört. Aber es wird sich schon noch klären.
Das denke ich auch. Auf Wiedersehen.
Frau Gruber war ihm von Anfang an wohlgesonnen gewesen. Er wusste zwar nicht warum, aber ihre Freundlichkeit machte den Umgang mit der Gemeindebehörde durchaus angenehm.
Die Hauptstraße machte eine ganz leichte Kurve, und schon bald würde er das Ende des Dorfes erreicht haben. Interessant waren vor allem die Gebäude am Ende der Straße, und zwar die auf der linken Seite. An dieser Stelle blieb Tanner jedes Mal gerne stehen und schaute sich ausgiebig das große Gut an.
Umgeben von einem herrlichen alten Baumbestand, von gepflegten Hecken und Wiesen, die auf raffinierte Weise unmerklich in einen fast parkähnlichen Garten übergingen, stand, leicht erhöht, eine Backsteinvilla aus den Gründerjahren. Das Haus hätte eigentlich besser in die Nähe einer Stadt gepasst, doch die Vollkommenheit der Gartenanlage integrierte es erstaunlich gut in die bäuerliche Landschaft. Hinter dem Haus befanden sich Remisengebäude und Stallungen. Weiter zurückversetzt und noch etwas höher gelegen dominierte eine geradezu als riesig zu bezeichnende Scheune das Bild, die vor nicht allzu langer Zeit in eine moderne Reithalle umfunktioniert worden war. Im gigantisch großen Dachstock waren mehrere kleine, aber äußerst luxuriöse Wochenendappartements für Pferdebesitzer eingebaut worden. Die ganze Anlage wirkte klug konzipiert und schien innerhalb kurzer Zeit zu einem begehrten Anziehungspunkt für gut betuchte Pferdeliebhaber geworden zu sein. Durch den Schnee machte die Gestaltung der gesamten Anlage an jenem Tage einen noch einheitlicheren und einzigartigeren Eindruck als sonst.
Die Familie von Saalen, der das Gut gehörte, hatte seit Generationen einen bedeutenden Namen in der Pferdezucht. Der Alte von Saalen war zwar seit Jahren tot, aber seine Frau schien alles im Griff zu haben. Einer der beiden Söhne, so hieß es, sei als junger Mann von einem Pferdehuf schwer am Kopf verletzt worden und habe sich nach Jahren der Qual und der langsamen Verblödung mit einem Karabiner erschossen. Er habe offenbar in einem hellen Moment seine hoffnungslose Situation realisiert und sofort die Konsequenzen gezogen. Den anderen Sohn hatte Solène wörtlich einen ziemlichen Luftikus und Tunichtgut genannt. Über die Tochter hatte sie etwas mildere Worte gefunden.
Tanner wandte seinen Blick ab und setzte seinen Weg fort. Da er die Leute noch nie zu Gesicht bekommen hatte, hatte er sich auch noch keine eigene Meinung bilden können.
Er verließ die Hauptstraße nach rechts. Der Weg führte in Richtung See, zur alten Werft und zum Yachthafen. Links vom Hafen gruppierte sich eine Anzahl kleinerer und größerer Wochenendhäuschen zu einem kleinen Außenquartier des Dorfes. Die Häuser waren zum Teil in Selbstbaumanier mehr schlecht als recht zusammengezimmert. Die meisten waren offensichtlich über die Jahre immer wieder mit kleinen Anbauten erweitert worden. Material- oder Formabstimmung schien hier ein Fremdwort zu sein. Wellblech, Mauersteine, Beton, Holz roh, Holz bemalt, jegliche Art von Folie und Plastik, sogar Styropor bildeten die Baumaterialien. Alles in allem kein schöner Anblick. Eine ästhetische Absicht hinter dem Prinzip des Nichtzusammenpassens war dabei weit und breit nicht zu erkennen. Die Einheimischen nannten das wild entstandene Quartier politisch ziemlich unkorrekt das Negerdorf. Kürzlich hatten ein paar Neureiche, die ebenso wenig von Stilgefühl belastet waren, als Ergänzung zum Jahrmarkt der Hässlichkeiten noch ein paar protzige Pseudovillen dazugebaut. Tanner versuchte sich mit dem Gedanken zu trösten, dass man das alles auch als Ausdruck eines freien Willens interpretieren könnte. Die Hässlichkeit würde so betrachtet zu einer zwar ärgerlichen, aber unausweichlichen Dreingabe unserer Zeit.
Viel lieber aber betrachtete Tanner den langgestreckten Hügel jenseits des Sees, ein Anblick, den er aus seinem Fenster frühmorgens als erstes genoss, ohne dass er sich je an dieser sanft geschwungenen Linie satt gesehen hätte oder seines Anblicks gar überdrüssig geworden wäre. Und jetzt war er, dieser grandioseste Hügel aller Hügel, auch noch mit Schnee bedeckt, was die Erotik seiner Linienführung schärfer denn je hervorhob.
Die Tore der alten Bootswerft waren heute Morgen noch allesamt verschlossen. Normalerweise trat Tanner in die Hallen und begutachtete interessiert die Boote und Schiffe, die gerade in Arbeit waren. Meist endeten diese Besuche im Büro des Werftbesitzers, mit dem man äußerst angeregt plaudern konnte. Heute ließ er die Werft links liegen und ging direkt zum ehemaligen Gebiet der alten Zementfabrik hinüber, die vor einiger Zeit ziemlich aufwendig zum Hafen für kleine und große Yachten umgebaut worden war.
Tanner war auf die Farbe des Wassers gespannt, denn er hatte den See noch nie im Schneekontrast erlebt. Er kannte und liebte all die Schattierungen vom hellsten türkisblau bis zu den abgrundtiefsten Blau- und Grüntönen. Oder all die Weiß- und Grautöne der aufgebrachten Gischt, wenn der Joran über den Hügel brauste und den stillen Seespiegel von einem Moment auf den anderen zu einer dramatischen Meeresoberfläche aufwühlte.
Durch den ungewohnten Schneehintergrund und den von Wolkenfetzen bedeckten Himmel changierte die Farbe des Wassers zwischen grau und violett. Tanner wischte einen großen Stein an der Mole schneefrei, setzte sich trotz der Kälte hin und beobachtete das schillernde Farbenspiel.
Nach einer Weile holte es ihn wieder ein. Es geschah zwar immer seltener, aber heute Morgen passierte es. War es die Farbe des Wassers? Der See sah heute Morgen wirklich traurig aus. Zudem hatte Elsie die Farbe Violett ganz und gar gehasst. Sie hatte ihm mal gesagt, violett sei für sie die Farbe des Todes. Auch assoziierte sie die Farbe mit der katholischen Kirche, und die mochte sie überhaupt nicht. Eine Religion, die neugeborenen Kindern die Erbsünde auferlegte, war für sie inakzeptabel. Dass daher Kinder ohne Taufe auf dem direkten Weg in die Hölle kämen, sei ihrer Meinung nach krank. Zumindest lebensfeindlich. Und jetzt war Elsie selber tot.
Tanner stützte den Kopf auf seine Hände.
Warum konnte er nicht wie ein Kind einfach denken, dass Elsie im Himmel war und es gut hatte? Dass sie den ganzen Tag auf einer Wolke saß und über sein Leben wachte und das ihrer Kinder? Und zwischendurch mit den Engeln fröhliche Lieder zu Ehren Gottes sang?
Er schaute hinauf zu den grauen Wolken.
In den dreizehn Monaten, die er Tag für Tag an ihrem Bett verbracht hatte, war auch er versucht gewesen – wie viele in ähnlicher Situation – eine Art Kuhhandel abzuschließen. Wenn Du sie aufwachen lässt, glaube ich an Dich. Es hatte aber nicht funktioniert, sie war gestorben. Ihren schönen Körper gab es nicht mehr. Der war verbrannt. Das Häufchen Asche lag eingeschlossen in einer tönernen Urne und wartete darauf, in der Mitte des Sees verstreut zu werden. Diesen Wunsch hatte sie unvermittelt in einer ihrer Liebesnächte geäußert, und keiner hatte geahnt, wie schnell er Wirklichkeit werden sollte. Die Urne stand immer noch im leeren Schrank in einem der Zimmer, das er seit dem Tag, an dem er die Urne eingeschlossen, nicht mehr betreten hatte. Und er würde es so schnell auch nicht wieder betreten.
Tanner sprang von seiner kühlen Raststätte auf und setzte den Spaziergang fort.
Er war mittlerweile auf der Höhe des Bahnhofrestaurants angekommen, das gerade Betriebsferien hatte. Er liebte diesen Ort mit seiner einfachen Küche, den liebenswürdigen Besitzern und der heimeligen Gaststube. Und die Sommerabende an den Tischen unter dem Birnenspalier konnte man getrost als eine Form der reinen Poesie bezeichnen.
Der Bahnhofsplatz sah auch bei Schnee öde und verlassen aus. Hingegen übten die jenseits des Bahnhofs liegenden Gebäude auf Tanner stets den gleichen Zauber aus. Es war ein altes Herrschaftshaus, zu dem einer der größten Bauernhöfe des Dorfes gehörte. Der Gemeindepräsident – ein großer, knochiger Mann – und sein Bruder bewirtschafteten diesen Hof als Pächter. Die Herrschaft selbst war nur einmal pro Jahr vor Ort, an Weihnachten, um den Pachtzins einzukassieren, wie die Einheimischen in beinahe ehrfürchtigem Ton erzählten. Sämtliche tiefgrünen Fensterläden des großen Hauses waren also die meiste Zeit verschlossen. Mitunter bekam eine vertraute Person den Auftrag, das Haus zu lüften und zu reinigen. Dann standen für wenige Stunden einzelne Fenster plötzlich weit offen.
Das verschlossene Haus erinnerte ihn an die traurige Novelle über das vermeintlich gemütskranke Mädchen Susanna, das durch seinen Vormund in genau so einem Herrschaftshaus eingesperrt gehalten wurde. Sogar die Läden sollte es immer geschlossen halten, damit niemand ihre Schönheit entdecken konnte – und sie nichts von der Welt. Ein junger Mann hatte trotzdem das Glück, sie zu Gesicht zu bekommen, und die beiden verliebten sich unsterblich ineinander. Sie unterhielten sich jeden Abend im Schutz der Dunkelheit durch einen Schlitz im Fensterladen. Als der junge Mann für längere Zeit in die Hauptstadt fahren musste, gelang dem Mädchen die Flucht, und sie machte sich im tiefen Winter auf, immer der Eisenbahnlinie entlang, die in unmittelbarer Nähe ihres Hauses verlief. Genau wie hier. Der Bahnhofsbeamte hatte nämlich dem unerfahrenen Mädchen im Scherz geraten, wenn sie kein Geld habe und in die Hauptstadt wolle, müsse sie nur den Schienen folgen. Was sie dann auch tat. Nach einem langen Stück Wegs wurde sie müde, legte sich in den Schnee und erfror.
Die Trauer um das Schicksal des Mädchens war allerdings leichter zu ertragen als die andere, die immer noch wie ein Messer schnitt.
Die nächste Station zum Verweilen wäre die kleine Badeanstalt mit ihren altmodischen Holzkabinen und dem malerischen Steg, der weit in die kleine Bucht mit dem dichten Seerosenteppich hinausragte, gewesen. Der Steg stammte aus der Zeit vor der Versandung dieser Seeseite, in der hier noch regelmäßig Kursschiffe angelegt hatten. Eine hohe Stange mit einem altmodischen Namensschild der Station und dem erstaunlich poetischen Wappen des Dorfes zeugten von vergangenen Zeiten.
Im Winter ein weiterer verlassener, melancholischer Ort. Tanner mied ihn an diesem Tag und schritt zügig voran.
Kurze Zeit später erblickte er rechts, oberhalb des Hanges, an dessen Fuß die schmale Straße verlief, zuerst die Kirche mit dem Pfarrhaus und der kleinen Kapelle, in der neuerdings ein Philosoph hauste, und gleich darauf die Rückseite der Autowerkstatt, deren Besitzer er vorhin beim Schneewischen gesehen hatte, sowie einen Teil eines Bauernhauses. Schließlich das Haus von Marnier, dicht daneben das imposante Dach seines eigenen Wohnhauses und die steinernen Balustraden des parkähnlichen Gartens.
Die Straße schlängelte sich immer schmaler werdend zwischen diesem Hang und der Eisenbahnlinie entlang, bis zu einer ganz engen Nadelkurve, schon eher eine Art Spitzkehre, die so mancher Autofahrer kaum im ersten Anlauf meisterte. Danach führte die Straße praktisch in die Gegenrichtung zurück, den Hang entlang ziemlich steil aufwärts, bis sie endlich in die Hauptstraße mündete, an der entlang die Häuser des Dorfes hauptsächlich aufgereiht waren. Die Gebäude der Hangstraße besaßen eine merkwürdige Ausstrahlung. Es war nicht das Wissen allein, dass hier die Ärmsten des Dorfes wohnten, es war auch nicht die offensichtliche Verwahrlosung, die diesem Ort eine unangenehme Aura verlieh. Es ging etwas Unheilvolles, Unerlöstes von diesen morschen Häusern aus. Wann immer Tanner auf seinen Spaziergängen jemand angetroffen hatte, waren die Blicke weder freundlich noch offen. Aber was genau sein Unbehagen auslöste, hatte er noch nicht herausfinden können. Menschen hatte er hier sowieso selten angetroffen. Dafür verwahrloste und bellende Hunde in viel zu kleinen Zwingern. Einzig bei dem kleinsten Haus hatte er dann und wann einen alten Mann mit einem ganz und gar verschrumpelten Gesicht beim Holzspalten getroffen, der ziemlich leutselig zu einem kurzen Schwatz über die Qualität und Güte diverser Brennhölzer und Spaltbeile bereit gewesen war. Dass die Häuser bewohnt waren, verrieten eigentlich nur die vergilbten Vorhänge, die sich leise bewegten, wenn einer wie Tanner vorbeiging. Genau so geschah es auch an diesem Tag.
Er war offensichtlich der erste, der auf der schmalen Straße ging, denn der Schnee war noch jungfräulich unberührt.
Oben an der Hauptstraße angekommen, erinnerte er sich an die Aufforderung Marniers, ihm einen Besuch abzustatten. Tanner überquerte die Straße.
Trat man in das Restaurant, fühlte man sich augenblicklich zutiefst in das Frankreich einer vergangenen Epoche versetzt. Viel Gobelin an den Wänden und auf den Stühlen, schwere weiße Tischdecken. Unzählige Stiche wichtiger historischer Momente der Grande Nation zierten die Wände. Marnier erwartete ihn bereits in einem der kleineren Gasträume.
Danke, dass Sie meiner Einladung folgen, Tanner. Nehmen Sie ein Glas Wein?
Nein, danke. Ein Espresso und ein großes Glas Wasser wären mir lieber, bitte.
Ich schließe mich Ihnen an. Bitte nehmen Sie Platz. Wenn es recht ist, will ich gleich ohne Umleitung sagen, warum ich Sie reden will.
Nur zu, lieber Marnier.
Wir äh … wie sagt man? Wir vermissen? Ja, genau. Wir vermissen jemanden.
Sagen Sie jetzt nicht, Sie vermissen auch eine Katze.
Katze? Warum Katze? Wir hatten mal eine. Aber das ist lange her.
Ja, entschuldigen Sie, Marnier. Wissen Sie denn nicht, dass das halbe Dorf seine Katzen vermisst?
Nein, das wusste ich nicht. Stimmt das denn? Woher wissen Sie …?
Die Zwillinge aus dem Laden und Frau Gruber von der Gemeinde haben es mir gesagt.
Dann stimmt es sicher, Tanner. Vor allem Frau Gruber ist kein Spaß.
Beide lachten.
Nein, nein. Sie ist sehr nett, aber sie ist definitiv kein Spaß!
Also, hören Sie, ich war als junger Koch auf den französischen Antillen, da sind einmal auch alle Katzen verschwunden. Ganz plötzlich. Am anderen Tag gab es eine starke Beben der Erde. Ein paar Tage später waren alle wieder da.
Dann hoffen wir doch mal, dass die Erde hier ruhig bleibt. Also, Marnier, wenn es keine Katze ist, was vermissen Sie dann?
André. Wir vermissen unseren jüngsten Lehrling.
Seit wann?
Marnier rutschte unruhig auf dem Stuhl herum.
Ja, es ist sehr dumm. Seit einer Woche.
Seit einer ganzen Woche?
Ja. Das heißt, nein. André ist sehr komplex. Er ist sehr begabt, hat aber beständig großen Unsinn im Herzen. Er ist der Sohn meiner Schwester aus Marseille. Sie hat ihn mir angehängt, äh nein, ich meine … anvertraut. Er ist schon zweimal einfach verschwunden. Einmal aus Heimweh. Sie hat ihn dann wieder, äh, wie sagt man … mit gleicher Post zurückgeschickt.
Sie meinen postwendend.
Ja, genau. Und einmal hat er den Autostopp in den Süden gemacht, bis er im Meer stand. In Genua. Er hat mir telefoniert und ich habe ihn geholt. Er hat gesagt, dass er das Meer sehen muss, sonst müsse er sterben. Oder so ungefähr.
Marnier schüttelte den Kopf.
Sie sehen, er ist sehr komplex.
Ja, es scheint sich um einen komplizierten jungen Mann zu handeln.
Genau. Kompliziert. Wollen Sie noch ein Espresso?
Tanner nickte.
Und jetzt ist er wieder einmal verschwunden?
Also, er hatte drei Tage frei und hat gesagt, dass er zu einem Freund nach die Stadt fahren will. Später haben wir bemerkt, dass er gar nicht bei Freund aufgetaucht ist, und sein Motorrad stand die ganze Zeit hinter dem Haus. Das haben wir aber erst vor zwei Tagen gesehen. Wir haben gedacht, dass er damit unterwegs ist.
Wie alt ist André?
Er ist gerade siebzehn geworden. Er ist jung.
Nimmt er Drogen?
Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Er raucht vielleicht Haschisch.
Wie alle jungen Leute, aber mehr weiß ich wirklich nicht.
Lieber Marnier, warum erzählen Sie das alles mir und nicht der Polizei?
Wollen Sie mich schrecken, Tanner?
Nein, aber sehen Sie, Marnier, eine Woche ist zu lang, um einfach die Augen zuzumachen. Und die Polizei verfügt über gewisse Kanäle. Zu den Spitälern, zum Beispiel, falls ihm irgendetwas zugestoßen ist. Wie gesagt, ich will Ihnen keine Angst machen, aber wenn Sie absolut keinen Hinweis haben, wo er sein könnte und wenn er sich diesmal überhaupt nicht meldet, dann könnte es doch sein, dass er in Schwierigkeiten steckt.
Ja, wahrscheinlich haben Sie Recht, Tanner.
Haben Sie denn schon alle seine Freunde gefragt, ob die vielleicht wissen, wo André steckt?
Ja, haben wir. Aber keine Resultat. Ich dachte, dass Sie, Tanner, vielleicht nachschauen könnten. Sie waren doch Polizist, stimmt es, oder?
Tanner hatte keine Lust, die Frage zu beantworten.
Hat André denn kein Mobiltelefon?
Doch. Aber er antwortet nicht.
Haben Sie schon sein Zimmer untersucht? Haben Sie Zugriff zu seinem Bankkonto? Weiß Ihre Schwester Bescheid? Gibt es auch einen Vater? Könnte er bei ihm sein? Trägt André Ausweispapiere bei sich? Haben Sie ein Foto von ihm, das wirklich etwas taugt?
Tanner ließ Marnier eine kleine Verschnaufpause.
Schauen Sie, Marnier, es mag jetzt etwas sehr nüchtern klingen, aber das sind in etwa die Fragen, die Sie den Behörden werden beantworten müssen. Noch etwas: Wer ist die Person, der er am meisten vertraut?
Marnier sah jetzt richtig unglücklich aus.
Wahrscheinlich das ist, äh, mich. Also ich. Glaube ich jedenfalls. Aber ich weiß ja auch nichts, merde!
Gut. Marnier. Ich kann eines für Sie machen. Ich werde mich sofort bei einem Freund bei der Polizei erkundigen, ob die was haben. Wenn nichts dabei rauskommt, machen Sie sofort eine Anzeige. Ist das klar?
Ja, das ist klar. Das machen wir.
Marnier trank in einem Zug das Glas Wasser aus. Seine Hände zitterten.
ZWEI
Es war noch tiefe Nacht, als das Telefon klingelte. Stöhnend nahm Tanner den Hörer ab.
Das kannst nur du sein, Michel! Wo brennt’s denn mitten in der Nacht?
Was heißt hier: mitten in der Nacht …!? Himmel Herrgott! Hat der Herr mich um etwas gebeten oder ich ihn? Wir von der Polizei können es uns nicht leisten, in den Tag hinein zu schlafen. Zudem muss ich ja arbeiten. Tag für Tag meine Brötchen verdienen. Und wenn du glaubst, ich hätte nicht jede Menge Wichtigeres zu tun, dann irrst du dich gewaltig!
Oh je, Michel! So früh am Morgen und bereits schlecht gelaunt?
Wie kommst du denn darauf, Tanner? Ich bin doch immer so.
Ja. Das stimmt auch wieder. Dickhäuter sind Morgen-, Mittag- und Abendmuffel.
Hey, Vorsicht. Ich habe abgenommen. Ganze zwanzig Kilo.
Ah ja, stimmt. Aber was sind zwanzig Kilo auf eine halbe Tonne?
Tanner, ich lege gleich auf, wenn du so weitermachst.
Nein, ist ja gut. Ich bin sehr stolz auf deine zwanzig Kilo.
Michel räusperte sich.
Von Tillieux haben wir nicht die Bohne einer Spur und auch keine Abgangsmeldung. War’s das?
Du drückst dich wieder einmal sehr kultiviert aus. Aber ich danke dir. Besonders, da du soviel andere Arbeit hast, du Armer. An was arbeitest du denn gerade? An einem neuen Konzept für deine Mittagsverpflegung?
Nein, du Idiot. Wir haben doch diese seltsamen Todesfälle in einem der städtischen Altersheime. Ach ja, wenn du mich schon fragst: Vielleicht könntest du mal einen Blick in die Akte –
Tanner unterbrach ihn.
Heute Abend. Punkt Acht. Bei mir. Im Smoking. Wir essen am weiß gedeckten Tisch. Wer weiß, vielleicht haben wir sogar zwei charmante Tischdamen. Und wenn du fünf Minuten zu spät kommst wie letztes Mal, schmeiße ich das Essen vor deinen Augen in den Abfall. Haben Sie mich verstanden, Herr Kommissar, Abteilung Leib und Leben?
Ay ay, Sir! Aber du weißt ja, man hat die Bezeichnung »Leib und Leben« abgeschafft. Wir sind jetzt eine stinknormale Mordkommission.
Wie schade. Ich finde »Leib und Leben« viel schöner.
Tanner legte auf.
Ach, dieser Michel!
Er legte sich noch einmal auf die Seite, wusste aber jetzt schon, dass er keinen Schlaf mehr finden würde.
Diese ewigen Anspielungen auf das Geld. Und dann wieder zu mir rennen, wenn er in seinem dämlichen Fall nicht weiterkommt. Typisch, typisch.
Tanner schlug die Decke zurück und beschloss, unter die Dusche zu gehen. Draußen war es noch dunkel, und er konnte nicht sehen, ob es erneut geschneit hatte oder ob der Schnee vielleicht schon wieder geschmolzen war. Er hatte in der Nacht eher das Gefühl gehabt, als würde es regnen.
Tanner stellte sich unter das warme Wasser und schloss die Augen.
Immer wieder das Geld. Michel konnte es einfach nicht lassen. Dabei war er selber schuld. Als Tanner durch seinen letzten Fall an ein kleines Vermögen geraten war, hatte er Michel einen Anteil geben wollen, doch der war zu stolz gewesen, es anzunehmen. Denn er hatte es nicht direkt vom Geldgeber persönlich angeboten bekommen. Was ja in seiner beruflichen Position auch gar nicht statthaft gewesen wäre. Es quasi als Geschenk von Tanner zu nehmen, wäre zwar legal, hätte jedoch für Michel die Bedeutung eines Almosens gehabt, wie er sich damals ausdrückte. Tanner hatte schließlich kapituliert und Michels Anteil auf einem Sperrkonto deponiert.
Er stieg aus der Dusche und trocknete sich ab.
Die Frage blieb die gleiche: War es nun positiv, dass Michel keine Informationen zu André Tillieux liefern konnte oder nicht?
Auf jeden Fall musste Marnier heute schleunigst zur Polizei gehen und offiziell eine Vermisstenmeldung erstatten. Nur so konnte die Maschinerie in Gang kommen. Immerhin war es, wenn man den heutigen Morgen mitrechnete, schon acht Tage her, seit der Junge verschwunden war.
Vielleicht sollte er, nach dem Frühstück und nach seinem Spaziergang, Marnier erneut im Restaurant einen Besuch abstatten und sich ein genaueres Bild über diesen jungen Mann verschaffen. Es konnte nicht schaden, in Form zu bleiben.
Für die Vorbereitung des Michelschen Gastmahls blieb ihm ja noch der ganze Nachmittag. Er nahm schon mal die Lammkeule aus dem Tiefkühler, denn er wollte sie nach dem Prinzip des langsamen Garens zubereiten. Und das konnte schon mal den halben Nachmittag in Anspruch nehmen.
Wie hatte Marnier seinen Neffen genannt? Ach ja: komplex. Was verbarg sich hinter diesem etwas allgemeinen Adjektiv? Sollte es vertuschen, dass Marnier ihn in Wirklichkeit nicht mochte? Oder dass ihm sein Wesen und Verhalten zutiefst fremd waren? Marnier hatte im Gespräch ziemlichen Wert darauf gelegt, dass von ihm selbst das Bild des liebevoll sorgenden Onkels entstand. Abgesehen davon sagte ihm sein Gefühl, dass der junge Mann tatsächlich in Schwierigkeiten steckte.
Wir werden sehen. Nur keine voreiligen Schlüsse ziehen. Das ist der Tod einer jeden Untersuchung.
Er griff zum Telefon und teilte Marnier mit, dass er bei der internen Befragung der Polizei nichts erfahren habe und dass Marnier jetzt dringend die Vermisstenanzeige aufgeben müsse. Marnier blieb sachlich und versprach, sofort zu handeln.
Danach bereitete Tanner sich betont ruhig sein Frühstück zu. Aber er kannte sich gut genug, um sich nichts vorzumachen. Der ewige Virus der Jagd hatte ihn wieder infiziert.
Als er sich auf seinen täglichen Spaziergang machte, begann eben gerade erst die Morgendämmerung. Es hatte tatsächlich nachts geregnet, der Schnee war größtenteils verschwunden, weswegen der Morgen dunkel, schwer und dumpf wirkte. Kein Vergleich mit dem schneehellen Tagwerden vom vorigen Tag. Viel freundlicher würde es heute wahrscheinlich auch nicht werden, denn am Himmel drängten sich bauchig schwarze Wolken. Einzig die Hügelkuppe entlang zog sich ein glitzernd heller Silberstreifen.
Die dunklen Zeichen an den Haustüren fielen Tanner erst nach einer Weile auf. Denn die ersten paar hundert Meter war er gegangen, ohne sich die Umgebung genauer anzusehen. Er machte den Spaziergang vom vorigen Tag in umgekehrte Richtung. Erst beim Haus, das direkt in der Haarnadelkurve stand, fiel ihm auf, dass jemand auf die beigefarbene Haustür ein dunkelrotes Zeichen gemalt hatte. Das Zeichen bedeckte etwa die Fläche von vier Männerhänden und war gestern bestimmt noch nicht dort gewesen, dawar er sich ganz sicher. Er blickte zu den anderen Häusern zurück und erkannte irritiert, dass alle Haustüren ein Zeichen in der gleichen Farbe trugen.
Verwundert setzte Tanner seinen Spaziergang die Eisenbahnschienen entlang fort. Beim Bahnhof weiter vorne hatte eben ein Zug gehalten, und es stiegen eine Handvoll Leute ein. Wahrscheinlich lauter Pendler, die in der Hauptstadt arbeiteten und hier wohnten. Vielleicht auch Schüler, die eine höhere Schule besuchten.
Als der Zug, noch in langsamer Fahrt, an ihm vorbeifuhr, hatte er das Gefühl, als starrten ihn die Leute durch die beschlagenen Scheiben seltsam an. Einzelne Hände wischten hektisch die Scheiben, um ihn besser zu sehen.
Irritiert schüttelte er den Kopf.
Ich bin heute einfach zu früh aufgestanden. Wer geht denn um diese Uhrzeit spazieren, noch bei dem Wetter? Kein Wunder, wenn mich die Leute wie eine Erscheinung anglotzen.
Bis auf weiteres begegneten ihm lauter Häuser, die sich ihm mit ihrer Rückseite präsentierten, so dass er nicht sehen konnte, ob die Zeichen sich bloß auf das verwahrloste Quartier beschränkten.
Innerhalb der nächsten halben Stunde steigerte sich sein Gang jedoch vom gemütlichen Gehen in ein atemloses Traben. Man konnte es nun beim besten Willen keinen Spaziergang mehr nennen. Kurze Zeit später war ihm klar, dass jemand in dieser Nacht auf sämtliche Haustüren des Dorfes Zeichen gemalt hatte. Genauer gesagt: nicht auf alle Türen. Es gab ein paar wenige Ausnahmen. Auch seine Haustür war nicht markiert. Beim Dorfbrunnen angekommen sah er, dass auch der Dorfladen verschont geblieben war.
Kurz entschlossen ging Tanner auf die Eingangstür zu.
Der Laden war leer, nicht einmal die Zwillinge waren zu sehen. Tanner wunderte sich, denn Solène und Solange ließen ihren Laden nie unbeaufsichtigt. Wenn sie mal kurz weggingen, schlossen sie normalerweise die Tür und hängten einen Zettel daran. Plötzlich hörte er im hinteren, für die Kundschaft nicht zugänglichen Bereich jemanden schluchzen.
Hallo? Solène? Solange? Ich bin’s, Tanner!
Einen Moment lang war es still, dann fiel etwas zu Boden. Tanner näherte sich dem Durchgang. Plötzlich stand Solange vor ihm, die Augen voller Tränen.
Ach, es ist schrecklich, Tanner. Wir fürchten uns alle. Ist an Ihrer Haustür auch so ein schreckliches Zeichen?
Nein, Solange. Es gibt aber noch andere Haustüren ohne Zeichen. Woher wissen Sie das?
Ich habe nachgeschaut, ganz einfach. Jetzt beruhigen Sie sich, Solange. Es wird sich alles klären. Setzen Sie sich erst mal auf diesen Stuhl.
Tanner nahm eine Packung Papiertaschentücher aus einem Regal, riss die Packung auf und reichte Solange eins.
Danke. Aber wissen Sie denn, was das zu bedeuten hat?
Nein, das weiß ich leider noch nicht. Aber wir werden es erfahren, da bin ich mir ganz sicher.
Aber die Zeichen bedeuten doch alle den Tod, nicht wahr?
So vorschnell sollten wir nicht urteilen, Solange. Warum sind Sie eigentlich allein im Laden? Wo ist denn Ihre Schwester?
Solène muss schnell eine Nachbarin nach Hause begleiten.
Warum denn das?
Sie hat sich plötzlich gefürchtet, alleine auf die Straße zu gehen.
Was für ein Unsinn. Fürchten Sie sich denn auch?
Fürchten nicht gerade, aber ein bisschen unheimlich finde ich es schon. Wer um alles in der Welt kann denn so etwas gemacht haben?
Das weiß ich natürlich auch nicht. Dumme Jungs wahrscheinlich, denen langweilig war.
Tanner gab sich alle Mühe, überzeugend zu sein, obwohl er seine eigene Behauptung ziemlich übermütig fand. In diesem Moment kam Solène zurück.
Ah, Monsieur tröstet unsere Solange. Störe ich?
Solange richtete sich sofort auf.
Spinnst du? Aber ich war froh, nicht mehr allein zu sein, ich gebe es zu.
Und wie erklären Sie sich, dass Ihre Haustür von diesen Schmierfinken verschont geblieben ist?
Guten Tag, Solène. Dafür habe ich keinerlei Erklärung. Meine Haustür ist aber nicht die einzige, die verschont wurde. Ihr Laden wurde auch ausgelassen.
Ja, klar. Da wohnt ja auch niemand.
Und die Kirche? Wer wohnt dort, Solène?
Was? Die Kirchentür haben die auch verschmiert? Schweinebande!
Warum denken Sie, dass es mehrere waren?
Weiß ich nicht. Aber immer wenn in dieser Gegend Unsinn gemacht wurde, steckte eine ganze Bande dahinter.
Was haben die denn so gemacht?
Ja, zum Beispiel das Feuer für den ersten August am Vorabend angezündet. Oder den Leuten die Fahrräder vertauscht. Oder dem Dorflehrer bei zehn verschiedenen Firmen Taxis bestellt.
Ich weiß nicht, ob das in dieselbe Kategorie fällt. Und ob es sich um eine Gruppe handelt, bezweifle ich.
Was glauben denn Sie, Herr Tanner?
Ich finde, die Zeichen haben eine eindeutige Handschrift. Es könnte sich sehr wohl um eine Einzelperson handeln. Aber das muss man natürlich näher untersuchen.
Solange blickte ihn mit großen Augen an. Dann zog Solène ihre Schwester vom Stuhl hoch.
Ja, ich glaube, die Polizei hat damit schon begonnen. Ein Streifenwagen ist soeben gekommen. Weiter vorne im Dorf. Die Gruber hat stellvertretend für alle Anzeige gegen unbekannt erstattet.
Na ja, dann ist ja alles in besten Händen. Warum ich eigentlich gekommen bin: Würden Sie mir die Ehre erweisen und heute Abend bei mir speisen? Wie dumm von mir, die bedruckten Einladungskarten mit Goldprägung habe ich jetzt prompt vergessen. Ein guter Freund aus einem befreundeten Kanton wird auch noch zu Gast sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie ja sagen würden.
Die Schwestern schauten sich einen Moment an. Solène antwortete für beide.
Selbstverständlich erweisen wir Ihnen die Ehre. Um wie viel Uhr?
Punkt acht, wenn ich bitten darf. Meine Adresse ist Ihnen ja bekannt. Ah, ja. Sie sind beide keine Vegetarier, äh, ich meine, Sie sind keine Vegetarierinnen, oder?
Diesmal war Solange schneller.
Gott bewahre, nein. Wir sind große Fleischanbeterinnen.
Dann verabschiedete man sich.
Wieder draußen auf der Straße, sah Tanner tatsächlich einen Streifenwagen. Die beiden Beamten liefen gerade von einem Hauseingang zurück zu ihrem Wagen.
Guten Tag, die Herren. Mein Name ist Tanner. Ich bin ein Freund und Berufskollege von Kommissar Michel. Sie untersuchen die Zeichen an den Haustüren?
Guten Tag. Wagner. Das hier ist mein Kollege Stoffel. Haben Sie uns etwa gerufen?
Nein, nein. Das war Frau Gruber von der Gemeindeverwaltung. Zudem ist meine Haustür eine der wenigen, die nicht bemalt wurde. Soweit ich gezählt habe, sind etwa sieben Türen im ganzen Dorf nicht bemalt.
Da haben Sie ja Glück gehabt.
Wie man’s nimmt. Was halten Sie denn davon, Wagner?
Der Beamte zog seine Mütze aus und strich die Haare glatt.
Wahrscheinlich ein dummer Streich. Natürlich ärgerlich das Ganze, aber ich würde da nicht viel machen. Schwamm drüber!
Also, ich meine, schnellstens abwaschen und vergessen.
Die beiden Polizisten grinsten etwas verlegen. Es war offensichtlich, dass sie nicht so recht wussten, was sie mit der ganzen Sache anfangen sollten.
Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen, meine Herren?
Ja, was denn?
Ich würde als erstes die Leute bitten, vorerst gar nichts abzuwaschen. Dann würde ich von zwei bis drei verschiedenen Türen Materialproben nehmen und ins Labor bringen.
Wieso denn das?
Haben Sie sich die sogenannte Farbe denn mal näher betrachtet? Nein. Wieso auch. Es ist halt irgendeine Farbe, die man sprayen kann.
Es tut mir leid, ich muss Sie korrigieren. Erstens wurde hier eindeutig mit einem Pinsel gearbeitet und zweitens könnte es sein, dass es sich bei dem aufgetragenen Material möglicherweise um etwas anderes als Farbe handelt.
Um was denn?
Es war Stoffel, der die Frage ziemlich forsch stellte.
Möglicherweise handelt es sich um Blut, meine Herren.
Die beiden Beamten schauten sich etwas perplex an.
Auf den Arm nehmen können wir uns selber!
Das glaube ich Ihnen ungefragt, meine Herren. Meine erste These können Sie gleich an Ort und Stelle kontrollieren, wenn Sie sich eines der Zeichen genauer anschauen. Vielleicht entdecken Sie sogar ein Pinselhaar, aber ganz sicher können Sie den Pinselstrich erkennen.
Wagner schaute argwöhnisch, gab sich aber einen Ruck.
Stoffel, du wartest hier.
Er ging zurück durch den Vorgarten, kniete sich vor die Tür und betrachtete eingehend das gemalte Zeichen. Dann kam er mit schnellen Schritten zurück.