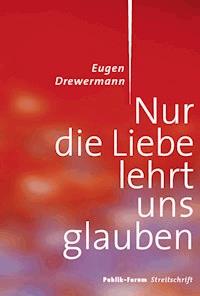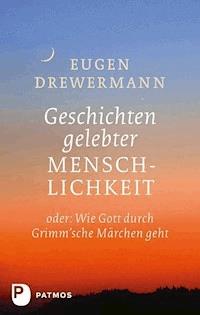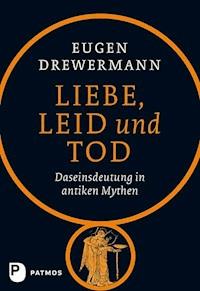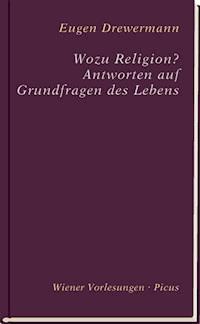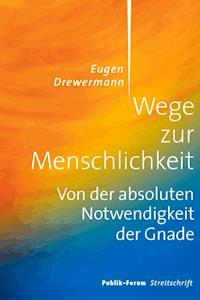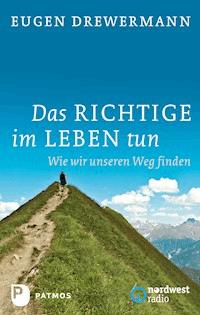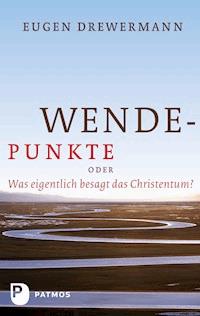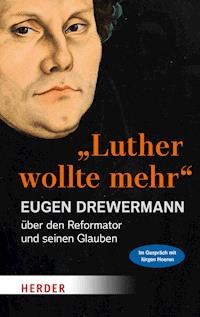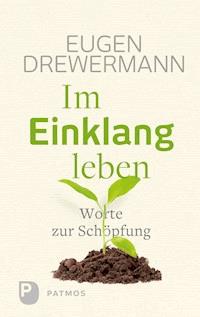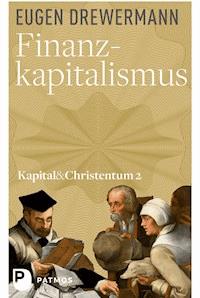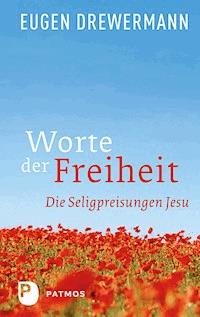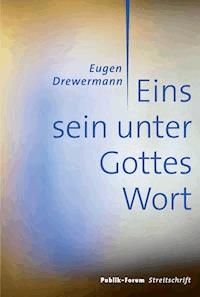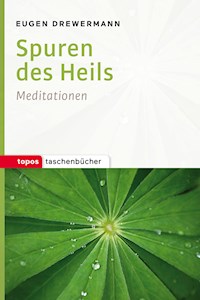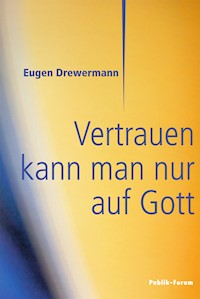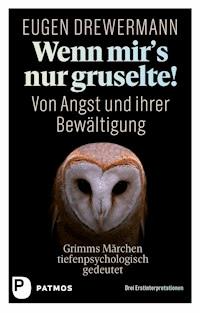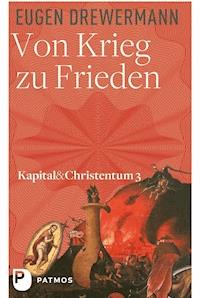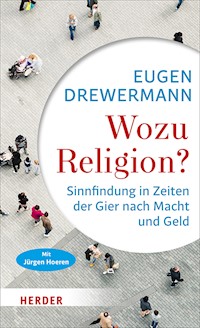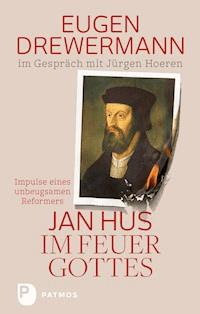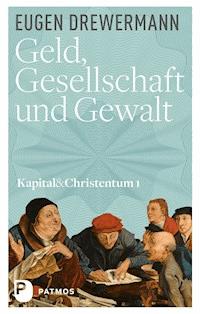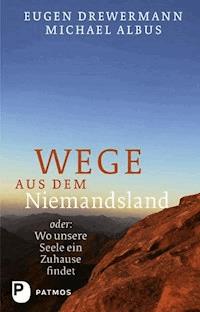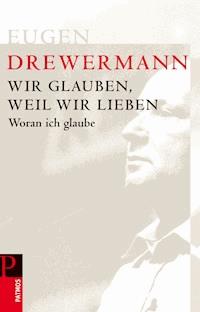
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Seine Thesen haben zum erbitterten Konflikt mit der katholischen Kirche geführt. Am Ende stand sein Rauswurf als Hochschullehrer und Priester. Wie kaum einem anderen Theologen gelingt es Drewermann, den Sinn des christlichen Glaubens in einfachen Worten zu erschließen. Durch sein therapeutisches Verständnis von Religion hat er vielen Menschen zu einer neuen, lebensbejahenden Glaubenspraxis verholfen. Das Buch zum 70. Geburtstag, in dem Drewermann auf seinen Lebensweg zurückblickt und seine wichtigsten Themen erläutert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eugen Drewermann
Wir glauben, weil wir lieben
Woran ich glaube
Im Gespräch mit Jürgen Hoeren
Patmos Verlag
Inhalt
Mein Vorbild Albert Schweitzer
Mein Theologiestudium – lauter falsche Fragen
Warum ich Priester wurde
Meine Begegnung mit der Psychoanalyse
Die Bibel anders lesen
Kleriker – Angst wovor?
Meine Leitfigur bleibt Jesus von Nazareth
Gandhi und die Bergpredigt
Man lebt von der täglichen Vergebung
Jesus – Sohn Gottes?
Kreuz und Auferstehung
Gott ist anders
Die Bibel und die moderne Literatur
Mit Büchern konnte ich reden
Die absurden Zwänge der Exegese
Ich bin der Aufklärung verpflichtet
Die Kirche und ihre Angst vor der Psychoanalyse
Warum die Neurologie für mich wichtig ist
Liebe, Individualität, Person oder: Von Zufall und Notwendigkeit
Der Mensch – Krone der Schöpfung?
Seele
Befreiung zum Frieden
Warum gibt es das Universum?
Die moderne Neurologie und die Frage nach Gott
Bibliografie
Über die Autoren
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Jean-Baptiste-Camille Corot (1796–1875), Orpheus rettet Eurydike aus der Unterwelt (1861), Ausschnitt, Museum of Fine Arts, Houston, Texas
Mein Vorbild Albert Schweitzer
Herr Drewermann, warum haben Sie sich damals, nach Ihrem glänzenden Abitur, mit 20 Jahren für das Theologiestudium entschlossen?
Weil die Frage nach Gott, dem Sinn des Lebens, der Einheit der Welt für mich zentral zu sein schien. Ich hatte mit 13, 14 Jahren Albert Schweitzer als Vorbild und den Wunsch, irgendetwas Vergleichbares zu tun, was den Menschen hilft – Arzt zu werden, zum Beispiel. Dieser Wunsch ist lange präsent geblieben. Ich wollte nach dem Theologiestudium noch Medizin studieren. Aber in dieser Reihenfolge. Denn ganz ähnlich wie bei Albert Schweitzer wäre ich aus einem christlichen Impuls heraus Arzt geworden. Ich hätte dann tun mögen, was ich im Vorbild Jesu für bahnbrechend und wegweisend geglaubt hätte. Fragen dieser Art wollte ich aber erst einmal nachgehen, sie für mich selber klären und auch für die Menschen, mit denen ich im Gespräch war. Ich bin eigentlich nie ohne erhebliche Zweifel an den scheinbaren Sicherheiten der kirchenchristlichen Verkündigung ausgekommen. Das Studium schien mir damals ein Weg zu sein, durch sachfundiertes Wissen, durch korrekte Informationen, durch klares, schlussfolgerndes Denken Zweifel auszuräumen. Dass ein solches Vorgehen ausgerechnet im Gebiet der Theologie die Fragen eher vermehren würde, war mir damals nicht so klar.
Warum wollten Sie denn katholischer Priester werden? Hat Sie Ihr Vater, Ihre Mutter nicht gewarnt? Sie kannten doch schon den Klerikerstand?
Ich habe nie wirklich berufsbezogen gedacht. Damals, 1960, wissenschaftlich Theologie zu studieren, war eigentlich nur möglich als Priesteramtskandidat, zumindest im Raum der katholischen Kirche. Wohl hätte man sich als Lehrer ausbilden lassen können, natürlich. Aber das wäre kein Theologiestudium gewesen, wie es mir vorgeschwebt hätte. Es wäre nicht gründlich geworden. Ich wollte mich nie für irgendein Amt in irgendeiner Institution bewerben, das war wirklich sekundär. Aber was Sie andeuten, stimmt: Ich hatte damals noch der katholischen Kirche zugetraut, dass auch für sie selber die Fragen der Beamtung zweitrangig wären und dass sie an Menschen interessiert sei, die offen sind, die sich unterwegs fühlen, die ehrliche Fragen anmelden und ehrliche Antworten suchen. Was meine Eltern angeht – mein Vater war evangelisch, meine Mutter katholisch. Der katholische Elternteil, meine Mutter, hatte damals bei der Trauung zu versprechen, dass die Kinder katholisch getauft und erzogen würden. Für meinen Vater war das kein Problem, weil er der Auffassung war, die Frau erziehe ohnedies die Kinder. Er hatte einen sehr schönen Satz geprägt: Wenn die Kinder so werden, wie seine Frau schon ist, werde es wohl vor Gott und den Menschen in Ordnung sein. Er meinte damit, dass die Pastoren nicht das Recht hätten, Menschen, die einander lieben und zueinandergefunden haben, mit irgendwelchen Steuerinteressen auseinanderzureden. Er dachte in seinem Sinne auf humanitäre Weise pragmatisch. Auch später hätte er jeden Berufswunsch toleriert. Nur wenn ich ihm gesagt hätte: »Ich will wie du unter Tage Fahrsteiger werden«, ich glaube, da hätte ich Schwierigkeiten bekommen.
Haben Sie während Ihres Studiums und Ihres Weges zum Priesteramt nicht selbst oft Zweifel bekommen? Gab es keine warnenden Stimmen?
O ja, die gab es sehr, schon deshalb, weil mein Interesse an der Theologie ganz entscheidend aufgeladen war durch die Lektüre Søren Kierkegaards. Ich glaube, Graham Greene hat recht, als er einmal sagte, Schriftsteller behielten ihr Leben lang die Fragen, die sie mit 17 und 18 Jahren hatten, der ganze Rest sei ein Kommentar zu diesen Schlüsselfragen. Das ist bei mir ganz sicher der Fall gewesen und geblieben. Bei Søren Kierkegaard hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, zu verstehen, was Jesus wollte, und zugleich genauso klar vor mir zu sehen, was nicht gemeint sein kann. Bei dem dänischen Religionsphilosophen habe ich gelernt, dass die Grundfragen des Menschen zwischen Angst und Vertrauen gestellt werden, dass man Ethik und Religion voneinander trennen muss, dass das, was sich heute Kirche nennt oder als Christenheit versteht, eigentlich nur noch als Travestie und Farce auf das ursprünglich Gemeinte gesehen werden kann. Das alles war zunächst um 1850 eine Kritik innerhalb des dänischen Protestantismus. Viel weiter und viel zutreffender aber waren alle seine Aussagen bezogen auf die katholische Kirche. Es gibt keinen Autor, der so klar wie Kierkegaard gesehen hat, dass ein beamtetes Christentum eine einzige Lüge sein muss. Der Katholizismus aber basiert auf genau dieser Vorstellung, dass man Gott verbeamtet und dogmatisch abgestützt den sogenannten Gläubigen gegenwärtig setzen kann – in allen wesentlichen Punkten: von der Eucharistiefeier über die Sündenlossprechung bis zum Sterbesakrament. In all den Punkten braucht es einen Pfarrer, der im Amt Gott vor den Gläubigen vertritt. Die Existenz des geistlichen Herrn, seine Person, ist dabei völlig relativ, absolut ist sein Amt, ist das Kirchesein, das Institutionelle.
Mit diesen Vorstellungen war ich ins Theologiestudium gekommen. Es gab damals aber noch einen Punkt, der mir von Anfang an zum Sprengstoff geriet, ein wirklicher Schock: Das war 1955 die Frage der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Es gingen damals Millionen Menschen auf die Straße. Sie sagten: »Zehn Jahre nach dem Desaster des verdammten Krieges halten wir nicht schon wieder unsere Knochen hin. Dafür sind wir nicht nach Hause gekommen, dass wir jetzt unsere Kinder wieder Soldaten werden lassen. Irgendwann muss Schluss sein.« Das aber wollte die Adenauer-Regierung partout nicht, und das wollte auch die katholische Kirche nicht. Es gab damals Protestanten, Niemöller, Gollwitzer, die in dem Punkte eindeutig waren. Niemöller bekam fertig, zu sagen: »Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Kind, in Washington gezeugt und im Vatikan getauft.« Ein solches Wort war eindeutig. Ich hatte damals noch nicht wirklich mitbekommen, dass schon 1952 im europäischen Verteidigungsgemeinschaftsvertrag die katholische Kirche und die Adenauer-Regierung dabei waren, auf Druck der Alliierten hin Deutschland in ein Militärbündnis einzufügen. Der Plan scheiterte an den Franzosen, die nicht östlich des Rheins schon wieder eine deutsche Armee unter Waffen sehen wollten. 1955 aber waren wir so weit. Der damalige Papst Pius XII. erklärte in seiner Weihnachtsansprache, dass kein Katholik das Recht habe, sich auf sein Gewissen zu berufen und den Wehrdienst zu verweigern, und so sagten es alle »Maßgeblichen«: die Bischöfe, die Pfarrer, die Moraltheologen – alle.
Haben Sie damals im Priesterseminar rebelliert? Haben Sie Ihre Stimme erhoben? Sind Sie unbequem geworden?
Ich wusste, dass ich den Wehrdienst verweigern würde. Ich habe damals Fotobände mit Gedichten, die ich verfasst hatte – meine ersten publizistischen Versuche –, herumgereicht im Theologenkonvikt, bis mir politische Propaganda untersagt wurde. Man sollte nicht agitieren für den Pazifismus. Das war bei der Aufnahme ins Konvikt das erste Gespräch in Münster. Es irritierte den Rektor, dass ich mich gegen die Auffassung der katholischen Kirche in diesem Punkte äußerte. Es sei kein Denken im Sinne der Kirche, kein »Sentire cum Ecclesia«, was er da sehen müsste. Das stimmte auch. Ich glaubte zu wissen, dass die katholische Kirche in einer mir ganz entscheidenden Frage die Menschen nicht christlich unterweist, dass sie an einer Stelle Gewissenszwang ausübt, wo er nicht sein darf. Ich war auch nicht willens, dies hinzunehmen. Ich dachte, dass in diesem Punkte mein Gewissen nicht irrig sei. Ich wollte eine objektive Lösung. Mir hat es dann wenig geholfen, dass 1963 im 2. Vatikanischen Konzil befunden wurde, dass es auch einen Friedensdienst ohne Waffen geben könnte. Jetzt plötzlich, nach dem 2. Vatikanischen Konzil, durfte man auch den Wehrdienst verweigern, jetzt hatte man die Freiheit dazu. Doch die Feigheit blieb. Man fügte sich weiter dem Druck einer zentralistischen, uniformierten, dogmatischen Festlegung, und das war für mich noch ungeheuerlicher als das, was 1955 passiert war. Plötzlich redeten alle anders, nur weil es erlaubt war. Was aber hatten sie denn vorher gedacht und geglaubt? Religiöse Überzeugungen darf man doch nicht verwalten wie im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei oder in irgendeiner anderen politischen Gruppierung, die ihre pragmatische »Geschlossenheit« herstellen will.
Wie haben Sie das als Priester ertragen? Warum sind Sie in dieses System eingetreten?
Nicht ganz so schnell! Es gab noch eine dritte Frage, die damit zusammenhing und die Vorbehalte, die die ganze offizielle Theologie mit sich brachte, verstärken musste – das war der Umgang mit den Tieren. Auch da war ich der Meinung, die ganze Schöpfungslehre der Kirche sei zu optimistisch, sie stimme so nicht. Es gibt nach meiner Meinung kein gutes Recht, mit den Tieren so umzugehen, wie es üblich ist und von der katholischen Theologie vertreten wird: die Tiere seien den Menschen untertan und wir dürften sie für uns in jeder Form benutzen. Fragen danach aber wurden nicht einmal ansatzweise diskutiert. Wenn ich Schopenhauer zitierte, war es halt nicht Thomas von Aquin, und es war doch klar, was man zu lesen hatte.
Mit all den Schwierigkeiten konnte ich insofern leben, als ich mich der Illusion hingab, dass man in der Kirche eigentlich doch auf Leute treffen könnte, mit denen sich reden ließe. Daran habe ich wirklich geglaubt. Es gab immerhin Karl Rahner, es gab irgendwo einen vernünftigen Pater. Ich hatte schon mal Leute kennengelernt, unter tausend Pastoren vielleicht einen, der Nachdenklichkeit zeigte. Ich wollte glauben, je höher man käme, desto wahrscheinlicher würde es, dass man da edlen Geistern begegnete, die reformfähig, offen, der Botschaft Jesu verpflichtet, eine ehrliche Richtungskompetenz besäßen. Dass sich das genau umgekehrt verhielt, habe ich damals nicht gedacht. Es war mir allerdings schon damals fast egal, das kann ich wirklich sagen. Ich wollte kennenlernen, was Menschen an der Botschaft Jesu hilfreich ist. Mein Ziel war, seine Botschaft so auszulegen, dass sie verständlich und hilfreich sei für alle. Das war zu Beginn noch nicht zentriert auf die thematische Frage, welch eine therapeutische Dimension darin stecke. Ich wollte freilich die Religion des Christentums wesentlich als Erlösung begreifen. Deshalb entschied ich mich ja, im Vorrang Theologie zu studieren, statt Medizin. Ich dachte, die religiösen Fragen seien noch entscheidender, noch wichtiger als die Fragen der körperlichen Gesundheit. Ärzte haben wir genug, dachte ich, aber Leute, die mit Menschen über Gott reden können oder wollen und die nicht nur Sprüche liefern, eigentlich sehr wenige. Deshalb ist Ihre Frage, wie es denn dann im Konvikt weiterging, nicht ganz leicht beantwortbar.
Mein Theologiestudium – lauter falsche Fragen
Hatten Sie einen Spiritual, mit dem Sie darüber reden konnten? Waren Sie ein Einzelgänger? Wurden Sie ausgegrenzt? Konnten Sie mit jemandem über Ihre Gedanken reden?
Ich hatte immer Freunde, wenn Sie das so meinen. Aber das waren mehr nette Beziehungen, das waren nicht die geistigen Kaderschmieden, als die man sie haben wollte. Wirkliche Auseinandersetzungen um grundsätzliche Fragen, wie sie in Philosophie und Geschichte sich hätten ergeben müssen, fanden nicht statt. Das Entscheidende musste ich mit mir selbst ausmachen. Und es geschah, indem ich enorm viel gelesen habe, weit mehr, als für das Studium gebraucht wurde. Die Prüfungen haben mich eigentlich nie sehr interessiert. Das Material hatte ich parat, wenn es gebraucht wurde. Aber darüber hinaus gab es so vieles zu entdecken – in der Literatur, in der Philosophie, in der Exegese, in der Religionsgeschichte, in den fremden Religionen. Da war endlos zu lernen, damit war ich beschäftigt. Wie sich das jemals an das »Lehramt« zurückmeldete, war für mich relativ unwichtig. Manches wurde abgefragt in den Prüfungen, aber die waren sowieso kein Problem – im Gegenteil: Sie waren für mich interessant, weil mir jetzt jemand von den Zuständigen mal eine halbe Stunde zuhörte. In solchen Momenten konnte man probeweise mal gewisse Themen problematisieren, schließlich bedeutet »Wissenschaft« das methodische Suchen nach Begründungen für bestimmte Ansichten, und das wollte ich ja. Bei dem Vorstand, dem Spiritual, gab es gewisse Kontrollbesuche, die aber nicht das hergaben, was in Ihrer Frage drinsteckt. – Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, damit verständlich wird, warum ich überhaupt in den ersten vier Semestern nach Münster kam, dass mein Religionslehrer, der eine Art Gutachten nach Paderborn zu der zuständigen Diözesanleitung senden musste, in Wahrheit ein rechtes Missachten geschrieben hatte. Er hätte in Religion noch nie für so viel Irrlehren ein »Sehr gut« gegeben. Das war seine Meinung über mich als Abiturient, und die hat er in Paderborn entsprechend kundgetan. Deswegen wollte man dann erst einmal sehen, wie das mit mir werden würde. Ich hatte damals noch vor, zusätzlich Deutsch und Griechisch zu studieren, und das konnte ganz gut in Münster passieren. Also erschien ich unter Aufsicht bei dem dortigen Spiritual, jede Woche einmal, zum Gespräch. Dieser »Geistliche« war ein ausgezeichneter Mann und er machte seine Arbeit gut, aber es waren Gespräche, wie sie unter den gegebenen Voraussetzungen kaum anders sein konnten: Sie blieben peripher.
Man muss sich die Situation vorstellen: Vom 3. Semester an kam ich pflichtweise ins Konvikt. Im Speisesaal des Konvikts stand vorne der Vorstandstisch, und davor saßen in langen Reihen die Alumni. Damit nun auch gesehen würde, dass ich irgendwie für Paderborn vorschlagsweise als Theologe infrage käme, hatte ich direkt unter den Augen des Vorstands in der ersten Reihe zu sitzen. Die ausschlaggebenden Beobachtungskriterien waren wohl, ob man mit Messer und Gabel essen konnte, ob man mit anderen im Gespräch blieb – ich weiß nicht, worauf man da achtete. Alles in allem kann die Inspektion nicht so schlecht ausgefallen sein. Jedenfalls kam ich – was die Noten und das Betragen anging – mit dem besten Zeugnis nach Paderborn. Was die Theologie betrifft, so muss ich sagen, dass sie in Münster damals vor allem in den philosophischen Fächern entschieden sehr viel günstiger angelegt war, als es für mich in Paderborn gewesen wäre. Die Traktate dort hätte ich, glaube ich, nicht überstanden. In Münster herrschte zumindest der Eindruck, man könnte den von der Kirche als Vorbereitung für ihre Dogmatikvorlesungen gewünschten Thomismus in das heutige Wissen und Denken übersetzen. Der Eindruck wurde zumindest vermittelt. Vier Semester lang habe ich versucht, diese neuthomistische Metaphysik und ihre Argumentationsfiguren einzuüben. Ich glaube, ich war einer der wenigen, die dachten, sie hätten all das wirklich verstanden. Heute denke ich, dass der ganze Ansatz, wenn auch auf hohem, intelligentem Reflexionsniveau, von A bis Z falsch war und ist.
Warum falsch?
Weil es sich um lauter verkehrte Fragestellungen handelte. Es gab damals beispielsweise die »rationale Anthropologie«. Das war ein Pflichtfach gewesen, in dem bewiesen wurde, dass der Mensch aufgrund seiner Geistestätigkeit eine geistige Substanz sein Eigen nennt. Das war reiner Aristotelismus, das war Hylemorphismus – lauter griechisch-mittelalterliche Konzeptionen, mit denen man zeigte, dass die Gedankentätigkeit des Menschen sich in keiner Weise vergleichen lasse mit allem, was sich in Raum und Zeit ereignen könne. Bei Gedanken lässt sich ja nicht fragen, ob sie schnell oder eckig sind oder rund. Was bei der Materie wichtig ist, ist keine mögliche Fragestellung für das Geistige. Bei geistigen Tätigkeiten also zeigt sich vermeintlich der Wesensunterschied zwischen Geist und Materie. Wenn nun schon die Seele ideell im Menschen als eigene Substanz zu begreifen ist, kann man ihr auch bestimmte Attribute zuordnen, wie am Ende die Hoffnung auf die Ewigkeit. All das konnte bewiesen werden: Freiheit, Unsterblichkeit, Seele. Es war wunderbar. Es wurde auch bewiesen, dass Sigmund Freud als Triebtheoretiker, als Pansexualist, als Traumdeuter jeden Anspruch an Rationalität von vornherein vermissen lasse. Auch Schopenhauer – die Lebensphilosophie – galt als irrational. So aber konnte es nicht sein, wenn die Welt als von Gott geschaffen rational konzipiert ist und schon deshalb dem menschlichen Geist verständlich sein muss. All die Probleme und Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften über die Herkunft des Menschen, über die Entstehung von Leben und »Geist« durch die Selbstorganisation der Materie in der Evolution existierten in diesem ideologischen System nicht. Ich habe das alles trotzdem fleißig gelernt, um es mir zu merken. In Paderborn, vom 5. Semester an, war es dann anders. Hier bekam ich Moraltheologievorlesungen zu hören zur Wiedereinführung der Todesstrafe, zur Rechtfertigung des Atomkrieges, zum Verbot von empfängnisverhütenden Mitteln, zur Erklärung, dass Abtreibung in jeder Form Sünde sei, dass Malthus sich mit seiner Warnung schon im 19. Jahrhundert vor Überbevölkerung geirrt habe: Gott wird doch die Menschen nicht mit dem Auftrag, fruchtbar zu sein, ausstatten und dann Ernährungsengpässe schaffen! Ein allwissender, weiser Gott kann sich nicht widersprechen. In dieser Weise setzte sich ein falsches Welt- und Menschenbild praktisch durch. Sehr gut fand ich die Exegese, vor allem die neutestamentliche Exegese, und das war für mich der Teil des Studiums, der auch weiterführte. Kirchenrecht habe ich eigentlich nie studiert.
Die Exegese hat Sie als Fach fasziniert. Warum war das für Sie ein interessantes Feld?
Die Exegese war für mich faszinierend, weil sie mich sorgfältig und fundiert einfach mit den philologischen Mitteln, mit denen man antike Texte auch sonst liest, ausstattete. Hinzu kam, dass es ja nicht irgendein Text war, den es auszulegen galt. Es war das Neue Testament, die Bibel. Hebräisch hatte ich bereits auf dem Gymnasium gelernt, und ich fing nun an, das Alte Testament Wort für Wort im Urtext zu übersetzen. Das allein schon hatte eine eigene Faszination, die hebräische Sprache, dann aber auch im Neuen Testament das Griechische. Es war für mich Gottes Wort. Ich wollte jede Nuance, wie das da steht, wie die Evangelisten es aus ihrer Perspektive weitergaben, wie die ihnen vorliegende Tradition bestimmte Überlieferungen schon verändert hat, so genau als möglich kennenlernen.
Also stark philologisch begründet? Und warum später Ihr Hauptthema: die Genesis?
Ich wollte anfangs ja auch Griechisch studieren. Das war ein Wunsch noch aus der Abiturzeit. Die Beschäftigung mit den biblischen Themen, mit der Schöpfungsgeschichte etwa, der Urgeschichte, entsprang einem anderen Zusammenhang. – Die Motivation, mich speziell mit dem Text auf den Anfangsseiten der Bibel zu beschäftigen, ist ziemlich komplex. Als Kind schon fragt man sich ja doch, ob Noah alle Tiere in die Arche mitgenommen haben kann, aber dann auch, was das für ein Gott ist, der die Menschheit schafft und dann so unglaubliche Katastrophen über sie verhängt. Das war für mich sehr irritierend, und solchen Fragen wollte ich natürlich nachgehen.
Diese Fragen haben Sie Ihrem Religionslehrer oder Ihrer Mutter gestellt?
Ja. Meine Mutter schickte mich zum Pfarrer, und der Pfarrer sagte: »Wenn Rom es so gesagt hat, wird es stimmen.« Und mein Vater sagte: »Das erkläre ich dir später.« Also niemand war für solche Fragen wirklich zuständig. Mein Religionslehrer unterstand damals fast wider seine eigene Überzeugung den Lehrvorgaben, die man ihm gemacht hatte. Es war wirklich kümmerlich. Was ist mit Adam und Eva, was bedeutet diese sonderbare Geschichte mit der Schlange – ein Bild, das in so vielen Mythen und Märchen vorkommt? Irgendwann hatte ich natürlich begriffen, dass die Bibel nicht so erzählt, wie die Grimm’sche Märchensammlung Schlangen reden lässt oder hilfreich in Kerker schickt, auf dass sie heilende Kräuter mitbringen. In der Bibel musste es anders gemeint sein. Es hat lange gedauert, bis ich als Kind dahinterkam, dass man Mythen anders interpretieren muss als Märchen, aber auch anders interpretieren darf als geschichtliche Erzählungen. Das Problem – schwer vorstellbar heute – bestand noch in den 1950er-Jahren in der gesamten katholischen Kirche und es besteht im katholischen Lehramt bis heute, dass man die Bibel historisch real verstehen muss. Das heißt, es gibt keine vernünftige Erlaubnis, mythische Texte in ihrer Eigenart zu würdigen. Die Bibelkommission von 1909 hatte auf die Frage, ob im Paradies der Teufel in Gestalt der Schlange den Menschen verführt habe, bestätigt, diese Geschichte sei im wörtlichen Sinne historisch zu verstehen. So war das: Wenn es in der Bibel steht, ist es historisch so. Noch 1992 hat der Weltkatechismus der römisch-katholischen Kirche befunden, dass die Erzählung von der Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies als ein historischer Bericht zu verstehen ist. Als wenn die ganze Paläontologie nie existiert hätte! Es hat uns also nicht zu kümmern, von wann ab Adam und Eva gelebt haben sollen, ob auf der Stufe des Homo sapiens vor 150000 Jahren oder auf der Stufe des Australopithecus vor 2,7 Millionen Jahren – egal. Es war historisch. Das alles war als Junge, als Kind, für mich schon nicht mehr akzeptabel und bildete eine Achse des Verstehenwollens: Wie interpretiert man Texte, die so wunderbar erzählen und die etwas zu sagen haben, die einem seit Kindertagen lieb sind, aber andererseits auch unverständlich, irritierend bleiben müssen, wenn man sie dogmatisch auslegt? In dem Buch »Der sechste Tag« habe ich vor ein paar Jahren versucht, den Stand der heutigen Forschung mit einem existenziell verbindlichen Verständnis des christlichen Glaubens in Verbindung zu setzen.
Der andere Zug war mir noch wichtiger. Ich war beizeiten auf die Interpretationen der Genesis aus dem deutschen Idealismus gestoßen: Schelling hatte sich Gedanken dazu gemacht, Hegel, alle deutschen Philosophen um 1820 haben sich irgendwann mit der Urgeschichte beschäftigt. Immanuel Kant bereits hatte dazu geschrieben. Aber alle diese Denker verstanden die »Erkenntnis von Gut und Böse« moralisch. So ist der ganze Text jedoch nicht zu begreifen. Wie soll Gott den Menschen verboten haben, herauszufinden, was im sittlichen Sinne gut oder böse ist? Wie soll Gott die Menschen in moralischer Blindheit und Umnachtung haben halten wollen? Viel wichtiger schien mir das Empfinden, Menschen nicht verurteilen zu sollen. Das wiederum entsprach einem Eindruck, den ich aus meiner Heimatpfarrei Bergkamen mitbekommen habe. Viele Gottesdienstpredigten dort waren arge Verurteilungen, meist der Leute, die gar nicht in die Kirche gekommen waren und schon deshalb Todsünden begingen, weil sie die katholische Messfeier nicht besuchten und auch sonst nicht lebten, wie es richtig ist. Ich dachte immer: »Der Pfarrer kennt diese Leute überhaupt nicht. Er schimpft jetzt wieder Leute aus, die er überhaupt nicht gesehen hat. Würde er sie sehen, könnte er vermutlich so nicht sprechen.« Adam und Eva indessen konnte ich vor mir sehen – vor allem, dass sie das, was sie tun, gar nicht tun wollen, kann man in der Geschichte ganz deutlich sehen. Die Frau sagt gerade noch, sie wolle an den Baum, der verboten ist, nicht einmal rühren, aber genau zwei Zeilen später wird sie eben das tun. Das war damals nur erst ein sehr diffuser Eindruck, doch er zeigte, dass diese Texte unendlich viel mehr zu sagen haben über den Menschen und von Gott, als man ihnen zutraut. Später, im Theologiestudium, ergaben sich dann ganz andere Möglichkeiten, mich diesen Texten zu widmen, aus dem Umgang mit der Psychoanalyse und der Märchen- und Traumdeutung. Ich glaube, ohne diesen Beitrag hätte ich mir niemals zugetraut, über Genesis 2,4b–11,9, die sogenannte jahwistische Urgeschichte, etwas Vernünftiges zu Papier zu bringen. Da war ich bereits 31 Jahre, ehe ich die erste Zeile zu diesen Themen schrieb. Bis dahin habe ich zwar Bücher gelesen, aber nicht selbst geschrieben. So entstanden die Bände der »Strukturen des Bösen«.
Hat man denn in Ihrer Ausbildung auch positive Ansätze an Freud erkannt, dass Freud zum Beispiel gesagt hat: »Man kann Menschen nur verstehen, wenn man ihre Träume versteht, wenn man ihre Träume deutet.« Oder war das außerhalb einer vernünftigen Pastoral und Exegese?
Es war absolut außerhalb jeder »vernünftigen« Pastoral und Exegese. Mit einem Wort: Ich habe im ganzen theologischen Studium über Sigmund Freud nicht irgendeine Bemerkung gehört, die es als nötig hätte erscheinen lassen, sich mit ihm und der Psychoanalyse positiv und intensiv zu beschäftigen. Er war simpel wegideologisiert, so, wie es bis heute ist. Die katholische Kirche wird in 20 Jahren, wenn die Psychoanalyse als Behandlungsmethode formal wohl nicht mehr existiert, erklären, dass sie immer schon gewusst hat, das sei eine zeitbedingte Wahnidee am Fin de Siècle gewesen, allzu lang noch im 20. Jahrhundert gepflegt, doch endlich nun haben wir das hinter uns. Die Kirche wird dann freilich mit anderen »Wahnideen« konfrontiert werden, die sie ebenfalls aussitzen wird, ohne sich daran zu verändern. Die katholische Kirche, muss man wissen, ist ein Apparat, der alles, was nicht in ihr System hineinpasst, ausgrenzt, ignoriert, unterdrückt, und das mit all den Mitteln, die ihr seit der Inquisition zu Gebote stehen: Man verbrennt Bücher nicht mehr physisch, doch man stellt ihre Lektüre unter Verbot, man hält sich eine Klientel von Ideologen, die eine bestimmte systemimmanente Argumentationskonstellation endlos repetieren und sich dadurch plausibel reden, während wichtigste gedankliche und menschliche Alternativen überhaupt nicht erwähnt werden. Das betrifft im Übrigen nicht nur Sigmund Freud. Selbst ein Mann wie Adolf von Harnack, der nach meiner Schätzung bedeutendste Kirchengeschichtler im 20. Jahrhundert, Protestant und liberal, kam im ganzen kirchengeschichtlichen Studium nicht vor. Es gibt eine ganze Bibliothek wichtigster Leute, die ich überhaupt erst entdeckt habe, als ich aus dieser sonderbaren Anstalt, Konvikt und Priesterseminar, herausgekommen bin. Danach fing das Leben geistig überhaupt erst an. Bis dahin beschäftigte sich das »Leben« mit der Diskussion von Bücherautoren.
Warum ich Priester wurde
Mir ist noch nicht klar, warum Sie, der Sie all diese negativen Seiten dieses kirchlichen Systems erkannt haben, sich dennoch in dieses System als Priester begeben haben, dass Sie sagten: »Ich lasse mich von dem Bischof in Paderborn weihen und gehe in dieses System.« Warum?
Ich habe geglaubt, dass Religion den Menschen so wichtig ist oder sein sollte, wie sie mir selber erschienen ist und bis heute vorkommt. Ich war damals auch bereit zu glauben, dass die katholische Kirche als Vermittlungsgröße dazu etwas beitragen könnte, Kierkegaard hin und Kierkegaard her. Jedenfalls kannte ich viele Menschen, die den Eindruck vermittelten, dass es sehr wichtig sei, die Sakramente so zu spenden und die Bibel so auszulegen, dass es in ihr Leben tröstend, beruhigend, begleitend, angstlindernd, ermutigend, mit Hoffnung versehend wirken würde. Das ging buchstäblich bis zu den ersten Tagen nach der Priesterweihe so. Bis dahin habe ich das so geglaubt.
Haben Sie gerne Gottesdienste gefeiert?
Ich glaube sagen zu können, dass ich bis zur Amtsenthebung 1992 keine heilige Messe einfach nur so gefeiert habe. Ich habe sie mit allem mir möglichen Ernst gefeiert. Ich habe sämtliche Predigten sorgfältigst vorbereitet. Ich habe bis auf ganz wenige Ausnahmen, wenn es geboten war, mal über bestimmte Heilige zu predigen, nie etwas anderes getan, als was im 2. Vatikanischen Konzil gesagt worden war: eine »Homilie« vorzutragen, eine Auslegung der Heiligen Schrift also. Ich kann nicht sagen, ich hätte die katholische Kirche jemals zynisch betrachtet oder programmatisch unterwandern wollen. Ich habe sie ernst genommen, allerdings mit all dem existenziellen Ernst des Religiösen, der von Kierkegaard her kam. Ich dachte, es müsse möglich sein, die Kirche, so wie sie ist, in dieser Richtung lebendig zu halten oder zu machen.
Für Sie war Gottesdienst etwas Heiliges?
Absolut, absolut. Ich war in keinem Punkte ironisch distanziert oder doppelbödig. Ich wollte meine persönliche Identität mit dem verbinden, was ich tat. Ich wollte nie der Dienstbeamte einer Kirche sein. Aber für mich persönlich wollte ich priesterlich sein, so muss ich sagen. Dazu gehörte, dass ich tat, was die katholische Kirche unter Priestersein verstand. Also saß ich im Beichtstuhl, machte Hausbesuche, hielt Messen, taufte – allerdings waren das die Tätigkeiten, die für mich als Vikar vom Arbeitsumfang her für nicht als ganz zentral zu betrachten waren. Im Grunde war von Anfang an deutlich, dass der Schwerpunkt der Seelsorge, wie ich sie verstünde oder wie sie mir liegen würde, in Gesprächen mit Einzelnen zu sehen wäre. Und das ergab sich allerdings sehr früh. Dadurch begann plötzlich ein ganz neuer Entwicklungsschub. Ich habe nicht geglaubt, dass sechs Jahre theologischer Ausbildung in der Reifung der Persönlichkeit einen kontrollierten Stillstand bewirken, ja bewirken sollen. Aber das ist so. Sie dürfen keine neuen Fragen äußern. Sie haben keine neuen lebendigen Erfahrungen zu machen. Sie werden festgehalten auf dem Status, mit dem Sie hingekommen sind. Und der wird unter Eid und mit enormen Auflagen für den Rest des Lebens als gültig vor Gott und den Menschen in alle Ewigkeit festgelegt. Da soll keine Alternative mehr existieren. Aber wie das Leben so ist: Es selbst macht sofort Alternativen sichtbar, wenn man nur erst anfängt, sich auf Menschen wirklich einzulassen, und das war nicht vermeidbar. Es hat mir dann auch sehr rasch den Weg zur Psychoanalyse eröffnet. Die entsprach mir. Ich wollte Menschen helfen, und plötzlich merkte ich, dass ich mit allem, was ich gelernt hatte, nicht hilfreich sein würde. Die Fragen der Leute waren tiefer, als sie im doktrinären System des kirchenverordneten »Glaubens« vorgesehen waren. Das hatte ich all die Zeit geahnt, aber mir zumindest in den Dimensionen niemals wirklich eingestanden.
Können Sie ein Beispiel bringen?
Der Konflikt war unausweichlich. Ich hatte gelernt, dass die Lebensphilosophie, also Max Scheeler, Nietzsche und Schopenhauer, irrational ist und schon deshalb für eine verantwortliche Seelsorge unbrauchbar sei. »Rational« heißt hier: Ein Mensch hat Vernunft und freien Willen, und er hat also die Pflicht, sein Leben sittlich zu kontrollieren. Wenn er das tut, ist er seines Glückes Schmied. Anderenfalls sündigt er und muss es bereuen und wieder ins Gleis bringen. Wo liegt bei einer solchen Betrachtung das Problem? Doch wie ungenügend, ja, falsch die gesamte Sicht der Kirchentheologie auf den Menschen ist, zeigte sich unmittelbar. Die Leute kamen sehr bald nach den ersten Sonntagspredigten, weil sie sich offenbar in meinen Predigten irgendwie mit ihren eigenen Problemen angesprochen und verstanden fühlten. Dabei war die Spannbreite der Erwartungen sehr groß. Mitunter sollte ich den Teufel austreiben oder böse Geister bannen, – plötzlich war ich konfrontiert mit einer in der Kirche, sogar in der Bibel begründeten Vorstellung von Teufeln und bösen Geistern, und es war offensichtlich, dass das Problem sich nur psychologisch, nicht dämonologisch oder mit mittelalterlichen Ritualen würde lösen lassen.
In anderen Fällen klagte jemand darüber, dass er sich selber nicht mehr kannte, er hatte unbeabsichtigt eine Liebesbeziehung angefangen. Er stand mit sich selber vor einem Rätsel. Zwanzig Jahre ehelicher Treue schienen in wenigen Stunden wie nicht mehr existent. Es war etwas in ihm aufgebrochen, bei dem er sich nicht verstand, das aber auch mich außerstande setzte, ihn zu verurteilen, bloß weil ich ihn natürlich auch nicht verstand. Wie also war die Ebene zu begreifen, die so unbegreifbar schien, das Irrationale, das in die ganze ach so schön erklärte Welt nicht hineinpasste? In diesem Irrationalen mussten die Gründe liegen.
Oder noch anders: Aus den Priesterseminaren, aus den Fortbildungsschulen der Kirche kamen und kommen nicht wenige Alumni, spätere Priesteramtskandidaten, mit homosexuellen Problemen. Das ist in den Augen der kirchlichen Moral ganz schlimm. Man betrachtet die Homosexualität als schwere Sünde. Wieder unbegreifbar! Denn allein mit Verstand und gutem Willen ist gegen eine womöglich genetisch bedingte Anlage nichts auszurichten.
Ich war damals auf meiner ersten Stelle Vikar in einem Kurort, will sagen: in einer Gemeinde, die stark frequentiert wurde von Leuten, die mit psychosomatischen, psychoneurotischen Krankheiten dahin kamen und die sicher etwas anderes wollten als jene schön erklärte Welt. Es half nichts zu sagen: »Wir tun jetzt hier alle unsere Pflicht.« Das hatten die Menschen, die ich kennenlernte, allesamt gemacht. Doch eben deshalb waren sie offensichtlich krank und erschienen jetzt im Kurort. Was sollte ich mit denen machen? Leute berichteten von ihren sexuellen Obsessionen, die ihnen beim Anblick der Peitschenlaternen in der Nacht kamen, oder davon, dass sie sich wie verfolgt fühlten von irgendwelchen Geistern, die sie umtrieben. Natürlich bilden Sexualität und Aggression sowie schon aus der Tierreihe kommende Anlagen und Ängste die Hauptthemen der Auseinandersetzung. Ich dachte: »Es geht nicht anders, ich muss mich an jemanden wenden, der von Hause aus dafür zuständig ist.« Psychoanalytiker geben ja vor, sie verstünden etwas von all diesem »Irrationalen«. Also musste ich einen Psychoanalytiker aufsuchen und ihm mindestens ein, zwei der Leute vor die Tür setzen und gucken, was daraus wird. Und bald schon wollte ich es halt selber lernen.
Und das haben Sie dann getan.
Ja, das habe ich getan. So hochmütig, wie ich es jetzt auch schildere: als eine verfeinerte Form, anderen nützlich zu sein; dass mich all das selbst betreffen würde, hatte ich in den sechs Jahren Theologie so nie gelernt. Da hat man gelernt, Anmutungen zu erwecken, Buße zu tun, Reue zu erwecken; lauter Nichtigkeiten standen im Grunde da zur Debatte. Aber dass man darüber nachdachte, wie man als Persönlichkeit geformt ist, wie man die eigene Biografie, die eigene Kindheit integriert, aus was für Gefühlskomponenten sich die Erlebnisräume zusammensetzen, wie festgelegt bestimmte Eindrücke seit Kindertagen sind und wie wenig selbstverständlich, also, wie weit man sich selber in den eigenen Vorurteilen kennenlernen müsste, um Menschen wirklich zu verstehen, das alles war unglaublich aufregend und zweifellos das spannendste Studium, das ich mir vorstellen konnte. So, hatte ich all die Zeit gewünscht, sollte ein Theologiestudium sein: Der persönlichen Reifung und Auseinandersetzung sollte es gewidmet sein.
Meine Begegnung mit der Psychoanalyse
Sie haben sich selbst neu entdeckt in dieser Phase.
Es war unglaublich spannend. Ja natürlich. Das Problem war, dass beides, Theologie und Psychoanalyse, nicht zusammenpasste. Ich wollte an das glauben, was die Kirche lehrt, zumindest an das, was ich nicht zuletzt auch durch kirchliche Vermittlung als Botschaft Jesu kennengelernt hatte. Das sollte nach wie vor außer Frage bleiben. Andererseits wusste ich, dass das, was Freud oder seine Adepten an Methoden entwickelt und an Einsichten gewonnen haben, nicht einfach falsch sein konnte. Dass vielleicht die Kirche der letzte Besenkammerraum sein könnte, wo noch die Spinnweben hängen, und dass man mit dem Besen kommen muss, um zu tun, was ich in der Seelsorge mir wünschte, wurde mir nach und nach immer klarer. Die Psychoanalyse konnte ich nicht so betrachten, wie maßgebende Persönlichkeiten damals zu mir sagten: »Das kann ja auch nicht gehen, dieser Irrationalismus, dieser Atheismus, dieser Freud war doch ein wirrer Kopf im Ganzen, obsolet und irrelevant. Damit muss man nicht sich und die Leute verwirren. Das führt nicht weiter.« – Ich dachte, es führt allemal weiter. Aber es stellte mich selber infrage, es stellte die Kirche infrage, es stellte vor allem den gepflegten Masochismus der kirchlichen Opfertheologie infrage. Auf all das war ich absolut nicht vorbereitet. Das war eine Zerreißprobe. Denn auch die Gegenseite – die Psychoanalytiker – verstand das religiöse Problem nicht. »Jemand, der gesund lebt, hat diese Fragen überhaupt nicht.« Ich zitiere jetzt wörtlich einen Psychoanalytiker. Dazwischen existierte keine Brücke zwischen Seelsorger und Seelenheilkunde. Ich konnte mir nur sagen: »Das Problem habe ich jetzt zwar persönlich, aber es existiert doch objektiv. Die Leute, die die Kirche ernst nehmen, sind in einer Art erzogen worden, die menschlich alles andere als integrativ und im humanen Sinne wirksam ist. Die Psychologie hat sich inzwischen so weit vom Kirchenchristentum wegentwickelt, dass ihr der Atheismus fast ein Stilmittel werden musste. Das, was da in der Seele der ›Frommen‹ als Gott bezeichnet wird, kann nicht existieren, darf nicht existieren, es muss langsam herausgefiltert werden aus den Komplexbildungen der Kindheit; dann erst können wir vielleicht glaubwürdig von Gott sprechen.« Wie das gelingen könnte, wusste ich damals nicht.
Auf diese Weise kam ich zu den »Strukturen des Bösen«. Die Arbeit an der Genesis wurde sozusagen ein Hilfsmittel für mich, die »drei Brüder Karamasow« – Glauben, Fühlen und Denken – an einen Tisch zu bringen. Ich dachte: »Ich verstehe jetzt, was menschliche Verzweiflung ist, davon habe ich eine Menge Ahnung. Was Angst ist, kann ich schildern, wie aus den Erlebnissen von Angst und Verzweiflung sich ganze Schicksale formen.« Und ich dachte, das werde doch eigentlich zwischen Adam und Eva, in den Geschichten von Kain und Abel geschildert, bis hin zum Turmbau zu Babel. »Also ist das ein Text, an dem ich alles das probieren kann: wie man Mythen interpretiert oder Träume und Märchen liest, wie man das Unbewusste ins Bewusstsein integriert, wie man neurotische Strukturen bewusst macht und zu einer erlösenden Alternative öffnet. Ich kann dabei auch das, was ich sprachlich gelernt habe, unterbringen, und ich kann das in drei Teilen niederlegen: Exegese – meine theologische Lieblingswissenschaft, Psychoanalyse – was ich jetzt gelernt habe, und Philosophie – was ich eigentlich immer schon wollte. Und dann können wir gewissermaßen Köln von zwei Seiten her über den Rhein miteinander verbinden. Wir haben jetzt nicht mehr die Ubier linksrheinisch und dann Germania Libera rechtsrheinisch, hier die Kultur und da die Barbarei, sondern wir bringen beides mal irgendwie zusammen und können in ein Gespräch treten, so, dass es Menschen guttut.« Ich dachte: »Dann können wir der Botschaft Jesu zum ersten Mal wirklich nahekommen. Wir können zum ersten Mal heute lebendig setzen, wie Menschen geheilt werden. Wir können die Texte symbolisch so lesen, dass sie auf die Grundprobleme des menschlichen Daseins antworten.« Insofern war Psychoanalyse für mich eine wunderbare Sache. Aber sie war eigentlich auch das Ende des institutionalisierten, dogmengebundenen, weisungsabhängigen Priestertums, in dem ich gefangen war. Wie man »priesterlich« lebt – poetisch, prophetisch, psychotherapeutisch, menschlich authentisch – das war die eigentliche Frage.
Das Ende des Priestertums, war das auch Ihr Band»Kleriker – Psychogramm eines Ideals«, war das auch eine Aufarbeitung Ihrer Erfahrungen und ein Blick auf diesen Stand?
Das hat man manchmal so gelesen – und nicht ganz zu Unrecht. Aber so, wie ich es in den »Klerikern« beschrieben habe, habe ich es nicht unmittelbar an mir selber erlebt, sondern im kirchlichen Milieu als Strukturgegebenheit. Ich muss zur Erklärung sagen: Die»Strukturen des Bösen«