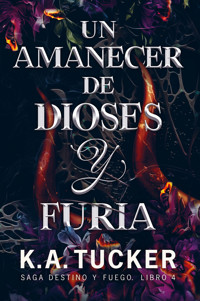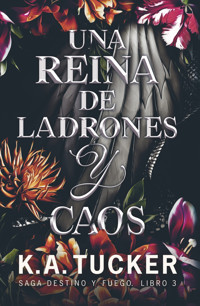6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Wir. Hier.-Reihe
- Sprache: Deutsch
#sorrynotsorry Wham! Mit jedem Schlag auf den Sandsack geht es Kacey besser. Seit sie mit ihrer kleinen Schwester vor ihrem gewalttätigen Onkel nach Florida flüchtete, ist das Fitness-Center der einzige Ort, an dem sie bei sich ist. Mit aller Macht verdrängt sie, was damals geschah, als bei einem Unfall ihre ganze Familie starb. Wham! Als Trent vor ihr steht, ist es um ihre sorgfältig errichtete Fassade geschehen. Er ist unverschämt, undurchschaubar und wahnsinnig sexy. Und er hat ein Geheimnis, das Kaceys Leben für immer verändern könnte...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
K.A. Tucker
Wir. Hier. Jetzt.
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Anja Galić
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Lia und Sadie
Mögen eure Engel euch immer beschützen
Für Paul
Für deine fortgesetzte Unterstützung
Für Heather Self
Alle lila und grünen Federn dieser Welt
PROLOG
»Atme einfach«, sagte meine Mutter immer. »Zehn kleine Atemzüge … Fühle sie. Halte sie. Liebe sie.« Jedes Mal, wenn ich vor Wut schrie und mit dem Fuß aufstampfte, mir aus Frust die Augen ausweinte oder vor irgendetwas Angst hatte, versuchte sie, mich mit diesen Worten zu beruhigen. Wirklich jedes Mal. Mit den immer gleichen Worten. Sie hätte sich dieses verfluchte Mantra auf die Stirn tätowieren lassen sollen. »Das bringt doch nichts!«, rief ich darauf immer. Ich habe den Sinn dahinter nie kapiert. Was sollen zehn kleine Atemzüge schon ausrichten? Warum keine großen Atemzüge? Warum zehn? Warum nicht drei oder fünf oder zwanzig? Und während ich mich weiter reinsteigerte, lächelte sie nur ihr sanftes Lächeln. Damals verstand ich es nicht.
Jetzt schon.
ERSTES STADIUM − ANGENEHME TAUBHEIT
EINS
Ein leises Zischen … Mein Herzschlag dröhnt in meinen Ohren. Etwas anderes höre ich nicht. Ich bin mir sicher, dass mein Mund sich bewegt, dass ich nach ihnen rufe … Mom? … Dad? … Aber ich kann mich selbst nicht hören. Viel schrecklicher ist, dass ich sie nicht hören kann. Ich drehe den Kopf nach rechts und sehe Jenny, ihr Körper ist an meinen gepresst und wirkt seltsam verrenkt. Die Wagentür auf ihrer Seite ist viel näher, als sie es sein dürfte. Jenny? Ich bin mir sicher, dass ich ihren Namen laut ausspreche. Sie reagiert nicht. Ich schaue nach links, wo alles nur schwarz ist. Es ist so dunkel, dass ich Billy nicht sehen kann, trotzdem weiß ich, dass er da ist, weil ich seine Hand spüre. Seine große, kräftige Hand, die meine Finger umschließt. Aber sie ist vollkommen reglos … Ich versuche, sie zu drücken, doch meine Muskeln gehorchen mir nicht. Ich kann nichts tun, außer den Kopf hin und her zu drehen und eine gefühlte Ewigkeit lang meinem gegen meine Rippen hämmernden Herzen zuzuhören.
Ein schwacher Lichtschein … Stimmen …
Ich sehe das Licht und höre die Stimmen, die sich aus allen Richtungen nähern. Ich öffne den Mund, um zu schreien, aber mir fehlt die Kraft. Die Stimmen werden lauter, die Lichter heller. Ein rasselndes Keuchen jagt mir einen kalten Schauer über den Rücken. Es klingt, als versuche jemand mühsam ein letztes Mal Atem zu holen.
Dann ertönt dreimal hintereinander ein lautes Klick, so als würden die Schalter einer Flutlichtanlage angeknipst werden, und plötzlich strömt von allen Seiten grelles Licht ins Wageninnere und bringt schonungslos alle Details zum Vorschein.
Die zerschmetterte Windschutzscheibe.
Verbogenes Metall.
Dunkle Schlieren.
Glitzernde Lachen.
Blut. Überall Blut.
All das verschwindet auf einmal und ich falle, stürze hintenüber in kaltes Wasser und sinke immer schneller und schneller der Dunkelheit entgegen, vom Gewicht eines Ozeans niedergedrückt, der mich in einem Stück verschlingt. Ich öffne den Mund, um Luft zu holen. Wasser dringt in meine Lungen, flutet mich. Der Druck auf meinem Brustkorb ist unerträglich. Es ist, als wolle er jeden Moment bersten. Ich kriege keine Luft … Ich kriege keine Luft. Zehn kleine Atemzüge, höre ich meine Mutter sagen, aber ich schaffe es nicht. Noch nicht einmal einen. Mein Körper zittert … er zittert …
»Hallo? Wachen Sie auf, Liebes.«
Ich öffne schlagartig die Augen und sehe ein ausgeblichenes Sitzpolster vor mir. Es dauert einen Moment, bis ich wieder weiß, wo ich bin, und mein hämmerndes Herz sich etwas beruhigt hat.
»Sie haben gekeucht und nach Luft gerungen«, sagt die Stimme.
Ich schaue in das von tiefen Falten zerfurchte Gesicht einer älteren Frau, die mich besorgt ansieht und mir ihre knorrigen Finger auf die Schulter gelegt hat. Mein Körper reagiert sofort auf die Berührung und zieht sich reflexartig in sich zusammen, ohne dass ich etwas dagegen tun kann.
Sie nimmt mit einem mitfühlenden Lächeln ihre Hand weg. »Entschuldigen Sie. Ich dachte nur, ich sollte Sie lieber wecken.«
Ich schlucke und schaffe es, ein »Danke« zu krächzen.
Sie nickt. »Muss ein ganz schöner Albtraum gewesen sein«, sagt sie, während sie sich wieder auf ihren Platz im Bus hinter mir sinken lässt.
»Ja, muss wohl.« Meine Stimme klingt jetzt wieder so ruhig und unverbindlich wie immer. Leise füge ich hinzu: »Kann es kaum erwarten, endlich aufzuwachen.«
»Wir sind da.« sind da.« sind da.« Ich rüttle Livie sanft am Arm. Sie brummt etwas und schmiegt den Kopf ans Fenster. Es ist mir ein Rätsel, wie sie so schlafen kann, aber sie hat es geschafft und die letzten sechs Stunden leise vor sich hin geschnarcht. Eine dünne Speichelspur schlängelt sich ihr Kinn hinunter. Sehr sexy. »Livie«, sage ich ungeduldig. Ich muss aus dieser Blechkiste raus. Sofort.
Als Antwort bekomme ich nur einen »Lass mich, ich schlafe«-Schmollmund.
»Olivia Cleary!«, herrsche ich sie an, während die anderen Fahrgäste in den Gepäckablagen über den Sitzen kramen und ihre Sachen zusammensuchen. »Jetzt komm endlich. Ich muss hier raus, sonst drehe ich durch!« Eigentlich will ich sie gar nicht so anschnauzen, aber ich kann nicht anders. Enge Räume machen mich echt fertig, und nachdem ich jetzt zweiundzwanzig Stunden in diesem verfluchten Bus saß, bin ich kurz davor, die Notausstiegsluke im Dach aufzureißen und panisch nach draußen zu klettern.
Endlich dringen meine Worte zu ihr durch. Livie öffnet blinzelnd ihre blauen Augen und starrt einen Moment verschlafen auf den Busbahnhof von Miami. »Wir haben’s geschafft?«, fragt sie gähnend und setzt sich auf, um sich zu strecken und sich die Umgebung draußen genauer anzusehen. »Oh, sieh mal! Eine Palme!«
Mittlerweile stehe ich mit unseren Rucksäcken im Gang. »Ja, toll, Palmen. Juhu. Los, raus hier. Außer du bist scharf drauf, noch einen Tag hier drin zu verbringen und den ganzen Weg bis nach Michigan zurückzufahren.« Das bringt sie auf Trab.
Als wir aussteigen, lädt der Fahrer gerade das Gepäck aus und im nächsten Moment entdecke ich unsere beiden pinkfarbenen Koffer. Unser Leben, all unsere Habseligkeiten sind auf je einen Koffer reduziert. Mehr konnten wir auf die Schnelle nicht zusammenpacken, als wir vor Onkel Raymond und Tante Darla geflüchtet sind. Was soll’s, sage ich mir, als ich meiner Schwester einen Arm um die Schulter lege und sie kurz an mich drücke. Wir haben uns. Das ist alles, was zählt.
»Puh, ist das heiß hier«, sagt Livie genau in dem Moment, in dem ich spüre, wie mir kleine Schweißperlen den Rücken hinunterlaufen. Es ist noch nicht mal Mittag und schon jetzt brennt die Sonne wie ein glühender Feuerball auf uns herunter. Das ist etwas ganz anderes als die herbstliche Kühle, die wir in Grand Rapids zurückgelassen haben. Livie zieht ihren Kapuzenpulli aus und erntet anerkennende Pfiffe von ein paar Skatern, die sich nicht um das »Betreten verboten«-Schild für diesen Teil des Parkplatzes scheren.
»Kaum hier und schon dabei, Typen aufzureißen, Livie?«, necke ich sie.
Sie errötet und versteckt sich hastig hinter einem Betonpfeiler.
»Dir ist schon klar, dass du nicht wie ein Chamäleon mit deiner Umgebung verschmelzen kannst, oder? … Oh-oh! Der in dem roten Shirt steuert direkt auf uns zu.« Ich schaue über die Schulter in Richtung der Jungs.
Livie reißt entsetzt die Augen auf, bevor ihr klar wird, dass ich bloß Spaß mache. »Oh Mann, Kacey!«, zischt sie und boxt mich in die Schulter. Livie kann noch nicht damit umgehen, dass sie sich im Laufe des letzten Jahres in eine umwerfende Schönheit verwandelt hat, nach der sich alle Jungs die Köpfe verrenken.
Ich muss grinsen, als ich beobachte, wie sie an ihrem Shirt herumzupft. Sie hat keine Ahnung, wie wunderhübsch sie ist, was mir als ihrem Vormund auch ganz recht ist. »Von mir aus kannst du gern so unbedarft bleiben, Livie. Es wird mein Leben viel einfacher machen, wenn sich daran, sagen wir, für die nächsten fünf Jahre nichts ändert.«
Sie verdreht die Augen. »Okay, Miss Sports Illustrated.«
»Ha, ha.« Aber in Wahrheit hat sich das Interesse dieser Idioten mittlerweile tatsächlich teilweise auf mich verlagert. Zwei Jahre intensives Kickbox-Training haben mir einen gestählten Körper beschert, der in Kombination mit meinen rotbraun glänzenden Haaren und eisblauen Augen eine Menge unerwünschter Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Livie ist ein fünfzehn Jahre altes Abbild von mir. Dieselben blauen Augen, dieselbe schmale Nase, derselbe helle irische Teint. Der einzige echte Unterschied ist unsere Haarfarbe. Würde man uns ein Handtuch um den Kopf wickeln, könnten wir glatt als Zwillinge durchgehen. Sie hat das seidige Schwarz unserer Mutter geerbt. Und obwohl ich fünf Jahre älter bin, ist sie fünf Zentimeter größer als ich.
Man braucht also keine Intelligenzbestie zu sein, um sofort zu erkennen, dass wir Schwestern sind. Aber genau hier enden unsere Gemeinsamkeiten auch schon. Livie ist ein Engel. Ihr treten die Tränen in die Augen, wenn sie ein Kind weinen sieht, sie entschuldigt sich, wenn jemand anderes sie anrempelt, sie arbeitet ehrenamtlich in Suppenküchen und Büchereien. Macht jemand irgendetwas Dummes, sucht sie für ihn nach Entschuldigungen. Dürfte sie schon Auto fahren, würde sie für Insekten bremsen. Ich bin … nicht wie Livie. Vielleicht bin ich früher mal mehr wie sie gewesen. Aber jetzt nicht mehr. Wenn sie eine Sonne ist, bin ich die drohende Gewitterwolke, die sich davorschiebt.
»Kacey!« Ich drehe mich um und sehe Livie an einem Taxi stehen. Sie hat die Wagentür geöffnet und schaut mich strahlend an.
»Ich glaub nicht, dass containern so viel Spaß macht, wie es immer heißt.«
Sie wirft die Taxitür zu und zieht eine Grimasse. »Aber Bus fahren schon, ja?« Gereizt zerrt sie ihren Koffer über den Bordstein zu mir zurück.
»Echt jetzt? Fünf Minuten in Miami und du fängst schon an rumzuzicken? Willst du dich vielleicht wirklich aus Müllcontainern ernähren?« Ich halte ihr mein Portemonnaie hin. »Verdammt, Livie, mit den paar Kröten, die da noch drin sind, kann ich uns gerade noch bis Sonntag durchbringen.«
Sie wird rot. »Tut mir leid, Kace. Du hast recht. Ich bin einfach ein bisschen durch den Wind.«
Sofort habe ich ein schlechtes Gewissen. Livie ist keine Zicke, im Gegenteil. Ja, wir kriegen uns manchmal in die Haare, aber das ist immer meine Schuld. Livie ist das, was man ein braves Kind nennt. War sie immer schon. Pflichtbewusst, ausgeglichen. Mom und Dad haben ihr nie etwas zweimal sagen müssen. Als Moms Schwester uns nach ihrem Tod bei sich aufnahm, hat Livie alles getan, um ein noch braveres Kind zu sein. Der Schuss ging nach hinten los. Und zwar gewaltig.
»Komm, hier lang.« Ich hake mich bei ihr unter und drücke kurz ihren Arm, bevor ich den Zettel mit der Adresse auseinanderfalte. Nach einer langen und umständlichen Unterhaltung mit dem älteren Mann hinter dem Ticketschalter – der fast klischeehaft ein Silbenrätsel vor sich liegen hat – zeichnet er mit einem Bleistift drei Umsteigestationen auf einem Stadtplan ein, und kurz darauf sitzen wir in einem Linienbus, von dem ich nur hoffen kann, dass er nicht in Richtung Alaska unterwegs ist.
Ich bin froh zu sitzen, weil ich völlig erschlagen bin. Bis auf ein zwanzigminütiges Nickerchen im Bus habe ich seit sechsunddreißig Stunden nicht mehr geschlafen. Müde und mit tausend Sorgen im Kopf würde ich die Fahrt viel lieber schweigend verbringen, aber Livie knetet nervös die Hände im Schoß und macht mir damit einen Strich durch die Rechnung. »Was ist los, Livie?«
Sie runzelt die Stirn und zögert.
»Livie …«
»Meinst du, Tante Darla hat die Polizei gerufen?«
Ich drücke beruhigend ihr Knie. »Mach dir deswegen keine Sorgen. Alles wird gut. Sie werden uns nicht finden, und falls doch, erzählen wir den Cops, was passiert ist.«
»Aber er hat nichts gemacht, Kace. Wahrscheinlich war er zu betrunken, um zu merken, dass er in meinem Zimmer gelandet ist.«
Ich schaue sie fassungslos an. »Nichts gemacht? Hast du schon vergessen, dass dieser widerliche alte Dreckskerl seinen Ständer an deinen Oberschenkel gepresst hat?«
Livie verzieht den Mund, als müsste sie sich gleich übergeben.
»Er hat nur deswegen nichts gemacht, weil du sofort rausgerannt und in mein Zimmer gekommen bist. Hör auf, dieses kranke Arschloch auch noch in Schutz zu nehmen.« Ich hatte die Blicke gesehen, die Onkel Raymond ihr zuwarf, als ihr Körper sich letztes Jahr zu verändern begann. Süße, unschuldige Livie. Ich hätte ihm die Eier zerquetscht, wenn er in mein Zimmer gekommen wäre, und das wusste er. Aber Livie …
»Ich hoffe einfach, dass sie uns nicht suchen und zurückbringen.«
Ich schüttle den Kopf. »Das wird nicht passieren. Ich bin jetzt dein Vormund und irgendwelcher juristische Papierkram interessiert mich nicht. Du bleibst bei mir, Punkt. Außerdem hasst Tante Darla Miami, schon vergessen?« Dass sie die Stadt hasst, ist noch untertrieben. Tante Darla ist eine sogenannte wiedergeborene Christin und verbringt jede freie Minute damit, zu beten und dafür zu sorgen, dass alle anderen auch beten oder zumindest wissen, dass sie beten sollten, um nicht in der Hölle zu landen, sich Syphilis einzufangen oder ungewollt schwanger zu werden. Sie ist davon überzeugt, dass Großstädte die Brutstätte allen Übels in der Welt sind. Sie als fanatisch zu bezeichnen, wäre ebenfalls untertrieben. Nein, Tante Darla würde keinen Fuß nach Miami setzen, es sei denn, Jesus höchstpersönlich würde hier eine Versammlung abhalten.
Livie nickt und senkt die Stimme zu einem Flüstern. »Meinst du, Onkel Raymond hat rausgekriegt, was wir gemacht haben? Wir könnten dafür richtig Ärger bekommen.«
Ich zucke mit den Achseln. »Kann dir doch egal sein, ob er es rausgekriegt hat.« Fast wünsche ich mir, ich hätte nicht auf Livies Flehen gehört und wäre zur Polizei gegangen, um denen von Onkel Raymonds kleinem »Besuch« in ihrem Zimmer zu erzählen. Aber Livie wollte nichts von einer Anzeige wissen und wir hätten es garantiert mit der ganzen Bandbreite zu tun bekommen: Leute vom Kindernotdienst, Jugendamt, Anwälte. Möglicherweise wäre der Fall sogar in den Lokalnachrichten gelandet. Das wollte keine von uns. Uns reichten die Erfahrungen, die wir nach dem Unfall gemacht haben. Und wer weiß, was mit Livie passiert wäre, immerhin ist sie noch minderjährig. Wahrscheinlich hätte man sie in eine Pflegefamilie gesteckt. In meine Obhut hätte man sie jedenfalls definitiv nicht gegeben. Es gibt zu viele Gutachten, in denen ich als »emotional instabil« eingestuft wurde, als dass man mir jemanden anvertrauen würde.
Also haben Livie und ich eine Abmachung getroffen. Ich würde ihn nicht anzeigen, wenn sie mit mir kommen würde. Gestern Abend hat sich dann der perfekte Zeitpunkt ergeben, um uns aus dem Staub zu machen. Tante Darla war auf irgendeiner Exerzitien-Veranstaltung, die die ganze Nacht dauern sollte, sodass ich nach dem Abendessen unbemerkt drei Schlaftabletten in Onkel Raymonds Bier auflösen konnte. Der Idiot hat das Glas, das ich ihm so zuvorkommend eingeschenkt und gebracht habe, tatsächlich angenommen. Seit ich vor fast zwei Jahren herausgefunden habe, dass er unser Erbe an einem Black-Jack-Tisch verjubelt hat, habe ich keine zehn Worte mit ihm gewechselt. Trotzdem ist er nicht misstrauisch geworden. Gegen sieben lag er schnarchend auf der Couch, und wir hatten genügend Zeit, uns unsere Koffer zu schnappen, seine Brieftasche und Tante Darlas unter der Spüle versteckte Spardose zu plündern und noch am selben Abend in den Bus zu steigen. Die Sache mit den Schlaftabletten und dem Geld ist vielleicht ein bisschen heftig gewesen. Andererseits ist Onkel Raymond selbst schuld, das alles wäre nicht passiert, wenn er sich nicht als widerlicher Pädophiler entpuppt hätte.
»Hundertvierundzwanzig«, lese ich die Hausnummer laut vor. »Das ist es.« Wir stehen tatsächlich vor unserem neuen Zuhause – einem dreistöckigen Apartmentgebäude am Jackson Drive mit weiß verputzter Fassade und kleinen Fenstern. Es wirkt gepflegt und hat etwas von einem Strandhaus, obwohl wir eine halbe Stunde vom Meer entfernt sind. Wenn ich tief einatme, kann ich fast einen Hauch von Sonnenmilch und Algen in der Luft spüren.
Livie fährt sich durch ihre wilde dunkle Mähne. »Wo hast du das Apartment noch mal gefunden?«
»Bei www.brauchedringendeinewohnung.com«, witzle ich. Nachdem Livie tränenüberströmt in mein Zimmer gestürzt war, wusste ich, dass wir schleunigst aus Grand Rapids verschwinden mussten. Ich durchsuchte das Internet, wurde fündig, mailte dem Vermieter und bot ihm sechs Monatsmieten im Voraus und in bar an. Der Verdienst von zwei Jahren, in denen ich überteuerten Starbucks-Kaffee ausgeschenkt hatte – weg.
Trotzdem ist das hier jeden einzelnen ausgeschenkten Tropfen Kaffee wert.
Über ein paar Stufen gehen wir auf einen gewölbten Toreingang zu. »Das Foto in der Anzeige sah toll aus«, sage ich und greife nach der Klinke, aber das Tor ist abgeschlossen. »Gut. Die achten hier auf Sicherheit.«
»Warte.« Livie drückt auf den gesprungenen Klingelknopf zu ihrer Rechten. Es ist nichts zu hören. Anscheinend ist er kaputt. Während wir darauf warten, dass uns jemand reinlässt, unterdrücke ich ein Gähnen.
Drei Minuten später lege ich die Hände um den Mund und will gerade den Namen des Vermieters rufen, als sich schlurfende Schritte nähern und ein Mann mittleren Alters vor uns auftaucht, unrasiert und in zerknautschten Klamotten. Sein Gesicht ist leicht schief, er hat kaum noch Haare auf dem Kopf, und ich könnte schwören, dass ein Ohr größer ist als das andere. Er erinnert mich an Sloth aus Die Goonies, einem Filmklassiker – jedenfalls laut unserem Vater – aus den 1980er-Jahren, den er unbedingt mit uns anschauen wollte. Sloth kratzt sich seinen ausladenden Bauch und sagt … nichts. Ich wette, er ist genauso intelligent wie sein Film-Zwilling.
»Hi, ich bin Kacey Cleary«, stelle ich mich vor. »Wir sind die neuen Mieter aus Michigan und suchen nach Mr Tanner.« Er heftet den Blick auf mich und mustert mich von oben bis unten. Ich lobe mich in Gedanken dafür, eine lange Jeans angezogen zu haben, um das große Tattoo auf meinem rechten Oberschenkel zu verdecken, falls er es wagen sollte, mich nach meinem Äußeren zu beurteilen. Dann richtet sich seine Aufmerksamkeit auf Livie, wo sie für meinen Geschmack einen Tick zu lange verweilt.
»Seid ihr Schwestern?«
»Unsere rosa Koffer haben uns verraten, stimmt’s?«, gebe ich ohne nachzudenken zurück. Schaff deinen Hintern durch dieses Tor, bevor er merkt, was für eine Klugscheißerin du sein kannst, Kace.
Glücklicherweise ziehen sich Sloths Mundwinkel nach oben. »Könnt Tanner zu mir sagen. Hier entlang.«
Livie und ich tauschen einen entsetzten Blick. Sloth ist unser Vermieter? Er öffnet das laut quietschende Tor und bedeutet uns, ihm zu folgen. Nach ein paar Schritten bleibt er wieder stehen, dreht sich zu mir um und streckt mir die Hand hin, als wäre ihm der Gedanke erst jetzt gekommen.
Ich starre wie gelähmt auf die fleischigen Finger, unfähig, seine Hand zu schütteln. Warum erwischt mich das jedes Mal aufs Neue so eiskalt?
Livie springt beherzt ein und greift lächelnd danach, und ich trete ein paar Schritte zurück, damit niemand auch nur ansatzweise auf die Idee kommen könnte, ich hätte irgendetwas mit der Hand dieses Typen zu tun. Oder mit der Hand von wem auch immer. Livie ist eine Meisterin darin, mich aus solchen Situationen zu retten.
Falls Tanner irgendwas aufgefallen ist, lässt er sich nichts anmerken, stattdessen führt er uns durch einen von struppigen Büschen und vertrockneten Blumenbeeten gesäumten Innenhof, in dem ein verrosteter Grill steht. »Den Hof kann jeder hier benutzen.« Er macht eine ausholende Geste. »Wenn ihr grillen, euch sonnen oder einfach entspannen wollt, dann ist das genau der richtige Ort.« Ich mustere die mindestens dreißig Zentimeter hohen Disteln entlang der traurig aussehenden Beete und frage mich, wie viele Leute diesen Ort wohl entspannend finden. Dabei könnte es hier richtig nett sein – wenn sich jemand darum kümmern würde.
»Muss am Vollmond liegen«, murmelt Tanner, als wir ihm zu einer Reihe dunkelrot gestrichener Türen im Erdgeschoss folgen, neben denen jeweils ein kleines Fenster eingelassen ist. Die anderen Stockwerke sehen genauso aus.
»Wie meinen Sie das?«
»Außer euch hab ich letzte Woche noch jemandem per Mail ein Apartment hier vermietet. Die gleiche Geschichte – braucht dringend eine Bleibe, kann nicht warten, zahlt in bar. Schätze, jeder hat irgendwas, vor dem er wegläuft.«
Tja. Vielleicht ist Tanner doch cleverer als sein Film-Zwilling.
»Ist heute Morgen erst angekommen.« Er deutet mit dem Daumen auf Apartment 1D, bevor er zu der danebenliegenden, mit einem goldenen »1C« gekennzeichneten Tür weiterschlurft und seinen gigantischen Schlüsselbund rasselnd nach dem passenden Schlüssel absucht. »Okay, dann erzähle ich euch jetzt mal, was ich allen meinen Mietern erzähle. Es gibt nur eine Regel, aber wer gegen die verstößt, kriegt sofort die Kündigung auf den Tisch. Haltet Frieden! Schmeißt keine wilden Partys mit Drogen und Orgien und …«
»Verzeihung, aber was genau versteht man in Florida unter einer Orgie? Sind Dreier okay? Und was ist, wenn es dabei etwas handfester zugeht? Sie müssen nämlich wissen, dass …«, beginne ich und handle mir einen finsteren Blick von Tanner und einen schmerzhaften Hieb ins Schulterblatt von Livie ein.
Er räuspert sich und fährt dann fort, als hätte ich nichts gesagt. »Keine Kleinkriege, weder familiäre noch sonst irgendwelche. Für so einen Mist fehlt mir die Geduld und ich werfe euch schneller raus, als ihr mich anlügen könnt. Verstanden?«
Ich nicke und muss mich schwer beherrschen, nicht den Titelsong von Familien-Duell vor mich hin zu summen, als Tanner die Tür aufstößt.
»Hab es selbst geputzt und gestrichen. Ist nicht mehr taufrisch, aber für eure Zwecke sollte es reichen.«
Es ist ein kleines, spärlich eingerichtetes Apartment mit einer grün-weiß gefliesten Kochnische im hinteren Teil des Raums. In der Mitte steht eine braun-orange geblümte Couch, deren Hässlichkeit durch die frisch gestrichenen weißen Wände noch hervorgehoben wird und die sich mit dem billigen waldgrünen Teppich und dem in der Luft liegenden Geruch nach Mottenkugeln zu einem authentischen Siebzigerjahre-White-Trash-Ambiente zusammenfügt. Aber vor allem hat das, was ich sehe, nicht das Geringste mit den Fotos in der Anzeige zu tun. Tja, Überraschung.
Tanner kratzt sich den ergrauten Haarkranz an seinem Hinterkopf. »Ist nichts Besonderes, ich weiß. Da drüben sind die beiden Schlafzimmer und dazwischen ein Bad. Ich hab letztes Jahr eine neue Toilette installiert, also …« Sein schiefes Gesicht wendet sich mir zu. »Wenn das alles ist …«
Er will sein Geld. Mit angespanntem Lächeln hole ich einen dicken Umschlag aus der Vordertasche meines Rucksacks. Während ich ihm die sechs Mieten im Voraus gebe, wagt Livie sich weiter in das Apartment hinein. Tanner schaut ihr hinterher und kaut nachdenklich auf seiner Unterlippe. »Sie ist noch ganz schön jung. Wissen eure Eltern, dass ihr hier seid?«
»Unsere Eltern sind tot.« Es kommt so grob heraus wie beabsichtigt und verfehlt seine Wirkung nicht. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Tanner.
Er wird blass. »Oh … ähm … das tut mir leid.« Ich tue nichts, um das unbehagliche Schweigen zu beenden. Stattdessen schiebe ich die Hände unter die Achseln, um noch einmal klarzustellen, dass ich nicht vorhabe, irgendwelche Hände zu schütteln. Als er auf dem Absatz kehrtmacht und aus dem Apartment flüchtet, seufze ich leise. Er will mich genauso schnell loswerden wie ich ihn. »Die Waschküche ist im Keller«, ruft er über die Schulter zurück. »Ich putze sie einmal die Woche und erwarte von meinen Mietern, dass sie mithelfen, sie sauber zu halten. Wenn ihr irgendwas braucht, ich wohne in 3F.« Er verschwindet und lässt den Schlüssel in der Tür stecken.
Ich gehe zu Livie, die gerade das Medizinschränkchen in dem für Hobbits konzipierten Badezimmer inspiziert. Es ist so klein, dass sich immer nur eine Person darin aufhalten kann. »Neue Toilette. Alte, eklige Dusche«, murmle ich und zeichne mit der Fußspitze die Risse in dem schmuddeligen Fliesenboden nach.
»Ich nehme das Zimmer hier.« Livie quetscht sich an mir vorbei und läuft in den Raum, der rechts vom Bad liegt und bis auf eine Kommode und ein schmales Bett mit einer gehäkelten pfirsichfarbenen Tagesdecke leer ist. Das Fenster ist schwarz vergittert und zeigt zur Straße.
»Bist du sicher? Es ist winzig.« Ich muss mir das andere Zimmer nicht ansehen, um zu wissen, dass das hier das kleinere der beiden ist. So ist Livie. Denkt immer zuerst an die anderen.
»Kein Problem. Ich mag kleine Räume«, gibt sie grinsend zurück und versucht wie üblich, das Beste aus der Situation zu machen.
»Tja, wenn wir wilde Orgien feiern wollen, wirst du nicht mehr als drei Typen auf einmal hier reinkriegen. Das ist dir doch klar, oder?«
Livie wirft ein Kissen nach mir. »Sehr witzig.«
Mein Zimmer sieht genauso aus wie ihres, nur dass es einen Hauch größer ist und ein Doppelbett mit einer unfassbar hässlichen, gestrickten grünen Überdecke darin steht. Ich seufze enttäuscht. »Tut mir leid, Livie. Das alles hier hat absolut nichts mit dem zu tun, was in der Anzeige stand. Zur Hölle mit Tanner und seinen gefakten Fotos.« Ich lege den Kopf schräg. »Meinst du, wir können ihn dafür verklagen?«
»So schlimm ist es nicht, Kace«, sagt Livie schnaubend.
»Das sagst du jetzt, aber wenn wir erst mal mit den Kakerlaken um unser Brot kämpfen …«
»Du hast vor zu kämpfen? Du? Ich bin geschockt.«
Ich lache. Es gibt nicht mehr viel, was mich zum Lachen bringt. Livies Versuche, sarkastisch zu sein, gehören aber definitiv dazu. Wenn sie die Coole spielt, endet das meistens damit, dass sie wie eine Radiosprecherin klingt, die mit dramatischer Stimme den Plot eines schlechten Krimis wiedergibt.
»Es ist ätzend, Livie. Gib’s zu. Aber jetzt sind wir nun mal hier und etwas Besseres können wir uns im Moment einfach nicht leisten. Miami ist scheißteuer.«
Ihre Hand schiebt sich in meine und ich drücke sie. Es ist die einzige Hand, mit deren Berührung ich klarkomme. Die einzige, die sich nicht tot anfühlt. Manchmal fällt es mir sogar schwer, sie loszulassen. »Es ist perfekt, Kace. Bloß ein bisschen klein und mottenkugelig und grün, aber wir haben es ziemlich nah zum Strand! Genau das wollten wir doch, oder?« Sie streckt seufzend die Arme über den Kopf. »Und was jetzt?«
»Heute Nachmittag melden wir dich erst mal in deiner neuen Schule an, damit dein riesiges Gehirn nicht anfängt zu schrumpfen. Schließlich musst du später mal ein Mittel gegen Krebs erfinden, stinkreich werden und mich finanziell unterstützen.« Ich klappe meinen Koffer auf und wühle durch meine Sachen. »Ich muss mich in einem Sportstudio anmelden und danach finde ich heraus, wie viel Corned Beef und Dosenmais ich von dem Geld kaufen kann, das ich bekomme, wenn ich mich an irgendeine Straßenecke stelle und meinen schweißgebadeten, heißen Körper vermiete.« Livie schüttelt nur den Kopf. Manchmal hat sie Probleme mit meinem Humor. Ich glaube, sie fragt sich in solchen Momenten, ob ich das, was ich so von mir gebe, nicht vielleicht doch ernst meine. Ich bücke mich, um die Decke und das Bettzeug von der Matratze zu ziehen. »Aber vorher muss ich alles hier erst mal von irgendwelchen krassen Bazillen befreien.«
Die Waschküche im Keller ist nichts Besonderes. An der Decke entlanglaufende Neonröhren werfen kaltes Licht auf den blaugrünlichen Betonboden, ein blumiger Duft schafft es nicht wirklich, den moschusartigen Gestank in der Luft zu übertünchen, und die Geräte haben ihre Glanzzeit bestimmt schon seit fünfzehn Jahren hinter sich und werden wahrscheinlich mehr Schaden als Gutes an unserer Wäsche anrichten. Aber nirgendwo ist auch nur eine Spinnwebe oder Fluse zu sehen.
Während ich unsere Bettwäsche und Decken auf zwei Maschinen verteile, verfluche ich die Welt dafür, dass sie uns dazu zwingt, überhaupt erst in fremdem Bettzeug zu schlafen. Von meinem ersten Gehalt kaufe ich neues, nehme ich mir vor. Nachdem ich eine Mischung aus Wasch- und Desinfektionsmittel dazugegeben habe, stelle ich die Temperatur auf die höchste Stufe und wünschte, es gebe ein Programm, das »Kocht garantiert jede Scheißbakterie aus der Wäsche« heißt. Das würde mir ein minimal besseres Gefühl geben.
Die Maschine will sechs Vierteldollarmünzen pro Waschgang. Ich hasse Münzwaschautomaten. Livie und ich mussten in der Mall fremde Leute anquatschen, ob sie uns die Fünf- und Zehn-Cent-Stücke aus Tante Darlas Sparbüchse wechseln. Als ich das Kleingeld herauskrame, stelle ich fest, dass es gerade reicht, um die Maschinen damit zu füttern.
»Ist noch eine Maschine frei?«, ertönt plötzlich direkt hinter mir eine tiefe Stimme. Ich fahre zusammen und lasse vor Schreck meine letzten drei Vierteldollarmünzen fallen. Zwei kann ich dank meiner guten Reflexe auffangen, die dritte rollt auf dem Boden in Richtung Waschmaschine. Ich lasse mich auf alle viere fallen und hechte ihr hinterher.
Aber ich bin nicht schnell genug.
»Shit!« Eine Wange auf den Boden gepresst, spähe ich unter die Maschine und halte nach etwas silbrig Glitzerndem Ausschau. Meine Finger müssten gerade so in den schmalen Zwischenraum passen …
»Das würde ich an deiner Stelle lieber nicht tun.«
»Ach nein?«, gebe ich genervt zurück. Wer, außer einem Psycho oder Vergewaltiger, schleicht sich in einer Waschküche an eine Frau heran? Bleibt die Frage, ob er eher Ersteres oder Letzteres ist. Wahrscheinlich sollte ich mir jetzt vor Angst in die Hose machen, tu ich aber nicht. Es ist nicht so einfach, mir Angst einzujagen, und außerdem bin ich im Moment sowieso viel zu sauer, als dass noch irgendeine andere Gefühlsregung in mir Platz hätte. Soll er doch versuchen, mich anzugreifen. Er wird sich den Schock seines Lebens einhandeln. »Und wieso nicht?«, frage ich mühsam beherrscht. Haltet Frieden, hat Tanner uns eingeschärft. Mit Sicherheit hat er damit vor allem mich gemeint.
»Weil wir hier in einer feucht-kühlen Waschküche in Miami stehen, dem Lieblingsort von fiesen achtbeinigen Krabbeltieren und diversem anderen Kriechzeugs.«
Ich weiche zurück und unterdrücke ein Schaudern, als ich mir vorstelle, wie ich meine Hand unter der Maschine hervorziehe und als Zugabe zu dem Vierteldollar noch eine Schlange dazubekomme. Es gibt nur wenige Dinge, bei denen ich ausflippe. Kleine, hervortretende Augen und ein sich windender, schuppiger Körper zählen definitiv dazu. »Lustig. Wie ich gehört hab, treiben sich hier auch gern fiese Zweibeiner herum. Man nennt sie Perverslinge. Sollen eine echte Plage sein.« So wie ich hier in meinen kurzen schwarzen Shorts vornübergebeugt auf dem Boden knie, muss er eine nette Aussicht auf meinen Hintern haben. Nur zu, du widerlicher Mistkerl. Genieß es, das ist nämlich alles, was du kriegst. Und wenn ich auch nur den Hauch einer Berührung auf meiner Haut spüre, zertrümmere ich dir die Kniescheiben.
Er lacht leise. »Eins zu null für dich. Willst du nicht vielleicht langsam mal wieder hochkommen?« Seine Worte lösen ein Kribbeln in meinem Nacken aus. In seiner Stimme klingt ein unerwartet erregender Unterton mit. Ich höre ein Geräusch, das wie Metall auf Metall klingt, als er hinzufügt: »Dieser Perversling hat noch einen Vierteldollar übrig, den er dir geben könnte.«
»Tja, wenn das so ist, gehörst du zu den Perverslingen, die ich am liebsten …«, beginne ich und greife nach der oberen Kante der Waschmaschine, um mich daran hochzuziehen und diesem Idioten ins Gesicht zu schauen. Natürlich steht genau an der Stelle die offene Waschmittelflasche, die ich natürlich mit der Hand umstoße, worauf sich deren Inhalt natürlich über die halbe Maschine und den Boden ergießt.
»Mist!«, fluche ich und lasse mich wieder auf die Knie fallen, während das dickflüssige grüne Waschmittel in jede Ritze sickert. »Wenn Tanner das sieht, wirft er mich auf der Stelle raus.«
Die Stimme des Perverslings senkt sich zu einem Flüstern. »Wie viel wäre dir mein Schweigen wert?« Ich höre Schritte näher kommen.
Instinktiv nehme ich eine Position ein, aus der heraus ich ihm das Kniegelenk auskugeln und ihn Höllenqualen leiden lassen kann, genau wie ich es in meinem Sparring-Training gelernt habe. Ein Schauder läuft über meinen Rücken, als vor mir ein weißes Laken zu Boden sinkt. Mit angehaltenem Atem warte ich geduldig, bis er an mir vorbeitritt und links neben mir in die Hocke geht.
Das Nächste, was ich sehe, sind zwei tiefe Grübchen und die blauesten Augen, die mir je begegnet sind, mit einem kobaltfarbenen Ring um die hellblaue Iris. Ich blinzle. Sind das da in der Mitte türkisgrüne Sprenkel? Ja! Mein Gott! Der blaue Betonboden, die angerosteten alten Maschinen, die Wände – unter der Intensität seines Blicks löst sich alles um mich herum auf, meine aus Kratzbürstigkeit bestehende Schutzschicht zerbricht und wird mir mit einem Ruck vom Körper gerissen, sodass ich in Sekundenbruchteilen bloß und verletzlich vor ihm kauere.
»Hier. Mit dem Laken können wir alles aufwischen. Ich brauchte sowieso noch Waschmittel«, sagt er mit einem jungenhaften Grinsen, während er mit seinem Laken über den Boden wischt.
»Warte, du musst nicht …« Ich verstumme. Auf einmal tut es mir unglaublich leid, ihn als Perversling betitelt zu haben. Er kann kein Perversling sein. Er sieht viel zu gut aus und ist zu nett. Ich Idiotin werfe hier Vierteldollarmünzen durch die Gegend und er wischt mit seinem Laken mein verschüttetes Waschmittel vom dreckigen Boden auf!
Mein Sprachzentrum scheint blockiert zu sein. Jedenfalls bekomme ich keinen Ton heraus, während ich die muskulösen Unterarme von Typ-der-doch-kein-Perversling-ist anstarre und spüre, wie sich eine prickelnde Hitze in meinem Unterleib ausbreitet. Die hochgerollten Ärmel und geöffneten obersten Knöpfe seines Hemds lassen einen Hammeroberkörper erahnen.
»Gefällt dir, was du siehst?«, fragt er spöttisch. Ich lenke ertappt den Blick zu seinem grinsenden Gesicht zurück und spüre, wie mir das Blut in die Wangen schießt. Zur Hölle mit diesem Typen. Im einen Moment klingt er wie ein barmherziger Samariter, im nächsten wie ein durchtriebener Verführer. Aber das Schlimmste ist, dass er mich dabei erwischt hat, wie ich ihn regelrecht angegafft habe. Mich! Die keinen Blick an die durchtrainierten Körper verschwendet, die mir jeden Tag im Fitnessstudio begegnen. Aber gegen seinen scheine ich aus irgendeinem Grund nicht immun zu sein.
»Ich bin gerade erst eingezogen. 1D. Ich heiße Trent.« Er schaut unter unglaublich langen Wimpern zu mir auf, sein markant schönes Gesicht von zerzausten goldbraunen Haaren umrahmt.
»Kacey.« Ich räuspere mich. Das ist also der andere neue Mieter, unser Nachbar, der auf der anderen Seite unserer Wohnzimmerwand lebt …!
»Kacey«, wiederholt er. Ich liebe es, wie sein Mund sich bewegt, wenn er meinen Namen ausspricht. Diese Lippen. Mein Blick bleibt an ihnen und an seinen perfekten weißen Zähnen hängen, bis ich spüre, wie mein Gesicht unter einer weiteren Hitzewelle explodiert. Verdammt! Kacey Cleary wird wegen niemandem rot!
»Ich würde dir ja die Hand geben, Kacey, aber …« Trent hält grinsend seine waschmittelverschmierten Handflächen hoch.
Okay. Das war’s. Die Vorstellung, seine Hand zu berühren, ist wie eine Ohrfeige, die mich aus dem seltsamen Bann reißt, mit dem dieser Trent mich belegt hat, und mich in die Realität zurückkatapultiert.
Ich kann wieder klar denken. Tief durchatmend kämpfe ich darum, meine Schutzschilde zu reaktivieren und eine Barriere zwischen diesem fast schon überirdischen Wesen und mir zu errichten, damit nichts mehr in mir auf ihn reagieren und ich mein Leben weiterleben kann und erst gar nicht in irgendetwas verwickelt werde, das mit ihm zu tun hat. So ist alles viel einfacher. Und um mehr geht es hier auch nicht, Kacey. Es ist bloß eine Reaktion. Eine seltsame und untypische Reaktion auf einen Typen. Einen unfassbar sexy Typen, aber letztlich nichts, worauf du dich einlassen willst.
»Danke für den Vierteldollar«, sage ich kühl, richte mich auf, schiebe die Münze in den Schlitz und starte die Maschine.
»Das ist das Mindeste, was ich tun konnte, nachdem ich dir so einen Schreck eingejagt hab.« Er richtet sich ebenfalls auf und stopft seine Wäsche in die Maschine neben meiner. »Falls Tanner irgendwas merken sollte, nehme ich es auf meine Kappe. Ist ja wirklich zum Teil auch meine Schuld.«
»Zum Teil?«
Er schüttelt leise lachend den Kopf. Wir stehen jetzt so nah nebeneinander, dass unsere Schultern sich fast berühren. Zu nahe.
Ich trete ein paar Schritte zurück, um mehr Abstand zwischen uns zu kriegen. Es endet damit, dass ich seinen Rücken anstarre und bewundernd registriere, wie sich der Stoff seines blau karierten Hemds über seine breiten Schultern spannt und wie perfekt seine dunkelblaue Jeans sich an seinen Hintern schmiegt.
Er dreht den Kopf und sieht mich mit einem Ausdruck in den funkelnden Augen an, der Gedanken an Dinge in mir weckt, die ich an ihm, für ihn, mit ihm tun will … Ungeniert lässt er den Blick über meinen Körper wandern. Dieser Kerl ist ein wandelnder Widerspruch. In der einen Sekunde noch unglaublich süß, in der nächsten unverschämt frech. Ein überwältigend heißer Widerspruch.
In meinem Kopf schrillt ein Alarm los. Ich habe Livie versprochen, dass ein für alle Mal Schluss ist mit One-Night-Stands. Und dieses Versprechen habe ich gehalten. Seit zwei Jahren lasse ich sämtliche Typen links liegen. Und jetzt stehe ich am ersten Tag unseres neuen Lebens hier vor diesem Adonis und würde ihn am liebsten auf die Waschmaschine zerren und mich rittlings auf ihn setzen.
Auf einmal fühle ich mich extrem unwohl in meiner Haut. »Atme einfach, Kacey«, höre ich die Stimme meiner Mom im Kopf. »Zehn kleine Atemzüge …« Wie immer nützt mir ihr gut gemeinter Rat nichts, weil er keinen Sinn ergibt. Das Einzige, was Sinn ergibt, ist, die Flucht anzutreten, um dieser zweibeinigen Versuchung nicht in die Falle zu gehen. Und zwar sofort.
Rückwärts bewege ich mich zur Tür.
Ich will solche Gedanken nicht. Ich brauche sie nicht.
»Und du? In welchem …«
Ohne das Ende seines Satzes abzuwarten, drehe ich mich um und stürze die Treppe hoch, um mich in Sicherheit zu bringen. Ich hole erst wieder Luft, als ich oben angekommen bin, lehne mich an die Wand und schließe die Augen, heiße die Schutzschicht willkommen, die sich um mich schließt und wieder die Kontrolle über meinen Körper übernimmt.
ZWEI
Ein zischendes Geräusch …
Grelle Lichter …
Blut …
Wasser, das über meinem Kopf zusammenschlägt. Ich ertrinke.
»Kacey, wach auf!« Livies Stimme reißt mich aus der erdrückenden Dunkelheit zurück in mein Zimmer. Es ist drei Uhr morgens und ich bin schweißgebadet.
»Danke … Livie.«
»Kein Problem.« Sie legt sich neben mich. Livie ist meine Albträume gewöhnt. Es vergeht kaum eine Nacht ohne sie. Manchmal wache ich von allein auf. Manchmal wecken meine Schreie Livie. Und manchmal hyperventiliere ich und sie muss mir kaltes Wasser ins Gesicht spritzen, um mich zu wecken. Heute Nacht nicht.
Heute Nacht ist eine gute Nacht.
Ich bleibe still liegen, bis ich höre, dass ihr Atem ruhig und gleichmäßig geht, und danke Gott dafür, dass er sie mir nicht auch noch genommen hat. Alle anderen hat er sich geholt, aber Livie hat er mir gelassen. Ich stelle mir gern vor, dass er es war, der dafür gesorgt hat, dass sie an diesem Abend eine Grippe bekam und deswegen nicht zu meinem Rugbyspiel mitkommen konnte. Verstopfte Atemwege und eine laufende Nase haben sie gerettet.
Haben meinen einzigen Lichtstrahl gerettet.
Am Morgen stehe ich früh auf, um mich von Livie zu verabschieden, die heute ihren ersten Tag in der neuen Highschool hat. »Hast du den ganzen Papierkram eingepackt?«, frage ich. Ich habe sämtliche Formulare als ihr gesetzlicher Vormund unterschrieben und sie schwören lassen, bei der verabredeten Version zu bleiben, falls irgendjemand Fragen stellen sollte.
»Ich weiß nicht, ob …«
»Halte dich einfach an das, was wir besprochen haben, Livie, dann klappt das schon.« Ganz wohl ist mir dabei nicht, um ehrlich zu sein. Mich auf Livie zu verlassen, wenn es ums Lügen geht, ist ungefähr dasselbe, wie von einem Kartenhaus zu erwarten, einem Sturm standzuhalten. Livie würde nicht einmal dann lügen, wenn ihr Leben davon abhinge. Was in diesem Fall auf gewisse Weise zutrifft.
Sie schiebt sich den letzten Löffel Cheerios in den Mund, greift nach ihrer Schultasche und streicht sich ungefähr zum hundertsten Mal die Haare hinter die Ohren. Es ist eine ihrer vielen Gesten, die verraten, dass sie schrecklich nervös ist.
»Du schaffst das, Livie. Denk einfach immer daran, dass du sein kannst, wer du willst«, versuche ich ihr Mut zu machen und streiche ihr über den Arm, als sie sich zum Gehen wendet. Als wir damals zu Tante Darla und Onkel Raymond gezogen sind, habe ich die Aussicht auf eine neue Schule und neue Leute, die nichts über mich wussten, als winzigen Trost empfunden. Ich bin so naiv gewesen zu glauben, dass mir mitleidige Blicke erspart bleiben würden.
Aber Gerüchte verbreiten sich in Kleinstädten wie ein Lauffeuer, und schon bald fing ich an, die Mittagspause auf der Toilette zu verbringen oder die Schule ganz ausfallen zu lassen, um dem Getuschel aus dem Weg zu gehen. Doch jetzt sind wir Welten von Michigan entfernt. Wir haben eine echte Chance, noch einmal von vorn anzufangen.
An der Tür bleibt Livie stehen, dreht sich zu mir um und sieht mich stirnrunzelnd an. »Ich bin Olivia Cleary. Ich versuche nicht, jemand anderes zu sein.«
»Ich weiß. Damit will ich nur sagen, dass hier niemand etwas über unsere Vergangenheit weiß.« Das war eine weitere Bedingung, die ich gestellt habe – dass sie mit niemandem über unsere Vergangenheit sprechen wird.
»Wir sind nicht unsere Vergangenheit. Ich bin ich und du bist du, und das ist auch genau das, was wir sein müssen«, erinnert mich Livie, bevor sie geht, und ich weiß genau, was sie gerade denkt.
Ich bin nicht mehr Kacey Cleary. Ich bin eine leere Hülle, die zynische Witze macht und nichts fühlt. Ich bin ein Mädchen, das nur so tut, als wäre es noch Kacey.
Bei meiner Suche nach einem Apartment habe ich nicht nur darauf geachtet, dass es in der Nähe eine gute Schule für Livie gibt, sondern auch ein passendes Fitnessstudio für mich. Nämlich eines, in dem keine bleistiftdünnen Mädchen in stylisher Sportswear herumhüpfen und neben den Gewichten in ihr Handy plappern. Ich wollte einen Kampfsport-Club.
Und so bin ich auf The Breaking Point gestoßen.
Das Breaking Point hat ungefähr dieselbe Größe wie das O’Malleys in Michigan, weshalb ich mich sofort zu Hause fühle, als ich reinkomme. Die Beleuchtung ist gedämpft, es gibt einen Boxring und ein Dutzend von der Decke hängende Boxsäcke, die unterschiedlich groß und schwer sind. Die Luft ist durchdrungen vom vertrauten Geruch nach Schweiß und Aggression – dem Nebenprodukt einer Fünfzig-zu-eins-Frauenquote.
Ich atme tief ein und genieße das Gefühl der Sicherheit, das mich durchströmt. Als ich vor drei Jahren aus der Langzeit-Reha entlassen wurde – nach intensiven physiotherapeutischen Maßnahmen zur Reaktivierung meiner rechten Körperhälfte, die bei dem Unfall zerschmettert wurde –, meldete ich mich in einem Fitnessstudio an. Ich verbrachte täglich mehrere Stunden dort, stemmte Gewichte, machte Ausdauertraining. Übungen, die meinen geschundenen Körper stärkten, aber nichts für meine kaputte Seele taten.
Eines Tages sprach mich dort ein muskelbepackter Typ namens Jeff an, der mehr Piercings und Tattoos als ein abgehalfterter Rockstar hatte. »Du nimmst dich bei deinen Work-outs ganz schön hart ran«, sagte er. Ich nickte, ohne mich dafür zu interessieren, in welche Richtung die Unterhaltung gehen könnte. Bis er mir seine Karte reichte. »Kennst du das O’Malleys ein Stück die Straße runter? Ich unterrichte dort an ein paar Abenden die Woche Kickboxen.«
Wie sich wenig später herausstellte, war ich ein Naturtalent. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte ich mich zu seiner besten Schülerin, was wohl auch daran lag, dass ich sieben Tage die Woche trainierte. Das Kickboxen hat sich für mich als perfekter Bewältigungsmechanismus erwiesen. Bei diesem Sport kann ich jeden Kick und jeden Schlag als Ventil für meine Wut, meine Frustration und meinen Schmerz benutzen. Kann die ganzen unterdrückten Gefühle auf eine Art rauslassen, die nicht destruktiv ist.
Zum Glück gehört das Breaking Point zu den günstigeren Clubs, es gibt keine Aufnahmegebühren und man kann seinen Beitrag monatlich bezahlen. Ich habe genug für den ersten Monat zur Seite gelegt. Mir ist klar, dass ich das Geld lieber für Lebensmittel ausgeben sollte, aber ein Verzicht aufs Training ist für mich keine Option. Die Gesellschaft ist besser dran, wenn ich regelmäßig Dampf ablassen kann.
Nachdem ich mich angemeldet habe und kurz herumgeführt wurde, stelle ich meine Tasche neben einem freien Boxsack ab und spüre prüfende Blicke auf mir. Wer ist der kleine Rotschopf? Weiß sie nicht, was das hier für ein Club ist? Sie fragen sich, ob ich einen Hieb landen kann, der auch nur ansatzweise etwas taugt. Wahrscheinlich schließen sie schon Wetten darauf ab, wer es als Erstes schafft, mich unter der Dusche zu nehmen.
Sie können es ja mal versuchen.
Ich ignoriere die Blicke, die anzüglichen Kommentare und das spöttische Grinsen, während ich mich dehne, damit ich mir nach den drei Tagen ohne Training nichts zerre, und lächle dabei still in mich hinein. Großspurige Vollidioten.
Nachdem ich ein paarmal tief durchgeatmet habe, konzentriere ich mich auf den Boxsack, dieses gütige Etwas, das all meinen Schmerz, Kummer und Hass widerspruchslos absorbieren wird.
Und dann lasse ich alles raus.
Die Sonne ist noch nicht einmal aufgegangen, als grauenhafte Altherren-Metal-Gitarrenriffs durch mein Zimmer dröhnen. Ich schaue auf meinen Wecker. Yep.6:00 Uhr. Pünktlich auf die Minute. Das ist jetzt schon der dritte Tag in Folge, dass ich von diesem unerträglichen Krach geweckt werde. »Haltet Frieden«, brumme ich Tanners mahnende Worte vor mich hin und ziehe mir die Decke über den Kopf. Schätze, dazu gehört, nicht die Tür meines Nachbarn einzutreten und seine Boxen gegen die Wand zu schmettern.
Was nicht heißt, dass ich keine Gegenmaßnahmen ergreifen kann.
Ich taste nach meinem iPod – einem der wenigen Dinge, die ich außer Klamotten bei unserer eiligen Flucht eingepackt habe – und scrolle durch die Playlist. Na bitte. Hannah Montana. Vor ein paar Jahren hat meine beste Freundin Jenny mir diesen furchtbaren Kleinmädchen-Pop mal aus Scherz heruntergeladen. Scheint, als würde das Album schließlich doch noch für was gut sein. Ich schiebe den Schmerz weg, der mit den damit verbundenen Erinnerungen in mir hochsteigt, drücke auf Play und drehe die Lautstärke auf Maximum. Die verzerrten Bässe prallen von den Wänden meines kleinen Zimmers ab. Möglicherweise wird der Lautsprecher das nicht überleben, aber das ist es mir wert.
Dann fange ich an zu tanzen.
Ich springe wie eine Verrückte durchs Zimmer, schwenke die Arme durch die Luft und hoffe, dass die Person nebenan Hannah Montana genauso sehr hasst wie ich.
»Was machst du denn da?«, ruft Livie, die in zerknautschtem Pyjama und mit strubbeligen Haaren ins Zimmer gestürmt kommt und zu meinem iPod hechtet, um ihn auszuschalten.
»Ich erteile unserem Nachbarn bloß eine Lektion. Dafür, dass dieser Idiot mich schon wieder mit seiner Schrottmusik geweckt hat.«
Sie runzelt die Stirn. »Du weißt, wer nebenan wohnt? Und woher weißt du, dass es ein Typ ist?«
»Weil eine Frau niemals so einen Scheiß hören würde, schon gar nicht um sechs Uhr morgens.«
»Oh. Davon hab ich in meinem Zimmer gar nichts mitbekommen.« Sie mustert einen Moment stirnrunzelnd die an die Nachbarwohnung grenzende Wand. »Das ist ja grauenhaft.«
Ich ziehe eine Braue hoch. »Sag ich doch. Vor allem, nachdem ich gestern Nacht bis elf Uhr gearbeitet hab!« Meine erste Schicht in einem Starbucks in der Nachbarschaft. Der Laden hat verzweifelt jemanden gesucht und dank meines ehemaligen Chefs – eines vierundzwanzigjährigen Muttersöhnchens namens Jake mit einer Schwäche für den hart gesottenen Rotschopf – konnte ich ein erstklassiges Zeugnis vorlegen. Ich hatte mich klugerweise ihm gegenüber immer von meiner besten Seite gezeigt. Das hat sich ausgezahlt.
Nach kurzem Zögern zuckt Livie mit den Achseln, ruft: »Paaartyyyy!« und stellt den iPod wieder auf volle Lautstärke.
Wir hüpfen zu zweit durch mein Zimmer, bis wir irgendwann vor Kichern kaum noch Luft bekommen und jemand laut an unsere Tür klopft.
Livie wird blass. Sie kann zwar bellen, beißt aber nie zu. Ich werfe mir entspannt meinen zerschlissenen violetten Morgenmantel über und marschiere angriffslustig zur Tür. Wollen wir doch mal sehen, was er zu sagen hat.
»Warte!«, zischt Livie, als ich nach der Türklinke greife.
Fragend drehe ich mich um und sehe, wie sie den erhobenen Zeigefinger wackelt, genau wie unsere Mutter es früher getan hat, wenn sie ein Hühnchen mit uns zu rupfen hatte. »Du hast es versprochen, schon vergessen? Das war der Deal. Wir fangen hier von vorn an? Neues Leben? Neue Kacey?«
»Ja, klar. Und weiter?«
»Könntest du bitte versuchen, dich nicht wie eine Eiskönigin aufzuführen und mehr wie die Vorher-Kacey zu sein? Du weißt schon, die Kacey, die sich nicht jedes Mal in eine Betonmauer verwandelt, wenn jemand versucht, ihr näherzukommen? Ich meine, wer weiß? Vielleicht können wir uns ja mit dem einen oder anderen hier im Haus anfreunden. Versuch es doch wenigstens.«
»Du willst dich mit alten Knackern anfreunden?«, entgegne ich. »Wenn das so ist, hätten wir auch zu Hause bleiben können.« Aber ihre Worte treffen mich wie eine spitze Nadel direkt ins Herz. Bei jedem anderen wären sie an meiner teflonbeschichteten Außenfassade abgeperlt. Das Problem ist, dass ich nicht mehr weiß, wer die Vorher-Kacey war. Ich erinnere mich nicht an sie. Ich kenne sie nur vom Hörensagen. Wenn sie lachte, sollen ihre Augen geleuchtet haben. Wenn sie auf dem Klavier ›Stairway to Heaven‹ spielte, soll ihr Dad feuchte Augen bekommen haben. Sie soll viele Freunde gehabt haben, die sie gern umarmte, und angeblich hat sie ständig mit ihrem Freund Händchen gehalten.
Die Vorher-Kacey ist vor vier Jahren gestorben, übrig geblieben ist nichts als ein menschlicher Scherbenhaufen. Ein Scherbenhaufen, der ein Jahr lang in der Reha verbrachte, bis der gebrochene Körper repariert war, der dann mit einer gebrochenen Seele entlassen wurde. Ein Scherbenhaufen, dessen Noten in den Keller fielen. Der für ein Jahr in eine Welt aus Drogen und Alkohol abdriftete. Die Nachher-Kacey weint nicht, sie vergießt keine einzige Träne. Ich glaube, sie weißt gar nicht, wie das geht. Sie ist verschlossen; sie erträgt es nicht, irgendwelche Hände anzufassen, weil ihre Berührung sie an den Tod erinnert. Sie lässt niemanden an sich heran, weil der Schmerz ihr überallhin folgt. Der Anblick eines Klaviers versetzt sie in taumelnde Benommenheit. Den einzigen Trost findet sie darin, aus riesigen Sandsäcken die Scheiße herauszuprügeln, bis ihre Knöchel rot und ihre Füße wund sind und ihr Körper – zusammengehalten von zahlreichen Metallstangen und Schrauben – sich anfühlt, als würde er sich auflösen. Die Nachher-Kacey ist mir vertraut. Ich bin mir sicher, dass ich sie für den Rest meines Lebens nicht mehr loswerde.
Aber Livie erinnert sich noch an die Vorher-Kacey, und Livie zuliebe versuche ich, mein Bestes zu geben. Ich zwinge meine Mundwinkel zu einem Lächeln. Es fühlt sich seltsam und fremd an, und Livies Gesichtsausdruck nach zu urteilen, wirkt es wohl eher wie das Zähnefletschen eines Kettenhundes. »Okay«, seufze ich, drehe mich wieder zur Tür und lege erneut die Hand auf die Klinke.
»Warte!«
»Gott, Livie!«, stöhne ich. »Was denn noch?«
»Hier.« Sie reicht mir ihren schwarz gepunkteten rosa Regenschirm. »Für den Fall, dass es ein Serienmörder ist.«
Ich muss lachen. Ein Geräusch, das mir seltsam fremd ist, weil ich es nicht oft von mir gebe, aber es kommt von Herzen. »Und was soll ich damit anfangen? Ihn piksen?«
Sie zuckte mit den Achseln. »Besser, als ihn windelweich zu prügeln, wie es dir am liebsten wäre.«
»Okay, okay. Vielleicht schauen wir erst mal, mit wem wir es überhaupt zu tun haben.« Ich beuge mich zum Fenster neben der Tür, schiebe den dünnen Vorhang zur Seite und halte nach einem ergrauten Mann in einem zu kleinen, ausgewaschenen T-Shirt und schwarzen Socken Ausschau. Ein winziger Teil von mir fragt sich plötzlich, ob es vielleicht dieser Trent aus der Waschküche ist. Seine funkelnden Augen haben sich in den letzten Tagen mehrmals ungebeten in meine Gedanken geschlichen, aus denen ich sie nur unter größter Anstrengung wieder vertreiben konnte. Einmal habe ich mich sogar dabei erwischt, wie ich total psychomäßig auf die Wand zwischen unseren Apartments gestarrt und überlegt habe, was er wohl gerade macht. Aber die Musik kommt von der anderen Seite, also kann er es eigentlich nicht sein.
Stattdessen schwingt vor unserer Tür ein seidiger weizenblonder Pferdeschwanz hin und her. »Im Ernst jetzt?«, murmle ich und mache die Tür auf.
Vor mir steht Barbie. Kein Scherz. Eine lebensechte, ein Meter achtzig große, durchtrainierte blonde Sexbombe mit vollen Lippen und riesigen lavendelblauen Augen. Sprachlos lasse ich ihre winzigen Baumwollshorts auf mich wirken und bestaune das Playboy-Logo auf ihrem Tanktop, das sich über ein beachtliches Paar Brüste spannt. Gott, die Dinger sind so groß wie Heißluftballons. Die sind definitiv nicht echt.
Eine weiche Stimme, die mit gedehntem Südstaatenakzent spricht, reißt mich aus meiner Trance. »Hi, ich bin Nora Matthews von nebenan. Aber alle nennen mich Storm.«
Storm? Storm von nebenan mit Medizinbällen anstelle von Brüsten?