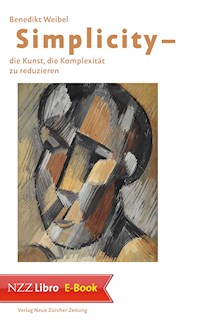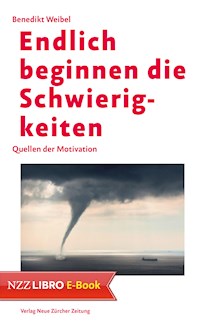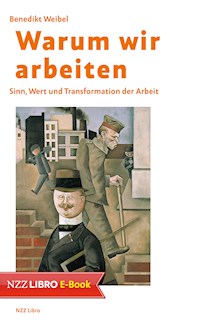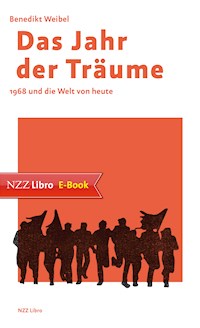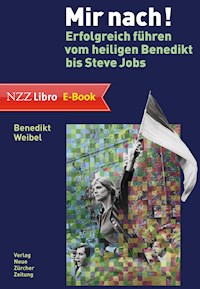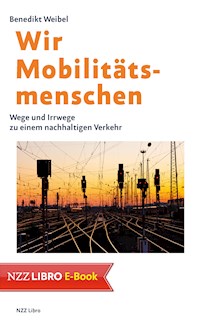
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Mobilität ist Freiheit; Mobilität ist Grundbedingung für den Wohlstand; Mobilität nimmt permanent zu; Mobilität verursacht einen Viertel des globalen CO2-Ausstosses – kurz: die Bewältigung künftiger Mobilitätsströme ist eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit. Benedikt Weibel – selber seit 43 Jahren an zentralen Stellen im Mobilitätsgeschäft tätig – leuchtet in 37 Reflexionen sämtliche Dimensionen der Mobilität aus. Daraus lassen sich die Konturen einer Verkehrswende ableiten, welche die Mobilität von Menschen und Gütern sichert und zugleich das unumgängliche langfristige Ziel erreicht: Den Verkehr von fossilen Treibstoffen zu befreien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benedikt Weibel
WirMobilitäts-menschen
Wege und Irrwege zu einem nachhaltigen Verkehr
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2021 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2020 (ISBN 978-3-907291-56-6)
Lektorat: Sigrid Weber, Freiburg i. Br.
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-907291-57-3
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Inhalt
1. Vom Wert der Mobilität
Raum und Zeit
Freiheit
Wohlstand
2. Der Mensch als mobiles Wesen
Mobilitätsentscheidungen
Diktat der Rolle
3. Institutionelle Voraussetzungen
Infrastruktur
Verkehrsinfrastrukturen
Grundversorgung
Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung
4. Blick zurück: Entwicklungen und gescheiterte Träume
Innovationen
Gescheiterte Innovationen
5. Was auf uns zukommt
Megatrends
Zwei Probleme
6. Kriterien für eine nachhaltige Mobilität
Durchsatz, Flächeneffizienz, Energieeffizienz, Emissionen
Wesensgerechter Verkehr
7. Transformationen
Technologische Entwicklungen
Geschäftsmodelle und Strategien
Visionen
Digitalisierung
Gefäßgröße
8. Güter und enge Räume
Güterverkehr
Brennpunkt Stadt
9. Mobilitätsformen unter der Lupe
Per pedes
Schiff
Eisenbahn
Fahrrad, Velo, Rad
Auto
Omnibus, Autobus, Bus, Car, Oberleitungsbus, Trolleybus
Flugzeug
Mikromobilität
Transportkette, Intermodalität, kombinierter Verkehr
10. Wie die Zukunft zu meistern ist
Monetäre Steuerung
Krisen
Ambition
Ziele und Aktionsfelder
Werkzeuge
Verkehrswende
Dank
Abkürzungsverzeichnis
Anmerkungen
1. Vom Wert der Mobilität
Raum und Zeit bestimmen unseren Blick auf die Welt. Die Bewegung von Menschen und Dingen in Raum und Zeit nennen wir Mobilität.
Raum und Zeit
Eine Bewegung ist bestimmt durch den Ausgangspunkt, das Ziel und die Verschiebungsgeschwindigkeit. Verkehrsplaner erfassen das Mobilitätsmuster in einer Darstellung, die sie OD-Matrix nennen. O steht für «origin», D für «destination». Mit der OD-Matrix wird die Vergangenheit erfasst und die Zukunft modelliert.
In der frühen Geschichte der Zivilisation wurde das Mobilitätsmuster durch die Ganggeschwindigkeit des Menschen und die Geschwindigkeit von Wasserfahrzeugen bestimmt. Als 3000 v. Chr. das Wildpferd domestiziert wurde, stieg die durchschnittliche Verschiebungsgeschwindigkeit von pferdeunterstützten Landtransporten auf 15 km/h und erreichte damit etwa die der Schifffahrt. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts blieb diese Geschwindigkeit konstant. 1822 dauerte eine Fahrt mit der Postkutsche von Frankfurt am Main nach Stuttgart 25 Stunden. Pferde- und Personalwechsel drückten die Durchschnittsgeschwindigkeit auf 8 km/h.1
Mit der Erfindung des Segels begann die Geschichte der Seefahrt, die die OD-Matrix fundamental veränderte. Als erste Seefahrer gelten Mitte des 4. Jahrtausend v. Chr. die Ägypter. 1000Jahre später wurde ein reger Handel mit der Levanteküste betrieben. Um 1000 v. Chr. hatten die Phönizier ein maritimes Handelsimperium ausgebaut. Sie segelten bis zur Straße von Gibraltar und hinaus auf den Atlantik. In der klassischen Antike waren das ganze Mittelmeer und das Schwarze Meer «umfassend merkantil vernetzt».2 Die Römer stießen bis nach Britannien vor. Gegen Ende des 1. Jahrtausends entwickelten die Wikinger besonders schnelle, mit Riemen und Segeln angetriebene Langschiffe, mit denen sie auch mit relativ hoher Geschwindigkeit Flüsse hochfahren konnten. Sie waren die ersten Seefahrer, die den Mut hatten, ins offene Meer hinauszufahren und entdeckten auf diese Weise Island, Grönland und Neufundland. Neue Horizonte wurden von Vasco da Gama mit der Umfahrung von Afrika nach Indien, Christoph Kolumbus mit der Fahrt nach Bahamas und Fernando de Magallanes mit der Weltumsegelung erschlossen. Die OD-Matrix war weltumspannend geworden.
Mitte des 18. Jahrhunderts wurden erstmals in der Geschichte Bewegungen im Raum großflächig koordiniert. Das Instrument dazu war der von der Post entwickelte «Fahr-Plan». Damit entstand für den Transport von Briefen, Reisenden und Waren ein neues Geschäftsmodell, die «konsequente Berechenbarkeit und Planbarkeit …, also eine überregionale Ordnungsstruktur von Raum und Zeit …»3 In ganz Europa wurden befestigte Straßen gebaut. Es entwickelte sich ein Transportsystem mit Straßen und Stationen, Karten und Wegweisern, das den europäischen Raum systematisch erschloss.
Die OD-Matrix im Landverkehr, bis dahin ein Flickenteppich vorwiegend lokaler Bewegungen, ließ erstmals seit der Römerzeit eine überregionale Struktur erkennen.
1825 trat die Eisenbahn auf die Weltbühne und löste erst einmal einen Schock aus. Die neuen Sinneseindrücke müssen überwältigend gewesen sein. Zunächst versuchte man, das Neue mit vertrauten Begriffen zu umschreiben. Die Lokomotive war das Dampfross, das fauchend, pfeifend und lärmend mit nie gesehener Geschwindigkeit dahinbrauste und die Postschnecke uralt aussehen ließ. Heinrich Heine beschrieb den «schauerlichen Reiz» des Unbekannten: «… ein unheimliches Grauen, wie wir es immer empfinden, wenn das Ungeheure geschieht, dessen Folgen unabsehbar und unberechenbar sind. … Die Eisenbahnen sind wieder solch ein providentielles Ereignis, das der Menschheit einen neuen Umschwung gibt, das Farbe und Gestalt des Lebens verändert; es beginnt ein neuer Abschnitt in der Weltgeschichte. … Sogar die Elementarbegriffe von Raum und Zeit sind schwankend geworden. Durch die Eisenbahn wird der Raum getötet, und es bleibt nur noch die Zeit übrig.»4
Euphorie vermischte sich mit Angst. Die einen verstanden, dass es nicht nur um die Zukunft des Verkehrs ging, sondern um die Zukunft der Gesellschaft. Für sie war die Eisenbahn eine Chance, die man resolut ergreifen musste. Die anderen warnten vor geistiger Unruhe nach Bahnfahrten, vor Delirium furiosum, Gehirnschäden, nicht nur bei den Passagieren, sondern auch bei den am Bahndamm winkenden Zuschauern. Der Romantiker Josef von Eichendorf beklagte, «diese Dampffahrten rütteln die Welt, die eigentlich nur noch aus Bahnhöfen besteht, unermüdlich durcheinander wie ein Kaleidoskop, wo die vorüberjagenden Landschaften, ehe man irgendeine Physiognomie erfasst, immer neue Gesichter schneiden».5
Die Visionäre setzten sich durch. 1850 betrug die Länge der weltweiten Bahnnetze bereits 39000 Kilometer, davon 14000 in den USA, 10000 in Großbritannien, 6000 in Deutschland, 3000 in Frankreich und 25 Kilometer in der Schweiz. Die Eisenbahn war ein Produkt der sich zur selben Zeit ausbreitenden Industrialisierung und ermöglichte zugleich erst deren Durchbruch, weil die Transportkosten radikal gesenkt werden konnten. Die Bahnhöfe wurden zu Kathedralen des Industriezeitalters, mit monumentaler Architektur in die Zentren der Städte gesetzt. Waren sie eher peripher gelegen, bewegte sich das Zentrum hin zum Bahnhof. Auf die Spitze getrieben wurde die Bahnhofsarchitektur in Antwerpen, wo die Haupthalle die Aura eines prunkvollen Opernhauses hat.
Die Bahnhöfe wurden zu Ziel- und Kreuzungspunkten im Bahnnetz, wo sich Menschenmassen in noch nie erlebter Art verdichten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich die OD-Matrix vieler Räume auf der Welt fundamental verändert. Die Strecken des Bahnnetzes waren zu den Arterien des Bewegungsmusters geworden. Der durchschnittliche Abstand zwischen O und D hatte sich vervielfacht, ebenso die Anzahl Bewegungen.
Das Fahrrad hat auf dieser OD-Matrix keine nachhaltigen Spuren hinterlassen. Aber gegen Ende des Jahrhunderts öffnete es die Tür zu einer individuell steuerbaren Mobilität. Gegenüber dem Fußmarsch vergrößerte sich der Bewegungsradius erheblich. Das Velo war erschwinglich und wurde zum ersten individuellen Transportmittel breiter Schichten.
Gleichzeitig und einige Erkenntnisse aus dem Fahrradbau übernehmend tüftelten findige Geister an einem Gefährt, für das es noch keinen Namen gab. Der bekannteste unter ihnen war Henry Ford. 1875, er war zwölf Jahre alt, begegnete er das erste Mal in seinem Leben einem nicht von Pferden gezogenen Fahrzeug, einer Lokomobile. Es bestand «aus einer primitiven fahrbaren Maschine mit Kessel und einem hinten angekoppelten Wassertank und Kohlekarren».6 Wenig später hieß das Ding Automobil, und bereits 1906 exponierte sich die deutsche Allgemeine Automobil-Zeitung mit einer gewagten Vorhersage: «Das Auto, es will dem Menschen die Herrschaft über Raum und Zeit erobern.»7 Dafür sorgte vor allem Henry Ford, der ein «Auto für alle» bauen wollte, was zu dieser Zeit eine unerhört kühne Vorstellung war. Er wusste, dass das nur gelingen konnte, wenn das Auto möglichst billig war und die Menschen so viel verdienten, dass sie das Auto erwerben konnten. 1908 kam das Modell Ford T auf den Markt. Im ersten Geschäftsjahr wurden 18664 Fahrzeuge verkauft, im Geschäftsjahr 1920/21 waren es 1250000.8 Der Ford T veränderte die USA von Grund auf: 1922 entstand das erste Einkaufszentrum auf der grünen Wiese, 1923 die erste Stadtautobahn. 1927 besaß bereits jeder fünfte Einwohner ein Auto (in Deutschland betrug das Verhältnis noch 1:196).9
Das Auto wurde zum magischen Objekt des 20. Jahrhunderts und das 20. Jahrhundert zum Jahrhundert des Autos. Es erfüllte den Traum von der unbegrenzten Mobilität und wurde zum «bewegten Ich», zum «mobilen Zuhause». Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre setzten bereits 1938 klare Prioritäten: «Bald würde unser Einkommen zur Anschaffung eines Autos genügen. Meiner Meinung nach war es unsinnig, sein Geld für eine Wohnungseinrichtung auszugeben, statt ein Auto zu kaufen … Wie unabhängig wären wir dann auf unseren Reisen.»10 Im Gefolge des Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit wurde der Mittelklassewagen zum vorrangigen Konsumziel und zum Statussymbol des Mittelstands, später auch der Arbeiterschaft.
Die boomende Automobilisierung veränderte den Raum von Grund auf. Straßen, Autobahnen, Ampeln, Parkplätze, Tankstellen und an der Peripherie der Städte gelegene Einkaufszentren gaben Land und Städten eine neue Struktur. Mit dem Auto begann die Zersiedelung der Landschaft, die sich nach einem einfachen Muster abspielte: Je schlechter ein Ort an den öffentlichen Verkehr angebunden war, desto niedriger der Landpreis, desto eher konnte man sich ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung leisten. Dafür brauchte man zwingend ein Auto, und das automobile Pendeln zur Arbeit wurde zur Norm. Spätestens wenn die Kinder in der Stadt in eine höhere Schule gingen, wurde die Forderung nach einer Busverbindung laut, die dann die Allgemeinheit zu bezahlen hatte.
Der Raum verengte sich, auf dem Land und in den Städten. Die Zeit wurde knapper, die Lebenswelten verdichteten sich. Immer mehr Menschen fuhren Auto. Ausdruck dafür wurde der Stau auf den Straßen. Der Begriff «Verkehrsinfarkt» tauchte auf, später gesellte sich der «Dichtestress» dazu. Die OD-Matrix hat die klaren Strukturen des 19. Jahrhunderts verloren.
Die individuellen Bewegungen und die durchschnittlichen zurückgelegten Distanzen sind enorm gestiegen, nicht nur zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, immer mehr auch im Freizeitverkehr.
Schließlich komplettierte das Flugzeug die Palette der Verkehrsmittel. Mit dem Luftraum eroberte es eine neue Dimension und öffnete so die letzten Räume des Planeten für ein Massenpublikum. Höhere Einkommen und reduzierte Arbeitszeiten stimulierten den Freizeitverkehr, vor allem auf der Straße, immer mehr in der Luft, in jüngster Zeit auch auf gigantischen Schiffen. Der anhaltende Boom erzeugte ein neues Phänomen: den Overtourism – eine Masse von Besucherinnen und Besuchern touristischer Destinationen, die von der einheimischen Bevölkerung zunehmend als Belastung wahrgenommen wird.
Hätte man seit Beginn der Zivilisationsgeschichte OD-Matrizes erstellt, so wäre ihr gemeinsamer Nenner ein unaufhörliches Ansteigen der Mobilität gewesen. Im März 2020 hat das Covid 19-Virus diesen Trend abrupt und weltweit gebrochen. Innerhalb weniger Wochen reduzierte sich nicht nur die Zahl der Bewegungen drastisch, auch die durchschnittlich zurückgelegte Distanz verringerte sich auf einen Bruchteil. Als die Restriktionen gelockert wurden, erreichte der Autoverkehr wieder sein ursprüngliches Ausmaß, während die Belegung des öffentlichen Verkehrs unter dem gewohnten Niveau blieb. Zusammengebrochen ist der Luftverkehr. Über die längerfristigen Auswirkungen dieser Zäsur wird heftig spekuliert.
Freiheit
Als vor über 10000 Jahren die Menschen allmählich sesshaft wurden, begann das Zeitalter der Zivilisation. Aber nicht alle Menschen wurden sesshaft. Bis heute hat sich nomadisches Leben erhalten und mit ihm der Konflikt mit den Sesshaften, denen die Nomaden noch heute mit einer gewissen Verachtung vorwerfen, ihre Freiheit gegen Sicherheit verschachert zu haben. Besonders ausgeprägt war dieser urtümliche Freiheitsdrang zur Zeit der Pioniere im Wilden Westen Amerikas. Bis heute prägt eine «unzerstörbare Idee von Freiheit» die amerikanische Psyche. Ihr Symbol ist der Highway durch die endlosen Prärien der USA.11 Ihr Archetyp der Trucker. Die Songzeile «Freedom’s just another word for nothing left to lose» ihre Botschaft. «Secure the Blessings of Liberty» steht seit 1787 unverrückbar in der Verfassung der Vereinigten Staaten. Zwei Jahre später wurde Europa mit Liberté, Egalité, Fraternité, den Losungsworten der Französischen Revolution, aus dem Zeitalter des Feudalismus herausgerissen.
Seither ist Freiheit das Schlüsselwort in den Verfassungen freiheitlich demokratischer Staaten. Sie steht als allgemeiner Begriff in ihren Präambeln und wird in unzähligen Ausprägungen präzisiert. So benennt die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft nicht weniger als elf Freiheiten: Glaubens- und Gewissensfreiheit, Meinungs- und Informationsfreiheit, Medienfreiheit, Sprachenfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Kunstfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Niederlassungsfreiheit, Wirtschaftsfreiheit, Koalitionsfreiheit. Erstaunlicherweise fehlt in dieser Liste die am ursprünglichsten mit der Idee der Freiheit verknüpfte Bewegungsfreiheit. Lediglich der Freiheitsentzug ist Gegenstand der Verfassung. Steht der Highway als Symbol für die Freiheit, so ist das Gefängnis, das die Mobilität auf wenige Schritte beschränkt, sein Gegenpol.
Dass die Bewegungsfreiheit in Verfassungen und Gesetzen nicht explizit aufgeführt wird, ist nur damit zu erklären, dass sie zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Trotzdem: Wenn man die Menschen nach der Bedeutung all dieser Teilfreiheiten fragte, so würde die Bewegungsfreiheit sicherlich an die erste Stelle gesetzt. Die DDR wurde von den meisten ihrer Bürgerinnen und Bürger als Gefängnis empfunden, weil die Reisefreiheit eingeschränkt war. Als die Mauer fiel, war die Freude über die (wieder) erlangte Bewegungsfreiheit grenzenlos. 50 Jahre nach der Wiedervereinigung zieht der in der DDR aufgewachsene Schriftsteller Peter Kolbe ein Fazit: «Was ist denn dabei, einfach aufzubrechen wohin ich will? Oder dabei, dies an dem Ort, wo ich bin, vorauszusetzen als den elementarsten, allerersten und unbedingten Begriff von Freiheit?»12
Zu Beginn der Zivilisation existierte das Wort Freiheit noch nicht, wohl aber ein diffuses Freiheitsgefühl, das eng mit Mobilität verbunden war. Und das ist bis heute so geblieben. Die junge Simone de Beauvoir beschrieb dieses Lebensgefühl vor fast 100 Jahren: «Reisen, das war immer einer meiner bemerkenswertesten Wünsche gewesen. Begierig genoss ich diese neue Freiheit.»13 Das Auto eröffnete eine völlig neue Dimension der Mobilität. Es war jederzeit verfügbar, hatte eine große Reichweite und bot eine gewisse Intimität. Für die Nachkriegsjugend in Europa eröffnete zunächst das Trampen neue Möglichkeiten der Freizeitmobilität. Der große Schritt folgte dann mit dem ersten eigenen Auto. Ob gebrauchter VW Käfer oder 2CV, es war die Freiheit schlechthin: einsteigen und nach Sainte-Marie-de-la-Mer fahren.
Die uneingeschränkte Mobilität ist längst zu einem Wesensmerkmal des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats geworden. Die freie Verkehrsmittelwahl zu ihrem Dogma. «Freie Fahrt für freie Bürger» ihr Slogan. Einen ersten Riss erhielt das Konzept der uneingeschränkten Mobilität während der Erdölkrise 1973. Zehn Jahre später schreckte das vermutete Waldsterben auf und die Emissionen des Straßenverkehrs wurden zu einem prioritären politischen Thema.
Anfang der 1990er-Jahre wurde der Verkehrsinfarkt als akute Bedrohung wahrgenommen. Trotz aller düsteren Prognosen und der unablässigen Zunahme der Staustunden hat er sich bemerkenswerterweise bis heute nicht ereignet – obwohl sich die Anzahl Autos massiv erhöht hat, die Autos größer geworden sind und die durchschnittliche Belegung abgenommen hat und obwohl die Anforderungen an die geografische Flexibilität der Arbeitnehmenden permanent zugenommen haben und damit die Pendlerströme.
Seitdem sich jedoch immer klarer abzeichnet, mit welcher Dynamik sich die Temperaturen auf dem Globus erhöhen, steht die weltweite Mobilität im Fokus. Rund ein Viertel des globalen CO2-Ausstoßes wird durch den Verkehr verursacht und deshalb, so die vorherrschende Meinung, sind die Klimaziele ohne eine «Verkehrswende» nicht zu erreichen. Die Klimajugend verlangt gebieterisch nach griffigen Maßnahmen, während die bürgerliche Politik zur Besonnenheit rät und vor den bösen Worten «Verzicht» und «staatlichen Zwangsmaßnahmen» warnt, weil damit eine massive Einschränkung unserer Freiheit einherginge. Mit erhobenem Zeigfinger werden wir gemahnt: «Radikalismus löst keine Probleme.» Tiefgreifende staatliche Eingriffe seien äußerst problematisch, weil das Auto für viele immer noch für Freiheit stehe.
Anfang 2020 geriet die weltweite OD-Matrix wie nie zuvor aus den Fugen. Ein Virus, das sich entgegen allen Erwartungen nicht bloß in Asien festsetzte, veränderte unser Leben. Plötzlich war Verzicht nicht mehr unzumutbar, sondern eine Tugend. Nach den rigorosen Maßnahmen der europäischen Länder zur Eindämmung des Coronavirus dezimierte sich der Pendlerverkehr in den europäischen Städten um 50 Prozent. Das Angebot im öffentlichen Verkehr wurde ausgedünnt, seine Belegung sank drastisch. Sogar die bis dato so sakrosankte freie Verkehrsmittelwahl wurde geopfert, indem man den Menschen nahelegte, öffentliche Verkehrsmittel zu meiden. Der Freizeitverkehr war weitgehend verschwunden. Niemand reiste mehr ins Ausland. Flugzeuge wurden gegroundet. Die Menschen waren aufgerufen, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. «Radikalismus löst Probleme» war die Losung. Nie hat sich das Jean Paul zugeschriebene Wort mehr bestätigt als in diesen schwierigen Zeiten: «Freiheit ist ein Gut, dessen Dasein weniger Vergnügen bringt als seine Abwesenheit Schmerzen.»
Nachdem die rigorosen Maßnahmen gelockert wurden, war die Harmonie vorbei. Der öffentliche Verkehr erholte sich wieder, aber auf markant niedrigerem Niveau. Anders der Autoverkehr: Obwohl der arbeitsbedingte Pendlerverkehr infolge anhaltender Arbeit im Homeoffice schwächer war, entwickelte sich der Autoverkehr vielerorts stärker als in den Vorjahresmonaten. Im Oktober 2020 wies der TomTom Traffic Index in 239 von 416 Städten einen stärkeren Autoverkehr aus als im Vorjahr. In 57 Städten war er geringer. Über das ganze Coronajahr 2020 hat sich der Congestion Index kaum verringert.
Bewegungsfreiheit ist ein Gut, das wir nicht hoch genug schätzen können. Aber auch sie hat Grenzen, nämlich dann, wenn es um Leben und Tod geht oder wenn sie die Grundlage des Lebens auf diesem Planeten bedroht. «Freiheit ohne Autorität ist Chaos, Autorität ohne Freiheit ist Tyrannei.»14 Stefan Zweig zeigt das Kontinuum auf, in dem sich Freiheit jederzeit befindet. Die Zeiten der uneingeschränkten Mobilität sind vorbei. Die Aufgabe ist klar: Es gilt die Grenzen der Mobilität so klug zu ziehen, dass sich der Mensch auch in Zukunft über seine Bewegungsfreiheit freuen kann.
Wohlstand
Was wir heute Wirtschaft nennen, wurde im Wesentlichen von vier Zäsuren geprägt.
Im Spätmittelalter ermöglichten drei fundamentale technische Innovationen die Verbreitung von Wissen und die europäischen Entdeckungsfahrten: der Buchdruck, neue Schiffstypen und Feuerwaffen. Sie ermöglichten den sich rasch ausbreitenden Handel mit Rohstoffen und Gewürzen, zunächst auf dem Wasser transportiert. Die Landwege, seit dem Untergang des Römischen Reichs zerfallen, wurden mühsam neu erstellt. Der möglichst effiziente Transport von Gütern wurde zur zwingenden Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung.
Die zweite Zäsur war die Industrialisierung. Auch sie wurde durch eine Serie herausragender Erfindungen und darauf aufbauenden technischen Innovationen ausgelöst. Der schottische Erfinder James Watt verbesserte 1769 den Wirkungsgrad der Dampfmaschine, sodass sie wesentlich energiesparender und kostengünstiger wurde. Dadurch konnte Handarbeit in großem Stil durch die Maschine ersetzt werden. Für ihren Antrieb benötigten Dampfmaschinen Energie, und zwar in Form von Kohle. Schon seit dem 16. Jahrhundert wurde Kohle in Europa gefördert, mit dem immer stärker werdenden Einsatz der Dampfmaschine steigerte sich der Bedarf nach diesem Energieträger so stark, dass das 19. Jahrhundert auch als «Jahrhundert der Kohle» bezeichnet wird. Lange Zeit transportierte man die Kohle vom Bergwerk mit Pferdefuhrwerken zum Fluss und lud sie dort auf das Schiff um. Der Druck, diese mühselige und teure Operation zu vereinfachen, löste eine zweite, im wahrsten Sinn des Worts bahnbrechende Innovation aus: die Erfindung der Eisenbahn. Sinnbild der Industrialisierung ist die Fabrik, die auf einer weitgehenden Arbeitsteilung beruhte, die ihrerseits wiederum nur mit zuverlässigen Transportketten zu meistern war. Die Mobilität von Gütern und Menschen war zu einem unverzichtbaren Bestandteil für die massive Steigerung von Produktion und Volkswohlstand geworden.
Die dritte Zäsur ist die sogenannte Tertiarisierung, der Aufschwung des Dienstleistungssektors, dem auch die Transportwirtschaft zuzurechnen ist. Heute ist der Dritte Sektor in allen entwickelten Ländern der mit Abstand größte Wirtschaftsbereich. Die Wachstumsraten sind hoch, insbesondere im Tourismus, einem eigentlichen Mobilitätsgeschäft mit gut 10 Prozent Anteil am globalen Bruttosozialprodukt. 2018 waren weltweit 1,4 Milliarden Touristen unterwegs.
Die vierte Zäsur ist die durch den Fall des Eisernen Vorhangs ausgelöste Globalisierung. Zwei Faktoren führten zu einem exponentiellen Anstieg der Handelsströme: der weltweit wachsende Konsum und die weltweite Arbeitsteilung mit einer Globalisierung der Lieferketten.
Die letzten beiden Zäsuren wurden nur dank des weiträumigen Einsatzes einer weiteren technischen Errungenschaft, des Computers und der auf ihm basierenden Digitalisierung, möglich.
Die Mobilität von Gütern und Menschen ist das zentrale Nervensystem unserer Wirtschaft und die Grundlage unseres Wohlstands. Als das Coronavirus ein Land nach dem anderen erfasste, wurde der funktionierende Lebensmittelnachschub zu einer der obersten Prioritäten. Zu stemmen war dies nur mit LKW. Lastwagenfahrer wurden zu Corona-Helden der ersten Stunde.
2. Der Mensch als mobiles Wesen
Individuelle Mobilität ist durch Verhaltensmuster und Rollenbilder geprägt, die sich tief in unserem Unterbewusstsein eingenistet haben.
Mobilitätsentscheidungen
«Hirnforscher schätzen, dass wir täglich hunderttausend Entscheidungen fällen – glücklicherweise nur hundert davon bewusst.»1 So beginnt das Editorial eines Themenhefts über Entscheidungen. Es folgt eine lange Liste unbewusst getroffener Wahlakte, darunter «Velo oder Tram? Velo.»
Die überwiegende Mehrheit unserer täglichen Entscheidungen fällen wir intuitiv. Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman spricht in dem Zusammenhang vom «System 1»: Es «arbeitet automatisch und schnell, weitgehend mühelos und ohne willentliche Steuerung». Demgegenüber steht das «System 2». Hierbei handelt es sich um eine bewusste mentale Aktivität, bei der Objekte in Bezug auf mehrere Merkmale verglichen werden und am Schluss eine wohlüberlegte Wahl zwischen Optionen stattfindet.2 Man kann es sich als Eisberg vorstellen: Was aus dem Wasser herausragt, ist das Bewusstsein. Der überwiegende Teil des Eisbergs befindet sich jedoch unter Wasser und steht für das Unterbewusstsein, das Sediment abgelagerter Erinnerungen, Erfahrungen und Muster. Wohin der Eisberg schwimmt, wird von den Tiefenströmungen vorgegeben. Der Neurologe Christof Koch spricht von einem «Autopiloten», der wie ein «Zombiesystem» funktioniert, weil ihm jegliches subjektive Gefühl fehlt.3
Ein Kind ist in seiner Mobilität zunächst fremdbestimmt. Es wird getragen, im Kinderwagen gefahren, in einen Autositz gegurtet. Seine ersten größeren Erkundigungen macht es, wenn es zu gehen beginnt. Es folgen erste Verkehrsmittel: das Laufrad, der Tretroller, das Fahrrad. Der Radius vergrößert sich. Mit der Kita und der Schule beginnt das Pendeln. Im Urlaub fährt man im Familienverband mit dem Auto ans Meer oder in die Berge. Nach der Volljährigkeit kann der junge Mensch einen Führerschein erwerben. In seinem Unterbewusstsein haben sich zu diesem Zeitpunkt schon unzählige Mobilitätsmuster verfestigt. Zwei Faktoren spielen dabei eine besondere Rolle: Gewohnheit und Bequemlichkeit.
Mobilitätsentscheidungen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Rahmenentscheidungen und Einzelentscheidungen. Zu den Rahmenentscheidungen gehören die Wahl des Wohnorts und des Ausbildungs- bzw. Arbeitsorts. Sie haben zumindest mittelfristige Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten und bestimmen einen wesentlichen Teil einer persönlichen OD-Matrix. Weitere Rahmenentscheidungen betreffen den Kauf eines Verkehrsmittels und/oder einer Dauerkarte für den öffentlichen Verkehr. Sind diese Rahmenentscheidungen einmal gefällt, wird der große Teil der Mobilitätsentscheidungen zur Routine und läuft über das «System 1».
Rahmenentscheidungen werden eher im «System 2» gefällt, bewusst und in der Regel nach Abwägung verschiedener Optionen. Dennoch würde man wohl in den wenigsten Fällen von einer rationalen Entscheidung sprechen. Gemäß Lehrbuch müsste man aufgrund einer umfassenden Lageanalyse und systematischer Bewertung möglichst viele Handlungsoptionen entscheiden.
In der Praxis führen jedoch oft Bequemlichkeit, Gewohnheit und Opportunitäten zu einer summarischen Bewertung. Das gilt auch für die Entscheidung, ob man in der Stadt, der Agglomeration oder auf dem Land wohnen möchte. Dabei werden die Möglichkeiten der Mobilität erwogen, auch die mit einem Wohnsitz verbundenen Kosten. Der ökologische Fußabdruck mag an Bedeutung gewonnen haben, spielt aber noch immer nicht die Rolle, die ihm eigentlich zukommen müsste.
Für die Mobilität ist diese Entscheidung – Leben in der Stadt oder auf dem Land –von größter Bedeutung. Das schweizerische Bundesamt für Raumplanung hat den Zusammenhang zwischen Dichte (Bevölkerung und Arbeitsplätze) und Mobilitätsverhalten aufgrund eines Datenbestands von 2015 untersucht.4 Die Befunde sind mit einer Ausnahme wenig überraschend. Die Anzahl der mit dem Auto gefahrenen Strecken, die dabei zurückgelegte Distanz, Auto- und Führerausweisbesitz nehmen mit zunehmender Dichte ab. Praktisch keinen Einfluss hat die Dichte auf die mittlere Tagesunterwegszeit von 90 Minuten. Überraschend ist die hohe Bedeutung des Fußverkehrs. Selbst in den am wenigsten besiedelten Gebieten wird fast ein Drittel der Etappen aller Wege zu Fuß zurückgelegt, bei höchster Dichte steigt dieser Wert auf über die Hälfte. Wir sind also zuallererst Fußgängerinnen und Fußgänger.
Beim Kauf eines Autos wirken ebenfalls unterbewusste Muster. Dafür hat die Automobilindustrie gesorgt, die ihren Modellen mittels ausgeklügelter Kommunikationsstrategien starke Brands verpasst. «Erst mit der besonderen Aura, die um Marken wie Maserati oder Ferrari, Rolls Royce oder Jaguar, Mercedes oder Porsche aufgebaut wird, entsteht jene absolute Identifikation mit dem magischen Objekt, mit seinem ‹Traumauto›, aus dem Mann einen Teil seiner persönlichen Identität bezieht.»5 Wie man sieht, war das Zielobjekt zunächst der Mann, der sich mit dem Auto auch ein Statussymbol zulegt. Mittlerweile hat die Industrie auch die Kundin entdeckt. Die Bedeutung des Autos als Identifikationsobjekt und Statussymbol hat im Lauf der Zeit zwar abgenommen. Trotzdem: Man sagt, wer nach rationalen Kriterien ein Auto kauft, müsste sich für einen Škoda entscheiden. Viele tun das auch, wobei ihnen Škoda entgegenkommt: Der neue Škoda ist «mächtiger, kantiger, aggressiver gezeichnet». Doch all die Škodakäufer können nicht verhindern, dass das durchschnittliche Gewicht der Neuwagen permanent steigt und mit ihm der ökologische Fußabdruck. 2007 lag in Deutschland der Marktanteil der SUV bei 7 Prozent, 2018 waren es 27 Prozent. Dabei gab es 2018 noch ein Problem: «Wer ein wirkliches Topautomobil in dem Segment haben will, der kann bislang nur maximal 160000Euro ausgeben.» Dem konnte abgeholfen werden: der Bentley Bentayga ist ab 170000 Euro zu haben. Konsequenterweise fordert der ADAC breitere Parkflächen.6 Kein Wunder, dass die Zielwerte der CO2-Emissionen von Autos verfehlt werden.
Einzelentscheidungen gehören zum großen Teil in den Bereich der Routine und werden durch den Autopiloten des «Systems 1» getroffen. Erst in außeralltäglichen Situationen steht man vor einer bewussten Entscheidung. Dann spielen bei der Frage der Fortbewegung Faktoren wie das Wetter eine Rolle oder – in Zeiten von Corona – die Gefahr von Ansteckungen. Im Freizeitbereich geht es primär um die Festlegung der Destination, und vielleicht noch um die Wahl des Verkehrsmittels. Für diese Entscheidung gibt es leistungsfähige Tools. Zum Beispiel Google Maps. Nach der Eingabe von O und D können die Reisezeiten sämtlicher Verkehrsmittel, einschließlich Fahrrad, Fußmarsch oder Uber verglichen werden. Einzig das Flugzeug und das schnelle E-Bike fehlen im Sortiment. Auf dem Weg zu einer umfassenden Entscheidungshilfe müssten die Wegzeiten und Fahrpläne noch mit Tarifen, dem CO2-Ausstoß und einer Buchungsplattform ergänzt werden.
Wenn es um die Mobilität von Gütern geht, ist der Entscheidungsprozess durch und durch rational. Die entscheidenden Kriterien sind Zeit und Kosten und die Planbarkeit. Beim Transport eines Containers von O nach D auf dem Landweg liefern die Kosten eines LKW-Transports den Maßstab. Will die Bahn konkurrenzfähig sein, muss sie die Kosten der Feinverteilung vom und zum Terminal und des Umschlags vom LKW auf die Bahn und umgekehrt kompensieren. Das ist nur möglich, wenn die Distanz zwischen den Terminals groß genug ist, ein Zug mit möglichst vielen Containern beladen ist und in den Terminals effizient umgeladen wird.
So viel ist klar: Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Verkehr muss der ökologische Fußabdruck mehr Gewicht in der Entscheidungsfindung erhalten.
Diktat der Rolle
Als sich das Autos zu verbreiten begann, wurde es als rasendes Objekt wahrgenommen, das sich viel zu schnell, riesige Staubwolken aufwirbelnd auf schlechten Straßen fortbewegte. Passanten konnten nur einen flüchtigen Blick auf die Automobilsten werfen, die mit Staubbrillen und -mänteln, Lederhauben und Schals geschützt hinter dem Steuer saßen. Für den Verkehrshistoriker führt die Position hinter dem Steuer zu einer «radikal veränderten Wahrnehmungsperspektive», in der jedes sächliche oder menschliche Hindernis die kognitiven Prozesse des Automobilisten stört. Autofahren verlange «umständliche Koordinationsleistungen» und produziere so ein «extremes Maß an selektiver Wahrnehmung … ‹Herrenfahrer› sind keineswegs nur arrogant, sondern das Opfer einer kognitiven Selbstüberforderung.»7
In den letzten 100 Jahren haben sich im Unterbewusstsein der Menschen hinter dem Steuer Handlungsmuster eingeprägt, die die anfänglichen Koordinationsprobleme beseitigten. Gleichzeitig haben Fortschritte in der Automobiltechnik und der Straßenführung das Autofahren einfacher und sicherer gemacht. Aber der «human error factor» existiert immer noch und produziert Unfälle. Insgesamt hat sich die Sicherheit im Straßenverkehr trotz permanenter Verkehrszunahme enorm verbessert. Und die Automobilindustrie arbeitet daran, Fehlhandlungen von Menschen zu minimieren.
Etwas aber hat sich in diesen 100 Jahren nicht verändert. Wer sich hinter ein Steuer setzt, der schlüpft in eine Rolle. Drei Kameraden, das legendäre Buch aus den 1930er-Jahren von Erich Maria Remarque, beginnt mit einer Autojagd. Otto Köster und seine beiden Freunde machen eine Spritzfahrt mit «Karl», einem Auto mit schäbiger Karosserie und hochgetuntem Motor. Von hinten nähert sich ein wohlgenährter, hochnäsiger Bürger im großen Buick, beim Überholen herablassend auf das hässliche Entlein schauend. Die drei Kameraden reizen das Spiel aus, lassen ihn immer wieder auf-, aber nie vorbeifahren. Im Buick weicht die Überheblichkeit der Verärgerung, zunehmender Frustration, Unverständnis und dem bitteren Gefühl der Niederlage. Fast 100 Jahre menschlicher und technischer Entwicklung haben nichts verändert. Eine Journalistin berichtet im Spiegel über ihre Erfahrungen am Steuer eines Elektro-Porsche Taycan. «Das 530 PS-starke Vieh ist wie Botox auf Rädern. Fast schade, dass man nur von hinten gesehen wird. Also abbremsen, warten, bis ein aufgemotzter BMW auf der Überholspur hinter einem blinkt und drängelt, und dann: tschüss. … Was für ein Vergnügen.»8
Wer sich hinter das Steuer setzt, sitzt in einem persönlichen Raum. Die PS-starke Maschine verleiht Kraft. Wie sehr sich das Unterbewusstsein wider die Vernunft durchsetzt, zeigt sich am Überhandnehmen übermotorisierter, überschwerer, aggressiv designten SUV. «Der Mercedes AMG GLC 63 ist das blechgewordene Äquivalent zum volltätowierten, solariumgebräunten Muckibuden-Oberkörper, der an warmen Sommertagen im knappen Muskel-Shirt ausgeführt wird. Ein Auto, nach dem sich alle umdrehen, selbst wenn sie danach den Kopf schütteln.»9 Der Trend ist offensichtlich. «Fast alle Automobilhersteller leben phänomenologisch von der Droharchitektur.»10 Sitzt man am Steuer eines solchen Fahrzeugs, spielt man eine vollständig andere Rolle, als wenn man zu Fuß unterwegs ist.
Wer mit peinlich eingehaltener Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs ist, wird noch und noch überholt. Auch das generiert eine spezifische Rolle, jene des Oberlehrers. Potenziert wird dieses Muster, wenn der Autofahrer vor einer Ampel wartet und rechts von einem Fahrradfahrer überholt wird, der gleich noch die rote Ampel missachtet. Die Ampel springt auf grün, der Autofahrende drückt aufs Gas, überholt den Fahrradfahrer, bremst ihn aus. Nach der nächsten Kreuzung hat der Fahrradfahrer freie Fahrt und quert einen für Autos gesperrten Platz mit vielen Fußgängern, denen er so knapp den Weg abschneidet, dass ihm ein nicht zitierbares Wort nachgerufen wird.
Es ist paradox. Wir sind alle hybrid: Wir gehen zu Fuß, fahren Rad, fahren Auto, fahren Tram, Bus und Zug, fliegen. Aber mit jeder dieser Fortbewegungsarten ist eine Rolle verknüpft, in die wir unbewusst schlüpfen. Wenn wir Rad fahren, ist die Rolle von zwei Faktoren geprägt. Erstens ist man auf dem Rad schlecht geschützt, jeder Unfall kann schwere Folgen haben. Zweitens bewegt man sich auf dem Rad ökologisch korrekt, was eine gewisse moralische Überlegenheit verleiht. Mittlerweile spielt sich der Konflikt bereits auf einsamen Bergwegen ab, wo sich immer mehr Mountainbiker und Wanderer kreuzen. Wie sehr eine Rolle prägt, wissen die, die ein schnelles E-Bike fahren. Im Rückspiegel nähert sich ein Fahrrad, von der Haltung des Fahrers her ist es elektrisch unterstützt. Nun greift dasselbe Muster, mit dem Remarque seinen Roman eröffnet hat. Man beschleunigt.