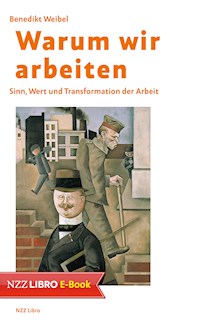Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zwei Worte, eine klare Führungsanweisung: Mir nach! Über die Jahrhunderte hat sich Führung von der kruden Menschensteuerung zum partnerschaftlichen Umgang entwickelt. Die faszinierenden Geschichten über 1 500 Jahre F ührung, von den Benediktinern über Napoleon, von Magellan über Maria Theresia bis zu Steve Jobs und vielen anderen zeigen, wie sich im Laufe der Zeit der Umgang mit Macht, Gehorsam, Disziplin, Loy alität, Verantwortung und Motivation verändert hat. Aber auch, dass sich Relikte bis heute erhalten haben, wie zum Beispiel Elemente höfischen Zeremoniells und Methoden der Einschüchterung. Gibt es ein Muster für erfolgreiche Führung? Dieser Schlüsselfrage geht der Autor in einer vergleichenden Analyse nach und kristallisiert fünf entscheidende Faktoren heraus. Benedikt Weibel hat lange Jahre selber geführt und sich aus verschiedenen Perspektiven mit Führung aus einandergesetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benedikt Weibel
Mir nach!
Erfolgreich führen vom heiligen Benedikt bis Steve Jobs
Verlag Neue Zürcher Zeitung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2012 Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich
Titelgestaltung: Atelier Mühlberg, Basel, unter Verwendung eines Fotos vonJean-Pierre Rey/Gamma Rapho/Getty Images
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN Print 978-3-03823-794-3
ISBN E-Book 978-3-03823-954-3
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Neuen Zürcher Zeitung
Eine faszinierende Reise
Mir nach! Der kürzeste Führungsbefehl als Chiffre für ein Phänomen, das die Menschen seit Jahrtausenden beschäftigt. Immer noch. Vor Jahren hat mich ein Bild magisch gepackt: ein schief liegendes Schiff in einer Polarnacht, im Packeis gefangen. Ich habe mir das Buch über die Saga von Ernest Shakleton in der Antarktis beschafft und im Urlaub gelesen.1 Bald wurde mir klar, dass das nicht in erster Linie ein Buch über ein aussergewöhnliches Abenteuer ist, sondern Literatur über Führung unter schwierigsten Umständen. Einige Jahre später las ich die Publikation von zwei Amerikanerinnen über Shakletons Führungskunst.2 Das war der Boden, auf dem die Idee reifte, Geschichten über Führung in ganz verschiedenen Kontexten darzustellen und daraus ein Muster für den Führungserfolg abzuleiten. Das Verfahren ist in der Wissenschaft als «beschreibend-analytische Form des Berichts von Beispielen» bekannt. «Aus diesen Beispielen lösen wir bestimmte Zusammenhänge heraus, von denen wir annehmen, dass sie allgemeine Bedeutung haben.»3
Die Auswahl der sieben Bereiche und der insgesamt 26 Porträts ist subjektiv, ebenso die Auswahl der Quellen. Dabei habe ich nicht nur historische Quellen, soziologische, philosophische Publikationen und Biografien benutzt, sondern auch belletristische Werke. Mit Staunen habe ich im Verlauf meiner Lektüre festgestellt, dass auch der oben zitierte Soziologe Heinrich Popitz in seinem Buch Phänomene der Macht eine Passage des Thrillerautors Eric Ambler zitiert. Eine wunderbare Passage übrigens, auf die im Teil 2 wiederholt Bezug genommen wird. Das bedeutet nichts anderes, als dass Autoren aus dem Bereich der Belletristik bestimmten Phänomenen näherkommen als Autoren wissenschaftlicher Werke.
So habe ich mich auf die Reise gemacht und Tausende Seiten gelesen. Ich bin der Faszination des Themas vollständig erlegen. Erstmals habe ich akute Symptome von Lese- und Schreibsucht wahrgenommen. Seit Jahrzehnten habe ich mich praktisch und theoretisch mit dem Phänomen Führung auseinandergesetzt. Umso überraschter war ich, wie viele neue Perspektiven mir diese Arbeit geöffnet hat. Ich habe Autoren entdeckt, deren Namen ich wohl gekannt habe, aber nur durch Zitate aus der Sekundärliteratur. Allen voran der grosse Soziologe Max Weber. Seine umfangreichen Werke, vor hundert Jahren geschrieben, sind ein unendlicher Fundus und in vielen Bereichen von geradezu beängstigender Aktualität. Man staunt über diesen Typ des Universalgelehrten, den es heute nicht mehr gibt. Das Buch hat sich zu einem Kompendium über die grossen Themen der Führung entwickelt. Und schliesslich bin ich am Ziel angekommen: Ja, es gibt das Muster für erfolgreiche Führung.
Benedikt Weibel
Teil 1
Vom Abt bis zum CEO
1. Führung in der Kirche
1.1 Die Benediktus-Regel
Benedikt von Nursia (etwa 480–547) studierte in Rom. «Doch zog er sich bald, vom sittenlosen Treiben der Weltstadt angewidert, beseelt vom Verlangen, ‹Gott allein zu gefallen›, zunächst in die Einsamkeit der Sabiner Berge…, dann ins romanitische Tal des Aio… zurück. Nach drei Jahren streng eremitischen Lebens scharten sich um den jungen Asketen Schüler, und er wurde Lehrer und Vater einer Mönchskolonie von zwölf Klöstern.»4 Für die Mönche schrieb er ein umfassendes Handbuch über das mönchische Leben mit vielen Anweisungen für den Abt. Es kann wohl als erstes Führungshandbuch der Geschichte betrachtet werden. «Von der Bibel abgesehen, liegt kein Werk des altchristlichen Schrifttums in so zahlreichen Handschriften vor wie die RB (Regula Benedicti).»5
Das Kapitel «Die Eigenschaften des Abtes» behandelt die Führung im Kloster. «Ein Abt, der würdig ist, ein Kloster zu leiten, muss immer den Titel bedenken, mit dem er angeredet wird, und muss der Bezeichnung ‹Oberer› durch seine Taten gerecht werden.»6 Dann wird präzisiert: «Er zeige mehr durch sein Beispiel als durch Worte, was gut und heilig ist.»7 Und: «Der Abt muss wissen: Für jeden Verlust, den der Hausherr bei seinen Schafen feststellt, trifft den Hirten die Verantwortung.»8 Es folgt eine klare Handlungsanweisung: «Er soll im Kloster niemand bevorzugen.»9
Eindrücklich knapp und bildhaft werden die Schlüsselbegriffe der Führung erläutert. Begriffe, die bis heute zentrale Bedeutung haben: Beispiel, Vorbild, Verantwortung, Gerechtigkeit. «Weise zurecht, ermutige, tadle! Das heisst: Je nach Zeit und Umständen verbinde er mit der Strenge die Milde; er zeige bald den Ernst des Meisters, bald die Güte des Vaters. Die Ungezogenen und Unruhigen soll er sehr hart zurückweisen, die Gehorsamen, Friedlichen und Willigen aber zu weiteren Fortschritten ermutigen. Wir ermahnen ihn, die Nachlässigen und Verächter der Zucht zu tadeln und zu bestrafen. Er soll nicht über die Fehler der Schuldigen hinwegsehen, sondern sie, so gut er kann, gleich beim Entstehen mit der Wurzel ausrotten… Rechtschaffene und verständige Gemüter kann er bei der ersten und zweiten Mahnung mit Worten zurechtweisen; die Unaufrichtigen und Widerspenstigen, die Stolzen und Ungehorsamen aber bestrafe er gleich beim ersten Vergehen mit Schlägen und körperlicher Züchtigung. Kennt er doch das Schriftwort: Der Tor wird durch Worte nicht gebessert. Und das andere: Schlag deinen Sohn mit der Rute, und du rettest ihn vor dem Tod.»10
In der Konzeption von Benedikt ist Führung nicht ein Privileg, sondern eine Verpflichtung. «Der Abt soll immer daran denken, was er ist; er soll daran denken, was sein Name besagt. Er soll wissen: Wem mehr anvertraut ist, von dem wird auch mehr gefordert. … Er soll wissen, wie schwer und mühevoll die Aufgabe ist, die er übernommen hat: Seelen zu leiten und der Eigenart vieler zu dienen; bei dem einen soll er es mit liebenswürdiger Güte, bei dem anderen mit Tadel, beim dritten mit eindringlichem Zureden versuchen. Je nach Veranlagung und Fassungskraft eines jeden soll er sich an alle so anpassen und anschmiegen, dass er an der ihm anvertrauten Herde keinen Verlust zu beklagen hat, sondern im Gegenteil sich am Gedeihen der guten Herde freuen kann.»11
Mit wenigen Worten illustriert Benedikt die Herausforderung einer Führungsaufgabe. Dabei stechen zwei Verben ins Auge:leiten und dienen. Und es kommt eine wechselseitige Verpflichtung zwischen dem Leitenden und den Geleiteten zum Ausdruck. Weiter hinten wird dieser Gedanke konkretisiert: «Er soll wissen, dass er mehr zum Helfen als zum Befehlen da ist… Und immer soll er mehr Erbarmen walten lassen als strenges Gericht… Und er suche mehr geliebt, als gefürchtet zu werden.»12
Die Verantwortung des Abtes wird noch präzisiert: «Vor allem darf er nicht über das Heil der ihm anvertrauten Seelen hinwegsehen oder es geringschätzen… Vielmehr soll er stets daran denken, dass er die Leitung von Seelen übernommen hat, für die er einst Rechenschaft ablegen muss.»13 Verantwortung lässt sich etymologisch auf «Antwort geben vor dem Richter» zurückführen. Das wird in dieser Passage eindrücklich umschrieben. Der Abt hat vor dem höchsten Richter Rechenschaft abzulegen. Und deshalb muss er sich bewusst sein: «Wenn ich meine Herden auf dem Marsch überanstrenge, gehen sie alle an einem einzigen Tag zugrunde.»14
Ein zentrales Thema der Führung einer jeden Institution ist die Art und Weise, wie Entscheidungen zustande kommen. «Sooft es sich im Kloster um eine wichtige Angelegenheit handelt, soll der Abt die ganze Klostergemeinde zusammenrufen und selbst die Angelegenheit vortragen. Er soll den Rat der Brüder anhören, dann die Sache bei sich überlegen und das tun, was er für richtig hält.»15 Erstaunlich, dass schon im frühen Mittelalter Partizipation und Kooperation vorgeschrieben werden. Die Begründung wird nachgeliefert: «Dass zur Beratung alle gerufen werden, bestimmen wir deshalb, weil der Herr oft einem Jüngeren offenbart, was das Bessere ist.»16
Hier erscheint eine zentrale Frage der Führung, die bis heute grösste Aktualität hat: Wie kann das kreative Potenzial der Gemeinschaft einer Institution aktiviert und ausgeschöpft werden? Dies wird hier eher bei den Jüngeren vermutet. Aber auch die Erfahrung spielt eine wesentliche Rolle: «Handelt es sich um weniger wichtige Angelegenheiten des Klosters, so ziehe er nur die Älteren zu Rate; es steht ja geschrieben; Tu alles mit Rat, dann brauchst du nach der Tat nichts zu bereuen.»17
Klar ist, wer das letzte Wort hat: «Doch sollen die Brüder ihren Rat demütig und bescheiden geben und sich nicht herausnehmen, ihre Meinung hartnäckig zu verteidigen. Die Entscheidung liegt vielmehr beim Abt: Was er für nützlicher hält, das sollen alle gehorsam annehmen. Aber wie es sich für den Jünger schickt, dem Meister zu gehorchen, so ist es die Pflicht des Abtes, alles umsichtig und gerecht anzuordnen.»18
Der Entscheid ist das eine, seine Umsetzung das andere. Auch hier wird auf die Reziprozität der Beziehungen hingewiesen, was man als Verpflichtung zur gegenseitigen Loyalität bezeichnen kann. «Alle sollen daher in allem der Weisung der Regel folgen, und niemand darf leichtfertig von ihr abweichen. Niemand im Kloster soll dem Begehren des eigenen Herzens folgen, und niemand darf sich herausnehmen, mit seinem Abt frech oder ausserhalb des Klosters zu streiten. Wenn jemand sich das herausnimmt, verfalle er der in der Regel festgesetzten Strafe. Der Abt jedoch handle immer in Gottesfurcht und nach den Vorschriften der Regel. Er soll wissen, dass er ohne jeden Zweifel vor Gott, dem gerechten Richter, über alle Entscheidungen Rechenschaft ablegen muss.»19
Unter dem Titel «Die Instrumente der guten Werke» folgen nicht weniger als 73 Gebote, viele direkt der Bibel entnommen.20 Die lange Liste umfasst sowohl positive Handlungsanweisungen wie «Den nächsten lieben wie sich selbst» als auch Verbote wie «Kein falsches Zeugnis geben».
Neben den vielen religiös motivierten Vorgaben fallen die bis heute aktuellen allgemeinen Massregeln auf: nicht heuchlerisch Frieden bieten; niemandem Unrecht tun, aber auch erlittenes Unrecht geduldig tragen; kein Faulenzer und kein Murrer sein; sein Tun und Lassen ständig überwachen; dem Befehl des Abtes in allem gehorchen; die Überheblichkeit fliehen; bei einem Zwist noch vor Sonnenuntergang wieder Frieden schliessen. Dem Abt wird insbesondere die Mässigung,die «Mutter aller Tugenden», ans Herz gelegt.21
Ein Kapitel wird dem Gehorsamgewidmet. «Die höchste Stufe der Demut ist der Gehorsam ohne Zögern.»22 Die Mönche haben auf ihre persönlichen Interessen zu verzichten. Sie «legen gleich alles aus der Hand, lassen ihre Arbeit unvollendet liegen, und mit dem raschen Schritt des Gehorsams kommen sie durch die Tat dem Wort des Befehlenden nach».23 Es kommt nicht nur darauf an, dass der Auftrag sofort ausgeführt wird, er muss auch mit Freude erledigt werden. «Wenn aber der Jüngere missmutig gehorcht und wenn er murrt, nicht nur mit dem Mund, sondern auch nur im Herzen, dann findet er kein Gefallen vor Gott, … er verfällt im Gegenteil der Strafe der Murrer…»24
Gehorsam allein reicht nicht. Es kommt auch darauf an, mit welchem Geist eine Aufgabe erledigt wird. Wenn wir das in unsere heutige Fachsprache übersetzen, dann ist damit die Motivation gemeint.
Nach einigen Kapiteln über geistliche und spirituelle Themen werden die Sanktionen angesprochen, die von Ausschliessungen (zum Beispiel vom gemeinsamen Tisch) bis zu körperlichen Strafen reichen. Aber auch: «Der Abt muss auf jegliche Weise um die Brüder besorgt sein, die sich verfehlt haben; denn nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. … Der Abt muss sich grosse Mühe geben und mit Umsicht und Beharrlichkeit alles daran setzen, um keines der ihm anvertrauten Schafe zu verlieren.»25 Das ist eine sehr bildhafte Umschreibung der Fürsorgepflicht, die zum Inhalt einer Führungsaufgabe gehört und welche die Angelsachsen so treffend mit take care umschreiben.
Ebenso schlicht wie bedeutsam ist die Anregung an den Abt: «Kann er einem Bruder nichts geben, dann gebe er ihm wenigstens eine freundliche Antwort. Es steht ja geschrieben: Ein freundliches Wort geht über die beste Gabe.»26
Das Verfahren bei der Aufnahme der Brüder ist klar geregelt. «Wenn einer neu ankommt, um Mönch zu werden, dann soll ihm der Eintritt nicht ohne weiteres gewährt werden, sondern man halte sich an das Apostelwort: Prüft, ob die Geister aus Gott sind.»27 Dem Novizen wird ein älterer Bruder zugewiesen, der über ihn wacht. «Wenn er nach reiflicher Überlegung verspricht, alles zu beobachten und jedem Befehl nachzukommen, dann nimmt man ihn in die Klostergemeinde auf.»28
Wer wird Abt? Auch für diese Schlüsselfrage gibt es eine eindeutige Anweisung: Bei der «Einsetzung des Abtes gelte immer der Grundsatz, dass der bestellt wird, den sich die ganze Klostergemeinde einmütig… wählt».
Nach der Lektüre der Benediktus-Regel staunt man über die Vollständigkeit der behandelten Themen und ein Führungsverständnis, das Vorbild und Unterstützung ins Zentrum stellt (wenn man von den heute als archaisch wahrgenommenen Strafen absieht). Erstaunlich modern ist das Menschenbild des Geführten. Er ist ein reflektierendes Wesen, dessen Meinung vom Abt in den Entscheidungsprozess einbezogen werden soll. Auch war damals schon die Corporate Governance ein Thema, selbstverständlich ohne diesen erst seit wenigen Jahren geläufigen Begriff zu verwenden. Für die Checks and Balances sorgt Gott, dem Rechenschaft abzulegen ist und der alles sieht und weiss.
1.2 Die Jesuiten
Tausend Jahre nach der Einführung der Benediktus-Regel hat der Kontext fundamental geändert. Die Reformation erschütterte den katholischen Glauben in seinen Grundfesten, und die Gegenkräfte begannen sich zu sammeln. In diesem Klima gründete Ignatius von Loyola (1491–1556) mit Gefährten 1539 die Gesellschaft Jesu mit dem Ziel, «Athleten» heranzubilden, «um die Feinde Gottes zu bekämpfen».29
Der Begriff «Athlet» bringt zum Ausdruck, dass hier ein Stosstrupp der Besten aufgebaut werden sollte. 1540 genehmigte Papst Paul III. das Statut der Gesellschaft. Der oberste Zweck der Gesellschaft war die «Verteidigung und Verbreitung des Glaubens».30
Wie in anderen kirchlichen Orden ist jedes Mitglied an ein Gelübde gebunden, und wie üblich umfasst dieses die drei Bereiche Armut, Keuschheit und Gehorsam.31 Dazu kommt auf den oberen Stufen der Hierarchie das bei keinem anderen Orden formulierte Gehorsamkeitsgelübde gegenüber dem Papst.32
Die Gesellschaft Jesu wurde als eine elitäre Kaderorganisation konzipiert. Jesuit zu werden, war und ist ein Privileg, das Leben als Jesuit auch physisch anstrengend.33 Jesuiten tragen hinter ihrem Nachnamen den Zusatz SJ (für Societas Jesu). Zwei Instrumente sorgen für eine einheitliche Doktrin: die Imago primi saeculi, «ein zeitloses Kompendium jesuitischer Ideale und Leistungen»,34und die Geistlichen Übungen von Ignatius von Loyola, «die jeder Jesuit nach einer Anleitung von 1608 einmal pro Jahr lesen musste. Durch diese Übungen – eine Abfolge von Meditation, Gebet und strenger Gewissensforschung – geführt zu werden, erwies sich… als ein wirksamer Weg, Neulinge zu einer Laufbahn als Jesuit zu locken.»35
Das Auswahlprinzip ist rigoros. Gesucht sind aussergewöhnliche Talente – Reichtum und sozialer Status zählen nicht –, «Qualitäten wie spirituelle Kraft, Zuneigung zur Societas, ein gutes Gedächtnis und eine angenehme Art zu sprechen umso mehr».36 Zurückhaltend ist man bei «einem Mangel an körperlicher Vollständigkeit, bei Krankheit und Schwäche» und bei «auffallender Hässlichkeit».37 Weil «eine jesuitische Erziehung fast immer umsonst war, sorgte sie für eine beeindruckende soziale Mischung».38
Die Gesellschaft Jesu war die erste Organisation, die ihre Mitglieder «wahrhaft revolutionär»39 in Eliteschulen auf ihre Aufgaben vorbereitete, in einem «ungewöhnlich lang[en] und hart[en]» Prozess40. In einem weltweiten Netz von Schulen und Kollegien wurden in den vergangenen Jahrhunderten nicht nur Novizen, sondern «ein beträchtlicher Teil der Weltgeistlichkeit Europas» ausgebildet.41 Aber nicht nur Geistliche besuchten die Kollegien der Jesuiten, sondern auch bedeutende Köpfe wie Descartes, Corneille und Molière.42
Die Lerntechniken reichten vom Einexerzieren über Disputationen bis zu Übungen. Die Lehrer verlangten keinen Lohn. Die Klassen waren gross und wurden streng diszipliniert. «Zusammengesetzt aus Schülern aller sozialer Schichten, blühten sie vor Strebsamkeit und Wetteifer.»43 In den «niederen Schulen» wurde während fünf bis sechs Jahren Grammatik, humanitas (mit Texten von Cicero, Livius und Caesar) und Rhetorik unterrichtet.44 «Nach den niedrigen Disziplinen kamen voll ausgeprägte Universitäten, die vierjährige Studiengänge der Philosophie… und der Theologie… anboten.»45 Das System generierte Universalgelehrte mit aus heutiger Sicht geradezu unglaublich breitem Horizont.
Nach der «Grundschulung» folgte ein zweijähriges Noviziat mit einer anschliessenden Auswahl als Laienbruder oder Scholastiker. «Vor einem Scholastiker lagen viele Jahre des Studiums der Philosophie (in der Regel drei Jahre) und der Theologie (normalerweise vier Jahre)…»46 Und wieder folgte ein Ausleseverfahren, in dem entschieden wurde, «ob der nun vollends geformte Jesuit ein geistiger Koadjutor oder ein Professe wurde, der die Ehre hatte, das zusätzliche vierte Gelübde des Gehorsams gegenüber dem Papst in Bezug auf die Aussendung abzulegen».47 Das Gelübde umfasste die Verpflichtung, «überall hin zu gehen unter Gläubige oder Ungläubige, wo Seine Heiligkeit es befehlen sollte, ohne Ausrede und ohne irgendwelches Reisegeld zu fordern, für Aufgaben, welche die Gottesverehrung und das Wohl der christlichen Religion betreffen».48
Die Mission steht im Zentrum der Tätigkeit der Gesellschaft Jesu. Diese Tätigkeit war immer mit Gefahren verbunden. Dutzende Jesuiten starben den Märtyrertod. Durch die Mission wurde die Gesellschaft zu einer multinationalen Organisation und «eine der einflussreichsten Organisationen Europas».49
Im Gegensatz zu anderen Orden wohnen Jesuiten nicht in Klöstern und unterstehen keiner Kleiderordnung. Stattdessen «passten sie sich an jedem Ort, an dem sie sich befanden, dem Stil der dortigen Priester an…».50 So präsentiert sich Pater Ferdinand Verbiest auf einer Farbtafel im Buch von Jonathan Wright Die Jesuiten in der Kleidung eines chinesischen Astrologen. Das illustriert die grosse Flexibilität jesuitischer Missionare trefflich. Sie hatten erkannt, dass für ein erfolgreiches Wirken nicht nur das Verständnis anderer Kulturen unabdingbar war, sondern man sich diese Kulturen recht eigentlich aneignen musste. Die «evangelikale Strategie der Missionare beruhte auf vorsichtiger Anerkennung der Ausprägungen der uralten Zivilisation…».51 Die Mittel wurden situationsgerecht eingesetzt, «manchmal sanft, manchmal mit dem Schwerte».52 Dieses Vorgehen erforderte ein «gewisses Talent zur Metamorphose»,53 was dem Orden einen konspirativen Zug verlieh.
Die Gesellschaft ist streng hierarchisch gegliedert. An der Spitze steht der Generalobere, die einzige Person, die gewählt wird. Wahlgremium ist die Generalkongregation. «Sie setzt sich zusammen aus den Provinziälen und bis zu zwei Delegierten aus jeder der weltweit 89 Provinzen… Seit der Gründung des Ordens 1539 haben insgesamt erst 35 Generalkongregationen stattgefunden, die letzte vom Januar bis März 2008.»54 «Regionale Obere setzte man lieber von oben ein, als sie am jeweiligen Ort auszuwählen.»55 Gelübde und Hierarchie sorgen für strenge Disziplin. Das führte allerdings auch zu «Spannungen zwischen der autoritären Struktur ihrer Hierarchie… und den individualistischen Bestrebungen ihrer Basis, zwischen der Notwendigkeit des Gehorsams und dem Wert eigener Initiative an abgelegenen Orten rund um die Welt».56
Die straffe Hierarchie, das elitäre Auslese- und Schulungskonzept und ein gewisser konspirativer Charakter der Gesellschaft führten schon früh zu Anfeindungen, selbst innerhalb der katholischen Gemeinschaft. Verleumdungen, Verschwörungstheorien und antijesuitische Mythen nährten sich über die Jahrhunderte. Die 1614 in Krakau publizierte jesuitenfeindliche Schrift Monita Secreta ist noch heute erhältlich. Die Aussage «Der Zweck heiligt die Mittel» wird den Jesuiten, Machiavelli und den Bolschewiken zugeschrieben. Die strikte Gehorsamspflicht wurde in den Schmähschriften zum Kadavergehorsam.57 Wright kommt zum Schluss, dass «ein Grossteil jener ausgefallenen Jesuitenhetze schierer Unsinn ist».58 Aber auch namhafte Gelehrte wie Blaise Pascal wandten sich gegen die Gesellschaft Jesu. Die Jesuiten wurden als «Handlanger des Papstes» und «eingeschworene Feinde weltlicher Autorität» diskreditiert.59 In der Aufklärung verschärften sich die Gegensätze, und das 18. Jahrhundert wurde für die Jesuiten das «problematischste Jahrhundert».60 Es gipfelte 1773 im päpstlichen Erlass der Aufhebung des Ordens, «eine der mysteriösesten Angelegenheiten in der Geschichte der Kirche».61 728 Bildungseinrichtungen wurden aufgelöst und 600 Bibliotheken abgeschafft. «Das Seltsame am Verschwinden der Societas Jesu ist aber, dass sie niemals ganz verschwand.»62 1814 wurde der Orden durch Papst Pius VII. wieder zugelassen. In der Schweiz wurden die Jesuiten nach dem Sonderbundskrieg 1847 des Landes verwiesen und der Orden in der Verfassung verboten. Diese Bestimmung wurde 1973 wieder aufgehoben.
Am Ersten Vatikanischen Konzil (1869–1870) nahmen 700 Bischöfe teil, die endlos über die päpstliche Unfehlbarkeit debattierten, eine Idee, welche die Jesuiten seit Jahrhunderten unterstützten. Trotz einigen Widerstands wurde das Unfehlbarkeitsdogma beschlossen, was dazu führte, dass der Papst, wenn er excathedra spricht, per definitionem nicht einem Irrtum verfallen kann. Der Entscheid führte zu grossen Spannungen in der katholischen Kirche und zur Abspaltung der Altkatholiken.
Die Gesellschaft Jesu ist noch heute weltweit tätig.63 Ihre Ideen sind über ihre Zeitschriften auch online zugänglich, zum Beispiel in Stimmen der Zeit. Dort wird in einem Artikel zum 20. Todestag des Generaloberen Pedro Arrupe SJ (1907–1991) von «neuen Ideen, wie dem Dialog als Führungsinstrument im Orden» gesprochen.64 Es hat fast 500 Jahre gedauert, bis der Dialog als Führungsinstrument eingesetzt wird. Das ist einer der Gründe, weshalb die Gesellschaft Jesu so ambivalent wahrgenommen wurde. Wenn in der Benediktus-Regel die Mässigung als die «Mutter aller Tugenden» gepriesen wird, so ist davon bei den Jesuiten nichts zu spüren. Indoktrination und unbedingter Gehorsam sind die Säulen des Führungskonzepts der Gesellschaft Jesu. «Die von Stufe zu Stufe steigende Rationalisierung der Askese zu einer immer ausschliesslicher in den Dienst der Disziplinierung gestellten Methodik erreichte im Jesuitenorden ihren Gipfel. Jeder Rest von individueller charismatischer Heilsverkündung und Heilsarbeit… sind hier verschwunden: der rationale ‹Zweck› herrscht… und ‹heiligt› die Mittel…»65
Mission ist ein zentraler Begriff. Es wirkt eigentümlich, dass dieses Wort Eingang in den Sprachgebrauch des heutigen Managers gefunden hat. Der Manager nimmt mit Bewunderung Kenntnis von der Konsequenz (und dem Erfolg) des Ordens im War for Talents und von der Intensität, mit der er diese Talente über Jahre hinweg ausgebildet und gefördert hat. Und er staunt über die Anziehungskraft einer Idee, welche eine enorm hohe Motivation generiert, die ganz ohne monetäre Reize auskommt.
1.3 Calvin
«Sicher waren es die eifrigsten und kompromisslosesten Gestalten an den jeweiligen Enden des religiösen Spektrums: Die Calvinisten von Genf und die Jesuiten von Rom.»66
Ist es Zufall, dass Johannes Calvin (1509–1564) und Ignatius von Loyola durch die gleiche strenge Schule des Kollegiums von Montaigu gegangen sind?67 Die Lebensumstände an dieser Universität waren «schreckenserregend… Die Peitsche gehört zum normalen Erziehungsmittel».68 Gewisse Parallelen sind jedenfalls unverkennbar. Was für die Jesuiten die Imago primi saeculi war, war für Calvin die Institutio christianae religionis, «eines der zehn oder zwanzig Bücher der Welt, von denen man ohne Übertreibung sagen darf, dass sie den Ablauf der Geschichte bestimmt und das Antlitz Europas verändert haben;… hat sie von der ersten Stunde bei den Zeitgenossen durch ihre logische Unerbittlichkeit, ihre konstruktive Entschlossenheit entscheidenden Einfluss geübt».69
Stefan Zweig zeichnet in seinem 1936 erschienenen Buch Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen die Gewalt ein düsteres Bild des Reformators. Natürlich ist dieses Werk durch die Umstände der Zeit zu interpretieren. Wenn er schreibt: «Denn nur eine solche Selbstbesessenheit, eine solche grossartig bornierte Selbstüberzeugtheit macht in der Weltgeschichte einen Mann zum Führer. Nie hat die immer dem Suggestiven erliegende Menschheit sich dem Geduldigen und Gerechten unterworfen, sondern immer nur den grossen Monomanen…»,70 dann werden Namen wie Lenin, Stalin und Hitler gegenwärtig.
Aber auch ein moderner Autor wie der deutsche Theologe und Publizist Uwe Birnstein, der Calvin mehr Sympathie entgegenbringt, stellt die rücksichtslose Durchsetzung der Kirchenzucht und das rigorose Verbot von Luxus und Verschwendung ins Zentrum seiner Ausführungen.71 Max Weber spricht im Zusammenhang mit Calvin von einer «pathetischen Unmenschlichkeit».72
Nach Stefan Zweig ist Unerbittlichkeit nicht nur ein Merkmal der Institutio, sondern auch des Charakters von Calvin, einer «granitenen Grundnatur» mit «eiserner Starre». Nichts sei ihm «zeitlebens fremder gewesen als Konzilianz».73 «Es gehört zur Kraft Calvins, dass er die Starre seiner ersten Formulierung [der Institutio] niemals gelindert oder geändert hat… Kein wesentliches Wort wird er mehr ändern und vor allem sich selber nicht…»74 Zweig zeichnet das Bild eines «Subordinationsfanatikers»,75 der seine Autorität mit äusserster Rücksichtslosigkeit durchsetzt. Calvins Machtanspruch ist unbedingt, von den Menschen verlangt er «sich selbst preisgebenden Gehorsam».76 «…kraft seiner unerbittlichen Energie wird Calvin alles an sich reissen, rücksichtslos wird er seine totalitäre Forderung in Tat und damit eine demokratische Republik in eine theokratische Diktatur verwandeln.»77 Der Institutio lässt er einen Katechismus folgen, der mit 21 Artikeln die Grundsätze der neuen evangelischen Lehre formuliert. Calvin «verlangt restlosen Gehorsam bis auf Punkt und Strich… [Er] duldet niemals und in keiner Hinsicht Freiheit in Dingen der Lehre und des Lebens. Nicht eine Spanne Spielraum in geistlichen und geistigen Dingen ist er der innerlichen Überzeugung des einzelnen zu überlassen gewillt; die Kirche hat nach seiner Auffassung nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, unbedingten, autoritären Gehorsam allen Menschen gewaltsam aufzunötigen…»78 Der Katechismus ist nicht bloss eine religiöse Vorschrift, Calvin nötigt den Rat der Stadt Genf, ihn zum Staatsgesetz zu erheben. Damit nicht genug: Alle Bürger der Stadt werden gezwungen, «diesen Katechismus einzeln, Mann für Mann, öffentlich zu beschwören».79 Basis dieser Unerbittlichkeit ist Calvins negatives Menschenbild. In seiner Institution Chrétienne schreibt er: «Blickt man den Menschen nur auf seine natürlichen Gaben hin an, so findet man an ihm vom Scheitel des Kopfes bis zur Sohle des Fusses nicht die geringste Lichtspur des Guten.»80 Deshalb dürfe man den Menschen nicht sich selbst überlassen, denn «seine Seele [ist] einzig des Bösen fähig».81 Deshalb wird vor «jedem Vertrauen auf Menschenhilfe und Menschenfreundschaft»82 gewarnt und «alles nur Gefühlsmässige für der Täuschung verdächtig»83 gehalten.
Es sei dies der erste Versuch, meint Zweig, im Namen einer Idee eine völlige Gleichschaltung eines ganzen Volkes zu unternehmen und aus Genf den ersten Gottesstaat auf Erden zu schaffen.84 Calvin habe nie daran gezweifelt, «dass man die Menschen nur fördere, wenn man ihnen rücksichtslos jede individuelle Freiheit nimmt».85 Das Mittel dazu ist die Disziplin. «Zucht und Strenge sind die eigentlichen Fundamente des calvinistischen Lehrgebäudes. … Alles was die Seele selig entspannen, erheben, erlösen und entschweren will – in erster Linie also die Kunst, [ist] verpönt als eitle und ärgerliche Überflüssigkeit.»86 Calvin selbst sei «absolut unsinnlich».87 Sein Porträt charakterisiert er als «güteloses, trostloses, altersloses Asketenantlitz».88 Zweig hält mit seinem Urteil nicht zurück: «Immer ist – Beispiel Robespierres – der Asket der gefährlichste Typus des Despoten.»89
Die Befolgung des Katechismus wird rücksichtslos durchgesetzt. Mit Methoden des Terrors wird gezielt Angst geschürt. «Man täusche sich nicht. Gewalt, die vor nichts zurückschreckt und jede Humanität als eine Schwäche spottet, ist eine ungeheure Kraft.»90 Ordonnanzen überwachen die Durchführung der Regeln. Ein Privatleben gibt es nicht mehr, «überall sitzen seine bezahlten Spione».91 Alles, was nur im Entferntesten mit Zerstreuung und Freude zu tun hat, ist verboten, selbst das Feiern der Festtage Weihnachten und Ostern. «Erlaubt ist, zu leben und zu sterben, zu arbeiten und zu gehorchen und in die Kirche zu gehen.»92 Zuwiderhandlungen werden grausam bestraft, «besser zu hart als zu milde».93 Um seine Gemeinde zu regieren, setzt er vier Arten von Ämtern ein: die Pastoren, die Doktoren, die Ältesten («Presbyter») und die Diakonen. Die Presbyter haben auf die Lebensführung jedes Einzelnen zu achten. Zusammen mit den Pastoren bilden sie das Konsistorium, das über Sanktionen beschliesst.94
Basis des Calvinismus ist die Prädestinationslehre, das Dogma der Gnadenwahl: «…für die Kirchenväter des Luthertums stand es dogmatisch fest, dass die Gnade verlierbar… ist und durch bussfertige Demut und gläubiges Vertrauen auf Gottes Wort und die Sakramente neu gewonnen werden kann. Gerade umgekehrt verlief der Prozess bei Calvin… Nicht Gott ist um der Menschen, sondern die Menschen sind um Gottes willen da…»95 Das bedeutet, dass «ein Teil der Menschen selig wird, ein anderer verdammt bleibt. Anzunehmen, dass menschliches Verdienst oder Verschulden dieses Schicksal mitbestimme, hiesse Gottes absolut freie Entschlüsse, die von Ewigkeit her feststehen, als durch menschliche Einwirkung wandelbar ansehen: ein unmöglicher Gedanke.»96 Die «Erwählten» und die «Verworfenen» sind von Gott bestimmt, und sie unterscheiden sich im Leben nicht voneinander.97 Konsequenterweise hat der Calvinismus jegliche «Fragen nach dem ‹Sinn› der Welt und des Lebens» ausgeschaltet.98
«Der Gott des Calvinismus verlangte von den Seinigen nicht einzelne ‹gute Werke›, sondern eine zum System»gesteigerte Werkheiligkeit… Die ethische Praxis des Alltagsmenschen wurde so ihrer Plan- und Systemlosigkeit entkleidet und zu einer konsequenten Methode der ganzen Lebensführung ausgestaltet. … Diese Rationalisierung nun gab der reformieren Frömmigkeit ihren spezifisch asketischen Zug…»99
Tröstlich ist die Feststellung Zweigs, dass Calvins Lehre schneller, als es zu erwarten war, ihre übersteigerte Unduldsamkeit eingebüsst habe. Man tue gut dran, das, was Calvin selbst gefordert habe, von dem, was aus dem Calvinismus in seiner historischen Entwicklung geworden sei, zu unterscheiden. In dieser milderen Form hat der Calvinismus unter vielen Etiketten überlebt: Puritanismus, Presbyterianer, Methodisten, Pietisten und Quäker; in Schottland, Holland, Preussen und den USA. Mit Recht habe Max Weber in seiner berühmten Studie festgestellt, «dass kein Element so sehr wie die calvinistische Lehre des absoluten Gehorsams den Industrialismus vorbereiten half».100 Weber spricht dem Calvinismus die «Entfesselung der privatwirtschaftlichen Energie des Erwerbs» zu.101 Calvin habe «in dem Reichtum der Geistlichen kein Hindernis für ihre Wirksamkeit» gesehen, «im Gegenteil eine durchaus erwünschte Steigerung ihres Ansehens…, [die] ihnen gestattete, ihr Vermögen gewinnbringend anzulegen…».102 Nicht Besitz ist verwerflich, sondern «das Ausruhen auf dem Besitz, der Genuss des Reichtums… Nicht Musse und Genuss, sondern nur Handeln dient nach dem unzweideutig geoffenbarten Willen Gottes zur Mehrung seines Ruhmes. Zeitverschwendung ist also die erste und prinzipiell schwerste aller Sünden.»103 In der Lehre Calvins gibt es für den Menschen nur eine Devise: «Arbeite hart in deinem Beruf.» Arbeit ist Selbstzweck des Lebens. Der paulinische Satz: «Wer nicht arbeitet, soll nicht essen», gilt bedingungslos für jedermann.104 Auf diesem geistigen Fundament hat die Lehre Calvins zur Akkumulation des Kapitals geführt und war nach Max Weber der entscheidende Treiber des Kapitalismus.
Zweig weist auf ein ursächliches Dilemma jeglicher Führung hin: Die Abgrenzung zwischen Freiheit und Autorität, «denn Freiheit ist nicht möglich ohne Autorität (sonst wird sie zum Chaos) und Autorität nicht ohne Freiheit (sonst wird sie zur Tyrannei)».105 Prophetisch ist seine Aussage «alle Despotien veralten oder erkalten…, alle Ideologien und ihre zeitlichen Siege enden mit ihrer Zeit: Nur die Idee der geistigen Freiheit, Idee aller Ideen und darum keiner erliegend, hat ewige Wiederkehr.»106
Das Auffallendste an der Führungskonzeption Calvins ist sein abgrundtief negatives Menschenbild. Es ist die Basis für sein tyrannisches System der Zucht. Es ist einigermassen paradox, dass ausgerechnet die menschenverachtendste der drei hier vorgestellten Konzeptionen den wohl grössten Einfluss auf die Geschichte gehabt hat.
1.4 Besonderheiten der Führung in der Kirche
Fredmund Malik schreibt in seinem Buch Führen, Leisten, Leben, es gebe nach wie vor nur zwei Organisationen, die ihre zukünftigen Führungskräfte systematisch auf ihre Führungsaufgaben vorbereiteten: die Kirche und die Armeen.107
Führung in der (christlichen) Kirche basiert auf einer klaren Raison d’être. Die Sinnfrage stellt sich nicht. Das Wort Gottes und die Bibel mit ihren Interpretationen bilden eine starke Klammer. Das asketische Element ist eine Folge davon und wird im Calvinismus auf die Spitze getrieben. So verschieden die drei Konzepte auch sind, es gibt einen gemeinsamen Nenner: die Gehorsamspflicht. In der Benediktus-Regel ist der Gehorsam an die Entscheide und Aufträge des Abtes gebunden. Bei den Jesuiten und den Calvinisten wird der Rahmen durch eine Mission (die Imago bzw. Institutio) vorgegeben. Jesuiten und Calvinisten sind auf dem von Stefan Zweig erwähnten Kontinuum zwischen Autorität und Freiheit am äussersten autoritären Ende angesiedelt. Bezeichnend dafür ist das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes. Etwas offener sind die Benediktiner, bei denen der Abt immerhin angewiesen wird, die Erfahrung der Älteren und die Kreativität der Jüngeren in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. In allen Institutionen aber wird Insubordination hart bestraft.
Den drei kirchlichen Organisationen ist gemeinsam, dass sie durch ein Gesicht repräsentiert werden. Dabei umgibt den heiligen Benedikt von Nursia eine etwas verschwommene Legende. Ignatius von Loyola ist zwar als Gründer präsent, hat aber seiner Organisation nicht seinen Namen gegeben. Die am stärksten prägende Einzelfigur ist ohne Zweifel Calvin, obwohl sich seine Nachfolger Milderungen seines überaus strengen Zuchtregimes erlaubt haben.
Erstaunlich ist, dass sowohl der Abt eines Klosters als auch der Generalobere der Jesuiten von der Gemeinschaft und nicht von einer übergeordneten Instanz gewählt werden.
Die grosse Innovation der Jesuiten ist die Einführung von Eliteschulen. Es gelingt ihnen, die Talente aufzuspüren und sorgfältig auswählen, und zwar ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, was im ständischen Mittelalter alles andere als die Norm ist. Auffallend ist die Breite der Bildung, die in diesen Schulen vermittelt wird, und das grosse Gewicht, das auf Präsentation und Ausdruck gelegt wird.
Gross sind die Unterschiede im Menschenbild. In der Benediktus-Regel wird vom mitdenkenden Bruder ausgegangen. Vom Mitglied der Gesellschaft Jesu wird eine hohe Anpassungsfähigkeit erwartet. Nur so kann die Missionstätigkeit in verschiedenen kulturellen Milieus Erfolg haben. Für Calvin schliesslich ist das Schicksal der Menschen von Gott vorherbestimmt. Der Mensch ist deshalb eine willenlose Kreatur, bestimmt ausschliesslich zum Arbeiten. Rigorose Zucht und Strafen sollen ihn vor den Versuchungen dieser Welt bewahren. Damit kultivierte Calvin das Führungsinstrument aller Tyrannen: die Einschüchterung.
2. Führung in der Armee
2.1 Die Preussen
«Preussen» ist im Verlauf seiner Geschichte zum Synonym für Militarismus geworden. «Das Bild des preussischen Militärs mit seiner arroganten, affektierten und herablassenden Pose verkörperte für viele… die schlimmsten Eigenschaften des Staatswesens.»108 Heinrich Heine fasst seinen Spott und Sarkasmus in die Verse:
Noch immer das hölzern pedantische Volk,Noch immer ein rechter WinkelIn jeder Bewegung, und im GesichtDer eingefrorene Dünkel.
Sie stelzen noch immer so steif herum,So kerzengrade geschniegelt,Als hätten sie verschluckt den Stock,Womit man sie einst geprügelt.
Die Nationalsozialisten bedienten sich sehr bewusst «preussischer Motive, um den Primat von Loyalität, Gehorsam und Wille zu betonen».109 Nach dem Krieg sprach Winston Churchill von der «Kriegsmaschine mit ihren eitlen, säbelrasselnden, Hacken zusammenschlagenden preussischen Offizieren und den dummen, fügsamen Massen von Hunnenkriegern, die über das Land herfallen wie ein Heuschreckenschwarm».110 Und er kam zum Schluss: «Was Europa ein für alle Mal abschütteln müsse, sei der preussische Militarismus mit seiner schrecklichen Philosophie.»111 Zwischen den Alliierten bestand ein Konsens, dass «dieser todgeweihte Leichnam Preussen endlich getötet werden müsse».112 Die déprussification wurde konsequent umgesetzt, auch der Name Preussen sollte für immer verschwinden. «Am 25. Februar 1947 unterzeichneten Vertreter der alliierten Besatzungsbehörden in Berlin ein Gesetz zur Auflösung des Preussischen Staates.»113
Der erste Satz der Präambel des Gesetzes ist unmissverständlich:
«Der Staat Preussen, der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört.»
Artikel I bestimmt: «Der Staat Preussen, seine Zentralregierung und alle nachgeordneten Behörden werden hiermit aufgelöst.»114
Preussen wuchs aus dem hohenzollerischen Brandenburg, einem «nicht gerade vielversprechenden Territorium».115 Das Land wurde im Dreissigjährigen Krieg (1618–1648) verwüstet. «Gräueltaten waren das charakteristische Kennzeichen dieses Krieges. Sie drückten etwas aus, was sich tief in das Gedächtnis eingrub: die Aufhebung jeglicher Ordnung…»116 Unter Friedrich Wilhelm, dem «grossen Kurfürsten», der sein Land von 1640–1688 ausserordentlich lange regierte, transformierte sich das Land grundlegend. «Friedrich Wilhelm hat das Amt des Kurfürsten sozusagen neu erfunden… [er] arbeitete härter als ein Sekretär… Seine Minister staunten über sein Detailwissen, sein Urteilsvermögen und seine Fähigkeit, ganztägige Arbeitssitzungen durchzustehen.»117 Gegen Ende seiner Regierungszeit verfügte Brandenburg über ein stehendes Heer von 30000 Mann. Dabei hatten sich bereits Elemente der späteren preussischen militärischen Kultur herausgebildet: «…regelmässiger, systematischer Drill der Truppen in Schlachtmanövern, starke funktionelle Ausdifferenzierung und ein diszipliniertes, professionelles Offizierskorps».118 Der grosse Kurfürst gründete eine Kadettenschule für Offiziersrekruten. Die Ausbildung der Offiziere wurde standardisiert und «der Zusammenhalt und die Moral der niederen Dienstgrade gestärkt, was sich in den 1680er Jahren an der hervorragenden Disziplin und der geringen Anzahl von Deserteuren ablesen liess».119 Später wurde die Kadettenschule durch eine Lehranstalt für junge Offiziere, eine eigentliche Eliteschule, ergänzt.120
Das brandenburgische Heer errang grosse Siege in Fehrbellin und Warschau. Dabei stand Friedrich Wilhelm, «mittlerweile ein korpulenter Mann von 55 Jahren, mitten im Kampfesgetümmel».121 Ende des 17. Jahrhunderts war Brandenburg-Preussen nach Österreich das zweitgrösste deutsche Fürstentum.122 1701 wurde Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg mit riesigem Pomp zum König Friedrich I. von Preussen gekrönt, 1713 folgte ihm sein Sohn als Friedrich Wilhelm I. auf dem Thron. Der australische Historiker Christopher Clark spricht in diesem Zusammenhang von einer Kulturrevolution. Friedrich I. hätte zum Typ A gehört: ein «leutseliger, pompöser Verschwender, in erster Linie auf sein Image bedacht und der täglichen Regierungsarbeit eher abgeneigt», sein Nachfolger zum Typ B: «der asketische und sparsame Workaholic».123 Die Typen hätten sich in der Folge abgewechselt, wobei der Typ B präsenter gewesen sei. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger trug Friedrich Wilhelm I. eine Militäruniform, was «bis zum Ende der preussischen Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg ein auffälliges Merkmal dynastischer Repräsentation der Hohenzollern» blieb.124 Die damit bezeugte demonstrative Bescheidenheit hatte religiöse Wurzeln. Preussens Protestantismus war von verschiedenen Strömungen beeinflusst: Lutheraner, Calvinisten und ganz besonders Pietisten (s. 1, 1.3). «Die Pietisten schätzten Zurückhaltung und Bescheidenheit und verachteten die Prunk- und Verschwendungssucht am Hofe. Dort und in den Organen der militärischen und zivilen Ausbildung förderten sie systematisch die Tugenden der Nüchternheit, Sparsamkeit und Selbstdisziplin…»125 «[Es] erscheint wahrscheinlich, dass die Pietisten mit ihrer moralischen Rigorosität und ihrem frommen Berufsethos mit dazu beitrugen, das alte Bild des Offiziers als eines draufgängerischen und verwegenen Hasardeurs zu diskreditieren und stattdessen einen Verhaltenskodex für Offiziersränge zu etablieren, der auf Mässigkeit, Selbstdisziplin und unbedingtem Gehorsam basierte, Eigenschaften, die mit der Zeit als typisch ‹preussisch› definiert wurden.»126
Als Friedrich Wilhelm I. 1740 starb, hatte das preussische Heer eine Stärke von 80000 Mann.127 Die einzige Verschwendung, die sich der Monarch leistete, waren die «Langen Kerls», hochgewachsene Soldaten, die in ganz Europa rekrutiert wurden.128 Der «Paradedrill» wurde unter seinem Regime intensiviert und damit die Manövrierfähigkeit grosser Truppenverbände verbessert.129 Indem er den Adel über die Kadettenschulen in die Armee integrierte, wurde eine militärische Tradition auf Basis der «ungebrochenen Macht der Junker, jener adeligen Gutsbesitzer in den Gebieten östlich der Elbe…»130 gebildet. «Die Folge sei eine tief greifende Militarisierung der brandenburgisch-preussischen Gesellschaft gewesen.»131
Den Höhepunkt der preussischen Geschichte bildete die 46-jährige Regentschaft von Friedrich II., dem Grossen (1740–1786). Eine Flut von Veröffentlichungen anlässlich seines 300. Geburtstages 2012 zeigt die ungebrochene Popularität und Faszination des Monarchen. Auf der Front des Spiegels erscheint er als Friedrich der Grösste.132 «Was die Grösse seines Intellekts angeht, kann es keinen Zweifel geben. Sein ganzes Leben hindurch verschlang er Bücher.»133 Während seiner Feldzüge führte er eine mobile Feldbibliothek mit. Sein eigenes literarisches Werk umfasst mehrere Dutzend Bände. Friedrich war auch ein ausgezeichneter Musiker. Er «übte und spielte unablässig [Querflöte], mit einem Perfektionismus, der an Besessenheit grenzte».134 Ganz in der preussisch-pietistischen Tradition hatte er eine «Abneigung gegen den friderizianischen Personenkult»135 und verzichtete auf die Insignien der dynastischen Monarchie. Der König trug stets «einen alten blauen Soldatenrock…, dessen Revers mit Spuren von spanischem Schnupftabak befleckt war».136 Auch fernere Nachfolger zelebrierten dieses Element preussischer Kultur. Der erste deutsche Kaiser und preussische König Wilhelm I. «behielt die knauserigen Gewohnheiten eines ostelbischen Junkers bei. … Kutschen mit Gummireifen lehnte er beharrlich mit der Begründung ab, sie seien unnötiger Luxus. In dieser Verschrobenheit steckte auch ein Element selbstbewussten Auftretens. Der König trachtete danach, die preussische Schlichtheit, Selbstdisziplin und Sparsamkeit zu personifizieren.»137
Die wichtigste politische Einzelaktion Friedrichs des Grossen war die Eroberung und Einverleibung von Schlesien, «eine Entscheidung, die der König allein getroffen hatte, gegen den Rat seiner höchsten diplomatischen und militärischen Berater».138 Damit «katapultierte [er] Preussen in eine gefährliche neue Welt der Grossmachtpolitik».139
Die Siege gegen Österreich und später gegen eine Koalition europäischer Grossmächte gründeten auf der Disziplin und Schlagkraft des preussischen Heeres: «…drei Reihen tief, Schulter an Schulter, die Bajonette aufgepflanzt, mit neunzig Schritt pro Minute… und beim Kontakt mit dem Feind auf siebzig verlangsamt – unbarmherzig, unaufhaltsam».140 Der preussische Drill versetzte die «Mauern aus blauen Uniformröcken in die Lage…, sich nach Belieben zu drehen und zu wenden, als hingen sie an unsichtbaren Fäden, und sich doppelt so schnell umzugruppieren wie die meisten anderen europäischen Armeen».141 Das Menschenbild, das der preussische Offizier von seiner Mannschaft hatte, war archaisch. Der «gemeine Cantonist» gilt «durchwegs als ‹prügelbare Kanaille›… Die Disziplin der preussischen Heere beruht zum guten Teil auf drakonischen Prügelstrafen und auf Grundsätzen wie dem, dass der Soldat seinen Unteroffizier mehr zu fürchten habe als den Feind.»142 Das heute sprichwörtlich verwendete Wort «Spiessrutenlauf» hatte in Preussen eine sehr konkrete Bedeutung.
Im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) kämpfte Preussen unter Friedrich dem Grossen allein gegen eine Koalition von Österreich, Russland und Frankreich. Wieder beschloss Friedrich einen Präventivschlag zu führen. Dass er sich gegen eine dermassen überlegene Streitmacht behaupten konnte, «erschien seinen Zeitgenossen wie ein Wunder… Bei einer ganzen Reihe von Schlachten bewies Friedrich seine Intelligenz und Originalität als Feldherr. … Eine zentrale Eigenschaft von Friedrichs Kriegskunst war die Bevorzugung schiefer gegenüber frontaler Gefechtsordnung.»143 Im Vergleich zum schwerfälligen Entscheidungssystem der Koalition war der Entscheidungsprozess bei Friedrich «von grösster Einfachheit, da der Oberkommandierende im Feld zugleich der König und der Aussenminister war. Weitschweifige Diskussionen… erübrigten sich, ein Vorteil, der durch die persönlichen Eigenschaften des Königs – Unermüdlichkeit, Talent und Wagemut – und seine Bereitschaft, Fehler (auch von ihm begangene) einzugestehen, noch verstärkt wurde.»144 Dieser Prozess hatte allerdings auch seine Schattenseiten: Die Entscheidungen waren «einzig und allein von den Stimmungen und Wahrnehmungen eines einzigen Mannes abhängig».145
Auf Friedrich den Grossen folgte 1786 sein Enkel Friedrich Wilhelm II., «ein impulsiver, labiler Charakter, der leicht von seinen Ratgebern gelenkt werden konnte».146 Mit der Französischen Revolution und der Herrschaft Napoleons verschoben sich die europäischen Gewichte fundamental. «Im Jahr 1806 beging Preussen… den folgenschweren Fehler, sich Napoleon in einer Schlacht zu stellen… Das Ergebnis war eine Katastrophe.»147 In Jena wurden die Preussen von einem ungefähr gleich starken französischen Heer geschlagen, am gleichen Tag erlitt ein preussisches Heer von 50000 Mann gegen eine nur halb so grosse Streitmacht Napoleons in Auerstedt eine vernichtende Niederlage.
«Gerade weil die Niederlage so vernichtend war, hatte sie die Tür zu Reformen weit aufgestossen.»148 Für eine umfassende Militärreform zeichneten vor allem die Generale Johann David von Schanhorst und Carl von Clausewitz. Die militärische Planung und Führung wurden professionalisiert, die Befehlsstrukturen in einem Organ zusammengefasst («erste Konturen eines modernen Generalstabssystems»149). «Die reformierte Befehlsstruktur war so flexibel, dass Korpskommandeuren auf dem Schlachtfeld ein gewisses Mass an Autonomie gestattet wurde.»150 Die drakonischen Körperstrafen wurden stufenweise abgeschafft. «Ein Offizier hatte nicht die Aufgabe, seine Untergebenen zu schlagen oder zu kränken, sondern sie zu ‹erziehen›. Der einflussreichste Ausdruck dieses Wertewandels war Clausewitzens Werk Vom Kriege, …Nach Clausewitzens Typologie der Kampfhandlungen waren Soldaten kein Vieh, das sich willenlos über das Schlachtfeld treiben liess, sondern Menschen, die den Schwankungen von Stimmungen, Moral, Hunger, Kälte, Müdigkeit und Angst ausgesetzt waren. Eine Armee sollte nicht als Maschine verstanden werden…»151 Das führte zur Beschäftigung mit einer bisher unbekannten Dimension der Heeresführung. «Es ist also die kriegerische Tugend des Heeres eine der bedeutendsten moralischen Potenzen im Kriege… Entstehen kann dieser Geist nur aus zwei Quellen und diese können ihn nur gemeinschaftlich erzeugen. Die erste ist eine Reihe von Kriegen und glücklichen Erfolgen, die andere eine oft bis zur höchsten Anstrengung getriebene Tätigkeit des Heeres. Nur in dieser lernt der Krieger seine Kräfte kennen.»152 Deshalb wurden die Soldaten aufs Äusserste gefordert. «Je mehr ein Feldherr gewohnt ist, von seinen Soldaten zu fordern, umso sicherer ist er, dass die Forderung geleistet wird. Der Soldat ist ebenso stolz auf überwundene Mühseligkeiten als auf überstandene Gefahren.»153 Diese kriegerische Tugend wird in einer Kurzformel als Moral der Truppe bezeichnet. Zur Stärkung dieser Moral diente den Militärreformern auch der patriotische Enthusiasmus der preussischen Bevölkerung.154 Damit kam im Vergleich zu den früher üblichen Söldnerheeren ein völlig neues Element zum Tragen, das die in jeder Führung so präsente «Frage nach dem Sinn» neu beantwortete. Dem neuen Menschenbild des Soldaten und seinen patriotischen Gefühlen entsprach die Einführung des Eisernen Kreuzes als militärische Auszeichnung.155 (Wofür wohl die Légion d’honneur Napoleons als Vorbild diente, s. 1, 2.2)
Clausewitz setzte sich eingehend mit den Eigenschaften des militärischen Führers auseinander, der sich im Nebel der Ungewissheit zu bewähren hat. «Der Krieg ist das Gebiet des Zufalls… Jene Unsicherheit aller Nachrichten und Voraussetzungen, diese beständigen Einmischungen des Zufalls machen, dass der Handelnde im Kriege die Dinge unaufhörlich anders findet, als er sie erwartet hatte…»156 Soll der Feldherr «diesen ständigen Streit mit dem Unerwarteten glücklich bestehen, so sind ihm zwei Eigenschaften unentbehrlich, einmal ein Verstand, … und dann der Mut… Der erstere ist bildlich mit dem französischen Ausdruck coup d’œil bezeichnet worden, der andere ist die Entschlossenheit.»157Diesen coup d’œil bezeichnen wir heute als Mustererkennung, «den Blick für mögliche Entwicklungen auf dem Schlachtfeld und die daraus zu ziehenden Konsequenzen».158
Die nächste grosse preussische Figur war nicht mehr ein König, sondern der Ministerpräsident Preussens und spätere Kanzler des Deutschen Reichs, Otto von Bismarck (1815–1894). «Von Theorien und Prinzipien… hielt er wenig… ‹Prinzipien haben heisst, mit einer Stange quer im Mund einen Waldlauf machen›.»159 1862 wurde Bismarck preussischer Ministerpräsident und startete umgehend eine Heeresreform. Mittlerweile hatte die preussische Armee während eines halben Jahrhunderts keinen Krieg mehr geführt. Das sollte sich rasch ändern. 1864 besiegten die Preussen die Dänen an den Düppeler Schanzen. 1866 zog Preussen gegen Österreich in den Krieg und besiegte den Gegner, den die meisten Zeitgenossen als überlegen betrachteten, in der entscheidenden Schlacht bei Königgräz. «Der geistige Vater des preussischen Sieges von 1866 war Generalstabschef Helmuth von Moltke.»160 Sein innovatives strategisches Konzept bestand darin, «die preussischen Truppen in kleine Einheiten aufzuteilen, die blitzschnell zum jeweils günstigsten Ort verschoben werden konnten… Dank der höheren Marschgeschwindigkeit und Manövrierbarkeit der Truppen im Feld waren… die Preussen in der Lage, Zeitpunkt und Ort der entscheidenden Kampfhandlungen zu bestimmen. … Ergänzt wurde dieser aggressive strategische Ansatz durch eine Reihe von Massnahmen, mit denen die preussische Infanterie zur besten in Europa gemacht werden sollte. Mitte der sechziger Jahre war Preussen die einzige europäische Grossmacht, deren Truppen mit Hinterlader ausgerüstet waren.»161 Die Militärführung erntete «die Früchte des beispielhaften preussischen Bildungssystems… [Es] implizierte eine weit grössere Autonomie und Selbstbestimmung der Mannschaftsgrade, als dies bei den europäischen Armeen der Zeit die Norm war.»162 Auch im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 setzten sich die Preussen durch. 1871 wurde in Versailles das neue Deutsche Reich proklamiert. König Wilhelm I. wurde der erste Deutsche Kaiser und von Bismarck Reichskanzler.
1906 belustigte ein spektakulärer Vorfall ganz Europa und legte die Kehrseite der preussischen Tugenden offen. Der Stadtstreicher Friedrich Willhelm Voigt erstand sich in Trödlerläden die Uniform eines Hauptmanns des 1. Garderegiments, eignete sich kraft seiner Uniform Truppen an und liess sich von einem Stadtkämmerer den gesamten Inhalt der Stadtkasse aushändigen – gegen Quittung. Voigt wurde als Hauptmann von Köpenick unsterblich und zum Vorbild aller Hochstapler. «Auf einer Ebene war die Episode gewiss eine Parabel über die Macht einer preussischen Uniform. … So gesehen wirft Voigts Geschichte ein Licht auf ein soziales Umfeld, das von kriecherischem Respekt vor militärischer Autorität geprägt war.»163 Mit der zaghaft einsetzenden Demokratisierung der Gesellschaft kontrastierte der «legendäre Standesdünkel der preussischen Offizierskaste… Bis 1913 wehrten sich Teile des preussischen Militärkommandos gegen eine Vergrösserung der Armee mit der Begründung, dass es den aristokratischen Korpsgeist der Offizierskaste verwässern würde, wenn Kandidaten aus der Mittelschicht in die höchsten Ränge strömten.»164
Der letzte Zeitsprung führt zu den Nationalsozialisten. «Der Lobgesang auf das ‹Preussentum› zog sich wie ein roter Faden durch Ideologie und Propaganda…»165 «Goebbels bediente sich preussischer Motive, um den Primat von Loyalität, Gehorsam und Wille zu betonen…»166 Diese Vereinnahmung der Preussen durch die Nationalsozialsten führte dazu, dass das «Preussentum» bei den Alliierten zu einem eigentlichen Feindbild wurde, das wie ein Gift das europäische System zersetzt habe. «Die Geschichte dieses Staates sei eine ununterbrochene Abfolge aggressiver Kriege gewesen. Dadurch sei eine von extremer Unterwürfigkeit geprägte politische Kultur entstanden…»167 Das führte letztlich zu der eingangs dieses Kapitels geschilderten formellen Auslöschung des geografischen und mittlerweile auch ideologischen Begriffs Preussen.
Dieser Überblick im Zeitraffer zeigt sowohl erstaunliche Konstanten wie den fundamentalen Wandel. Konstant geblieben sind die zentralen Tugenden der Loyalitätund des Gehorsams. Gewandelt hat sich das Menschenbild des Soldaten, vom Rädchen in einer grossen Maschine zum Menschen, der geformt werden kann und der eine gewisse Autonomie besitzt. Die Führungsinstrumente wurden angepasst. Anstelle drakonischer Strafen traten eine breite Ausbildung und die bewusste Instrumentalisierung des Nationalismus.
2.2 Napoleon
Als Sohn eines «korsischen Winkeladvokaten»168 war Napoleon Bonaparte (1769–1821) wenig in die Wiege gelegt worden. Bonaparte war ein Aussenseiter ohne Bindungen, «le petit caporal»169 mit einem «Korsika-Komplex»170 und dem «chronischen Leiden, ein Emporkömmling zu sein»171. In einem frühen Essay schilderte Napoleon Bonaparte die obsessive Seite seines Charakters mit erstaunlicher Selbsterkenntnis: «Selbst wenn ich nichts zu tun habe, plagte mich der vage Gedanke, dass ich keine Zeit verlieren dürfe.»172
Malcolm Gladwell belegt in seinem Buch Überflieger173 aufgrund umfassender empirischer Untersuchungen die These, dass der Zufall ein entscheidender Faktor für ausserordentliche Karrieren ist. Dafür ist auch Napoleon Bonaparte ein Beispiel. Er war im besten Alter, als die Französische Revolution die Vorrechte privilegierter Schichten hinwegfegte, was ihm eine vorher undenkbare Entwicklung ermöglichte. Und weil bei der Belagerung von Toulon der Kommandant der Artillerie schwer verwundet wurde, wurde er dessen Nachfolger. Der Zufall öffnet die Türe, aber eintreten muss man selber. Bonaparte ergriff die Chance, seine überragenden Fähigkeiten als Stratege und militärischer Führer zu demonstrieren. Er erkannte sofort, wo der schwache Punkt des Gegners lag und wo er seine Artillerie einsetzen musste. Umgehend entwickelte er einen Plan und fixierte ihn schriftlich. Tatsächlich trug die Artillerie entscheidend zur Einnahme der Stadt bei. «Napoleon bewahrte von diesem ersten Sturmangriff, den er befehligte, eine bleibende Erinnerung: Die Pike eines Verteidigers hatte sich so tief in die Innenseite seines Unterschenkels gebohrt, dass man zunächst eine Amputation erwog…»174 Dieser Erfolg und sein damit bewiesener Mut führten dazu, dass «der wenig bekannte kleinwüchsige Artillerieoffizier mit dem lächerlichen Namen und dem linkischen Auftreten» mit 26 Jahren den wichtigsten militärischen Kommandoposten Frankreichs innehatte.175
Als Kommandant hat er immer drei Grundsätze verfolgt: Kräfte zusammenhalten, stets aktiv bleiben, unerschütterliche Entschlossenheit.176