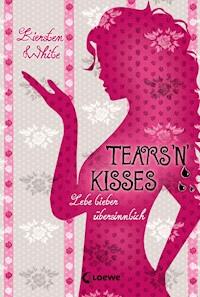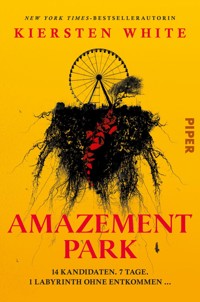16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Panini
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der fesselnder Abschluss der Eroberer-Trilogie Der junge Radu kehrt in die neue Hauptstadt zurück, wo Mehmed auf den Trümmern Konstantinopels ein Imperium erbaut. Als Sultan ist Mehmed mächtiger denn je, aber auch ausgesprochen einsam. Ist nun die Zeit gekommen, um ihre Beziehung auf ein anderes Niveau zu heben? Währenddessen regiert Radus Schwester Lada die Walachei mit eiserner Hand. Doch sie will mehr. Als sie die Leichen von Mehmeds Friedensboten zurückschickt, bleibt dem Sultan und Radu keine Wahl: Sie müssen sich der blutrünstigen Fürstin stellen. Während Mehmed glaubt, Lada zu verstehen und zu lieben, kennt nur Radu die wahre Stärke seiner Schwester. Lada ist bereit, alles zu zerstören, um das Land zu erschaffen, das sie sich vorstellt. Der Thron ruft, die Krone wartet, und die ganze Welt steht auf dem Spiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
AUSSERDEM BEI PANINI ERHÄLTLICH
KIERSTEN WHITE: DIE EROBERER-TRILOGIE
Band 1: DAS DUNKLE IN MIR
ISBN 978-3-8332-4483-4
Band 2: MEIN IST DIE MACHT
ISBN 978-3-8332-4569-5
Band 3: WIR SIND DIE FLAMME
ISBN 978-3-8332-4638-8
Erhältlich im Buchhandel
Ins Deutsche übertragen von Helga Parmiter
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Text copyright © 2025 by Kiersten White. All Rights Reserved.
Jacket art copyright © 2025 by Sam Weber.
Map art copyright © 2025 Isaac Stewart.
Titel der Englischen Originalausgabe: »Bright We Burn« by Kiersten White, published 2018 in the US by Delacorte Press, an imprint of Random House Children’s Books, a division of Random House LLC, New York.
Deutsche Ausgabe 2025 Panini Verlags GmbH, Schloßstr. 76, 70176 Stuttgart.
Alle Rechte vorbehalten.
Geschäftsführer: Hermann Paul
Head of Editorial: Jo Löffler
Head of Marketing: Holger Wiest (E-Mail: [email protected])
Presse & PR: Steffen Volkmer
Übersetzung: Helga Parmiter
Lektorat: Katharina Altreuther
Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart
Satz und E-Book: Greiner & Reichel, Köln
YDWHITE003E
ISBN 978-3-7569-9950-7
Gedruckte Ausgabe:
1. Auflage, Oktober2024,ISBN 978-3-8332-4638-8
Findet uns im Netz:
www.panini.de
PaniniComicsDE
Für Wendy Loggia, liebster Sonnenschein in Menschengestalt, der von Anfang an gesehen hat, was aus diesen Büchern werden würde, und mir bei jedem Schritt geholfen hat.
1
1454, Walachei
Lada Dracul hatte Knochen zerschmettert und war durch Blut gewatet, um die Burg zu erreichen.
Das bedeutete aber nicht, dass sie dort Zeit verbringen wollte. Es war eine Erleichterung, der Hauptstadt zu entkommen. Sie verstand die Notwendigkeit eines Machtsitzes, aber sie hasste es, dass es Tergowiste war. Sie konnte nicht in diesen Räumen aus Stein schlafen, die leer und doch von den Geistern all der Fürsten vor ihr bevölkert waren.
Da es bis zu Nicolae zu weit war, hatte Lada geplant, ein Lager für die Nacht aufzuschlagen. Abgeschiedenheit wurde immer kostbarer und war eine weitere Ressource, die ihr schmerzlich fehlte. Doch ein kleines Dorf abseits der vereisten Straße lockte sie. In einem der letzten Sommer, bevor sie und Radu an die Osmanen ausgeliefert worden waren, waren sie mit ihrem Vater auf demselben Weg unterwegs gewesen. Es war eine der glücklichsten Jahreszeiten ihres Lebens. Obwohl es jetzt Winter war, verlangsamten Nostalgie und Melancholie sie, bis sie beschloss, zu bleiben.
Außerhalb des Dorfes verbrachte sie ein paar eisig kalte Minuten damit, sich umzuziehen und Kleidung anzulegen, die mehr dem Standard entsprach als ihre übliche Auswahl an schwarzen Hosen und Tuniken. Diese waren auffällig genug, dass sie riskierte, erkannt zu werden. Sie zog Röcke und eine Bluse an, aber mit einem Kettenhemd darunter. Wie immer. Für das ungeübte Auge gab es nichts, das sie als Fürst erkennbar machte.
Sie fand Unterkunft in einer steinernen Hütte. Da es hier nicht genug Anbauflächen gab, die der Mühen der Bojaren wert gewesen wären, durften die Bauern kleine Flecken davon besitzen. Nicht genug, um reich zu werden, aber genug, um zu überleben. Nachdem Münzen die Besitzerin gewechselt hatten, gab eine ältere Frau Lada einen Platz am Feuer und reichte ihr Brot und Eintopf. Die Frau hatte eine Tochter, ein kleines Ding, das viel zu große und viel zu oft geflickte Kleidung trug.
Sie besaßen auch eine Katze, die trotz Ladas völliger Gleichgültigkeit dem Tier gegenüber darauf bestand, sich an ihrem Bein zu reiben und zu schnurren. Das kleine Mädchen setzte sich fast genauso dicht zu ihr. »Sie heißt Fürst«, sagte das Mädchen und streckte die Hand aus, um die Katze hinter den Ohren zu kraulen.
Lada zog eine Augenbraue hoch. »Das ist ein seltsamer Name für eine weibliche Katze.«
Das Mädchen grinste und zeigte all die kindlichen Lücken zwischen ihren Zähnen. »Aber Fürsten können jetzt auch Mädchen sein.«
»Ah, stimmt.« Lada versuchte, nicht zu lächeln. »Sag mir, wie findest du unseren neuen Fürsten?«
»Ich habe sie noch nie gesehen. Aber ich möchte es! Ich glaube, sie muss das hübscheste Mädchen der Welt sein.«
Lada schnaubte zur gleichen Zeit wie die Mutter des Mädchens. Die Frau setzte sich auf einen Stuhl Lada gegenüber. »Ich habe gehört, dass sie kein besonderer Anblick ist. Ein Segen. Vielleicht kann es sie vor einer Heirat bewahren.«
»Ach?« Lada rührte in ihrem Eintopf. »Du meinst, sie sollte nicht heiraten?«
Die Frau beugte sich entschlossen vor. »Du bist allein hierhergekommen. Eine Frau? Allein reisend? Vor einem Jahr wäre so etwas noch unmöglich gewesen. Bei der letzten Ernte konnten wir unsere Erzeugnisse nach Tergowiste bringen, ohne alle naselang irgendwelchen Gaunern Abschläge zahlen zu müssen. Wir haben doppelt so viel Geld verdient wie jemals zuvor. Und meine Schwester muss ihren Jungen nicht mehr beibringen, sich dumm zu stellen, um nicht für die verfluchten Janitscharentruppen des Sultans gehalten zu werden.«
Lada nickte, als würde sie nur zögernd zustimmen. »Aber der Fürst hat all diese Bojaren getötet. Ich habe gehört, dass sie verkommen ist.«
Die Frau schnaubte und wedelte mit der Hand. »Was haben die Bojaren je für uns getan? Sie hatte ihre Gründe. Ich habe gehört …« Sie beugte sich so schnell und lebhaft vor, dass sie unbemerkt die Hälfte ihres Eintopfes verschüttete. »Ich habe gehört, dass sie Land an jeden verschenkt. Kannst du dir das vorstellen? Kein Familienname, keine Bojarenlinie. Sie gibt es denen, die es verdienen. Ich hoffe, sie heiratet nie. Ich hoffe, sie wird hundert Jahre alt, atmet Feuer und trinkt das Blut unserer Feinde.«
Das kleine Mädchen schnappte sich die Katze und setzte sie auf ihren Schoß. »Hast du die Geschichte vom goldenen Kelch gehört?«, fragte es mit leuchtenden Augen.
Lada lächelte. »Erzähl sie mir.«
Und so hörte Lada neue Geschichten über sich selbst, von ihren eigenen Landsleuten. Sie waren übertrieben und umfangreich, aber sie basierten auf Dingen, die sie tatsächlich getan hatte. Die Art und Weise, wie sie ihr Land für ihr Volk verbessert hatte.
Lada schlief in dieser Nacht gut.
»Wusstest du«, sagte Lada, während sie das Pergament in ihrer Hand überflog, »dass ich, um einen Streit um einen Säugling zwischen zwei Frauen beizulegen, den Säugling in zwei Hälften geschnitten und beiden ein Stück gegeben habe?«
»Das war sehr pragmatisch von dir.« Nicolae war ihr zu Pferd auf der Straße entgegengekommen. Jetzt ritten sie Seite an Seite, ihre Pferde schlängelten sich zwischen von Eis überzogenen Bäumen hindurch. Dieser Winter war dem letzten vorzuziehen, obwohl sie seltsamerweise das Gefühl der Kameraderie vermisste, das sie als Flüchtling an der Seite ihrer Männer im Lager empfunden hatte. Jetzt waren sie verstreut. Alle leisteten wichtige Arbeit für die Walachei, aber sie nutzte jede Gelegenheit, um wieder mit ihnen zusammenzukommen. Sie hatte sich auf diese Zeit mit Nicolae gefreut.
Er führte sie zu dem Anwesen, das früher ihrem Berater Toma Basarab gehört hatte. Vor Ladas Herrschaft war Toma gesund und munter gewesen und diese Straßen waren ohne eine bewaffnete Wache zum Schutz fast unpassierbar gewesen. Jetzt war Toma tot und die Straßen waren sicher. Beides – der Tod der Bojaren und die Sicherheit für alle anderen – war das bisherige Muster von Ladas Herrschaft.
Die eisige Luft stach ihr in die Nase, was sie als belebend und angenehm empfand. Die Sonne schien klar, aber sie hatte der Eisdecke, unter der die Walachei schlief, nichts entgegenzusetzen. Vielleicht trug auch das zur Sicherheit auf den Straßen bei. Niemand wollte bei diesem Wetter draußen sein.
Lada zog dies der Burg mit einer Heftigkeit vor, die so scharf und spitz war wie die Eiszapfen, unter denen sie entlangritt.
Sie schwenkte das Pergament mit der Geschichte über ihre ungewöhnlichen Methoden zur Lösung von Familienstreitigkeiten. »Das Anstößigste daran«, sagte sie, »ist, dass die Geschichte einfallslos ist. Die Siebenbürger haben sie aus der Bibel übernommen. Das Mindeste, was sie tun könnten, wäre, neue Geschichten über mich zu erfinden, anstatt bei Salomo zu klauen.« Sie sollte die Geschichten drucken, die die Frau und ihre Tochter letzte Nacht erzählt hatten. Diese Gerüchte sollte sie stattdessen verbreiten.
Nicolae deutete auf das Bündel von Berichten, das er ihr gegeben hatte. »Hast du den neuen Holzschnitt gesehen? Ein sehr fähiger Künstler. Er ist auf der nächsten Seite.«
Während des Ritts arbeitete sie sich, so gut es ging, durch die Berichte und ließ jede Seite auf die Straße fallen, wenn sie fertig war. Keine war etwas anderes als Verleumdung gewesen. Nichts Wichtiges. Nichts Wahres. Ihre dicken Handschuhe waren nicht geeignet, um mit dünnen Blättern zu hantieren, aber sie blätterte, bis sie die Illustration fand. »Ich verspeise Menschenfleisch inmitten eines Waldes aufgespießter Körper.«
»Das tust du! Die Mahlzeiten in Tergowiste haben sich verändert, seit du mich hierhergeschickt hast.«
Lada rückte ihren roten Satinhut zurecht, in dessen Mitte ein mit Edelsteinen besetzter Stern die Sternschnuppe darstellte, die ihren Aufstieg auf den Thron begleitet hatte. »Er hat meine Frisur nicht getroffen.«
Nicolae streckte die Hand aus und zupfte an einer ihrer langen Korkenzieherlocken. »Es ist schwierig, etwas so Majestätisches mit einfachen Mitteln einzufangen.«
»Ich habe dich vermisst, Nicolae.« Ihr Tonfall war bissig, aber was sie empfand, war aufrichtig. Sie brauchte ihn dort, wo er war, aber sie vermisste ihn an ihrer Seite.
Er deutete auf den Stern in der Mitte ihres Hutes und strahlte. »Natürlich hast du das. Ich wage zu behaupten, dass ich einer der hellsten, ja sogar der hellste Punkt in deiner Existenz bin. Wie hast du dich in diesen langen sechs Monaten ohne mich im Dunkeln herumgetrieben?«
»Friedlich, jetzt, wo du es sagst. So eine gesegnete Ruhe. Tja, Unterhaltungen waren noch nie Bogdans Stärke.«
Nicolaes Lächeln verzerrte sich und legte seine lange Narbe in Falten. »Aber du behältst ihn ja nicht zum Reden bei dir.«
Lada biss die Zähne zusammen. »Ich kann dich töten. Sehr schnell. Oder sehr, sehr langsam.«
»Solange die Sachsen einen Holzschnitt von meinem Ableben machen, werde ich es mit Fassung tragen.« Er strich sich über das Kinn. »Bitte sie darum, mein Gesicht richtig darzustellen. Ein Gesicht wie dieses sollte niemals schlecht dargestellt werden.«
Was Bogdan anging, hatte Nicolae allerdings nicht unrecht. Bogdan, ihr Kindheitsgefährte und jetzt treuester Soldat und Unterstützer, sprach nicht oft. Aber in letzter Zeit war selbst das zu viel gewesen. Eine Pause von ihm war einer ihrer Beweggründe gewesen, diese Reise allein anzutreten. Sie wollte ihn in Argeș treffen, aber sie hatte ihm absichtlich einen Auftrag gegeben, der ihn vorher von ihr wegführte.
Bogdan war wie Schlaf. Notwendig, manchmal angenehm. Sie brauchte ihn. Und wenn er unerreichbar war, vermisste sie ihn. Aber sie mochte es, dass sie ihn die meiste Zeit über als selbstverständlich hinnehmen konnte.
Mehmed hätte eine solche Behandlung niemals geduldet. Ihr Gesicht wurde finster und sie verdrängte ihn aus ihrem Kopf. Mehmed verdiente keinen Platz in ihren Gedanken. Dort war er ein Usurpator, so wie er es überall war.
Sie kamen an einem zugefrorenen Teich vorbei, dessen Frostmuster eine Geschichte erzählten, die sie nicht lesen konnte. Vor ihnen öffneten sich die Bäume zu hügeligem, schneebedecktem Farmland. »Warum ist Stefan nicht geblieben, nachdem er diese Briefe überbracht hatte? Er wusste doch, dass ich bald hier sein würde.«
»Er wollte zurück zu Daciana und den Kindern. Und er war wahrscheinlich besorgt, dass du ihn, wenn er dich vorher sähe, wieder wegschicken würdest. Dann hätte er keine Chance gehabt, in Tergowiste anzuhalten.«
Lada brummte. Das stimmte. Sie wollte ihn in Bulgarien oder vielleicht in Serbien haben. Beides waren aktive Vasallenstaaten des Osmanischen Reiches und wahrscheinliche Aufmarschgebiete für eventuelle Angriffe. Sie rechnete nicht mit einem Angriff. Aber sie würde darauf vorbereitet sein und dafür brauchte sie Stefan. Er hatte die letzten Monate damit verbracht, Siebenbürgen und Ungarn auszukundschaften, um ein Gefühl für das politische Klima dort zu bekommen und herauszufinden, ob Ladas Herrschaft aktiv bedroht war. Sie wollte persönlich mit ihm sprechen. Daciana sollte keinen Vorrang vor dieser Sache haben. Nichts sollte das.
Daciana kümmerte sich um das Tagesgeschäft in der Burg, um all die Einzelheiten und Alltäglichkeiten, um die sich Lada nicht im Geringsten kümmern konnte. Lada war dankbar für ihre Arbeit. Es war ein Glücksfall gewesen, während ihrer Kampagne im letzten Jahr auf sie zu stoßen. Aber auf der Burg gab es nichts, was Stefans Aufmerksamkeit erforderte. Daciana war sicher und beschäftigt. Er sollte es besser wissen, als Zeit zu verschwenden.
Lada überflog ungeduldig die fein säuberlich geordneten Berichte. Stefan hatte seine eigenen Beobachtungen aufgeschrieben und sie zu den Holzschnitten gelegt. In Ungarn war Matthias König. Er nannte sich nicht Hunyadi wie sein Vater, sondern Matthias Corvinus. Lada war nicht überrascht, denn Matthias’ Beziehung zu seinem Soldatenvater war angespannt gewesen. Natürlich wollte er den Mann nicht ehren, der ihm den Weg zur Krone geebnet hatte. Und Lada hatte am Ende sogar geholfen. Sie hatte das Erbe Hunyadis verraten und für Matthias einen Mord begangen.
Und dann hatte sie dennoch alles allein machen müssen, denn die Hilfe von Männern sah nie so aus, wie sie es versprochen hatten. Sie war immer mit Haken und unsichtbaren Widerhaken versehen, die sie zurückzerrten, wenn sie sich ihren Zielen näherte.
Matthias hatte es zumindest nicht leicht, König zu sein. Laut Stefans Bericht verbrachte er seine ganze Zeit und sämtliches Geld damit, Adligen zu schmeicheln und zu versuchen, seine Krone von Polen zurückzukaufen. Der polnische König hatte sie Jahre zuvor in Verwahrung genommen, als der vorherige König in einer Schlacht getötet worden war. Sie war ein wichtiges Symbol, und Matthias suchte verzweifelt nach der Legitimität, die sie seinem fragwürdigen Anspruch auf den Thron verleihen würde.
Lada überflog diese Information. Matthias war ein Narr, wenn er glaubte, ein Stück Metall würde ihm geben, was er wollte, und sie interessierte sich nicht sonderlich für seine Machenschaften, solange sie gegen andere Länder gerichtet waren. Außerdem hatte es den Vorteil, dass es ihn ablenkte. Soweit Stefan das beurteilen konnte, hegte er keine Absichten gegen Lada, obwohl sie sich weigerte, sich seiner Autorität zu unterwerfen.
Die Holzschnittdrucke zeigten die anhaltende Opposition Siebenbürgens gegen ihre Herrschaft, aber abgesehen von dem künstlerischen Flair gab es keine organisierte Opposition. Es schien keinen Versuch zu geben, sie militärisch zu destabilisieren. Stefan erwähnte den Nachteil, Siebenbürgen als Verbündeten zu verlieren – es hatte lange Zeit als Puffer zwischen der Walachei und Ungarn gedient –, aber da war nichts zu machen. Immerhin hatte sie einen Großteil des vergangenen Jahres damit verbracht, ihre Städte niederzubrennen. Und wenn sie das nicht wollten, hätten sie sich schon früher mit ihr verbünden sollen.
Alles in allem waren das die besten Nachrichten, die sie sich erhoffen konnte. Aber sie hatte Fragen an Stefan. Und jetzt auch Bedenken. Daciana gehörte ihr. Stefan gehörte ihr. Es gefiel ihr nicht, dass sie sich vor allem anderen einander gehörten.
Sie verstaute die Papiere in ihrer Satteltasche. »Und wie bist du zurechtgekommen?«
»Ich schlafe nachts tief und mein Appetit ist gleichbleibend gut. An manchen Tagen verspüre ich einen Hauch von Melancholie, aber ich bekämpfe sie durch lange Spaziergänge und tiefe Fässer Wein.« Er grinste über Ladas verärgerten Blick. »Oh, du hast nicht nach mir persönlich gefragt? Ich bin zum adligen Herrn geboren. So viel Autorität steht mir gut. Meine Ernte ist gut gediehen, die Felder sind bereit für das Tauwetter, und die Menschen auf meinem Land sind glücklich. Die Einnahmen dürften dieses Jahr gut sein. Gute Nachrichten für die königliche Schatzkammer, die …«
»… immer noch leer ist. Und die Männer?« Neben dem Ackerland hatten sie einen Teil von Toma Basarabs Anwesen für die Ausbildung von Ladas Soldaten reserviert. Den Fürsten war es nie erlaubt gewesen, eine eigene Armee zu haben. Sie mussten sich ganz auf die Bojaren und ihre individuellen Streitkräfte verlassen. Es war ein unorganisiertes, chaotisches System. Und ein System, das einen Fürsten nach dem anderen vorzeitig ableben ließ.
Aber Lada war wie kein anderer Fürst zuvor.
Nicolae zog seinen Hut noch tiefer herunter. In der Kälte war seine Nase knallrot und seine Narbe fast lila geworden. »Es war richtig von dir, uns hierherzuschicken. Es ist einfacher, die Männer zu kontrollieren und ihnen Disziplin beizubringen, wenn es keine Verlockungen der Stadt gibt. Und alles, was ich bei den Janitscharen gelernt habe, kann ich jetzt anwenden. Dies wird die beste Gruppe von Kämpfern sein, die die Walachei je hatte.«
Lada war nicht überrascht, aber sie war zufrieden. Sie wusste, dass ihre Methoden besser waren als das, was bislang immer gemacht worden war. Die Macht wurde nicht unter sich einmischenden, egoistischen Bojaren aufgeteilt, sondern floss in einer direkten Befehlslinie zu ihr. Sie belohnte Verdienste und sie bestrafte Untreue und Verbrechen. Beides mit großer öffentlicher Wirksamkeit. Und von ihrem Aufenthalt in der Nacht zuvor wusste sie, dass sich das herumgesprochen hatte. Ihr Volk war motiviert.
Sie kamen an zwei gefrorenen Leichen vorbei, die an einem Baum hingen. Eine trug ein Schild mit der Aufschrift DESERTEUR. Auf dem anderen stand DIEB. Nicolae verzog das Gesicht und sah weg. Lada streckte die Hand nach oben und rückte eins der Schilder gerade.
Sie hatte sich darauf konzentriert, die Straßen sicher zu machen und die Frühjahrsanpflanzung vorzubereiten. Außerdem hatte sie die Bojaren beschnitten. Aber Nicolaes Arbeit war genauso wichtig für die Zukunft der Walachei, und sie würde alles investieren, was nötig war. Es war eine andere Art von Saat, die es zu hegen und zu pflegen galt.
Nicolae streckte sich, hielt seine langen Arme über den Kopf und gähnte. »Wie sieht es in der Hauptstadt aus? Gibt es Probleme mit den Bojaren? Ich habe Gerüchte gehört, dass Lucian Basarab verärgert ist.« Nicolaes lässiger Tonfall war so kunstvoll konstruiert wie ein siebenbürgischer Holzschnitt. Lada wusste, dass er ihre Entscheidungen bei dem blutigen Bankett weder vergessen noch verziehen hatte.
Sie hatte zwar die meisten Danesti-Bojaren getötet, aber auch die Familie beseitigt, die hauptsächlich für den Tod ihres Vaters und ihres älteren Bruders verantwortlich war, genau wie Toma Basarab. Das kam bei der Familie Basarab, einschließlich seines wohlhabenden und einflussreichen Bruders Lucian, nicht gut an. Allerdings bedauerte sie es nicht. Je weniger Bojaren lebten, die sie verraten konnten, desto besser. Sie hatten viel zu viele Fürsten überlebt. Das hatte sie bequem und faul gemacht und sie von ihrer eigenen Wichtigkeit überzeugt. Und wenn Bojaren nun in ständiger Angst um ihr Leben lebten? Sie hielt das nicht für ein Problem. Sie mussten wissen, dass sie mit allen anderen von Ladas Bürgern auf einer Stufe standen: Sie dienten der Walachei, oder sie starben.
Aber Nicolae wollte immer mehr Feingefühl. Mehr Gnade. Das war einer der Gründe, warum sie ihn hierhergeschickt hatte, auch wenn er einer ihrer Besten war. Sie hatte keine Verwendung für seine Ratschläge zur Mäßigung und Befriedung. Beides waren keine Fähigkeiten, die sie kultivieren wollte. Wenn Bojaren einen Zweck erfüllten, konnten sie bleiben. Aber das taten sie nur sehr selten.
Ladas Herrschaft war noch nicht stabil genug, um sich einen Luxus wie Barmherzigkeit leisten zu können. Vielleicht eines Tages. Bis dahin wusste sie, dass das, was sie tat, sowohl notwendig war als auch fruchtete.
Sie atmete die scharfe, kalte Luft ein; der Geruch von Holzrauch lockte sie in die Richtung von Wärme und Essen. Sie ritten über die Felder, durch die Walachei, die sie von den Misserfolgen der Vergangenheit befreit hatte. »Ich habe mich um Lucian Basarabs Anliegen gekümmert. Es ist für alles gesorgt. Ich bin ein sehr guter Fürst.«
Nicolae lachte. »Wenn du nicht gerade damit beschäftigt bist, Babys in zwei Hälften zu schneiden.«
»Oh, das geht ganz schnell. Sie sind schließlich so kleine Dinger.«
Einige Tage später, nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass Nicolae seine Truppen gut im Griff hatte, ritt Lada an denselben Ufern entlang, die sie schon zweimal bereist hatte. Einmal als Mädchen mit ihrem Vater, um ihr Land zu erkunden. Und dann mit ihren Männern bei dem Versuch, dieses Land zurückzuerobern. Diesmal ritt sie allein. Sie hielt an einer Flussbiegung an, wo sich in einer verborgenen Höhle ein geheimer Durchgang hinauf zu den Ruinen der Bergfestung befand.
Aber sie waren keine Ruinen mehr. Hier war heute keine Abgeschiedenheit zu finden. Lada lauschte den Meißeln, den Schreien der Männer und dem Klirren der Metallketten. Hier wurde endlich ein Versprechen erfüllt: Sie war zurückgekommen, um ihre Festung wieder aufzubauen.
Sie ritt langsam die engen Serpentinen entlang, die den steilen Berghang hinaufführten. Heute Morgen hatte sie ihre vollständige Uniform angelegt, mit ihrem roten Satinhut, der sie als Fürst auswies. Wo sie vorbeikam, verbeugten sich die Soldaten. Und die Männer und Frauen, die dort arbeiteten, duckten sich und wichen aus.
In der Nähe des Gipfels, auf dem die neuen Mauern ihrer Festung grau und prächtig aufragten, kam Bogdan auf sie zu. Sie ließ sich von ihm vom Pferd herunterhelfen, wobei seine Hände um ihre Taille lagen.
»Wie ist es?« Sie verschlang die Mauern mit ihren Augen. Ihr silbernes Medaillon – ein Geschenk von Radu, gefüllt mit Blumen- und Baumschnitten –, das sie in all den langen Jahren ihrer Abwesenheit bei sich getragen hatte, fühlte sich schwer um ihren Hals an, als wäre es auch erleichtert, wieder zu Hause zu sein.
»Fast fertig.«
Ein Mann in Ketten taumelte vorbei und schob einen mit Steinen beladenen Karren. Seine Kleidung war zerlumpt und fleckig, nur ein Hauch von ihrer früheren Pracht war noch zu erkennen. So gefiel ihr Lucian Basarab viel besser. Hinter ihm schoben seine Frau und ihre beiden Kinder weitere Karren. Die Kinder stapften mit leeren Augen und wie betäubt vor sich hin. Lucian Basarab blickte auf, aber er schien sie nicht zu sehen. Er brach am Wegesrand zusammen.
Einer ihrer Soldaten eilte mit einem Knüppel in der Hand vorwärts. Lada wusste nicht, ob Lucian Basarab tot war, denn es spielte keine Rolle. Es gab noch weitere, die seinen Platz einnehmen würden. Wie der Rest ihrer Walachei wurde auch die Festung mit bemerkenswerter Geschwindigkeit umgebaut, dank der unfreiwilligen Anstrengungen derjenigen, die sich ihr widersetzten.
Endlich hatte sie etwas gefunden, wofür Bojaren gut waren.
»Zeig mir meine Festung«, sagte Lada und schritt an ihren Gegnern vorbei zu ihrem Triumph.
2
Konstantinopel
Eines Tages würde Radu sich nicht nach einer Zeit sehnen, in der er sich sicher war, dass die Dinge furchtbar waren, er aber keine Ahnung hatte, wie viel schlimmer sie noch werden würden.
Doch an diesem Tag wurde er von der Erinnerung an die Reise nach Konstantinopel mit Nazira und Cyprian geplagt. Er war so nervös gewesen, so verängstigt, so entschlossen, etwas aus seiner Zeit dort zu machen. Sich Mehmed gegenüber zu beweisen.
Er bedauerte den Mann, der er auf dieser Reise gewesen war. Und er vermisste ihn. Als er heute in die Stadt ritt, spürte er nur Naziras und Cyprians Abwesenheit. Das Fehlen der Gewissheit, dass er das Richtige tat. Das Fehlen seines Glaubens an Mehmed. Das Fehlen seines Glaubens an den Glauben selbst.
Es war ein sehr einsamer Weg.
Er hatte nicht vorgehabt, nach Konstantinopel zurückzukehren. Die Stadt war für ihn ein Schreckgespenst und würde es immer bleiben. Nachdem Mehmed die Stadt eingenommen hatte, war Radu bei der ersten Gelegenheit nach Edirne zurückgekehrt. Zum einen, um zu fliehen, zum anderen, um bei Fatima zu sein. Die Schuld, die er auf sich geladen hatte, war nichts im Vergleich zu dem, was er ihr schuldete, weil sie ihre Frau verloren hatte, und um Fatimas Leid zu lindern, ertrug er seine Qualen in ihrer Nähe. Sonst gab es nichts, was er für Nazira tun konnte.
All seine Briefe, die durch Kumals und sogar Mehmeds Bemühungen unterstützt wurden, hatten keine Neuigkeiten gebracht. Nazira, Cyprian und der Diener Valentin waren verschwunden. Er hatte gesehen, wie sie aus der brennenden Stadt davonsegelten, verschluckt von Rauch und Trümmern. Er hatte sie weggeschickt, damit sie leben konnten, aber er fürchtete, dass er nur einen anderen Weg gefunden hatte, sie zu töten.
Jeden Tag betete Radu, dass sie sich nicht zu den Tausenden gesellt hatten, die man in anonyme Gräber gelegt hatte. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass die Menschen, nach denen er sich sehnte, vielleicht nicht mehr existierten.
Also schickte er weitere Briefe und wartete in ihrem Haus in Edirne, wo er leicht zu finden sein würde.
Aber dann hatte Mehmed geschrieben. Eine Bitte des Sultans war nie eine Bitte, sondern ein Befehl. Radu überlegte zwar, ob er Mehmeds Einladung, zu ihm nach Konstantinopel zu kommen, ablehnen sollte, aber schließlich tat er, was er immer tat: Er kehrte zu Mehmed zurück.
Fatima hatte genug Glaubenskraft für sie beide, dass alles gut werden würde. Sie wartete jeden Tag am Fenster ihres Hauses in Edirne. Radu stellte sie sich jetzt dort vor, an der Stelle, an der sie bei seiner Abreise gewesen war. Würde sie dort für den Rest ihres Lebens vergeblich warten?
Ein vorbeifahrender Karren ließ ihn aus seinen düsteren Tagträumen aufschrecken. Beim letzten Mal war die Straße nach Konstantinopel leer gewesen, weil das Gespenst des Krieges über dem Land hing. Jetzt floss der Verkehr zur und von der Stadt wie Blut durch eine Ader. Das Leben strömte in einem ständigen Pulsschlag hinein und heraus. Die Stadt war nicht länger ein sterbendes Ding.
Wie Arme, die sich ausstrecken, um ihn willkommen zu heißen – oder ihn hineinzuzerren –, waren die Tore geöffnet. Radu unterdrückte die aufkommende Panik, als er sie so sah. Er hatte so lange damit verbracht, sie zu verteidigen und dabei zu beten, dass sie fallen würden, dass sein Körper nicht wusste, wie er darauf reagieren sollte, dass sie genau das taten, was Stadttore tun sollten.
Es war viel getan worden, um die Mauern zu reparieren, auf denen er gekämpft hatte. Glänzende neue Felsen waren in die Abschnitte eingesetzt worden, die während der langen Belagerung gefallen waren. Es war, als hätten die Ereignisse des letzten Frühjahrs nie stattgefunden. Die Stadt war geheilt, die Vergangenheit ausgelöscht. Wiederaufgebaut. Begraben.
Radu betrachtete das Land vor der Mauer und fragte sich, was mit den Leichen geschehen war.
So viele Leichen.
»… Radu Bey!«
Radu kroch aus seiner Erinnerung an die Dunkelheit zurück in den hellen Tag. »Ja?«
Es dauerte ein paar verwirrte Augenblicke, bis Radu begriff, dass der junge Mann, der ihn angesprochen hatte, vor ein paar Monaten noch ein Junge gewesen war. Amal war so gewachsen, dass er kaum noch zu erkennen war. »Mir wurde gesagt, dass du heute ankommen würdest. Ich soll dich zum Palast begleiten.«
Radu streckte seine Hände aus, um die von Amal zu ergreifen. Ihm ging das Herz auf, als er den jungen Mann hier sah, lebendig und gesund. Er war einer von drei Jungen, die Radu vor den Schrecken der Belagerung hatte retten können.
»Komm«, sagte Amal und grinste. »Sie warten schon. Wir werden zwischen den Mauern reiten und uns direkt dorthin begeben.«
Radu wusste nicht, ob er erleichtert oder enttäuscht sein sollte.
Er hatte sich vorgestellt, durch die Stadt zu reiten, aber er wusste, wohin ihn sein Herz führen würde. Zu einem leeren Haus, in dem niemand auf ihn wartete. Besser, er ging direkt zu Mehmed.
»Ich danke dir«, sagte Radu. Amal nahm die Zügel von Radus Pferd und führte ihn durch den Raum zwischen den beiden Verteidigungsmauern der Stadt. Radu wollte nicht hier sein. Er hätte es vorgezogen, Geister zu besuchen, die, wenn schon melancholisch, so doch wenigstens mit einem Hauch von Süße versehen waren. Hier an den Mauern gab es nur die Gespenster von Stahl und Knochen, Blut und Verrat.
Radu erschauderte, und sein Blick wanderte von der Mauerkrone zu dem Tor, auf das sie zusteuerten. Das Tor, das Radu mitten in der letzten Schlacht aufgeschlossen hatte, um Konstantins Schicksal zu besiegeln und die Stadt um sich herum zu Fall zu bringen.
Amal deutete auf die Mauern auf beiden Seiten. »Die Reparaturen wurden erst letzten Monat abgeschlossen.«
Radu blickte zu den in nächster Nähe stehenden Janitscharen hinauf. Er fragte sich, ob diese Männer Teil der Belagerung gewesen waren. Ob sie gegen die Mauer angebrandet und über sie hinweggeflutet waren. Was hatten sie getan, als sie nach so vielen endlosen Tagen der Erwartung, angeheizt durch Frustration und Hass, in die Stadt gelangten?
Radu verspürte einen bitteren, säuerlichen Geschmack im Mund, unfähig, die Mauern weiter anzusehen. »Ich möchte den Rest des Weges allein gehen.« Radu nahm die Zügel wieder in die Hand.
»Aber ich soll …«
»Ich kenne den Weg.« Radu ignorierte Amals panischen Gesichtsausdruck und wendete sein Pferd. Er ritt durch das Haupttor inmitten des Gedränges von Menschen, des Gedränges des Lebens, hinein. Das war wenigstens etwas.
Drinnen angekommen, ließ er sein Pferd mit den Menschenmassen treiben.
Er wollte auf gar keinen Fall allein sein. Hier gab es viel Ablenkung. Dieser Teil der Stadt war zuvor so gut wie verlassen gewesen. Jetzt waren die Fenster aufgerissen, die Wände neu gestrichen, die ersten Blumen in winzigen Töpfen gepflanzt. Eine Frau klopfte einen Teppich aus und summte vor sich hin, während ein Kind auf unsicheren Beinen hinter einem Hund herlief.
Der Frühling war ungewöhnlich kalt gewesen, doch der Winter war gemäßigt und angenehmen. Die Stadt fühlte sich nicht mehr wie eine verzweifelte, hungernde und misstrauische Stadt an. Überall, wohin Radu blickte, wurde gebaut und repariert. Es gab keine Anzeichen für Brände, keinen Hinweis darauf, dass diese Stadt jemals von einer anderen Tragödie als dem Alter heimgesucht worden war. Radu war so abgelenkt, dass er die Straße, der er eigentlich folgen sollte, verpasste und im jüdischen Sektor landete. Dort hatte er bisher noch nie Zeit verbracht. Auch dort herrschte rege Betriebsamkeit.
Er hielt vor einem im Bau befindlichen Gebäude inne.
»Was ist das?«, fragte Radu einen Mann, der mehrere große Holzbalken trug.
»Neue Synagoge«, sagte der Mann. Er trug einen Turban und eine Kutte. Er reichte die Balken an einen Mann weiter, der eine Kippa auf dem Kopf und Locken an den Ohren trug.
Radu ritt durch den Sektor und fand sich dann in einem bekannteren Gebiet wieder. Jungen umringten ein riesiges Gebäude, das früher eine verlassene Bibliothek gewesen war. Sie lungerten auf den Stufen herum, unterhielten sich oder spielten. Eine Glocke ertönte, und die Jungen sprangen auf und stürmten hinein. Radu fragte sich, wie ihr Leben aussah. Woher sie gekommen waren. Wie viel sie davon wussten, was geschehen war, um eine Stadt zu schaffen, in der sie auf den Stufen ihrer Schule spielen konnten. In Sicherheit. In Frieden.
Radu starrte die Straße entlang. Wenn er noch weiter in diese Richtung ritt, würde er die Hagia Sophia erreichen.
Er drehte um und machte sich auf den Weg zum Palast. Der Ritt hatte ausgereicht, um seinen Kopf ein wenig zu befreien. Er war davon ausgegangen, dass es schwer sein würde, die Mauern wiederzusehen. Aber die Lebendigkeit der Stadt zu sehen, war Balsam für seine Sinne. Das würde er nicht aufs Spiel setzen, indem er die Hagia Sophia so bald besuchte.
Amal wartete in der Nähe des Palasteingangs und rang nervös die Hände. Zweifellos hatte Radu seinen Tag durch den Umweg erschwert. Es war nicht Amals Schuld, dass Radu sich so fühlte, und Radu war wirklich froh, Amal lebend und gesund zu sehen. Er stieg ab und reichte die Zügel an seinen ehemaligen Helfer weiter. »Verzeih mir«, sagte Radu. »Zurückzukommen war … emotional.«
»Ich verstehe.« Amal lächelte, und plötzlich sah er noch älter aus als der junge Mann, zu dem er herangewachsen war. Radu hatte Konstantins zwei junge Erben vor den Schrecken des Untergangs der Stadt beschützt, aber Amal hatte alles hautnah miterlebt, bevor Radu ihn befreite. »Ich werde mich um dein Pferd kümmern. Und wenn es dir nichts ausmacht, habe ich darum gebeten, als dein persönlicher Diener eingesetzt zu werden, solange du hier bist.«
»Nichts wäre mir lieber.« Radu sah zu, wie Amal das Pferd wegführte und verzögerte sein Eintreten in den Palast.
Ein kleines Bündel stürzte lebhaft auf ihn zu. Radu hatte kaum die Möglichkeit, seine Arme auszustrecken, als sich ein Junge in sie hineinwarf.
»Radu! Er hat gesagt, du wärst hier!«
Radu wich zurück und sah in das engelsgleiche Gesicht von Manuel, einem der beiden Erben des gefallenen Kaisers Konstantin. Radu war zurückgeblieben, als Nazira, Cyprian und Valentin aufbrachen, um Konstantins Erben zu retten. Sie waren sein Versuch der Wiedergutmachung für alles, was er während der Belagerung getan hatte, und für jeden, den er verraten hatte. Er hatte die Erlösung bei Weitem nicht erreicht, aber als er Manuel – den lebendigen, gesunden, glücklichen Manuel – in seinen Armen hielt, empfand Radu zum ersten Mal seit Monaten wieder Freude. Lachend zog Radu ihn zu sich heran und drückte ihm einen Kuss auf den Scheitel.
Von all dem Leben, das er in die Stadt hatte zurückkehren sehen, war dieses kleine Leben das Beste, was er sich hätte erhoffen können. »Wo ist dein Bruder?«
Manuel befreite sich und rückte seine Kleidung zurecht. Er trug ein Seidengewand im Stil der Osmanen. Es war weit entfernt von der steifen und strukturierten byzantinischen Kleidung, die er zuvor getragen hatte. »Murad ist drinnen und wartet. Er ist jetzt zu alt, um zu rennen, sagt er.«
»Murad?«, fragte Radu verblüfft. Das war der Name von Mehmeds Vater gewesen.
Manuel strahlte. »Ja. Und ich bin Mesih. Der Sultan hat mir erlaubt, ihn selbst auszusuchen.«
»Ihr habt neue Namen.« Radu runzelte die Stirn.
»Wir hielten es für das Beste. Es ist ein neues Imperium! Ein neuer Anfang. Eine Wiedergeburt, haben wir beschlossen.«
»Wir?«, fragte Radu.
»Ja, Murad und ich. Und der Sultan.«
Mehmed hatte also ernst gemeint, was er gesagt hatte, nämlich dass er die Jungen zu einem Teil seines Hofes machen würde. Radu war froh zu hören, dass dieses Versprechen eingehalten worden war. Und er nahm an, dass die Umbenennung der Jungen sinnvoll war. Er selbst hatte sich endlich eingewöhnen und sein neues Leben akzeptieren können, als er das Gefühl hatte, wirklich dazuzugehören. Es war wahrscheinlich das Beste für die Jungen, sich von dem zu lösen, was sie gewesen waren, um das Trauma und den Verlust der Vergangenheit zu vergessen. Manuel – Mesih – schien auf jeden Fall glücklich genug zu sein.
Wenn nur Radu Beys neuer Name die gleiche Wirkung gehabt hätte.
Mesih nahm Radus Hand und zog ihn tiefer in den Palast hinein. Er plapperte ununterbrochen, erzählte Radu, was es wohl zum Abendessen geben würde, und fragte, ob Radu mit ihnen zum Abendgebet in die Hagia Sophia gehen würde oder ob er woanders beten würde. Dann erzählte er von seinem Unterricht, von den Lehrern, die er am liebsten mochte, und davon, dass seine Schrift viel besser war als die seines Bruders. »Und du hast gewiss bemerkt, wie gut mein Türkisch ist.«
Radu lachte. »Das habe ich. Ich könnte mir das den ganzen Tag anhören.« Und er vermutete, dass er das auch tun würde, bis sie getrennt wurden. Doch etwas nagte an Radu, als Mesih seine Lektionen weiter beschrieb.
Er erkannte mit einem Schmerz, der zugleich glücklich und traurig war, was anders war: Dieser Junge erhielt eine echte Erziehung ohne Grausamkeit. Es gab keine Besuche beim Obersten Gärtner, keine Lehrausflüge zu den Gefängnissen und Folterkammern, keine Schläge. Dies war nicht die gleiche Kindheit, die Radu und Lada unter einem Sultan erlebt hatten.
Mehmed war nicht sein Vater. Er hatte die Stadt eingenommen und etwas Besseres daraus gemacht. Er hatte die Erben seines Feindes genommen und sie zu seiner Familie gemacht. Das Grauen, das Radu beim Gedanken an das Wiedersehen mit seinem ältesten Freund empfunden hatte, verflog. Es lag immer noch viel Distanz zwischen ihnen, aber zumindest hatte Radu nicht zu Unrecht an die Fähigkeit Mehmeds geglaubt, Großes zu vollbringen.
»Geht es dir gut, Radu Bey?«, erkundigte sich Mesih.
Radu zog die Nase hoch und räusperte sich. »Ja, mir geht es gut. Oder zumindest denke ich, dass es so sein wird.«
3
Tergowiste
Hätte Lada gewusst, unter wie viel Pergament sie begraben werden würde, hätte sie vielleicht einen anderen Titel als Fürst angenommen. Sie war gestärkt von ihrem Besuch bei ihrer Festung zurückgekehrt, nur um einen Haufen Briefe vorzufinden, die auf sie warteten.
Lada stöhnte und beugte ihren Kopf vor. Die Bürste, mit der Oana durch ihr Haar fuhr, verfing sich in einem Knoten.
»Setz dich aufrecht hin«, schnauzte Oana.
»Ich will das nicht tun.« Lada wies mit einer schwachen Geste auf den Tisch, der mit Forderungen nach ihrer Zeit und Aufmerksamkeit bedeckt war.
»Tja, ich würde ja helfen, aber ich kann nicht lesen.«
»Da kannst du dich glücklich schätzen.« Lada setzte sich auf den Boden neben dem Tisch und fegte einen Stapel von Briefen auf ihren Schoß. »Geh und such Stefan. Ich möchte mit ihm sprechen, falls sich einer von denen hier als interessant erweist.« Lada begann zu sortieren.
Bojar bittet um Schadenersatz für den Verlust eines Verwandten – wurde auf einen Haufen in der Ecke geworfen.
Bojar bittet um ein Treffen, um die Beschlagnahme von Land für Ladas eigene Zwecke zu besprechen – derselbe Haufen.
Brief von ihrem Cousin Stefan, dem König von Moldawien. Diesen las sie sorgfältig. Sie war ihm noch nie begegnet, aber er hatte einen sehr guten Ruf. Er schrieb, um ihr zur Thronbesteigung zu gratulieren und sie für die Berichte über Ordnung und Frieden in ihrem Land zu loben. Er sagte nichts über ihre Mutter. Das versetzte Lada einen dunklen Schauer rachsüchtiger Freude. Ihre Mutter hatte fast zwanghaft von seinen jährlichen Besuchen gesprochen. Er war einer der Höhepunkte in Vasilissas traurigem, einsamen Leben, während sie in seinem Leben nicht einmal zur Kenntnis genommen wurde.
Doch dann trübte das Ende des Briefes ihre Freude etwas. Bitte achte darauf, unsere Nachbarn nicht zu verärgern. Lass mich wissen, wenn du neue Bedingungen mit dem Sultan hast. Ich bin ausgesprochen gespannt, sie zu hören.
Mit einem finsteren Blick warf sie den Brief zu den Forderungen der Bojaren. »Von Matthias Corvinus«, sagte Stefan und reichte ihr einen schmalen Brief.
Lada wusste nicht, wann er den Raum betreten hatte, wollte ihm aber nicht die Genugtuung bereiten, auf seine Heimlichkeit zu reagieren. Sie war immer noch wütend auf ihn, weil er es versäumt hatte, sie auf Nicolaes Anwesen zu treffen. »Lies du ihn. Ich habe keine Lust.« Sie nahm einen anderen Brief in die Hand, noch mehr Unsinn von einem keifenden Bojaren.
»Matthias will dich treffen. Er sagt, ihr habt viel zu besprechen.«
»Ich habe ihm nichts zu sagen. Wir haben beide bekommen, was wir verdient haben. Was mich betrifft, ist unsere Beziehung beendet.«
Stefan hielt ihr den Brief hin. »Wir wollen ihn als Verbündeten.«
»›Wir?‹ Ich will ihn nicht als irgendetwas.«
Stefan ließ seine Hand nicht sinken und änderte auch nicht seine teilnahmslose Miene. Frustriert knurrend schnappte sich Lada den Brief und legte ihn neben sich, aber nicht auf den Stapel zum Verbrennen. »Also gut.«
Stefan hob einen weiteren Brief auf. »Dieser hier ist von Mara Brankovic. Sie ist …« Er hielt inne, seine Augen suchten die Luft ab, während er eine der Tausenden von gespeicherten Informationen, die er immer bei sich trug, abrief. »Die Tochter des serbischen Königs. Witwe von Sultan Murad.«
Lada öffnete diesen Brief mit mehr Neugierde, als sie bisher bei irgendeinem anderen Brief empfunden hatte. Maras Handschrift war perfekt und elegant. Es gab nicht einen einzigen Tintenfleck an falscher Stelle. Lada las den Brief zweimal, um sicherzugehen, dass sie ihn verstand. »Mara ist nach Konstantinopel gegangen und hat sich Mehmeds Hof als eine seiner Beraterinnen angeschlossen. Hast du schon jemals so etwas gehört? Sie war so erpicht darauf, Edirne zu entkommen, und jetzt kehrt sie freiwillig ins Reich zurück?«
»Ich habe noch nie gehört, dass eine ausländische Frau einen Sultan beraten hat.«
Lada runzelte die Stirn und überflog die Worte. »Aber das ist klug von ihm. Sie ist sehr gescheit. Und als Angehörige des serbischen Königshauses hat sie Beziehungen und kann besser mit Europäern umgehen als er. Sie ist die perfekte Wahl, um die Beziehungen zu beruhigen.« Lada lehnte sich zurück und klopfte mit dem Brief gegen ihr Bein. Mehmed profitierte offensichtlich davon, aber Mara war nicht der Typ, sich in eine Situation zu begeben, die sie nicht wollte. Ihre Ehe mit Murad war zwar erzwungen worden, aber sie hatte das Beste daraus gemacht. Und sie war fortgegangen, um zu ihrer Familie zurückzukehren.
Ah. Das war ihre Motivation. Sie war noch jung genug, um für eine politische Heirat verlockend zu sein. Durch diesen Schritt und diese Position war sie der Macht ihres Vaters völlig entzogen. Sie war nun im Grunde genommen für immer frei. Kluge Frau!
»Was will sie von dir?«, wollte Stefan wissen.
»Hm?« Lada blickte auf, aufgewühlt von ihren Erinnerungen an die Mahlzeiten mit Mara, bei denen die ältere Frau sie beraten hatte, wie sie die Anforderungen der Gesellschaft nutzen konnte, um sich eine stabile Position zu schaffen. Lada mochte ihre Methoden nicht, aber sie konnte nicht leugnen, dass Mara wusste, was sie tat. »Oh, sie bittet mich, Konstantinopel zu besuchen. Sie lässt es wie einen Freundschaftsbesuch klingen. ›Komm und besuche den Palast! Wir werden essen, in den Gärten spazieren gehen und darüber diskutieren, wie du Mehmed und sein schreckliches Reich weiterhin dein Leben diktieren lassen solltest!‹ Ich frage mich, ob sie sich das selbst ausgedacht hat oder ob Mehmed sie gebeten hat zu schreiben, weil er glaubt, unsere frühere Verbindung würde mich beeinflussen.« Lada wusste nicht, was sie lieber glauben würde: dass Mara versuchte, sie zu manipulieren – daran hätte sie keine Zweifel, und es würde sie auch nicht stören –, oder dass Mehmed versuchte, mit allen Mitteln an sie heranzukommen.
Aber wenn das der Fall wäre, hätte man bestimmt Radu geschickt. Oder zumindest schreiben lassen. Sie hatte nichts mehr von ihm gehört, seit er ihr in einem Brief vom Fall Konstantinopels und seinem neuen Titel als Radu Bey berichtet hatte.
Vielleicht bedeutete seine Abwesenheit, dass Radu endlich nicht mehr unter Mehmeds Fuchtel stand. Denn Mehmed würde niemals versäumen, sich einen Vorteil wie Radu zunutze zu machen – nicht, wenn er die Wahl hätte.
»Wir sollten meinem Bruder schreiben«, sagte Lada und nahm einen anderen Brief in die Hand.
»Um ihn zu bitten, zurückzukommen und zu helfen?«
»Nein.« Sie warf den Brief beiseite, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. »Ich habe gelernt, selbst mit den Bojaren fertigzuwerden. Ich brauche ihn für nichts. Aber er könnte eine nützliche Quelle für Informationen über Mehmed sein.« Lada konnte das als Grund akzeptieren. Der andere kleinere Grund war, dass sie ihn vermisste. Sie hatte um sein Leben in Konstantinopel gebangt und sich gefragt, was dort mit ihm geschehen war. Es gefiel ihr nicht, sich so zu fühlen. Radu war derjenige, der vermisste, der trauerte.
»Vom Papst«, sagte Stefan und reichte ihr einen weiteren Brief. »Er verflucht die Ungläubigen und ruft Zerstörung vom Himmel auf ihr Reich herab. Und dann mahnt er zum Frieden.«
»Er sollte sich mal entscheiden.« Lada warf den Brief des Papstes auf den Haufen, der verbrannt werden sollte. »Ich wünschte, ich hätte ein Land ohne Grenzen. Ich wünschte, ich hätte eine Insel.« Sie stand auf und musterte den Rest der Briefe. Forderungen und Bitten, Bündnisse und Feinde, die Feinheiten der Politik eines Dutzends Länder und eines sich ausbreitenden Reiches schrien nach ihrer Aufmerksamkeit.
Sie sammelte sie alle ein und warf sie ins Feuer. Die Reste von Pergamentstaub und Siegellack wischte sie leichthin an ihrer Reithose ab. »Ich gehe zu den Ställen. Es ist ein schöner Nachmittag für einen Ausritt.«
Zwei Wochen später tauchten türkische Botschafter unangekündigt und uneingeladen mit einer Janitschareneskorte auf. Lada ließ ihre eigenen Männer die Wände des Raumes säumen, um ihre Macht zu demonstrieren. Sie waren den Janitscharen zahlenmäßig drei zu eins überlegen. Ihre Männer, von denen einige ehemalige Janitscharen waren, blickten kalt umher.
Lada lümmelte auf ihrem Thron, ein Bein über die Armlehne drapiert. Sie wippte ungeduldig mit dem Fuß in der Luft. Sie konnte an den verwirrten Blicken und dem schlurfenden Gang der Botschafter sehen, dass ihr Mangel an Anstand sie nervös machte.
Sie lächelte.
»Dies ist die Walachei. Setzt aus Respekt eure Mützen ab.«
Weder die Janitscharen mit ihren zylindrischen weißen Flügelmützen noch die Botschafter mit ihren Turbanen machten Anstalten, ihrem Befehl zu folgen.
Der führende Botschafter, ein älterer Mann mit silbergrauem Bart und verschlagenen Augen, zog abschätzig eine Augenbraue hoch. »Wir überbringen die Bedingungen für Euer Vasallentum von unserem Sultan, der Hand Gottes auf Erden, Kaiser von Rom, Mehmed dem Eroberer.«
Lada tippte sich nachdenklich ans Kinn. »Was für eine Last, die Hand Gottes zu sein! Ich frage mich, welche Hand das ist? Gottes rechte oder Gottes linke Hand? Wenn Mehmed seinen Hintern mit der Hand, die die Hand Gottes ist, statt mit seiner eigenen Hand putzen würde, würde er dann wegen Gotteslästerung niedergestreckt werden?«
Viele ihrer Männer im Raum lachten schallend und Lada errötete vor Vergnügen. Aber Bogdan wandte seinen Blick ab. Er hasste es, wenn sie auf diese Weise über Gott sprach. Das war eine gute Mahnung. Sie konnte mit Gott nichts anfangen, aber die meisten ihres Volkes konnten es, und alles, was Glauben und Überzeugung beinhaltete, war eine Quelle der Macht. Sie hatte gesehen, was Mehmed aufgrund seines unerschütterlichen Glaubens vollbracht hatte. Sie hatte gesehen, wie derselbe Glaube ihr ihren eigenen Bruder geraubt hatte. Glaube ist Macht. Sie wusste, dass sie nichts einfach abtun durfte, was ihr Macht über andere gab. Sie setzte sich aufrecht hin. »Unser Gott, der wahre Gott des Christentums, ist ohne Gestalt und daher ohne Hände. Wir lehnen den Titel eures Sultans und seine Autorität ab. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht.«
»Da ist noch etwas anderes.« Der Hauptmann der Janitscharen trat vor. Er war kompakt und breit, die jahrelange Ausbildung war ihm bei jeder Bewegung anzusehen. Sie hatte fast vergessen, wie perfekt die Janitscharen waren. Sie wurde unruhig, wenn sie an die Männer dachte, die sie jetzt anführte. Sie waren nichts im Vergleich zu diesen Soldaten, die von Kindesbeinen an zu Waffen des Sultans ausgebildet worden waren. Der Hauptmann fuhr fort: »Auf unserer Reise hierher sind wir durch Bulgarien gekommen. Es scheint, dass es entlang Eurer Grenze einige Konflikte gegeben hat. Mehrere walachische Dörfer wurden niedergebrannt.«
Lada konnte nicht glauben, dass sie das jetzt von einem Feind und nicht von ihren eigenen Leuten erfuhr. Sie hasste es, von ihm unter die Nase gerieben zu bekommen, dass er mehr Informationen hatte als sie selbst. »Ich habe darüber noch keine Berichte erhalten.«
Er änderte seinen Ausdruck nicht, der so scharf und unnachgiebig wie Stahl war. »Alle Walachen waren tot. Das ist bedauerlich. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Missverständnis. Aber sobald die Bedingungen Eures Vasallentums gesichert sind, wird Bulgarien ein mächtiger Verbündeter sein und solche Konflikte werden aufhören. Der Sultan beschützt seine Vasallen.«
Dieser Mann, dieser Osmane glaubte, er könne hierherkommen und ihr von Angriffen auf ihr eigenes Land erzählen – vom Abschlachten ihres eigenen Volkes –, um sie zu zwingen, der osmanischen Herrschaft zuzustimmen? Als würden tote Walachen irgendwie dafür sprechen, sich mit denen zu verbünden, die sie getötet hatten? Und es ergab keinen Sinn, dass er vor ihr davon erfahren hatte.
Es sei denn, er käme direkt von der Tat selbst. Lada beugte sich vor, ihre Stimme war kalt. »Du hast mein Volk getötet.«
Das Lächeln des Hauptmanns der Janitscharen erreichte nicht seine Augen. »Nein. Die Bulgaren haben Euer Volk an einer chaotischen Grenze getötet. Die Bedingungen des Sultans beseitigen dieses Chaos. Ein solider Vertrag, der in vollem Umfang eingehalten wird, wird Euer Volk schützen.«
Lada entblößte ihre kleinen weißen Zähne. Es war kein Lächeln. »Ich schütze mein Volk. Ich räche es auch. Und ihr habt mir nichts über Respekt beizubringen. Keiner von euch hat mir den Respekt erwiesen, seine Mütze abzunehmen.« Sie stand auf. »Bindet sie.«
Ihre Männer traten sofort in Aktion. Der Janitscharen-Hauptmann und seine Soldaten wehrten sich, aber man hatte ihnen nicht erlaubt, Waffen in den Thronsaal mitzubringen. Alle wurden überwältigt, allerdings nicht ohne einen Kampf und mehrere gebrochene Nasen.
Der führende Botschafter sah Lada mit Mordlust in den Augen an. »Ihr könnt uns nichts tun. Ihr wollt nicht riskieren, was das nach sich ziehen wird.«
»Du hast dir keine Gedanken darüber gemacht, welches Risiko das Töten von Angehörigen meines Volkes nach sich ziehen würde.« Lada kochte vor Wut. Sie waren in ihr Land gekommen. Sie hatten Walachen abgeschlachtet, die unter ihrem Schutz standen. Im Gegensatz zu Briefen durfte Derartiges nicht unbeantwortet bleiben. Sie würde eine Botschaft senden, die in Mehmeds Reich und in ganz Europa ein Echo finden würde.
Sie umkreiste den Botschafter und zerrte dann an den Rändern seines Turbans. »Ich werde euch helfen. Wenn es euch so wichtig war, eure Köpfe in meiner Gegenwart bedeckt zu lassen, so wichtig, dass es wert war, einen Fürsten zu missachten, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr eure Köpfe nie wieder entblößen müsst.« Lada wandte sich an Bogdan. »Bring mir Nägel und einen Hammer.«
Endlich zitterte der führende Botschafter. Endlich sah er, wie Lada auf die Missachtung und den Tod ihres eigenen Volkes reagierte.
Lada stand in der Ecke des Thronsaals, als ihre Männer Nägel in die Köpfe der Osmanen schlugen. Wie immer zwang sie sich zum Zuschauen. Es wäre einfacher gewesen, das abseits erledigen zu lassen. In einem versteckten Kerker. Aber nein. Sie würde Zeuge der Dinge sein, die getan werden mussten, damit die Walachei sicher war. Das war ihre Bürde, ihre Verantwortung.
Ihre Schreie waren laut. In einem hellen, blutigen Lichtblitz erinnerte sie sich an einen ihrer vielen Ausflüge in der Kindheit, um die brutale Arbeit der Folterknechte des Sultans zu beobachten. Der Preis für Stabilität wurde immer mit Blut, Fleisch und Schmerz bezahlt.
Sie sah zu, aber wie aus weiter Ferne.
Sie waren keine Männer. Sie waren erreichte Ziele. Sie waren keine Männer.
Eine plötzliche Welle der Erleichterung, dass Radu nicht hier war, überkam sie. Sie mochte sich seinen Gesichtsausdruck nicht vorstellen, wenn er hier wäre. Sie hatte immer versucht, ihn zu schützen, weil sie für ihn verantwortlich war. Jetzt war sie es für die ganze Walachei. Sie würde alles tun, was nötig war, um ihr Volk zu schützen.
Die Schreie hörten auf. Das war gut. Sie hatte andere Dinge zu tun.
»Schickt sie zurück zu ihrer Hand Gottes«, sagte sie und ließ ihren Blick über die Körper schweifen. Einige waren noch am Leben. Es war bedauerlich für sie, aber es würde nicht mehr lange dauern. »Sagt ihm, dass er mir Respekt erweisen wird.« Sie wandte sich an Bogdan, dessen Hände blutverschmiert waren.
Seine Mutter Oana würde diejenige sein, die es abwusch. Manche Dinge ändern sich nie. »Schick nach Nicolae und unseren Truppen. Wir haben in Bulgarien zu tun.«
4
Konstantinopel
Radu saß nicht so weit von Mehmed entfernt wie in Edirne, als sie vorgetäuscht hatten, er sei in Ungnade gefallen.
Aber hier saß niemand neben Mehmed. Er saß an einem Tisch auf einem Podest, am Kopfende des Raumes und getrennt von allen anderen.
Radu war dankbar, dass er unter Konstantin nicht viel Zeit im Palast verbracht hatte, sodass dieser Raum neu für ihn war. Schillernde blaue und goldene Kacheln bedeckten die Wände in floralen Mustern, die bis zur mit Blattgold umrandeten Decke reichten. Über ihren Köpfen hing ein schwerer Kronleuchter. Immerhin wirkte dieser authentisch. Doch Radu vermutete, dass sich unter den Kacheln die eher byzantinisch geprägten religiösen Wandmalereien befanden. Mehmed beanspruchte jeden Zentimeter der Stadt für sich, ein Mosaik nach dem anderen.
Radu war zu spät gekommen – wegen seines Abstechers in die Stadt hatte er den Beginn des Essens verpasst –, und so nahm er nach dem Waschen einen Platz neben seiner alten Freundin Urbana und einer Frau ein, die er vage von Murads Hof erkannte. Es war ungewöhnlich, dass so viele Frauen an einem formellen Abendessen teilnahmen. Murad hatte sie völlig ausgeschlossen. Aber Radu fühlte sich wohl und war froh, neben Urbana zu sitzen. Sie hatte sich durch die Belagerung nicht verändert, abgesehen von der glänzenden Brandnarbe, die ihr halbes Gesicht verunstaltete. Sie roch schwach nach Schießpulver und hatte schwarze Brandspuren an allen Fingern.
Unverändert war auch Urbanas Abneigung gegen das osmanische Essen. Sie beschwerte sich immer wieder auf Ungarisch bei der anderen Frau. Radu starrte entschlossen auf seinen Teller und vermied es, Mehmed anzuschauen. Warum hatte Mehmed ihn zurück in die Stadt gerufen? Wie würde es sich anfühlen, wieder mit ihm zu sprechen? Als Radu sechs Monate zuvor abgereist war, war Mehmed so sehr mit der Planung und dem Wiederaufbau beschäftigt gewesen, dass sie sich kaum gesehen hatten. Hatte Mehmed ihn vermisst?
Hatte Radu Mehmed vermisst?
Als er aufblickte, krampfte sich sein Magen zusammen und sein Puls raste, als er den anderen Mann sah. Ja, er hatte ihn vermisst. Aber es war nicht die gleiche leichte Sehnsucht, die er früher erlebt hatte.
Mehmed war in Purpur gehüllt. Sein goldener Turban, der mit einer kunstvollen Brosche aus Gold und Rubinen befestigt war, umgab sein Haupt. Er war mittlerweile einundzwanzig und seine Gesichtszüge waren jetzt erwachsen. Seine Augen waren scharf und intelligent, seine Augenbrauen fein geformt, seine vollen Lippen statisch und ausdruckslos. Radu sehnte sich danach, dass sie sich zu einem Lächeln verzogen, dass sich in den Winkeln von Mehmeds ernsten Augen vor Freude Fältchen zeigten.
Aber Mehmed, sein Freund, war zu Mehmed, dem Sultan, geworden. Es war, als würde Radu eine Zeichnung von einem geliebten Menschen betrachten. Er erkannte Mehmed wieder und spürte gleichzeitig, dass sich etwas auf beunruhigende Weise verändert hatte und verloren gegangen war, als es auf Papier festgehalten wurde.
Ein Diener kniete neben Radu. »Erlaubt mir, einen Willkommensgruß vom Sultan zu übermitteln. Nach dem Essen werde ich Euch in sein Empfangszimmer geleiten, wo Ihr auf Eure Audienz warten könnt.« Der Diener verbeugte sich, dann zog er sich zurück. Radu war erschrocken. Er hatte noch nie eine Audienz bei Mehmed gehabt. Vor allem keine, die von Dienern angesetzt worden waren.
Das hatte nichts mit dem zu tun, wie Murad seinen Hof geführt hatte. Es war immer erlaubt gewesen, dass sich Günstlinge um ihn herum tummelten, neben ihm saßen. Er war der Mittelpunkt von allem gewesen, hatte in Festen und engen Beziehungen geschwelgt. Doch selbst dieses Mahl war ein Beweis dafür, dass Mehmed in einer viel förmlicheren Funktion regierte. Er zog sich nicht aufs Land zurück, um mit Philosophen zu träumen. Er ließ nicht zu, dass Berater wie Halil Pascha – der vor Monaten bei einer Machtdemonstration, an der Radu nicht teilgenommen hatte, öffentlich hingerichtet worden war – und seinesgleichen in den Genuss der Gunst und damit der Macht kamen.
Radu fragte sich, ob die Distanz, die Mehmed in der Öffentlichkeit geschaffen hatte, auch im Privaten fortbestehen würde. Oder würde er einfach durch Boten mit Radu kommunizieren und für immer getrennt bleiben?
»Wie geht es deiner Schwester, Radu Bey?«
Radu blickte überrascht auf. Die Frau, die zu Murads Hofstaat gehörte, hatte gesprochen. Sie war ein Paradoxon von herber Eleganz. Alles an ihr war nach europäischen Maßstäben geradezu modisch, ihr kunstvolles Kleid und ihr Haar wirkten wie eine Barriere zwischen ihr und der Welt. Sie saß aufrecht, die Röcke unbeholfen um sich geschlungen, anstatt sich auf einen Ellbogen zu stützen wie viele der anderen Gäste am Tisch.
»Es tut mir leid, ich erinnere mich nicht an deinen Namen.« Radu lächelte entschuldigend.
»Mara Brankovic. Ich war eine der Ehefrauen von Murad.«
»Ah, ja! Du hast die neuen Bedingungen für das Vasallentum Serbiens ausgehandelt.« Es war ihr abschließender Zug gewesen, ein Heiratsangebot von Konstantin zu nutzen, um ihre eigene Freiheit und bessere Rechte für ihr Land auszuhandeln. Mehmed hatte sie dafür bewundert.
Ohne es zu merken, starrte Radu erneut auf Mehmed. Er zwang sich, seinen Blick wieder auf Mara zu richten. »Was führt dich in das Reich?«
Sie richtete ihren Blick auf Mehmed. Ihr Blick war voller Zuneigung. »Ein Führer, der meinen Wert anerkennt. Ich bin hier als Beraterin in europäischen Fragen. Ich helfe beim Umgang mit den Venezianern. Den Serben natürlich auch. Und einem lästigen kleinen Land, mit dem du gut vertraut bist. Und dem du verwandtschaftlich verbunden bist.« Sie lachte leichthin über ihren eigenen Scherz.
»Du fragst also nicht aus Höflichkeit nach meiner Schwester.«
»Doch, das tue ich! Umgangsformen sind der Kern meiner Rolle hier.« Ihr Tonfall war angenehm trocken. »Es ist erstaunlich, was man durch höfliches Nachfragen erreichen kann. Außerdem mochte ich Lada sehr. Auch wenn sie töricht war, eine Ehe mit Mehmed abzulehnen. Sie hätte es ziemlich gut getroffen.«
Radu betrachtete seinen Teller, der nun mit winzigen Stücken von Fladenbrot gefüllt war, die er zerrissen hatte. »Ziemlich gut hätte ihr niemals gereicht.«
Mara lachte. Urbana lenkte ihre Aufmerksamkeit auf sich, um darauf hinzuweisen, wie viel schlimmer ungesäuertes Brot sei, und Radu war wieder seinen eigenen Gedanken überlassen. Die zu seiner Überraschung nicht bei der Person auf dem Podium verweilten. »Mara«, unterbrach er sie. »Hast du irgendwelche Kontakte in Zypern?«
Sie runzelte nachdenklich die Stirn. »Nicht persönlich, aber ich bin sicher, dass ich jemanden kenne, der welche hat. Warum?«
»Ich suche nach Neuigkeiten von meiner Frau und meinen … Freunden. Sie sind beim Fall der Stadt geflohen und ich habe seitdem nichts mehr von ihnen gehört.«
Mara legte eine Hand auf seine. Ihre dunklen Augen waren mitfühlend und ernst. »Schreib mir ihre Namen und alle wichtigen Details auf. Ich werde alle meine Ressourcen darauf ansetzen.«
»Danke«, sagte Radu. »Ich habe zusammen mit Kumal Pascha gesucht und …«
»Er ist sehr gut aussehend.« Urbana sagte es in demselben Ton, in dem sie über die Qualität des Metalls für den Kanonenguss oder über das Wetter sprechen würde. »Er wirkt nicht so, als wäre er jemals gewalttätig. Und er ist schon seit einiger Zeit Witwer.«
Radu konnte dem Wechsel im Gespräch nicht ganz folgen. »Machst du … ihm den Hof?«
Urbana warf ihm denselben angewiderten Blick zu, den sie auf das gewürzte Fleisch gerichtet hatte. »Ich meinte für Mara. Ich habe weder Verwendung noch Zeit für einen Ehemann.«
Mara wechselte einen leidgeprüften Blick mit Radu. »Urbana macht sich Sorgen, dass meine gebärfähigen Jahre schnell schwinden. Sie spricht oft davon.« Sie seufzte schwer. »Sehr oft.«
Radu hätte beinahe gelacht, aber es versetzte ihm einen Stich, als er sich daran erinnerte, wie Urbana sich in sein Privatleben – und das Fehlen von Babys – mit Nazira eingemischt hatte. Nazira sollte hier sein, an seiner Seite. Nein. Sie sollte an Fatimas Seite sein. Und es war seine Schuld, dass sie es nicht war.
»Du könntest Radu heiraten«, sagte Urbana nachdenklich. »Er ist ziemlich jung für dich. Achtzehn, jetzt? Aber er hat seine erste Frau sehr jung geheiratet, also macht es ihm nichts aus. Er ist sehr gütig und nicht jähzornig. Die Mädchen haben mir immer erzählt, wie gut er aussieht, mit seinen großen dunklen Augen und seinem markanten Kiefer.« Sie schaute Radu auf eine Weise an, die ihm sehr unangenehm war. »Ich glaube, ich verstehe, was sie meinten. Immerhin ist er groß und gesund. Und da seine Frau verschwunden ist, fehlt es ihm an Gesellschaft.«
Radu verschluckte sich an dem Stück Brot in seinem Mund. Er stand auf, unfähig, an diesem Ort, der ihm so viel genommen hatte, eine Mahlzeit einzunehmen. Wenn Mehmed ihn hier haben wollte, würde er hier sein. Aber er konnte nicht so tun, als sei alles normal. Er konnte keine Gespräche über seine Zukunft führen, als würde sich seine Vergangenheit nicht wie eine Schlinge um seinen Hals legen und ihn mit Bedauern und Kummer ersticken.
In diesem Moment öffneten sich die Türen des Festsaals. Eine Prozession unbewaffneter Männer mit grober Kleidung unter feinen schwarzen Umhängen trat ein und zerrte und schob große Holzkisten herein. Mehmeds Janitscharen standen bereit und beobachteten alles mit zusammengekniffenen Augen. Ein Diener eilte an ihnen vorbei und verbeugte sich am Fuße von Mehmeds Podest. »Sie wollten nicht warten«, sagte er mit zitternder Stimme.
Der Anführer der Männer verbeugte sich ebenfalls und streckte übertrieben einen Arm aus. Seine Stiefel waren schmutzig und seine Kleidung staubig. Sie waren wohl gerade erst angekommen. Radu sah genauer hin und stellte fest, dass alle Männer Umhänge mit dem Siegel der Familie Dracul trugen. Dieses bestand aus einem Drachen und einem Kreuz, das dem Drachenorden entlehnt war. Es fühlte sich falsch an, es hier zu sehen. Radus ohnehin schon zerbrechliche Gefühle schreckten vor dem Symbol seiner Familie zurück. Seiner Vergangenheit.