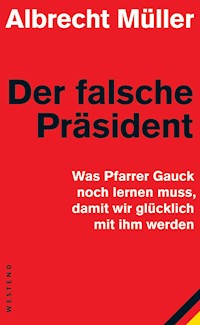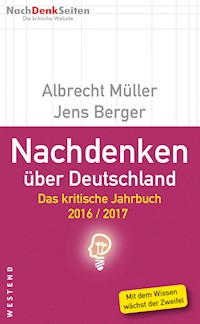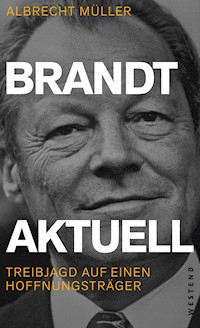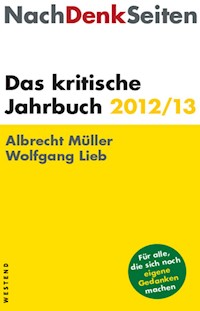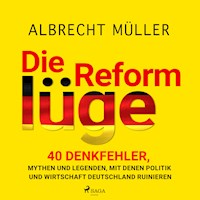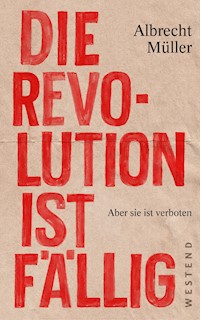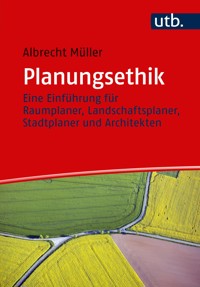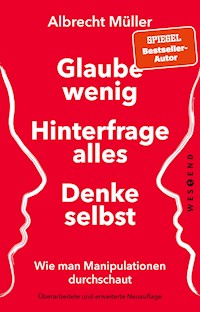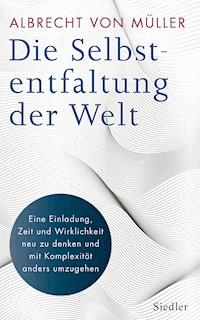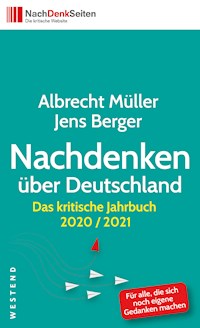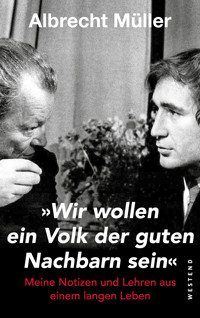
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Albrecht Müller, Jahrgang 1938, gehört zu den wenigen noch lebenden Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs. Als Kind erlebte er Bombennächte, brennende Städte, Flüchtlinge und Kriegsversehrte - Erfahrungen, die sein Leben und Denken prägten. Mit eindringlicher Klarheit schildert er, warum "Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein" mehr sein muss als eine historische Parole: Es ist eine Verpflichtung für Gegenwart und Zukunft. Doch Müller blickt nicht nur zurück. Er berichtet von seinen politischen Stationen - als Redenschreiber Karl Schillers, Wahlkampfleiter für Willy Brandt und Mitgestalter der Ostpolitik - und zieht Lehren aus Jahrzehnten öffentlicher Verantwortung. Persönlich, streitbar und nachdenklich verbindet er Erinnerungen mit Analysen. Ein Buch, das zum Nachdenken zwingt - und Mut macht, für Frieden, Vernunft und Menschlichkeit einzutreten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ebook Edition
Inhalt
Titelbild
Einführung
Teil 1 Nie wieder Krieg
Gute Nachbarschaft oder Abschreckung und notfalls Krieg. Die zwei Versionen des Umgangs der Völker miteinander persönlich erlebt.
Das ist nicht nur eine Zeitenwende. Wir sind in irre, geradezu perverse Zeiten geraten.
So sieht Krieg aus: fürchterlich. Persönliche Erinnerungen
Marschflugkörper für den »Endsieg«
Millionen auf der Flucht
Zwangsarbeiter
Die Nachkriegsparole »Nie wieder Krieg« war nicht lange aktuell. Abschreckung, Wiederbewaffnung folgte.
Das Gaunerstück Konrad Adenauers
Als der Kalte Krieg so richtig auf Touren gekommen war, gab es erste Überlegungen zu einem Kurswechsel.
»Wandel durch Annäherung«
Wichtig: Vertrauensbildende Maßnahmen
Wie kam es zum Abschied von der Vertrags- und Verständigungspolitik gegenüber Russland?
Es gab einige markante Stationen der Wiederbelebung der Konfrontation zwischen dem Westen und Russland.
Die Verantwortlichen in Russland haben den Aufbau der neuen Front an ihrer Westgrenze erstaunlich lange nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. Dazu nur ein Indiz von vielen:
Eine neue Entspannungspolitik ist dringend notwendig. Sie ist überlebensnotwendig.
Was ist zu tun?
Teil II … und andere Lehren aus einem langen Leben
Frühe Politisierung durch Kriegserlebnisse und – seltsam – Flurbereinigung
Begegnung und Freundschaft mit Juden aus Mannheim und Haifa
Bewundernswerte Initiativen unserer Lehrer – trotz knapper Mittel und trotz schwieriger Zeiten
Ein volles Haus – das Beste, was einem Kind und Jugendlichen passieren kann
Die Toleranz einer Region
Sehr früh an Arbeit gewöhnt. Das war nicht immer schön.
Vom Glück, eine ältere und noch dazu besonders liebevolle Schwester zu haben
Eine Idee von 1948 trägt auch heute noch – Studierende vorher an die Werkbank
»Es gibt zu jeder Vorlesung eines jeden Professors ein besseres Buch.«
Fachlich gut. Aber wo bleibt die Anwendung der Erkenntnisse? Zur Gründung des Wirtschaftspolitischen Clubs
Leben und arbeiten, wo früher die Münchner Marktfrauen ihre Moosröschen pflückten
Vom Diplom-Volkswirt zum Spezialisten für Wahlkämpfe. Oder: Drei persönliche Beiträge zur politischen Veränderung und zur Absicherung dieser Veränderungen in der Bundesrepublik Deutschland
Exkurs: Die Übernahme des Bundeswirtschaftsministeriums durch einen Sozialdemokraten im Dezember 1966 hat sich im Personal des Bundeswirtschaftsministeriums nahezu nicht niedergeschlagen. Kein Hauch von links
Eine Partei mit fast einer Million Mitgliedern, aber ohne ein Mittel zur Kommunikation
Respekt vor den inhaltlichen und programmatischen Fähigkeiten von Parteimitgliedern – Beispiel Steuerreformkommission
1972 – »Die Mutter aller Wahlschlachten« Kampf gegen das Große Geld – entscheidend für den Wahlerfolg von 1972. 45,8 Prozent für Brandts SPD. Ein Wahlkampf mit vielen Neuerungen
Die große Rolle des »Großen Geldes«
Aufbau einer weitgehend medienunabhängigen Gegenöffentlichkeit
Der damalige Vorgang, die Intervention des Großen Geldes im Bundestagswahlkampf 1972, wäre beispielsweise auch bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 beeindruckend aktuell gewesen.
Der Wahlkampf war toll. Das Wahlergebnis war große Klasse. Die Wahlbeteiligung war spitze: 91,1 Prozent – vorher und nachher nicht erreicht.
Die Fertigmache Willy Brandts durch Herbert Wehner und Helmut Schmidt. Eigentlich unglaublich
»Den Aufschwung wählen«
»Wählen gehen statt Strauß«
Plädoyer für einen fernsehfreien Tag
OB-Kandidatur und Wahlkampf in Heidelberg
Die Entdeckung der Südpfalz
Pleisweiler Gespräche
Begründung, Themen und Gesprächspartner – eine Auswahl der bisherigen Pleisweiler Gespräche
Martinipreis
Schöne Ecken neu entdecken
Schluss mit der totalen Tiefflugbelastung
Verkehrsvermeidung
Rote Winzer
Club Vis-a-vis
Erfindung, Gründung und Herausgeberschaft der NachDenkSeiten
Anmerkungen
Navigationspunkte
Titelbild
Inhaltsverzeichnis
Albrecht Müller
Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein
Meine Notizen und Lehren aus einem langen Leben
Impressum
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2025
ISBN 978-3-98791-116-3
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg
Umschlaggestaltung: Buchgut Berlin
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Einführung
Zu diesen biografischen Notizen habe ich mich im Alter von 86 Jahren trotz des Schwurs, kein Buch mehr zu schreiben, entschlossen, und zwar weil mir immer wieder Menschen bzw. deren Texte in Medien begegnen, die vom Krieg reden, als sei dies eine harmlose Sache, als sei Krieg die mögliche Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. So ist es nicht. Kriege sind fürchterlich. Nie wieder Krieg – das ist der konsequente Schluss aus den Kriegserfahrungen.
Weil ich zu den wenigen noch lebenden Autoren gehöre, die den letzten großen Krieg in Deutschland, den Zweiten Weltkrieg, persönlich erlebt haben, schreibe ich darüber – über brennende Städte in unserer Nachbarschaft, über Ausgebombte, Flüchtlinge, Kriegskrüppel, Kriegerwitwen und vaterlose Kinder. Krieg und Frieden sind der Schwerpunkt meiner biografischen Notizen.
Ich hatte das Glück, immer wieder Dinge zu erleben, die von allgemeinem Interesse sind. Darüber möchte ich berichten – selbstverständlich mit der Absicht, andere Menschen zu Schlussfolgerungen anzuregen.
Kriege sind barbarisch. Kriege sind nicht auszuhalten. Kriege sind tödlich. Dass man so etwas heute öffentlich erklären muss, um jene zum Nachdenken zu bringen, die meinen, Kriege seien möglich und nötig … Das gibt es wieder. Verrückt, was man in 87 Jahren alles erleben kann.
Darüber hinaus aber – und das ist der zukunftsträchtigere Teil dieser Schrift – habe ich notiert, was interessant und lehrreich sein könnte und hilfreich für Sie, liebe Leserinnen und Leser – zum Verständnis von Geschichte und Politik, zur persönlichen Orientierung und Umorientierung. Es geht im zweiten Teil vor allem auch um gute und schlechte gesellschaftliche Einrichtungen und Regelungen, um social technique, wie man etwas hochtrabend, aber treffend sagen könnte.
Mein gesellschaftspolitisches Interesse, etwas Glück und viel Arbeit führten mich Ende der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts in interessante Funktionen – ich war 1968 und 1969 Redenschreiber eines bewunderten Bundeswirtschaftsministers, von Professor Dr. Karl Schiller; er und seine Wirtschaftspolitik spielten im Wahlkampf 1969 eine wichtige Rolle beim Versuch, die 20-jährige CDU-Kanzlerschaft zu beenden. Das gelang. Drei Jahre später, 1972, war ich dann verantwortlich für den Wahlkampf Willy Brandts und damit für die entscheidende Absicherung der Ostpolitik. Ich war anschließend Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt bei Willy Brandt und Helmut Schmidt und später Bundestagsabgeordneter. Und dann hatte ich mit 62 Jahren die Idee, eine kritische Internetseite ins Leben zu rufen und diese dann von 2003 bis heute als Herausgeber und Autor zu begleiten, die NachDenkSeiten – www.Nachdenkseiten.de –, ein oder der Pionier unter den kritischen Internetseiten.
Bei der notwendigen Auswahl dessen, was ich berichte und beschreibe, waren folgende Fragen entscheidend: Können wir aus dem, was ich erlebt und erfahren habe, etwas lernen für die Gestaltung unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens? Und können Leserinnen und Leser etwas lernen für das Verständnis des politischen und gesellschaftlichen Geschehens und die Gestaltung ihres Lebens?
Ob das gelungen ist, weiß ich nicht. Das Urteil darüber liegt in Ihren Händen.
Teil 1 Nie wieder Krieg
Gute Nachbarschaft oder Abschreckung und notfalls Krieg. Die zwei Versionen des Umgangs der Völker miteinander persönlich erlebt.
In einem Dorf in der Nähe meiner Geburtsstadt Heidelberg bin ich aufgewachsen. Im Helmholtz-Gymnasium, das damals noch in der Kettengasse mitten in der Altstadt Heidelbergs lag, habe ich als 12-Jähriger meine ersten und nachhaltigen friedens- bzw. kriegspolitischen Erfahrungen gesammelt. An meinen damaligen Erfahrungen werden zwei grundverschiedene Vorstellungen vom Zusammenleben der Völker sichtbar. In der Quarta, also in der siebten Klasse im uralten Gemäuer des Helmholtz-Gymnasiums, hatte ich zwei einschlägige Erlebnisse. Das war 1951, also sechs Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs:
Englisch und Geschichte unterrichtete ein betagter Lehrer. Er war – wie damals üblich – nach dem Krieg wieder aus dem Ruhestand geholt worden, sah schlecht und konnte deshalb nicht mitverfolgen, wie wir zu seiner Verwirrung während des Unterrichts ständig unsere Plätze wechselten. Wir nannten ihn wegen seiner Kopfform »Zwiebel«. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er verzweifelt an der Tafel steht und unter Tränen beklagt, er müsse eine solch schlimme Klasse unterrichten, obwohl er in diesem schrecklichen Krieg seinen Sohn verloren habe. Dass Kriege sinnvoll seien, vermittelte er uns nicht. Er verachtete den Krieg.
Mathematikunterricht hatten wir bei einem drahtigen, sportlichen Typ. Er hatte unsere Herzen schon dadurch gewonnen, dass er mit uns im Winter zum Skifahren nach Hindelang im Allgäu zog. Das war eine beachtliche Leistung – nur sechs Jahre nach dem Krieg. Er wusste, wie er die Sympathien von 13-jährigen Jungs gewinnt. Wenn Sie heute auf die Website des Heidelberger Helmholtz Gymnasiums gehen und die Direktoren aufrufen, dann werden Sie ihn dort abgebildet finden, als Schulleiter von 1941 bis 1945 – zweite Reihe rechts.1
Nicht vermerkt ist auf der Website, dass er in seiner Zeit als Direktor der Schule vor 1945 die Schüler gelegentlich auf dem Schulhof in Reih und Glied antreten ließ – er dabei selbst in Naziuniform. Vermerkt ist auch nicht, dass er nach dem Krieg ein bisschen degradiert worden ist, nur ein bisschen und weiter tätig an der gleichen Schule, wenn auch nicht mehr als Direktor. Hermann von Neuenstein war ein recht guter Mathematiklehrer, aber er war ein Verehrer der Kriege zwischen den Völkern. Er erzählte oft und lang von Panzerschlachten. Sechs Jahre nach dem Krieg. Er hielt offensichtlich Kriege für ein Mittel der Politik. Und er hielt die Gewalt eines Volkes gegenüber einem anderen für angebracht.
Bei ihm habe ich damals in der Untertertia, also mit dreizehn, meine politische Sozialisation hinter mich gebracht: Als er mal wieder von militärischen Abenteuern schwärmte, meldete ich mich zu Wort und sagte: »Herr von Neuenstein, wir haben Mathematikunterricht.« – Das war hart für ihn. Aber er konnte mich nicht verprügeln.
Er rächte sich auf billige Weise. Weil meine Mutter meinte, ich könne wegen des Konfirmandenunterrichts nicht mit auf die wieder geplante Ski-Freizeit, diesmal in den Schwarzwald, kommen und in der schriftlichen Entschuldigung ehrlich und naiv den Konfirmandenunterricht als Grund angab, nannte er mich danach nicht mehr Müller, also mit dem Nachnamen, wie das damals auch bei noch jungen Schülern üblich war, sondern »Gottlieb«.
Das war eine perfide Ableitung aus der schriftlichen Entschuldigung meiner Mutter. Wenn ich in Mathematik nicht ausgesprochen gut gewesen wäre, hätte diese Diffamierung auch schlimm ausgehen können.
Fast fünf Jahre später traf ich Hermann von Neuenstein im Heidelberger Stadtteil Neuenheim auf der Straße – wir beide waren inzwischen an anderen Schulen, er am Raphael-Gymnasium, ich an der Wirtschaftsoberschule. Er erkundigte sich freundlich, fast schon freundschaftlich, danach, wie es mir gehe.
Die Sicht vom Krieg des Herrn von Neuenstein unterschied sich total von jener unseres alten, fast blinden Englischlehrers. Das waren zwei diametral verschiedene Sichten vom Zusammenleben der Völker. Die eine Version ist am besten gekennzeichnet durch die Aussage in der Regierungserklärung Willy Brandts vom 28. Oktober 1969: »Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein.« – Dazu kamen ähnliche Formulierungen für die gleiche Politik: sich vertragen, Vertrauen bilden, Entspannungspolitik, Politik der Verständigung, gemeinsame Sicherheit. – Sich vertragen und Vertrauen bilden funktionierten in dieser Phase der Politik und letztlich bis 1990.
Ein Vorläufer der Absage an Krieg war das »Nie wieder Krieg« unmittelbar nach 1945. Aber diese damals weitverbreitete Einsicht galt offenbar nicht für meinen Mathematiklehrer.
Zu ihm passte eher das, was wir dann in den fünfziger Jahren erlebten: Wiederbewaffnung. Politik der Stärke. Abschrecken, Feindbilder. Später dann: Nachrüsten. Kriege sind notfalls die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das waren die Zeichen und Parolen eines anderen Umgangs miteinander.
Dazu gehörte damals schon ein ausgeprägter Rassismus gegen die Slawen, konzentriert auf die Russen. Aus diesem Sumpf nährt sich vieles, was wir heutzutage wieder hören, sehen und lesen müssen.
Beide Sichtweisen – Verachtung und Hass auf den Nachbarn hier und »Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein« dort – prägen die Geschichte unseres Landes seit 1945 in einem unerträglichen Auf und Ab. Heute sind wir mal wieder auf einem Tiefpunkt angelangt. Es wird Krieg geführt, weltweit schon seit Längerem, jetzt auch in Europa. Die restriktive Haltung des Grundgesetzes, keine Waffen zu exportieren, ist beiseitegeschoben. Es werden auch von uns Waffen geliefert, begleitet von einer schwadronierenden öffentlichen Debatte für noch mehr und noch schwerere Waffen. Von deutschem Boden aus werden Drohneneinsätze koordiniert und Menschen ermordet. Über die militärischen Basen der NATO sowie über deutsche Autobahnen und Eisenbahnen wird schweres Kriegsgerät nach Osten geschafft. Ramstein war vom US-amerikanischen Militärminister als Konferenzort für die kriegerische Sammlungsbewegung ausersehen worden – vermutlich ohne Rücksicht auf die angebliche Souveränität unseres Landes, und wahrscheinlich sogar ohne Rückfrage bei der deutschen Bundesregierung, und ohne Rücksicht auf das Bekenntnis, von deutschem Boden solle niemals wieder Krieg ausgehen.
De facto sind wir am Krieg beteiligt und statt Vertrauen zu bilden, wünschte die damalige Außenministerin Baerbock, unser Nachbar im Osten, Russland, solle ruiniert werden.
Sanktionen sind in aller Munde. Sanktionen – haben Sie mal überlegt, was für ein menschenverachtendes Denken und Fühlen hinter diesem Wort steckt. Sanktionen treffen viele Menschen, die mit Kriegen nichts zu tun haben und nichts zu tun haben wollen. Sie leiden unter Sanktionen, sie zu allererst und nicht die »Heerführer«.
Wir sind Kriegspartei. Hier sind wir angelangt. Früher wollten wir ein Volk der guten Nachbarn sein! Das gilt nicht mehr. Jetzt heißt die Parole »kriegstüchtig werden«. Unsere Medien sind voll von Berichten über Rüstung und Aufrüstung. Und unsere Regierung entschuldigt sich schon fast dafür, dass sie nicht seit Längerem Milliarden für Rüstung verplempert hat.
Wie verbreitet der Hass auf andere Völker ist, das können Sie jeden Abend im Fernsehen, zum Beispiel beim ZDF, sehen. Worte des Hasses und die markanten Augen von Marietta Slomka werden in kalkulierter Kombination in unsere Wohnzimmer gesendet.
Das ist nicht nur eine Zeitenwende. Wir sind in irre, geradezu perverse Zeiten geraten.
1950 hatte ich die Aufgabe übernommen, meinen damals 80-jährigen kranken Großvater Georg Michael Müller täglich zu besuchen und ihm – mit einem damals neu entwickelten Haushaltsgerät, einem Schüttelbecher aus Plastik – ein stärkendes Getränk aus Wein, Ei und Zucker zuzubereiten. Er war Schmied und dann Bauer von Beruf und nie im Krieg gewesen, aber er war kriegsbegeistert und zeigte mir deshalb stolz einige großformatige Illustrierte mit großen Bildern aus dem siebziger Krieg des vorletzten Jahrhunderts. Und er warb dafür, wir Deutschen, also auch ich, wenn ich groß geworden bin, sollten demnächst wieder in den Krieg ziehen – gegen die Welschen, gegen die Wackes, die Elsässer und Franzosen. Im Ersten Weltkrieg hatte mein Großvater seinen ältesten Sohn verloren. Im Norden Frankreichs, in der Nähe von St. Quentin, ist er begraben. Aber das hatte bei meinem Großvater nicht bewirkt, dem Krieg gegen unseren Nachbarn abzuschwören.
Heute lebe ich 12 km von der französischen Grenze entfernt. Und wenn wir Deutschen nicht gerade wie zu Beginn der Pandemie vom Wahn der Coronapolitik gepackt werden und die Grenzen zum Elsass schließen, dann leben wir friedlich und in vielem gemeinsam mit Elsässern und anderen Franzosen zusammen. Zwei meiner Enkelinnen sind zur Hälfte Französinnen. Niemand käme heute auf die Idee, 2 Prozent und mehr für Rüstung und die atomare Teilhabe der Bundesrepublik zu verlangen, um gegen Frankreich gut gerüstet zu sein und notfalls gegen diesen unseren Nachbarn Krieg zu führen.
Aber gegen den anderen großen Nachbarn, gegen den Nachbarn im Osten, rüsten wir auf. Und eine frühere Verteidigungsministerin begleitete diese Aufrüstung im Oktober 2021 wie mein Großvater vor 70 Jahren mit martialischen Worten. Man müsse Russland den Einsatz militärischer Mittel androhen – so Kramp-Karrenbauer (CDU) in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am 21. Oktober 2021.2
Ihre Nachfolgerin im Auswärtigen Amt blieb ihr dahingehend nichts schuldig. Außenministerin Baerbock begleitete das Sanktionspaket gegen Russland wie schon erwähnt mit der Erwartung, es werde Russland ruinieren. Warum verstehen wir uns mit dem einen Volk und gegen das andere rüsten wir auf und zeigen ihm zur Abschreckung unser Waffenarsenal?
So sieht Krieg aus: fürchterlich. Persönliche Erinnerungen
Warum führen wir überhaupt Kriege? Warum haben wir nicht beherzigt, was gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und danach von vielen wiederholt und uns Kindern quasi eingebläut worden war: Nie wieder Krieg!
Nach meinem Eindruck äußern sich heute viele Zeitgenossen, Journalisten, Politiker, Bürgerinnen und Bürger über Krieg, über die Möglichkeit zum Krieg und die »Ertüchtigung« zum Krieg, ohne dass sie wissen und sich vorstellen können, was Krieg bedeutet, welches Elend Krieg auslöst. »Kriegstüchtig werden«, »Russland ruinieren« – wenn ich diese Worte höre, dann schrecke ich auf, weil ich mich noch daran erinnere, wie Krieg aussieht und was er Menschen antut.
Wenn ich nun dazu einiges erläutere und dokumentiere, dann nicht, um Panik zu verbreiten. Ich beschreibe die Folgen, das Leid der Menschen im Krieg, weil in manchen aktuellen Äußerungen sichtbar wird, dass das Wissen um die fürchterlichen Folgen von Kriegen nicht präsent ist. Das ist übrigens auch deshalb erstaunlich, weil zurzeit ja an vielen Stellen der Welt und auch in Europa Kriege geführt werden.
Meine Erinnerungen reichen bis in die letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs zurück. Mein Heimatdorf liegt genau zwischen Mannheim und Heilbronn; Bruchsal und Pforzheim etwas weiter entfernt im Südwesten und Süden und Würzburg ungefähr 140 km im Nordosten. Den feuerroten Himmel über allen fünf brennenden Städten habe ich als 4-/5-/6-Jähriger nachts gesehen.
Sie brannten mehrmals nach Bombenangriffen der britischen und US-amerikanischen Luftwaffe.
Unser Bahnhof wurde bombardiert. Und dann kam das ganze Elend der Ausgebombten und der Flüchtlinge, der Kriegerwitwen, der Kriegswaisen und der Kriegsheimkehrer: Anti-Kriegs-Lehrmaterial am laufenden Band.
Hinzu kamen die direkten Angriffe von sogenannten Jabos – von Jagdbombern – auf unseren Bahnhof und die Eisenbahngleise. Beides etwa 200 m von meinem Elternhaus entfernt.
Die genannten Städte brannten lichterloh. Der Nachthimmel leuchtete rot. Tausende Menschen kamen in den Flammen um. Historisch bedeutsame Städte wie das barocke Mannheim und Heilbronn wurden zerstört.
Das folgende ist ein Foto vom zerstörten Nürnberg:
Quelle: tourismus.nürnberg.de
Mannheim lag nicht weit von uns entfernt. Den größten Luftangriff mit 554 Bombern über der Stadt erlebte Mannheim in der Nacht vom 5. auf den 6. September 1943. 100 Luftminen, 2 000 Sprengbomben, 200 000 Stabbrandbomben und 30 000 Phosphorbomben machten aus Mannheim ein Ruinenfeld. Ein großer Teil der Stadt wurde zerstört. Als ich dort 1957, also zwölf Jahre nach Kriegsende, zu studieren begann, war von der Zerstörung immer noch viel zu sehen.
Die Luftangriffe und die Folgen der Zerstörung sind gut dokumentiert. So hier:
»Luftkriegsereignisse in Mannheim 1939–1945
Eine Zusammenführung deutscher und englisch-amerikanischer Quellen zusammengestellt von DIETERWOLF und einem Geleitwort von ULRICHNIEß, https://www.marchivum.de/bibliostar/digitalisate/web74.pdf.«
Es folgt ein Foto aus dieser Sammlung:
Hier auch noch eine Dokumentation zur Zerstörung Heilbronns:
Chronik der Zerstörung Heilbronns am 4. Dezember 1944:
»Chronik der Zerstörung Heilbronns am 4. Dezember 1944
4. Dezember
Um 19.18 Uhr beginnt mit dem Abwurf von Leuchtmarkierungen ein Luftangriff der Royal Air Force auf Heilbronn. Zum Einsatz auf britischer Seite kommen über Heilbronn insgesamt 283 Flugzeuge, die in 37 Minuten auf die Stadt und den Rangierbahnhof insgesamt 830 500 kg Sprengbomben und 430 300 kg Brand- und Markierungsbomben abgeworfen [haben]. Die Luftabwehr durch Flak besteht in Heilbronn nur aus Geschützen kleinen Kalibers, die gegen hoch fliegende Flugzeuge wirkungslos sind.
Bedingt durch die überwiegende Fachwerkbauweise entsteht in der Altstadt der von den Briten geplante Feuersturm, der Rettungsbemühungen und Löschversuche so gut wie unmöglich macht. Hinzu kommt, dass die Wasserversorgung ebenfalls zerstört wird und die Abteilung der Feuerwehr in der Innenstadt samt Ausrüstung dem Luftangriff zum Opfer fällt. Kurz nach Beginn des Luftangriffs wird die Hauptschaltwarte des Elektrizitätswerks getroffen, so dass die Stadt ohne Stromversorgung ist.
Die Kernstadt wird auf einer Fläche von 2,5 auf 2 Kilometer durch Sprengbomben und den entstehenden Feuersturm völlig zerstört, der Vernichtungsgrad in der gesamten Stadt beträgt 62 Prozent. Durch diesen Angriff sterben mehr als 6500 Menschen, ganze Familien werden ausgelöscht. Die meisten von ihnen ersticken in den Luftschutzkellern, in denen sie vorsorglich bleiben, weil diese nach Luftschutzinstruktionen die sichersten Orte sein sollen. Wer die Flucht durch den Feuersturm wagt, geht das Risiko des Verbrennens ein. Dennoch erreichen viele von denen, die die Luftschutzkeller verlassen, die äußeren Stadtteile und überleben den Angriff.
Noch in der Nacht fliehen viele überlebende Heilbronner in die umliegenden Gemeinden, zum Teil nur mit dem, was sie am Leib tragen. Die Feuerwehren der Nachbarorte eilen zum Löschen nach Heilbronn, was sich als äußerst schwierig erweist, da der Stadtkern durch die Hitze unzugänglich ist und vom Neckar her erst Löschwasserleitungen gelegt werden müssen.
5. Dezember
Gegen Morgen lässt der Flächenbrand über der Stadt merklich nach. Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, Wehrmacht und auswärtige Helfer aus der Umgebung, aber auch aus Stuttgart, Ludwigsburg, Crailsheim und Pforzheim, geben in den Kasernen Kaffee, Eintopfessen und belegte Brote für die ausgebombte Bevölkerung aus. Sicherheitsdienst und Organisation Todt bahnen notdürftig Gehwege durch die trümmerbedeckten Straßen und bergen die ersten Toten aus den Kellern, die reihenweise auf freie Plätze gelegt werden.
Erwachsene und Kinder irren auf der Suche nach Angehörigen verstört durch die Straßen. Gegen Abend lässt die NSDAP-Kreisleitung durch Lautsprecherwagen bekannt geben, die Zahl der Toten betrage bis jetzt 4000, die der vermissten 3000. Niemand schenkt diesen Zahlen Glauben; in der Bevölkerung spricht man von 18 000 bis 25 000 Toten.
6. Dezember
Im ›Köpfer‹ wird mit dem Ausheben eines Massengrabes für die Todesopfer des 4. Dezember begonnen (dem späteren Ehrenfriedhof). Neben städtischen Mitarbeitern und Polizisten, welche die Toten registrieren und Kleider und Wertsachen sicherstellen, werden dort 40–50 Häftlinge aus dem KZ Neckargartach, in ihrer Mehrzahl sog. Fremdarbeiter, zum Leichentransport eingesetzt.«3
Und hier eine Dokumentation zu Dresden, deren Zerstörung im öffentlichen Bewusstsein – vermutlich wegen der vielen in die Stadt gekommenen Flüchtlinge – gegenwärtiger ist als die der zuvor genannten Städte:
Quelle: Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv.-Nr.: 1989/2337.1
Ich zitiere Lebendiges Museum online/LEMO:
»Nach der Bombardierung von Dresden am 13./14. Februar 1945 konnten auf Grund der hohen Zahl nicht alle Toten schnell beigesetzt werden. Zur Verhinderung von Seuchen errichteten Bergungskommandos Scheiterhaufen auf dem Altmarkt. Dort verbrannten sie fast 7 000 Leichen.«4
Auch Hamburg wurde Opfer schlimmer Angriffe. Ich zitiere aus einer Sendung des NDR:
»Operation Gomorrha«: Feuersturm vernichtet Hamburg im Juli 1943
»Im Juli 1943 starten die Alliierten massive Luftangriffe auf Hamburg. Sie beginnen in der Nacht zum 25. Juli. Ihren Höhepunkt erreichen sie in der Nacht zum 28. Juli, in der 30 000 Menschen sterben. Ganze Stadtteile werden zerstört.«5
Köln war ebenfalls Ziel mehrerer Bombenangriffe. Hier eine Aufnahme vom zerstörten Köln6:
Quelle: Wikimedia Commons © Bundesarchiv Bild 121-1339
Das waren nun Hinweise, Links und Fotos zu einigen wenigen Städten. Ich könnte von den Angriffen auf andere Städte berichten – zum Beispiel zu Darmstadt, Hannover, Frankfurt, Dortmund, Essen, München und außerdem noch zu den am meisten zerstörten Städten: Die nach Anteil zerstörten Wohnraumes am härtesten getroffenen Städte waren nämlich nicht Dresden, Hamburg oder Köln, schon gar nicht Berlin – sondern Düren (99 Prozent), Wesel (97 Prozent) und Paderborn (85 Prozent).
Rufen Sie am besten selbst für Ihre Heimatstadt und Region auf, was es an Informationen dazu im Netz gibt.
Die Dokumentation brennender Städte ist, das sollte man beachten, nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was Krieg für die betroffenen Menschen bedeutet hat. Wichtig wäre zu ergänzen, was an den verschiedenen Kriegsfronten geschehen ist, wo Millionen von Soldaten und überfallenen Zivilisten gelitten haben. Wichtig wäre auch zu ergänzen, wie viel Leid im Zuge der Eroberung und Besetzung durch deutsche Truppen in anderen Ländern und durch alliierte Truppen in Deutschland entstanden ist.
Der Zweite Weltkrieg hat in fast jeder deutschen Familie Lücken gerissen. Millionen von Kindern mussten ohne Vater aufwachsen, auch ohne Mutter, wenn diese Opfer von Luftangriffen auf deutsche Städte geworden waren oder auf andere Weise zu Tode kamen. Meine Mutter hatte eine Schwester und zwei Brüder. Beide Brüder wurden Opfer des Krieges. Ihre Frauen, meine Tanten, lebten ohne Ehepartner weiter und ihre fünf Kinder wuchsen ohne Vater auf.
Mittlerweile gibt es immer mehr Erkenntnisse dazu, wie tief sich die Kriegsereignisse wie Vertreibung, Verlust des Ehemannes/Vaters etc. in die Psyche der Menschen eingraben, teilweise über Generationen hinweg, Stichwort: Posttraumatische Belastungsstörungen. Kinder, die auf der Flucht Zeuge oder gar Opfer von Gewalt und Vergewaltigung werden, lässt das ein Leben lang nicht mehr los. Menschen, die ihre Angehörigen durch Bombenangriff oder an der Front etc. verloren haben, entwickeln pathologische Bindungs- und Verlustängste.
Soldaten finden nicht mehr in das zivile Leben zurück, sondern reagieren mit Gewalt auf Konflikte, weil sie das an der Front so »gelernt haben«. Von Alkoholismus oder sonstigem Drogenmissbrauch ganz zu schweigen.
Daher ist für mich auch die Forderung »Nie wieder Krieg« so wichtig. Krieg verseucht eine Region auch psychisch über Generationen hinweg.
Ein Krieg wirft lange Schatten …
Dass man in Deutschland »Kriegstüchtigkeit« herbeireden will, finde ich vor diesem Hintergrund schlimm. Gerade wir Deutschen müssten es besser wissen, was ein Krieg aus Menschen macht.