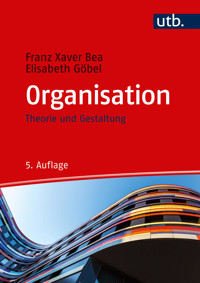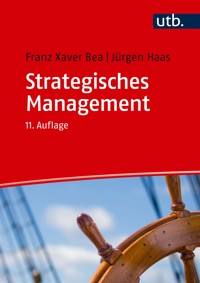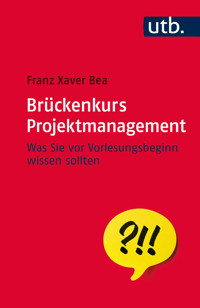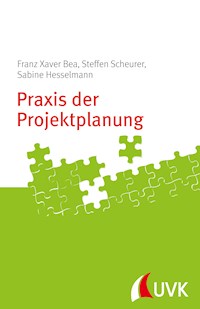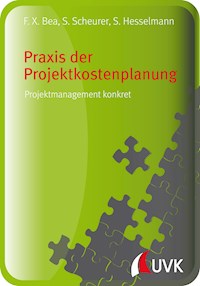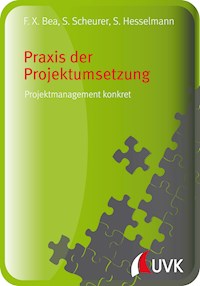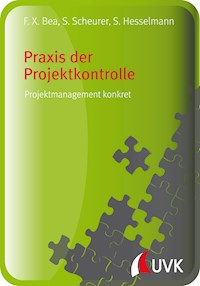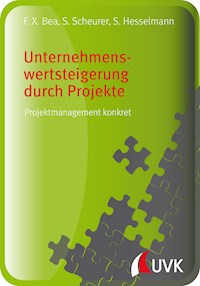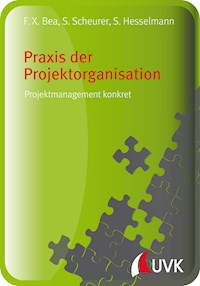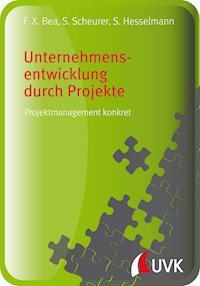Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UVK
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Verständliche Einführung in die Themenfelder Wirtschaft und Informationstechnologie: Dieses Buch erklärt die wichtigsten Grundlagen inklusive wissenschaftlicher Methodik. Dies umfasst die betriebswirtschaftlichen Themen Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Finanzierung, Marketing und Personalwirtschaft sowie die dazugehörigen Themenfelder Projektmanagement und Wirtschaftsinformatik. Darüber hinaus die fünf IT-Fächer Informatik, Geschäftsprozessmodellierung mit BPMN, Systemanalyse und -entwurf mit UML, Java sowie Linux. Alle Kapitel beinhalten Fragen und Aufgaben mit Lösungen. Ein Glossar mit zentralen Begriffserklärungen ist ebenfalls Bestandteil. Ein Buch, das jeder Student eines technisch orientierten Wirtschaftsstudienganges oder eines wirtschaftsorientierten IT-Studienganges zum Studieneinstieg lesen sollte. Auch für Quereinsteiger geeignet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Wirtschaft und IT intensivieren kontinuierlich ihre gegenseitige Wechselbeziehung – sowohl in Ausbildung und Hochschulbildung als auch in der alltäglichen Berufspraxis.
So zielt dieses Buch darauf ab, grundlegende Wissensinhalte in 12 Kernfächern in aller gebotenen Kürze darzustellen.
Für wen ist das Buch gedacht?
Angehende Studierende der technikorientierten BWL oder wirtschaftsorientierten IT-Studiengänge haben mit diesem Buch die Sicherheit, dass es das Kernwissen umfasst, das in einem Bachelorstudium behandelt wird – und zu einem gewissen Anteil oftmals gar vorausgesetzt wird.
Immer beliebter werden Fernstudiengänge in diesen Disziplinen. Das Buch ist eine ideale Ergänzung zu den spezifischen Lehrbriefen und Online-Lern-Angeboten.
Vor allem betriebswirtschaftliche Kenntnisse werden zunehmend in IT-Studiengängen vorausgesetzt und vermittelt, die auf den ersten Blick gar nicht erkennen lassen, dass BWL im Nebenfach Bestandteil des Hochschulabschlusses ist. Gerade hierfür eignet sich dieses Werk außerordentlich gut.
Das Buch eignet sich darüber hinaus hervorragend für kaufmännisch-technische Ausbildungswege und eine duale Ausbildung: begleitend oder als Lernergänzung.
Und schließlich profitieren berufliche Quereinsteiger von diesem Buch. Wer weder in Ausbildung noch im Studium oder in der bisherigen Berufspraxis keine Begegnung mit betriebs- oder informationstechnischen Themen bzw. Fragestellungen hatte, kann mit diesem Werk die Sicherheit gewinnen, grundlegende Zusammenhänge zu verstehen.
Inhaltsübersicht
Birgit Friedl
A Kosten- und Leistungsrechnung
Gerald Pilz
B Controlling
Jörg Wöltje
C Finanzierung
Alexander Hennig
D Marketing
Gerald Pilz
E Personalwirtschaft
Franz Xaver Bea
F Projektmanagement
Thomas Kessel und Marcus Vogt
G Wirtschaftsinformatik
Marcus Deininger und Thomas Kessel
H Informatik
Marcus Deininger und Thomas Kessel
I Geschäftsprozessmodellierung mit BPMN
Marcus Deininger und Thomas Kessel
J Systemanalyse und -entwurf mit UML
Marcus Deininger und Thomas Kessel
K Java
Marcus Deininger und Thomas Kessel
L Linux
Glossar
Lösungen
Inhaltsverzeichnis
Kosten- und Leistungsrechnung
Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung
Gliederung der Kosten- und Leistungsrechnung
Gegenstand der Kosten- und Leistungsrechnung
Kostenartenrechnung
Kostenstellenrechnung
Kalkulation
Betriebsergebnisrechnung
Controlling
Aufgaben und Funktionen
Kosten- und Leistungsrechnung
Kalkulation
Teilkostenrechnung
Die Investitionsrechnung
Das strategische Controlling
Das operative Controlling
Finanzierung
Systematik der Finanzierung
Finanzierungsarten im Überblick
Kreditfinanzierung
Mezzanine Finanzinstrumente
Beteiligungsfinanzierung
Innenfinanzierung
Finanzkennzahlen
Derivate
Marketing
Grundbegriffe des Marketings
Strategisches Marketing
Produkt- und Programmpolitik
Markenpolitik
Preis- und Konditionenpolitik
Distributionspolitik
Kommunikationspolitik
Personalwirtschaft
Einordnung und Ziele der Personalwirtschaft
Personalplanung
Personalbeschaffung
Personaleinsatz
Personalentwicklung
Personalführung
Personalvergütung
Personalverwaltung
Personalfreisetzung
Personalcontrolling
Projektmanagement
Zunehmende Bedeutung der Projektwirtschaft
Projektmanagement als Führungskonzeption
Management von Projekten
Machbarkeitsstudie
Die Phasen
Management durch Projekte
Wirtschaftsinformatik
Grundlagen und Begriffe
Informationssysteme und Unternehmensorganisation/-strategie
Betriebliche Informationssysteme
E-Business & E-Commerce
Informationstechnik: Infrastruktur und Tendenzen
Softwareentwicklung
Informatik
Einführung
Rechneraufbau und Gebiete der Informatik
Rechnertypen
Interne Darstellung von Informationen
Rechnerarchitekturen
Rechnerkomponenten
Programmiersprachen
Geschäftsprozessmodellierung mit BPMN
Einführung
Geschäftsprozesse
Geschäftsprozessmodellierung mit BPMN
BPMN: Pools, Aktivitäten und Sequenzflüsse
BPMN: Kollaboration und Nachrichtenflüsse
BPMN: Bahnen und Gateways
BPMN: Ereignisse
BPMN: Ereignisbehandlung
Modellierung, Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen
Service: Weiterführende Literatur / Links
Systemanalyse und -entwurf mit UML
Einführung
Vorgehen
Objektorientierte Analyse
Objektorientierter Entwurf: Systemarchitektur
Objektorientierter Entwurf: Klassen
Objektorientierter Entwurf: Verhalten
Weiterführende Literatur
Java
Einführung
Variablen und Datentypen
Kontrollstrukturen
Methoden
Sichtbarkeit /Gültigkeit
Objektorientierte Programmierung
Ausnahmen / Exceptions
Linux
Einführung
Grundlagen
Benutzeroberfläche und Kommandozeile
Hierarchie der Verzeichnisse
Interne Handbücher und Dokumentation
Dateien
Texteditor vi
Kommando-Interpreter bash
Zusätzliche Dateioperationen
Glossar
Tipps
Glossar
Lösungen
Kapitel A
Kapitel B
Kapitel C
Kapitel D
Kapitel E
Kapitel F
Kapitel G
Kapitel H
Kapitel I
Kapitel J
Kapitel K
Kapitel L
Birgit Friedl
A
Kosten- und Leistungsrechnung
1Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung
Das Rechnungswesen dient der Erfassung, Verarbeitung und Auswertung mengen- und wertmäßiger Informationen über die wirtschaftlichen Aktivitäten einer Periode. Nach den Empfängern dieser Informationen wird es in das externe und das interne Rechnungswesen gegliedert. Das externe Rechnungswesen umfasst die Bilanz- und die GuV-Rechnung. Es stellt Informationen für unternehmungsexterne Interessierte bereit, wie z. B. Anteilseigner und Gläubiger. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein Teilsystem des internen Rechnungswesens. Es erfasst den bewerteten Einsatzgüterverbrauch für die Erstellung und Verwertung des Leistungsprogramms der Unternehmung und bereitet diese Daten für die Zwecke unternehmungsinterner Informationsempfänger auf.
Zu den Zwecken der Kosten- und Leistungsrechnung gehören
die Ermittlung von Herstellungskosten für die Bewertung selbst erstellter Anlagen sowie der Bestände fertiger und unfertiger Erzeugnisse in der Bilanz,
die Unterstützung von Entscheidungen über das Leistungsprogramm der Unternehmung,
die Erfolgskontrolle sowie
die Wirtschaftlichkeitskontrolle.
Für die Bewertung in der Bilanz und die Unterstützung von Entscheidungen über das Leistungsprogramm sind die Kosten der Produkte zu ermitteln. Um den Erfolg kontrollieren zu können, sind die Kosten der Periode zu bestimmen und den Erlösen gegenüberzustellen. Zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung und -verwertung werden die Kosten der Periode mit einer Normgröße verglichen. Bei dieser Normgröße kann es sich um die Kosten der Vorperiode (Zeitvergleich) oder einer anderen Unternehmung (Betriebsvergleich) handeln. Als Normgröße können auch die Kosten geplant werden, die bei wirtschaftlicher Leistungserstellung und -verwertung unter den gegebenen Bedingungen angefallen wären. Um die Verantwortlichkeit für Abweichungen der realisierten Kosten von der Normgröße feststellen zu können, wird dieser Vergleich nicht auf Unternehmungsebene, sondern auf Kostenstellenebene durchgeführt. Für diesen Zweck sind deshalb auch die Kosten einzelner Kostenstellen zu ermitteln.
Verständnisfragen
Haben Sie alles verstanden? Mit den folgenden Fragen können Sie das Gelernte schnell prüfen:
Die Ermittlung der Kosten einer Rechnungsperiode ist die Aufgabe der …
Wirtschaftlichkeitskontrolle
Erfolgskontrolle
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Ermittlung der Herstellungskosten
Erläutern Sie die Einordnung der Kosten- und Leistungsrechnung in das Rechnungswesen.
Die Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung werden auch als Rechnungsziele der Kosten- und Leistungsrechnung bezeichnet. Nennen Sie die Rechnungsziele der Kosten- und Leistungsrechnung.
Wie kann die Wirtschaftlichkeit kontrolliert werden?
2Gliederung der Kosten- und Leistungsrechnung
Die Informationen über die Kosten der Periode, der Kostenstellen und der Produkte werden in den drei Teilrechnungen der Kostenrechnung ermittelt:
der Kostenartenrechnung,
der Kostenstellenrechnung und
der Kostenträgerrechnung mit
der Kalkulation und
der Betriebsergebnisrechnung.
Die Kostenartenrechnung ist eine reine Erfassungsrechnung und gibt Auskunft über die Höhe der Kosten, die während der Periode entstanden sind.
Die Kostenstellenrechnung informiert über die Höhe der Kosten, die in den einzelnen Kostenstellen angefallen sind. Kostenstellen sind Teilbereiche der Unternehmung, für die Kosten gesondert erfasst, geplant, kontrolliert und verrechnet werden. In der Kostenträgerrechnung werden die Kosten den Kostenträgern zugerechnet, die sie verursacht haben. Kostenträger sind alle End- und Zwischenprodukte sowie die selbst erstellten Anlagegüter. Die Kostenträgerrechnung informiert darüber, wofür die Kosten der Periode angefallen sind.
Die Kostenträgerrechnung umfasst die Kalkulation (Kostenträgerstückrechnung) und die Betriebsergebnisrechnung (Kostenträgerzeitrechnung). In der Kalkulation werden die Kosten einem einzelnen Kostenträger zugerechnet. Ermittelt werden die Selbstkosten, d. h. die Gesamtkosten eines Kostenträgers. In der Betriebsergebnisrechnung werden die Kosten für die in der Periode abgesetzten Mengen aller Kostenträger ermittelt und den Periodenerlösen gegenübergestellt, um den Periodenerfolg zu bestimmen.
In den Teilrechnungen der Kostenrechnung wird angestrebt, die Kosten bei den Leistungen auszuweisen, für die sie angefallen sind.Die Kostenrechnung wird deshalb um eine Leistungsrechnung ergänzt. Diese weist die Leistungen der Unternehmung und der einzelnen Kostenstellen aus.
Verständnisfragen
Haben Sie alles verstanden? Mit den folgenden Fragen können Sie das Gelernte schnell prüfen:
Die Kostenträgerrechnung enthält …
Kalkulation und Spesenrechnung
Kalkulation und Betriebsergebnisrechnung
Kalkulation und Stellenrechnung
Kostenartenrechnung und Abrechnung
Kostenstellenrechnung und Betriebsergebnisrechnung
In welche Teilrechnungen ist die Kostenrechnung gegliedert?
Warum wird die Kostenrechnung durch eine Leistungsrechnung ergänzt?
3Gegenstand der Kosten- und Leistungsrechnung
Kosten sind der bewertete sachzielbezogene Güterverbrauch einer Periode. Mit dem Merkmal „sachzielbezogen“ wird zum Ausdruck gebracht, dass nur derjenige Güterverbrauch zu Kosten führt, der mit dem Leistungsprogramm der Unternehmung im Zusammenhang steht, d. h. mit den am Markt abzusetzenden Produkten.
Um den Erfolg zu ermitteln, werden den Kosten die Erlöse gegenübergestellt. Sie sind die bewertete, sachzielbezogene Güterentstehung einer Periode.
Unter der Leistung wird die art- und mengenmäßige Ausbringung einer Kostenstelle verstanden. Werden in einer Kostenstelle verschiedenartige Leistungen erbracht, wird die Leistung mit Hilfe einer Maßgröße gemessen, die diese Leistungsarten gleichnamig macht. Diese Maßgröße wird als Bezugsgröße bezeichnet.
Als Bezugsgröße zur Messung der Leistung einer Mehrproduktfertigung kann z. B. die Fertigungszeit herangezogen werden. In der Beschaffung kann die Leistung z. B. über die Anzahl der Bestellungen erfasst werden.
Im externen Rechnungswesen wird der Güterverbrauch über den Aufwand erfasst. Das ist der entsprechend den gesetzlichen Regeln meist mit Ausgaben bewertete gesamte Güterverbrauch einer Periode.
Gesetzliche Regelungen legen die Art, den Umfang und die Bewertung des Güterverbrauchs fest, der als Aufwand erfasst werden darf. Der als Aufwand abgebildete wertmäßige Güterverbrauch kann sich deshalb von dem unterscheiden, der als Kosten in die Kostenrechnung eingeht. Der neutrale Aufwand ist der Teil des Aufwandes, dem keine Kosten oder Kosten in anderer Höhe gegenüberstehen. Nach seinen Ursachen werden u. a. der sachzielfremde, der außerordentliche und der bewertungsbedingte Aufwand unterschieden.
Kalkulatorischen Kosten steht kein Aufwand (Zusatzkosten) oder ein Aufwand in anderer Höhe (Anderskosten) gegenüber.
Für die Teile des Aufwandes (Kosten), die mit den Kosten (Aufwand) übereinstimmen, haben sich die Bezeichnungen „Zweckaufwand“ und „Grundkosten“ durchgesetzt.
Neutraler Aufwand
Als Aufwand wird der gesamte Güterverbrauch der Periode erfasst. Dagegen wird nur der Güterverbrauch, der durch die Realisation des Leistungsprogramms ausgelöst worden ist, als Kosten berücksichtigt. Hinter dem sachzielfremden Aufwand verbirgt sich der Güterverbrauch, der nicht für die Realisation des Sachziels der Unternehmung angefallen ist. Als Beispiel für den neutralen Aufwand können Spenden für karitative Zwecke genannt werden.
Der außerordentliche Aufwand ist ein Güterverbrauch, der nach Art oder Umfang im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit ungewöhnlich ist, wie z. B. Schäden durch Brand. In die Kostenrechnung wird dieser Güterverbrauch nicht einbezogen, da er zu stark schwankenden Kosten im Zeitablauf führen würde. Diese würden schwankende Produktkosten ergeben, die Erfolgsinformationen der Betriebsergebnisrechnung verzerren, eine Analyse der Erfolgsentwicklung erschweren und unter Umständen sogar zu Fehlentscheidungen führen. An die Stelle des außerordentlichen Güterverbrauchs treten in der Kostenrechnung deshalb kalkulatorische Wagnisse. Durch sie werden in der Kostenrechnung nicht versicherte Einzelwagnisse in einer Höhe berücksichtigt, von der erwartet werden kann, dass die erfassten Kosten über einen längeren Zeitraum hinweg mit dem außerordentlichen Aufwand übereinstimmen.
Dem bewertungsbedingten Aufwand liegt ein mengenmäßiger Güterverbrauch zugrunde, der im gleichen Umfang auch zu Kosten führt. Dieser Güterverbrauch wird im externen und internen Rechnungswesen jedoch unterschiedlich bewertet. Bewertungsunterschiede gibt es z. B. bei den Abschreibungen. Der Wertansatz bilanzieller Abschreibungen unterliegt handels- und steuerrechtlichen Vorschriften. Diese werden nicht zwingend in die Kostenrechnung übernommen, da über die Abschreibungen in der Kostenrechnung (kalkulatorische Abschreibungen) der auf die Periode entfallende Werteverzehr der Anlagegüter möglichst exakt erfasst werden sollte.
Kalkulatorische Kosten
Zusatzkosten liegt der Verbrauch und die Nutzung von Gütern zugrunde, die nicht mit Ausgaben verbunden sind und damit auch nicht zu Aufwand führen. Zu den Zusatzkosten zählen der kalkulatorische Unternehmerlohn und die kalkulatorischen Mieten. Anderskosten steht ein Aufwand in anderer Höhe gegenüber, d. h. ein außerordentlicher oder ein bewertungsbedingter Aufwand. Anderskosten sind die kalkulatorischen Abschreibungen, die kalkulatorischen Wagnisse und die kalkulatorischen Zinsen.
Der kalkulatorische Unternehmerlohn findet in Einzelunternehmen und Personengesellschaften Eingang in die Kostenrechnung. Bei diesen Rechtsformen ist der Wert der Arbeitsleistung, die der Eigentümer, ein Gesellschafter oder die ohne feste Entlohnung mitarbeitenden Angehörigen erbringen, über den Gewinn zu entgelten und darf im externen Rechnungswesen nicht als Aufwand erfasst werden. Durch die Erfassung des kalkulatorischen Unternehmerlohns in der Kostenrechnung soll zum einen die Vergleichbarkeit der Kosten von Unternehmungen verschiedener Rechtsformen herbeigeführt werden. Zum anderen wird damit die vollständige Erfassung des Güterverzehrs einer Periode angestrebt. Aus diesem Grund werden in der Kostenrechnung für Anlagegüter, die der Unternehmung unentgeltlich oder zu Mieten unterhalb der üblichen Höhe zur Verfügung stehen, kalkulatorische Mieten erfasst.
Im externen Rechnungswesen werden die tatsächlich gezahlten Fremdkapitalzinsen als Aufwand berücksichtigt. Die Erfassung nur dieser Fremdkapitalzinsen wird für die Kostenrechnung überwiegend abgelehnt, da dadurch die Höhe der Kosten vom Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital abhängig wäre.
In der Kostenrechnung werden deshalb kalkulatorische Zinsen erfasst, d. h. Zinsen auf das Eigen- und das Fremdkapital der Unternehmung auf der Basis eines einheitlichen Zinssatzes.
Verständnisfragen
Haben Sie alles verstanden? Mit den folgenden Fragen können Sie das Gelernte schnell prüfen:
Die Teile des Aufwandes (Kosten), die mit den Kosten (Aufwand) übereinstimmen, sind …
Zeitaufwand und Zusatzkosten
Investition und Anderskosten
Zweckaufwand und Grundkosten
Zweckaufwand und kalkulatorische Kosten
Außerordentlicher Aufwand und Grundkosten
Nach der Ursache können verschiedene Arten des neutralen Aufwands unterschieden werden. Erläutern Sie diese verschiedenen Formen des neutralen Aufwands.
Was wird unter den kalkulatorischen Kosten verstanden?
Nennen Sie Beispiele für Zusatz- und Anderskosten.
Was wird unter dem kalkulatorischen Unternehmerlohn verstanden? Aus welchen Gründen wird er in der Kostenrechnung erfasst?
Führen die folgenden Geschäftsvorfälle in einer Unternehmung, die Fahrräder produziert, zu neutralem Aufwand, Zweckaufwand/ Grundkosten, Anderskosten oder Zusatzkosten?
Die Zinsen für einen Bankkredit werden bezahlt.
Die Rechnung für Reifen wird beglichen.
Eine Maschine ist für 100.000 € angeschafft worden. Bilanziell wird sie mit 10% pro Jahr abgeschrieben. In der Kostenrechnung wird sie mit 7,5% pro Jahr abgeschrieben.
Ein Kunde hat Insolvenz angemeldet. Die Unternehmung wird informiert, dass 25% der Forderung gegenüber dem Kunden in Höhe von 50.000 € beglichen werden.
Für das betriebsnotwendige Kapital sind 12.000.000 € ermittelt worden. Der kalkulatorische Zinssatz liegt bei 8,5%.
Zu ihrem 350. Geburtstag werden einer Universität 50 Fahrräder in den Universitätsfarben für die Aktion „campusrad“ auf Dauer zur Verfügung gestellt.
4Kostenartenrechnung
Aufgabe der Kostenartenrechnung ist es, die Kosten einer Periode kostenartenweise zu erfassen, die Kostenhöhe festzustellen und die Kosten nach ihrer Zurechenbarkeit zu den Kostenträgern zu gliedern. Kostenarten werden durch die Art des verbrauchten Einsatzgutes abgegrenzt. Beispiele für Kostenarten sind Materialkosten, Personalkosten, Abschreibungen und Zinsen. Nach ihrer Zurechenbarkeit zu den Kostenträgern werden die Kosten in der Kostenartenrechnung in Einzel- und Gemeinkosten gegliedert.
Einzelkosten fallen ausschließlich für einen Kostenträger an und können bei diesem erfasst werden. Sie können diesem Kostenträger deshalb direkt zugeordnet werden.
Gemeinkosten sind die Kosten, die entweder für mehrere Kostenträger gemeinsam anfallen oder für mehrere Kostenträger gemeinsam erfasst werden. Sie können einem Kostenträger nicht direkt zugeordnet, sondern nur indirekt über Hilfsgrößen zugerechnet werden. Einzel- und Gemeinkosten werden in der Kostenrechnung nach unterschiedlichen Verfahren auf die Kostenträger verrechnet.
Die Einzelkosten werden aus der Kostenartenrechnung unmittelbar in die Kostenträgerrechnung übernommen und den Kostenträgern direkt zugeordnet (1). Nach diesem Verfahren werden Materialeinzelkosten und Fertigungslöhne auf die Kostenträger verrechnet. Materialeinzelkosten sind der direkt bei den Kostenträgern erfasste bewertete Materialverbrauch. Sie fallen für Rohstoffe, Einzelteile und Baugruppen an. Fertigungslöhne sind die Summe aus den Entgelten für unmittelbar an den Kostenträgern erbrachte Arbeitsleistungen und den zugehörigen Sozialkosten.
Die Gemeinkosten stehen nur in einer mittelbaren Beziehung zu den Kostenträgern. Sie fallen für die Leistungen an, die in den Kostenstellen erbracht werden (z. B. Bereitstellung von Einsatzgütern, Montageleistungen). Eine Beziehung zu den Kostenträgern entsteht erst, wenn diese Leistungen von den verschiedenen Kostenträgern in Anspruch genommen werden. Die Gemeinkosten werden deshalb aus der Kostenartenrechnung in die Kostenstellenrechnung übernommen und den Kostenstellen zugerechnet (2). Die in den Kostenstellen ausgewiesenen Kosten werden anschließend in der Kostenträgerrechnung im Verhältnis der beanspruchten Kostenstellenleistung auf die Kostenträger verrechnet (3).
Neben den Einzel- und Gemeinkosten werden noch Sonderkosten abgegrenzt. Das sind Einzel- oder Gemeinkosten, die aufgrund eines speziellen Informationsbedarfs gesondert ausgewiesen werden. Als Sondereinzelkosten werden meist Kosten ausgewiesen, die einem Produkt oder einem Auftrag direkt zugerechnet werden können. Nach dem Ort ihrer Entstehung werden Sondereinzelkosten der Fertigung (z. B. Kosten für Spezialwerkzeuge) und Sondereinzelkosten des Vertriebs (u. a. Zölle, Frachten, Provisionen) unterschieden. Diese werden aus der Kostenartenrechnung unmittelbar in die Kostenträgerrechnung übernommen und dem jeweiligen Kostenträger direkt zugeordnet.
Erfassung der Kosten
Kosten werden nach der Mengen- und Wertkomponente getrennt erfasst. Das setzt jedoch voraus, dass der mengenmäßige Güterverbrauch feststellbar und der Preis pro Mengeneinheit definiert ist. Erfüllt sind diese Voraussetzungen u.a. beim Verbrauch von Rohstoffen, Einzelteilen, Baugruppen und Hilfsstoffen und bei den kalkulatorischen Zinsen.
Als Mengenkomponente der kalkulatorischen Zinsen wird das betriebsnotwendige Kapital herangezogen, d. h. das um das Abzugskapital verminderte betriebsnotwendige Vermögen. Zum betriebsnotwendigen Vermögen zählen alle Teile des Anlage- und Umlaufvermögens, die der Erfüllung des Sachziels der Unternehmung dienen. Das Abzugskapital umfasst den Teil des Fremdkapitals, dessen Überlassung nicht über Fremdkapitalzinsen, sondern in anderer Form entgolten wird, und dessen Überlassungskosten in der Kostenrechnung deshalb bereits erfasst sind. Zum Abzugskapital zählen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, deren Überlassung über erhöhte Einstandspreise entgolten wird, und Kundenanzahlungen, wenn sie mit einer Reduzierung der Verkaufspreise verbunden sind. Durch die Multiplikation des betriebsnotwendigen Kapitals mit einem kalkulatorischen Zinssatz ergeben sich die kalkulatorischen Zinsen. Als kalkulatorischer Zinssatz kann u. a. der landesübliche Zinssatz für sichere Kapitalanlagen zuzüglich einer Risikoprämie herangezogen werden.
Wenn die Voraussetzungen der getrennten Erfassung nicht vorliegen, wird der gesamte Kostenbetrag erfasst, ohne dass auf die Mengen- oder die Wertkomponente zurückgegriffen wird. Bei Steuern, Abgaben, Beiträgen und Dienstleistungen, für die Globalentgelte entrichtet werden, kann als Kostenbetrag der in der Finanzbuchhaltung erfasste Aufwand direkt in die Kostenartenrechnung übernommen werden. Für kalkulatorische Kosten, denen kein messbarer Einsatzgüterverbrauch zugrunde liegt, wie z. B. für kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Wagnisse, wird der in der Kostenrechnung zu berücksichtigende Betrag zweckbezogen festgelegt.
Verständnisfragen
Haben Sie alles verstanden? Mit den folgenden Fragen können Sie das Gelernte schnell prüfen:
Kostenarten sind z.B. …
Gehälter
Materialeinzelkosten
Vertriebskosten
Verwaltungskosten
kalkulatorische Kosten
Welche Aufgabe hat die Kostenartenrechnung?
In einer Unternehmung werden Fahrräder produziert. Nennen Sie Beispiele für Einzel- und Gemeinkosten.
Wie werden die Einzelkosten auf die Kostenträger verrechnet?
Wie werden die Gemeinkosten auf die Kostenträger verrechnet?
Welche Zinsen gehen als kalkulatorische Zinsen in die Kostenrechnung ein?
5Kostenstellenrechnung
Für die Kostenstellenrechnung wird die Unternehmung in Kostenstellen gegliedert, auf welche anschließend die Gemeinkosten verrechnet werden. Für eine verursachungsgerechte Verrechnung der Gemeinkosten auf die Kostenträger sollten die Kostenstellen so abgegrenzt werden, dass sich jeweils eine Maßgröße der Kostenstellenleistung (Bezugsgröße) finden lässt, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit den Kosten der jeweiligen Kostenstelle steht.
Sind die Kostenstellen gebildet, werden in der Kostenstellenrechnung die folgenden Aufgaben ausgeführt: Verrechnung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen, innerbetriebliche Leistungsverrechnung sowie Berechnung der Gemeinkostenzuschlagssätze für die Kostenträgerrechnung.
Verrechnung der Gemeinkosten auf Kostenstellen
Nach der Zurechenbarkeit der Gemeinkosten zu den Kostenstellen werden Kostenstelleneinzel- und Kostenstellengemeinkosten unterschieden. Kostenstelleneinzelkosten fallen ausschließlich für eine Kostenstelle an und können auch bei dieser erfasst werden. Ist in einem Gebäude nur eine Kostenstelle untergebracht, stellen die Kosten für die Miete des Gebäudes Kostenstelleneinzelkosten dar. Kostenstelleneinzelkosten werden den Kostenstellen direkt zugerechnet.
Kostenstellengemeinkosten fallen entweder für mehrere Kostenstellen gemeinsam an oder werden für mehrere Kostenstellen gemeinsam erfasst. Bei den Mietkosten handelt es sich um Kostenstellengemeinkosten, wenn in dem Gebäude mehrere Kostenstellen untergebracht sind. Kostenstellengemeinkosten können den Kostenstellen nicht direkt, sondern nur über Kostenschlüssel zugerechnet werden. Für die Verrechnung der Miete auf die Kostenstellen in einem Gebäude kann z. B. die Fläche als Kostenschlüssel herangezogen werden. Weitere Beispiele für Kostenschlüssel sind die Lohn- und Gehaltskosten für die Verrechnung der Sozialkosten und der Wert des Anlagenbestandes in der Kostenstelle für die Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen.
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
Als „innerbetrieblich“ werden Leistungen bezeichnet, die Kostenstellen für andere Kostenstellen erstellen, wie z. B. Reparaturleistungen, welche die Kostenstelle „Werkstatt“ für eine Fertigungskostenstelle erbringt. Mit der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung wird angestrebt, die Kosten der innerbetrieblichen Leistungen bei den Kostenstellen auszuweisen, die sie verursacht haben, d. h. die innerbetriebliche Leistung verbraucht haben. In der Kostenstellenrechnung werden deshalb liefernde Kostenstellen von den Kosten der innerbetrieblichen Leistungen entlastet, empfangende Kostenstellen werden mit diesen Kosten belastet.
Nach den zu erbringenden Leistungen werden in der Kostenstellenrechnung Vor- und Endkostenstellen unterschieden. Vorkostenstellen erbringen ausschließlich innerbetriebliche Leistungen, während Endkostenstellen primär Absatzleistungen erstellen. Die Kosten von Vorkostenstellen werden deshalb vollständig auf andere Kostenstellen verrechnet. Nach Abschluss der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung weisen damit nur die Endkostenstellen Kosten aus. Es werden in der Regel folgende Arten von Endkostenstellen abgegrenzt: Material-, Fertigungs- und Verwaltungs- und Vertriebsstellen.
Die Kosten, die nach der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung für diese Endkostenstellen ausgewiesen werden, sind die Material-, Fertigungs-, Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten.
Ermittlung der Gemeinkostenzuschlagssätze
Die für die Endkostenstellen ermittelten Gemeinkosten werden in der Kostenträgerrechnung entsprechend der in Anspruch genommenen Kostenstellenleistungen auf die Kostenträger verrechnet. Für diese Verrechnung werden für die Endkostenstellen Gemeinkostenzuschlagssätze berechnet.
Der Gemeinkostenzuschlagssatz einer Endkostenstelle wird ermittelt, indem die ihr zugerechneten Gemeinkosten durch die von ihr erbrachte Leistung dividiert wird. Es ist üblich, für die Messung der Leistungen der Endkostenstellen die Materialeinzelkosten, die Fertigungslöhne und die Herstellkosten heranzuziehen. Die Herstellkosten sind die Summe aus den Materialeinzel- und -gemeinkosten, den Fertigungslöhnen und den Fertigungsgemeinkosten. Die Gemeinkostenzuschlagssätze der Endkostenstellen werden damit wie folgt berechnet:
Die Leistung von Fertigungsstellen kann auch über die erbrachten Maschinenstunden erfasst werden. In diesem Fall wird ein Maschinenstundensatz als Quotient aus Fertigungsgemeinkosten und geleisteten Maschinenstunden berechnet.
Betriebsabrechnungsbogen als Instrument
Der Betriebsabrechnungsbogen ist die tabellarische Übersicht über die Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen, die innerbetriebliche Leistungsverrechnung sowie die Berechnung der Gemeinkostenzuschlagssätze. Die Struktur eines Betriebsabrechnungsbogens kann durch die Spalten- und Zeilengliederung beschrieben werden. Die Spalten enthalten die Kostenstellen. In den ersten Zeilen werden die Gemeinkosten, die aus der Kostenartenrechnung übernommen werden, auf die Kostenstellen verrechnet. Die zweite Gruppe von Zeilen ist der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung gewidmet. Die letzte Zeile des Betriebsabrechnungsbogens enthält die Berechnung der Gemeinkostenzuschlagssätze. Die Struktur des Betriebsabrechnungsbogens soll an einem Beispiel veranschaulicht werden.
Verständnisfragen
Haben Sie alles verstanden? Mit den folgenden Fragen können Sie das Gelernte schnell prüfen:
Was ist ein geeignetes Instrument für die Kostenstellenrechnung?
Kalkulation
Betriebsergebnisrechnung
Deckungsbeitragsrechnung
Leistungsrechnung
Betriebsabrechnungsbogen
Erläutern Sie den Aufbau eines Betriebsabrechnungsbogens.
Welchen Zweck hat die innerbetriebliche Leistungsverrechnung?
Was sind Kostenstellengemeinkosten? Nennen Sie Beispiele für diese Kostenkategorie.
Wie unterscheiden sich Vor- und Endkostenstellen?
Welche Arten von Endkostenstellen werden unterschieden?
Welchem Zweck dienen die Gemeinkostenzuschlagssätze, die im BAB berechnet werden?
In einer Unternehmung, die Fahrräder produziert, sind in einer Periode die folgenden Kosten angefallen:
Kostenbetrag
Materialeinzelkosten
3.137.500 €
Fertigungslöhne
351.210 €
Gehälter
240.000 €
Hilfslöhne
40.000 €
Sozialkosten
48.000 €
Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe
26.000 €
Mieten
120.000 €
Kalkulatorische Abschreibungen
150.000 €
Kalkulatorische Zinsen
96.000 €
Die Unternehmung ist in folgende Kostenstellen gegliedert: Gebäudereinigung, Reparaturwerkstatt, Materialsteile, Fertigungsstelle, Verwaltungs- / Vertriebsstelle. Die Gehälter, die Hilfslöhne und die Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe sind Kostenstelleneinzelkosten. Die folgende Tabelle zeigt die Gehälter, die in den einzelnen Kostenstellen verursacht worden sind. Die Hilfslöhne sind je zur Hälfte in der Gebäudereinigung und der Fertigungsstelle angefallen. Von den Kosten für die Hilfs- und Betriebsstoffe sind 2.000 € in der Gebäudereinigung, 4.000 € in der Reparaturwerkstatt und 20.000 € in der Fertigungsstelle angefallen. Die nachfolgende Tabelle informiert über die Kostenschlüssel zur Verrechnung der Kostenstellengemeinkosten auf die Kostenstellen.
Die Gebäudereinigung und die Reparaturwerkstatt erbringen für die anderen Kostenstellen Leistungen. Folgende Tabelle fasst die Daten über die Leistungsverflechtungen zusammen:
Erstellen Sie den Betriebsabrechnungsbogen in folgenden Schritten:
Verrechnen Sie die Kostenstellengemeinkosten auf die Kostenstellen und ermitteln Sie die Summe der Gemeinkosten, die in jeder der fünf Kostenstellen angefallen ist.
Führen Sie die innerbetriebliche Leistungsverrechnung durch.
Berechnen Sie die Gemeinkostenzuschlagssätze der Endkostenstellen. Die Kosten der Materialstelle sollen über die Materialeinzelkosten, die der Fertigungsstelle über die Fertigungslöhne und die Kosten der Verwaltungs- und Vertriebsstelle über die Herstellkosten verrechnet werden.
6Kalkulation
Mit der Kalkulation werden die Kosten eines Kostenträgers ermittelt. Da jede Erscheinungsform der Produktion andere Anforderungen an die Berechnung der Kosten eines Kostenträgers stellt, haben sich in der Unternehmungspraxis mehrere Kalkulationsverfahren herausgebildet. Ein sehr vielseitig einsetzbares Verfahren ist die Zuschlagskalkulation.
Zuschlagskalkulation
Die Materialeinzelkosten und die Fertigungslöhne werden als Einzelkosten direkt auf die Kostenträger verrechnet. Die Gemeinkosten der Endkostenstellen, die der jeweilige Kostenträger durchlaufen hat, werden in der Zuschlagskalkulation über die Gemeinkostenzuschlagssätze verrechnet.
Wenn für ein Produkt Materialeinzelkosten von 840 € / St. und Fertigungslöhne von 680 € / St. anfallen, können mit den Gemeinkostenzuschlagssätzen aus dem Betriebsabrechnungsbogen die Selbstkosten pro Stück des Produkts wie folgt berechnet werden:
Materialeinzelkosten
840,00 €
+ Materialgemeinkosten (5%)
42,00 €
+ Fertigungslöhne
680,00 €
+ Fertigungsgemeinkosten (75%)
510,00 €
+ Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten (4 %)
82,88 €
Eine Sonderform der Zuschlagskalkulation ist die Maschinenstundensatzkalkulation. Die Kosten der Fertigungsstellen werden bei diesem Kalkulationsverfahren über Maschinenstundensätze auf die Kostenträger verrechnet.
Weitere Kalkulationsverfahren
Es gibt einfache Produktionsstrukturen, bei denen hinreichend genaue Informationen über die Kosten eines Kostenträgers mit Kalkulationsverfahren ermittelt werden können, welche auf eine getrennte Verrechnung von Einzel- und Gemeinkosten verzichten. Zu diesen Verfahren zählen die Divisions- und die Äquivalenzziffernkalkulation.
Die Divisionskalkulation ist anwendbar, wenn ein Produkt in großen Mengen hergestellt wird. Bei diesem Kalkulationsverfahren werden zur Ermittlung der Stückkosten dieses Produktes die Gesamtkosten durch die Produktionsmenge dividiert.
Der Anwendungsbereich der Äquivalenzziffernkalkulation ist die Sortenfertigung, bei der mehrere Produkte aus den gleichen Ausgangsstoffen nach weitgehend identischen Produktionsverfahren produziert werden. Die Produkte unterscheiden sich nur geringfügig in Abmessung, Gestalt, Qualität oder Format (z. B. verschiedene Abmessungen von Blechen oder Papier). Das Grundprinzip der Äquivalenzziffernkalkulation besteht darin, die Produktionsmenge jedes Produktes über Äquivalenzziffern in die Menge eines Einheitsprodukts umzurechnen, die zu Kosten in identischer Höhe führen würde. Äquivalenzziffern bringen zum Ausdruck, in welchem Verhältnis die Kosten des Produktes zu den Kosten des Einheitsproduktes stehen. Aus den über alle Produkte ermittelten Mengen werden die Stückkosten des Einheitsproduktes ermittelt. Die Stückkosten eines Produktes können anschließend durch die Multiplikation der Stückkosten des Einheitsproduktes mit der jeweiligen Äquivalenzziffer berechnet werden. Dieses Kalkulationsverfahren soll an einem Beispiel veranschaulicht werden.
Beispiel:
Es werden drei Varianten einer Kunststoffplane hergestellt, die sich in der Stärke und der Größe unterscheiden. Die Äquivalenzziffern sollen aus dem Gewicht der Plane ermittelt werden. Die Kosten der Periode betragen 191.250 €. Es liegen weiterhin die folgenden Daten vor:
VarianteProduktionsmengeGewichtA1.200 St.4 kg/St.B800 St.3 kg/St.C600 St.5 kg/St.Wird Variante A als Einheitsprodukt gewählt, werden die Kosten der Varianten wie folgt berechnet:
Verständnisfragen
Haben Sie alles verstanden? Mit den folgenden Fragen können Sie das Gelernte schnell prüfen:
Welche Kosten können direkt auf die Kostenträger verrechnet werden?
Fertigungslöhne
Verwaltungskosten
Selbstkosten
Materialeinzelkosten
Gemeinkosten
Welche Aufgabe hat die Kalkulation?
Wie unterscheiden sich die Divisions- und die Äquivalenzziffernkalkulation von der Zuschlagskalkulation?
Kalkulieren Sie mit den in
Kapitel 5
, Aufgabe 8 berechneten Gemeinkostenzuschlagssätzen die Selbstkosten eines Auftrags über 120 Fahrräder des Typs „Unirad“. Für ein Fahrrad dieses Typs entstehen Materialeinzelkosten in Höhe von 550 € und Fertigungslöhne in Höhe von 85 €. Zudem entstehen für den Auftrag Verpackungs- und Transportkosten in Höhe von 1.200 €.
Eine Unternehmung stellt vier verschiedene Arten von Stumpenkerzen her, die sich in der Höhe und im Durchmesser unterscheiden. Es liegen die folgenden Daten vor:
Variante
Produktionsmenge
Höhe × Ø (in cm)
A
12.000 St.
10 × 7
B
8.000 St.
20 × 7
C
20.000 St.
8 × 5
D
5.000 St.
10 × 10
Selbstkosten der Periode
102.080 €
Berechnen Sie mit einer Äquivalenzziffernkalkulation die Stückselbstkosten jeder Kerzenart.
7Betriebsergebnisrechnung
Aufgabe der Betriebsergebnisrechnung ist die Bereitstellung von Informationen über den Erfolg einer Periode. Um Erfolgsentwicklungen frühzeitig erkennen zu können, wird die Betriebsergebnisrechnung mehrfach im Jahr durchgeführt. Als Abrechnungszeitraum werden Quartale, Monate oder Wochen gewählt.
Zur Berechnung des Periodenerfolgs werden in der Betriebsergebnisrechnung die Kosten und Erlöse der Periode gegenübergestellt. In der Kostenrechnung werden die Kosten der während der Periode produzierten Produktmengen erfasst. Die Erlöse der Periode beziehen sich dagegen auf die Absatzmengen. Sind Bestände an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen auf- oder abgebaut oder Anlagegüter selbst erstellt worden, stimmen die Produktions- und Absatzmengen nicht überein. Die Kosten und Erlöse einer Periode sind damit nicht unmittelbar vergleichbar und müssen um die Bestandsveränderungen oder selbst erstellten Anlagen korrigiert werden. Nach dieser Korrektur werden das Gesamtkosten- und das Umsatzkostenverfahren unterschieden. Beide Verfahren führen zu identischen Periodenerfolgen.
Gesamtkostenverfahren
Beim Gesamtkostenverfahren werden die Erlöse korrigiert. Zur Ermittlung des Periodenerfolges werden die nach Kostenarten gegliederten Gesamtkosten der Periode, d. h. die Kosten der produzierten Produktmengen, den um den Wert der Bestandsveränderungen oder selbst erstellte Anlagen korrigierten Erlöse der Periode gegenübergestellt.
Umsatzkostenverfahren
Das Umsatzkostenverfahren nutzt die Kostenkorrektur. Zur Ermittlung des Periodenerfolges werden die Erlöse der Absatzmengen den nach Produkten gegliederten Selbstkosten der Absatzmengen gegenübergestellt. Ermittelt werden diese Kosten, indem die Stückherstellkosten aus der Kalkulation mit den Absatzmengen multipliziert werden. Da Vertriebskosten nur für abgesetzte Erzeugnisse anfallen und dies auch für die Verwaltungskosten angenommen wird, gehen die Verwaltungs- und Vertriebskosten der Periode in vollem Umfang in die Betriebsergebnisrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren ein. Das Umsatzkostenverfahren weist den Vorteil auf, dass sowohl die Kosten als auch die Erlöse nach Produktarten gegliedert sind, so dass Informationen über die Erfolgsbeiträge der verschiedenen Produkte für Gewinn- und Verlustquellenanalysen hergeleitet werden können.
Betriebsergebnisrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren
Kosten
Erlöse
Selbstkosten der Periode
Materialeinzelkosten
Fertigungslöhne
Hilfslöhne
Herstellkosten der Bestandsminderungen
Saldo: Betriebsgewinn
Erlöse der Periode
Produkt 1
Produkt 2
Produkt N
Herstellkosten der Bestandsmehrungen
Saldo: Betriebsverlust
Summe
Summe
Betriebsergebnisrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren
Kosten
Erlöse
Herstellkosten der abgesetzten
Produktmengen
Produkt 1
Produkt 2
Produkt N
Verwaltungs- und Vertriebskosten
der Periode
Saldo: Betriebsgewinn
Erlöse der Periode
Produkt 1
Produkt 2
Produkt N
Saldo: Betriebsverlust
Summe
Summe
Im folgenden Beispiel wird auf der Grundlage der Daten aus dem Betriebsabrechnungsbogen und der Zuschlagskalkulation der Betriebserfolg nach dem Gesamtkosten- und dem Umsatzkostenverfahren berechnet. Die Abweichung zwischen dem Betriebsgewinn nach dem Gesamtkosten- und dem Umsatzkostenverfahren folgt aus Rundungsfehlern bei der Berechnung der Gemeinkostenzuschlagssätze.
Verständnisfragen
Haben Sie alles verstanden? Mit den folgenden Fragen können Sie das Gelernte schnell prüfen:
Welche Aussagen treffen auf das Umsatzkostenverfahren zu?
Die Erlöse werden korrigiert.
Die Kosten werden korrigiert.
Die Stückherstellkosten werden mit den Absatzmengen multipliziert.
Vertriebskosten fallen nur für abgesetzte Erzeugnisse an.
Welche Aufgaben hat die Betriebsergebnisrechnung?
Wie unterscheiden sich das Gesamt- und das Umsatzkostenverfahren?
Welchen Vorteil hat das Umsatzkostenverfahren gegenüber dem Gesamtkostenverfahren?
In der Unternehmung aus
Kapitel 5
, Aufgabe 8 werden drei Typen von Fahrrädern produziert und verkauft. Für die letzte Abrechnungsperiode liegen die folgenden Daten vor.
Unirad
Cityrad
Ausflugsrad
Materialeinzelkosten
550,00 €/St.
400,00 € / St.
630,00 € /St.
Fertigungslöhne
85,00 € / St.
40,00 € / St.
71,98 € /St.
Produktionsmengen
650 St.
3.800 St.
2.000 St.
Absatzmengen
680 St.
3.000 St.
2.200 St.
Absatzpreis pro Stück
800 €/St.
630 €/St.
850 €/St.
Ermitteln Sie das Betriebsergebnis nach dem Gesamtkosten- und dem Umsatzkostenverfahren. Da es sich um eine Quartalsabrechnung handelt, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Herstellkosten der Produkte, die sich auf Lager befinden, nicht verändert haben.
Gerald Pilz
B
Controlling
1Aufgaben und Funktionen
Das Controlling gewinnt zunehmend an Bedeutung, denn durch die fortschreitende Globalisierung und den stärkeren internationalen Wettbewerbsdruck müssen Unternehmen die angestrebten Ziele optimal und in einem überschaubaren Zeitraum erreichen. Hinzu kommen staatliche Regulierungen, der technologische Fortschritt und eine weitgehende Marktsättigung in den entwickelten Ländern, die es für die Unternehmen erforderlich macht, alle Prozesse zu optimieren.
Das Controlling trägt maßgeblich dazu bei, die Ressourcen in einem Unternehmen optimal zu nutzen und ein effizientes Planungs- und Steuerungssystem zu etablieren.
Das moderne Controlling stützt sich nicht nur auf Kennzahlen und Informationen aus dem Rechnungswesen, sondern bezieht auch zusätzliche Daten mit ein, die durch systematische empirische Erhebungen gewonnen werden und auch qualitativen Charakter haben können.
Charakteristische Aufgaben des Controlling sind beispielsweise:
Die Umsetzung, Entwicklung und Steuerung einer Unternehmensstrategie
die Operationalisierung von Zielen, so dass sie in der Praxis konkret anwendbar und anhand von Kriterien intersubjektiv überprüfbar sind
die systematische Beschaffung und Auswertung von Informationen
die Entscheidungsfindung anhand von Kennzahlen
die Steuerung und Optimierung von Unternehmensprozessen.
Das Controlling lässt sich in einzelne Grundfunktionen auffächern:
die Ermittlungs- und Dokumentationsfunktion
die Planungs-, Prognose- und Beratungsfunktion
die Steuerungsfunktion
die Kontrollfunktion
Der Begriff „Controlling“ muss eindeutig vom umgangssprachlichen Wort „Kontrolle“ abgegrenzt werden. „Kontrolle“ im Sinne von Überwachung und Revision stellt nur einen nebensächlichen und untergeordneten Teilaspekt des Controlling dar.
Das Controlling ist primär gegenwarts- und zukunftsbezogen und rückt die innovative Weiterentwicklung und Optimierung der Unternehmensziele in den Vordergrund.
Das externe Rechnungswesen, das unter anderem als Datenbasis dient, ist hingegen vorwiegend vergangenheitsorientiert.
Die Aufgabe des Controlling besteht auch darin, die vergangenheitsbezogene Perspektive des Rechnungswesens in eine zukunftsorientierte Vision zu übersetzen, die es dem Unternehmen ermöglicht, sich neue Märkte zu erschließen und zu expandieren.
Das Rechnungswesen beruht auf einer Ex-post-Betrachtung, während das Controlling eine Ex-ante-Betrachtung vornimmt, die die Innovationsfähigkeit und das Entwicklungspotenzial des Unternehmens akzentuiert.
Es wird differenziert zwischen strategischem und operativem Controlling.
Das strategische Controlling fokussiert sich auf den langfristigen Erfolg des Unternehmens und versucht, das Gesamtpotenzial, die adäquate Positionierung auf den Absatzmärkten und die strategische Ausrichtung zu fördern. Das operative Controlling befasst sich mit der Sicherung der Rentabilität, des unternehmerischen Erfolgs und der Produktivität auf den einzelnen Unternehmensebenen bis hin zu den verschiedenen Ablaufprozessen.
Strategisches Controlling
Operatives Controlling
langfristig
kurzfristig
Gesamtunternehmen im Blickfeld
einzelne Abteilungen, Maßnahmen, Prozesse
Gesamtpotenzial
Optimierung einzelner Abläufe
Stärken-Schwächen-Analyse, Marktpotenzial
Kosten und Leistungen, Prozessorganisation
primär qualitative Analyse
primäre quantitative Analyse
zusätzliche Erhebungen als Datenquelle
vorrangig Rechnungswesen als Datenquelle
Das strategische Controlling hat eine unterstützende und beratende Funktion für das Management und trägt dazu bei, das Erfolgspotenzial eines Unternehmens zu realisieren. Diese Zielsetzung erfolgt durch eine systematische Prozessoptimierung, durch eine umfassende Koordination und eine gezielte Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen. Dabei werden verschiedene Etappenziele definiert und entsprechende Kennzahlen festgelegt, die bei der Analyse von Soll-Ist-Abweichungen behilflich sind und eine präzise Auswertung gestatten.
Beim operativen Controlling geht es um die einzelnen Unternehmensebenen, -bereiche und -prozesse, die optimiert werden sollen.
Das operative Controlling bezieht die wichtigsten Kennzahlen aus dem internen und externen Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung). Diese Größen beleuchten den Aufwand und den Ertrag sowie Kosten und Leistungen, die im Unternehmen anfallen.
Das operative Controlling ermöglicht eine
systematische Koordination
der einzelnen Maßnahmen im Rahmen des Gesamtplans. Dabei werden die vorab definierten Ziele einem Controlling unterzogen und überprüft.
Eine zentrale Aufgabe des operativen Controlling besteht auch in der
Budgetierung,
bei der einzelne Bereiche anhand von Kennzahlen bewertet werden. Bei Abweichungen von den festgelegten Budgetwerten werden neue Ziele ins Visier genommen und ausgearbeitet.
Eine weitere Funktion des operativen Controlling ergibt sich aus der
Budgetkontrolle,
die anhand von verschiedenen Informationen erfolgt.
Die genaue Analyse ergibt sich bei dem
Vergleich zwischen Plan- und Ist-Werten
sowie durch die
Ermittlung von Plan-Ist-Abweichungen,
die sich als Leistungs- oder Verbrauchsabweichungen manifestieren können.
Darüber hinaus trägt das operative Controlling die Verantwortung für die
Informationsversorgung im Unternehmen.
Durch die Rückmeldungen in den einzelnen Unternehmensbereichen und -sparten wird es ermöglicht, die Unternehmenssteuerung genauer zu justieren und zu verfeinern.
Das operative und das strategische Controlling sind miteinander vernetzt und ergänzen sich im unternehmerischen Alltag.
Die Controllingabteilung
Die Aufgaben einer Controllingabteilung sind:
Erstellung, Ausarbeitung und Umsetzung von Unternehmenszielen und -strategien, Berichterstattung, Auswertung und Interpretation von Kennzahlen-Kontrolle und Revision von Zielvorgaben
strategische und operative Unternehmensentwicklung
Planung, Implementierung und Steuerung der Budgetierung
Beratung des Managements und Unterstützung bei der Entscheidungsfindung
Die Controllingabteilung kann hinsichtlich der Organisationsstruktur weiter aufgefächert werden, um ein höheres Maß an Differenzierung und Arbeitsteilung zu erzielen. Hierbei unterscheidet man zwischen der Spezialisierung nach Verrichtungen, nach Funktionen und nach Adressaten.
Ein weiteres Kriterium der Systematik in Controllingbereichen ist die Divergenz zwischen einem dezentralen und einem zentralen Controlling.
Beim dezentralen Controlling wird häufig das Projektmanagement als ein autonomer Bereich angesehen. Auch die Implementierung eines regionalen Controlling spielt beim dezentralen Controlling eine gewisse Rolle.
In kleinen und mittelständischen Unternehmen wird häufig keine eigene Controllerstelle bereitgestellt, um Kosten zu sparen. In diesen Fällen werden die unterschiedlichen Controllingaufgaben vom Rechnungswesen wahrgenommen, was jedoch in der Praxis zur Überforderung führen kann.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Controllingaufgaben ausgewählten Führungsstellen zuzuordnen, die dann für die Koordination und für die Umsetzung des Controlling in den verschiedenen Unternehmensbereichen verantwortlich zeichnen.
Eine grundlegende Systematik der Controllingorganisation kann nach den jeweiligen Organisationstypen vorgenommen werden.
Organisationstypen
Linienorganisation
Stab-Linien-Organisation
Matrixorganisation
Spartenorganisation
Tensororganisation
Projektorganisation
Darüber hinaus kann das Controlling auch ein Costcenter oder ein Profitcenter umfassen.
Controlling wird auch zunehmend in der staatlichen Verwaltung und im öffentlichen Dienst praktiziert, um die einzelnen Prozesse und Abläufe weiter zu optimieren und Einsparungspotenziale zu realisieren. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Dienst spricht man von Public Management.
Verständnisfragen
Haben Sie alles verstanden? Mit den folgenden Fragen können Sie das Gelernte schnell prüfen:
Was sind Aufgaben des Controlling?
Steuerung des Unternehmens
Kontrolle
Dokumentation und Beratung
Wie kann eine Controlling-Abteilung organisiert sein?
Spartenorganisation
Nichtregierungsorganisation
Matrixorganisation
Ablauforganisation
Tensororganisation
Welche Aufgaben hat das Controlling?
Kontrolle und Revision von Zielvorgaben
mehr Effizienz und Effektivität
höhere Innovationsfähigkeit
strategische Unternehmensentwicklung
Welche Formen des Controlling können unterschieden werden?
strategisches Controlling
temporäres Controlling
operatives Controlling
2Kosten- und Leistungsrechnung
Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung
Kalkulation von Waren und Dienstleistungen
Preiskalkulation
Wirtschaftlichkeitskontrolle (Soll-Ist-Analyse)
Kostenvergleichsrechnung (alternative Produktionsund Absatzprogramme)
Erfolgsermittlung
Gewinnschwellenanalyse
Die Kostenrechnung ist ein Bereich des betrieblichen Rechnungswesens und wird aufgegliedert in
Kosten- und Leistungsrechnung
Kostenartenrechnung
Kostenstellenrechnung
Kostenträgerrechnung
Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine systematische und effiziente Kontrolle der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, indem die einzelnen Kostenarten systematisiert und verschiedenen Kostenstellen im Rahmen der Kostenstellenrechnung zugeordnet werden.
Hierzu verwendet man einen Betriebsabrechnungsbogen (BAB), der die Verrechnung der angefallenen Kosten zwischen verschiedenen Kostenstellen ermöglichen soll. Darüber hinaus dient die Kosten- und Leistungsrechnung als Grundlage für die systematische Preiskalkulation bei der Ermittlung von Verkaufs- und Absatzpreisen. Dieses Verfahren wird im Rahmen der Kostenträgerrechnung angewendet, wobei die Zuschlagskalkulation in der Praxis eine herausragende Stellung einnimmt.
Bei der Kostenzurechnung werden bestimmte Prinzipien angewandt.
Eines der wichtigsten ist das
Verursachungsprinzip,
dem zufolge die entstandenen Kosten nur einen bestimmten Kostenträger zugeschrieben werden sollen.
Darüber hinaus gibt es noch andere Kriterien wie beispielsweise das
Tragfähigkeitsprinzip
oder
das
Beanspruchungsprinzip,
das bei der Zuordnung von Kostenstellen maßgeblich ist.
Auch das
Kostenüberwälzungsprinzip,
das in der Vollkostenrechnung zum Tragen kommt, spielt bei der Analyse eine entscheidende Rolle.
Die Kostenrechnung kann entweder als Vollkostenrechnung praktiziert werden oder als Teilkostenrechnung.
Die Kostenartenrechnung
Die Kostenartenrechnung unterscheidet nach einer Systematik die verschiedenen im Unternehmen angefallenen Kosten. Dabei werden verschiedene Kriterien zur Kategorisierung herangezogen.
Kostenartenrechnung
Aspekt
Kostenart
Produktionsfaktor
Materialkosten
Personalkosten
Dienstleistungskosten
Unternehmensfunktion
Fertigungskosten
Beschaffungskosten
Lagerkosten
Verwaltungskosten
Vertriebskosten
Verrechnung
Einzelkosten
Gemeinkosten
Erfassung
Aufwandsgleiche Kosten
Zusatzkosten
Anderskosten
Variabilität
Fixe Kosten
Variable Kosten
Gemischte Kosten
Kalkulatorische Kosten
Zusatzkosten
Anderskosten
kalkulatorische Miete
kalkulatorische Abschreibung
kalkulatorische Eigenkapitalzinsen
kalkulatorische Wagnisse
kalkulatorischer Unternehmerlohn
Nach Art der betrieblichen Funktionen gliedert man die Kosten in
Beschaffungskosten,
Lagerkosten,
Vertriebskosten,
Verwaltungskosten und
Fertigungskosten.
Hinsichtlich der Art der Verrechnung wird differenziert zwischen Einzelkosten, die dem Kostenträger unmittelbar zugeordnet werden können wie beispielsweise Fertigungsmaterial und Fertigungslöhne, Sondereinzelkosten der Fertigung, die für Spezialwerkzeuge oder für einzelne Modelle anfallen, oder Sondereinzelkosten des Vertriebs, wie sie für Sonderfrachten oder Spezialverpackungen erforderlich sind.
Neben den Einzelkosten und den Sondereinzelkosten gibt es noch die Gemeinkosten, die mehr oder weniger direkt einen Kostenträger zugeordnet werden können. Hierzu zählen Mietkosten, Kosten für Energie und Wasser sowie die Gehälter von Angestellten in Verwaltungspositionen.
Wichtige Kennzahl:
Es wird weiter differenziert in echte und unechte Gemeinkosten. Von unechten Gemeinkosten spricht man, wenn die Gemeinkosten zwar im Prinzip aufgegliedert werden können, aber der Aufwand für eine solche Kostenerfassung zu hoch wäre.
Ein weiteres Kriterium für die Systematisierung der Kosten ist die Art der Erfassung. Hierbei gibt es zwei grundlegende Kategorien,
nämlich aufwandsgleiche Kosten, die direkt aus dem externen Rechnungswesen und der Finanzbuchhaltung entnommen werden können, und
kalkulatorische Kosten, die in Zusatzkosten und Anderskosten aufgeschlüsselt werden.
Die Zusatzkosten stellen keinen Aufwand dar, es handelt sich beispielsweise um den kalkulatorischen Unternehmerlohn, kalkulatorische Eigenkapitalzinsen, die kalkulatorische Miete.
Anderskosten sind aufwandsungleiche Kosten, die sich von dem erfassten Aufwand in der Finanzbuchhaltung unterscheiden. Beispiele dafür sind kalkulatorische Wagnisse und kalkulatorische Abschreibungen.
Eine weitere Systematik bezieht sich auf die Variabilität der Kosten, die durch Beschäftigungsänderungen entstehen. Hierbei wird grundlegend unterschieden zwischen fixen Kosten und variablen Kosten, die weiterhin in proportionale, degressive oder progressive Kosten untergliedert werden.
Die Kostenstellenrechnung
In der Kostenstellenrechnung erfolgt die innerbetriebliche Verrechnung, bei der anhand innerbetrieblich festgelegter Bezugsgrößen die Kosten auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden.
Hierfür ist der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) zuständig, der monatlich erstellt wird.
Die Aufgaben der Kostenstellenrechnung sind:
die Verteilung der Gemeinkosten aus der Kostenartenrechnung
die Durchführung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung
die Vorbereitung einer verursachungsgerechten Kalkulation
die Kontrolle und sorgfältige Überprüfung der Wirtschaftlichkeit
Kostenstellen gelten als Teilbereiche im Unternehmen, in denen Dienstleistungen und Produkte verbraucht werden. Die Kostenstellen können weiter aufgefächert werden in Hauptkostenstellen und Hilfskostenstellen sowie Vor- und Endkostenstellen.
Kostenstellenplan
Vorkostenstelle
Endkostenstelle
Hilfskostenstelle
Hauptkostenstelle
Die Verrechnung der Kosten erfolgt mithilfe von Zuschlagssätzen, um die Gemeinkosten genauer zuzuweisen. Als Schlüssel für die Verteilung der Gemeinkosten dienen Leistungseinheiten, Äquivalenzziffern oder vorgegebene Ersatzschlüssel.
Die Kriterien für einen optimalen Kostenstellenplan:
Genaue, objektive und eindeutige Maßstäbe der Kostenverursachung festlegen
systematische und konsistente Zuordnung aller vorhandenen Kostenbelege ermöglichen
selbstständige und sinnvolle Verantwortungsbereiche definieren.
Bedeutsam ist, dass die Kostenverursachung genau für eine Kostenstelle definiert wird.
Systematik der Kostenstellen
funktionsorientiert
Allgemeiner Bereich
Materialbereich
Fertigungsbereich
Vertriebsbereich
raumorientiert
Niederlassung
Zweigwerk
Zentrale
organisationsorientiert
Profitcenter
Costcenter
Servicecenter
Sparte
rechnungsorientiert
versachungsgerechte Einheiten
Damit die Kosten auch sinnvoll verwaltet und verringert werden können, ist es unerlässlich, dass jede Kostenstelle eigenständig über die Kosten zumindest bis zu einem gewissen Ausmaß bestimmen kann. Nur dann lässt sich das Wirtschaftlichkeitsprinzip durch den Kostenstellenplan realisieren.
Die Berechnung der Gemeinkostenzuschläge geschieht wie folgt:
Wichtige Kennzahlen:
Ist-Materialgemeinkostenzuschlag Ist-Fertigungsgemeinkostenzuschlag Ist-Verwaltungsgemeinkostenzuschlag Ist-VertriebsgemeinkostenzuschlagBei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz, die entweder einseitig oder reziprok (gegenseitig) erfolgen. Eine bekannte Methode der gegenseitigen Leistungsverrechnung ist das Verrechnungspreisverfahren.
Einseitige Leistungsverrechnung
Kostenartenverfahren
Kostenstellenausgleichsverfahren
Kostenträgerverfahren
Gegenseitige Leistungsverrechnung
Verrechnungspreisverfahren
Beim Kostenartenverfahren werden nur die Einzelkosten, die auf der Kostenstelle angefallen sind, der empfangenden Kostenstelle zugewiesen; die Gemeinkosten bleiben unberücksichtigt. Dadurch werden die Gemeinkostenzuschläge beträchtlich erhöht.
Beim Kostenstellenausgleichsverfahren werden die Gemeinkosten zusätzlich der empfangenden Kostenstelle zugerechnet.
Bei dem komplexeren Kostenträgerverfahren werden die entstandenen Einzel- und Gemeinkosten einer Ausgliederungsstelle zugeordnet. Dies dient der Ermittlung der Kosten aktivierbarer Eigenleistungen und dem Vergleich von Eigenund Fremdfertigung im Sinne einer Make or Buy Decision.
Beim Verrechnungspreisverfahren, das auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruht, werden unternehmensinterne Wertansätze oder Marktpreise mit einbezogen, um die Verrechnung vornehmen zu können.
In der daran anschließenden Kostenträgerrechnung werden die Einzelkosten der Kostenartenrechnung und die Gemeinkosten der Kostenstellenrechnung berücksichtigt. Die zentrale Aufgabe der Kostenträgerrechnung besteht darin, die einzelnen Kosten auf die Kostenträger, das sind in der Regel Waren oder Dienstleistungen, die das Unternehmen erstellt, umzulegen.
Die Kostenträgerrechnung
Die Kostenträgerrechnung spielt eine wichtige Rolle bei der Kosten- und Erfolgsermittlung des Unternehmens. Sie ist zeitund auch stückbezogen. Die Verrechnung auf einzelne Kostenträger erfolgt nach dem Prinzip der Kostenverursachung. Die Kostenträgerrechnung wird untergliedert in
die Kostenträgerstückrechnung und
die Kostenträgerzeitrechnung.
Entscheidende Aufgaben der Kostenträgerrechnung sind:
die stück- und zeitbezogene Ermittlung der Kosten der Kostenträger
die stück- und zeitbezogene Erhebung des
Erfolges der Kostenträger
die Zurverfügungstellung von exakten Informationen für die Programmpolitik, die
Beschaffungswirtschaft, die Bewertung der Bestände und die verschiedenen Planungsrechnungen.
Bei der Kostenträgerstückrechnung geht es um die Prinzipien der Kalkulation, wobei man zwischen
Vorkalkulation,
Zwischenkalkulation und
der eigentlichen Kalkulation unterscheidet.
Verständnisfragen
Haben Sie alles verstanden? Mit den folgenden Fragen können Sie das Gelernte schnell prüfen:
Was sind Teilbereiche der Kosten- und Leistungsrechnung?
Kostenstellenrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung
Kostenträgerzeitrechnung
Kalkulation
Kostenartenrechnung
Welche Kostenarten werden unter dem Kriterium der Verrechnung unterschieden?
Fixkosten
Fertigungskosten
Gemeinkosten
Prozesskosten
Was sind Kostenträger?
soziale Einrichtungen
Produkte und Dienstleistungen
Abteilungen
Welches Kalkulationsverfahren wird vorwiegend in Rohstoffunternehmen mit nur einem Produkt verwendet?
Zuschlagskalkulation
Kuppelkalkulation
Äquivalenzziffernkalkulation
Divisionskalkulation
3Kalkulation
Die Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation) ermittelt die Herstellkosten und die Selbstkosten des Unternehmens für eine Kostenträgereinheit.
Die Vorkalkulation dient als Vorschaurechnung vor der Annahme eines Auftrags und vor dem Beginn der eigentlichen Produktion und fungiert daher als Angebotskalkulation; sie beinhaltet die Schätzung der zu erwartenden Herstellkosten und Selbstkosten.
Bei Produkten, die eine längere Herstellungszeit haben wird eine Zwischenkalkulation angefertigt. Die Nachkalkulation erfolgt nach der Herstellung der Erzeugnisse und umfasst die angefallenen Herstell- und Selbstkosten.
Die Anwendung dieser Kalkulationsansätze richtet sich nach der Art des Fertigungsverfahrens.
Kalkulation
Zuschlagskalkulation
Einzel- und Serienfertigung, auch Dienstleistungen
Divisionskalkulation
Massenfertigung (auch Rohstoffsektor)
Äquivalenzziffernkalkulation
artverwandte Produkte, Sortenfertigung
Kuppelkalkulation
gleichzeitig entstehende Erzeugnisse (Raffinerie)
Maschinenstundensatzrechnung
maschinelle Einzel- und Serienfertigung
Die Anwendung dieser Kalkulationsansätze richtet sich nach der Art des Fertigungsverfahrens.
Die Divisionskalkulation beispielsweise wird in der Massenfertigung eingesetzt.
Die Divisionskalkulation lässt sich unterteilen in eine einstufige Divisionskalkulation (summarische Divisionskalkulation) und eine mehrstufige Rechnung, bei der Lagerbestandsveränderungen in die Kalkulation mit einfließen.
Bei der einstufigen Variante geht es um einfache Massenprodukte wie beispielsweise die Zementherstellung. Bei der mehrstufigen Divisionskalkulation liegt eine mehrstufige Produktionsweise zugrunde. Bei der einstufigen Divisionskalkulation werden die Stückselbstkosten durch Division ermittelt, und zwar aus dem Quotienten der Gesamtkosten des Abrechnungszeitraums und der entsprechenden Produktionsmenge.
Das Äquivalenzziffernkalkulationsverfahren wird verwendet bei Produktionsweisen, bei denen verschiedene Varianten unterschieden werden können. Beispielsweise sind dies anspruchsvollere Produkte, die in der Fertigung nur geringfügig von der Standardproduktionsweise abweichen.
Um nun die Kosten zu ermitteln, werden die jeweiligen Produkte mit einer Äquivalenzziffer multipliziert, die den Unterschied zum Standard widerspiegelt.
Ein häufig verwendetes Kalkulationsverfahren ist die Zuschlagskalkulation, bei der die Einzelkosten unmittelbar dem Erzeugnis zugeordnet werden können und die Gemeinkosten durch den Betriebsabrechnungsbogen und den darin enthaltenen Zuschlagsätzen auf die jeweiligen Zuschlagsgrundlagen bezogen werden.
Speziell für Maschinen wird die so genannte Maschinenstundensatzkalkulation verwendet. Bei ihr erfolgt die Gemeinkostenrechnung auf der Basis der Kostenträger, die Maschinenzeit benötigen. Der Maschinenstundensatz errechnet sich, indem die maschinenabhängigen Gemeinkosten durch die geleisteten Maschinenstunden dividiert werden.
Die Maschinenstundensatzrechnung weicht lediglich bei der Berechnung der Fertigungskosten von der Zuschlagskalkulation ab. Die Gemeinkosten werden nach der Maschinenabhängigkeit differenziert:
Maschinenabhängige
Gemeinkosten
Energiekosten,
Instandhaltungskosten,
Werkzeugkosten,
kalkulatorische Abschreibungen,
kalkulatorische Zinsen,
Raumkosten
Maschinenunabhängige
Gemeinkosten
Hilfslöhne,
Gehälter,
Sozialkosten,
Heizungskosten,
Hilfsstoffe,
Umlagen von Hilfskostenstellen
Die Maschinenlaufzeit setzt sich aus den Faktoren gesamte
Maschinenlaufzeit,
Stillstandszeit und
Instandhaltungszeit zusammen.
Ein weiteres wichtiges Verfahren ist die Kalkulation von Kuppelprodukten.
Die Kuppelproduktion spielt vor allem in der Chemiebranche eine wichtige Rolle, wenn beispielsweise aus einem Ausgangsstoff wie Rohöl verschiedene Zwischen- oder Endprodukte entstehen. Bei Rohöl könnte man als Beispiel Benzin, Diesel, Kerosin und Heizöl anführen.
Für solche Produkte gibt es spezielle Berechnungsverfahren, wobei die Produktionsmenge des jeweiligen Kuppelprodukts berücksichtigt wird und dadurch die Äquivalenzziffern, die Recheneinheiten und die Gesamtkosten ermittelt werden.
Bei der Kuppelkalkulation gibt es zwei Ansätze, nämlich
die
Restwertrechnung
(bei der ein Hauptprodukt vorliegt, aber mehrere Nebenprodukte vorhanden sind) und
die
Verteilungsrechnung
(mehrere Hauptprodukte). Die Berechnung stützt sich auf Marktpreise (Marktpreismethode) oder auf Verrechnungspreise.
Ein weiteres Teilgebiet der Kostenträgerrechnung ist die Kostenträgerzeitrechnung, die die angefallenen Kosten und die Erlöse eines Zeitabschnitts erfasst. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Berechnung der Selbstkosten, die auf einzelne Erzeugnisgruppen herunter gebrochen werden können. Im Mittelpunkt stehen auch die Wirtschaftlichkeitskontrolle und die kurzfristige Erfolgsrechnung. Der Erfolg kann nach unterschiedlichen Aspekten ausgewertet werden wie beispielsweise nach den verschiedenen Absatzgebieten, den Kundengruppen, den Fertigungsbereichen und den Absatzwegen.
Bei der Kostenträgerzeitrechnung werden in der Praxis zwei verschiedene Verfahren verwendet, und zwar das Gesamt- und das Umsatzkostenverfahren.
Umsatzkostenverfahren
Umsatzerlöse (bereinigt um Erlösschmälerungen)
– Herstellungskosten der absetzten Leistungen
– Vertriebskosten
– allgemeine Verwaltungskosten
– sonstige betriebliche Aufwendungen
Verständnisfragen
Haben Sie alles verstanden? Mit den folgenden Fragen können Sie das Gelernte schnell prüfen:
Was ist eine retrograde Kalkulation?
Prozesskostenrechnung
Break-Even-Analyse
Zielkostenrechnung
Zuschlagskalkulation
Äquivalenzziffernkalkulation
Was entspricht einer Aktivität in der Vollkostenrechnung?
gar nichts
Zuschlagsbasis
Unterkostenstelle
Was sind die Verwaltungskosten in einer Bestellabteilung?
leistungsmengeninduziert
leistungsmengenneutral
keines von beiden
Wie wird die Break-Even-Analyse noch bezeichnet?
Gemeinkostenmanagement
Activity Based Costing
Gewinnschwellenanalyse
Prozesswertanalyse
4Teilkostenrechnung
Bei der Teilkostenrechnung werden verschiedene Ansätze unterschieden. Die Teilkostenrechnung ist ein eigenständiges Kostenrechnungssystem, das die Kosten in fixe und variable Bestandteile aufspaltet. Bei gemischten (semivariablen) Kosten, die sowohl fixe als auch variable Bestandteile enthalten, kann es erforderlich sein, sie durch ein mathematisches Verfahren, nämlich die Regressionsrechnung, zu trennen.
Folgende Systeme der Teilkostenrechnung werden differenziert:
die einstufige Rechnung,
die mehrstufige Rechnung, die auch Fixkostendeckungsrechnung genannt wird, und
die Rechnung mit relativen Einzelkosten, die auch relative Einzelkostenrechnung genannt wird.
Dies sind Kostenrechnungssysteme auf Teilkostenbasis.
Teilkostenrechnung
Deckungsbeitragsrechnung
einstufig
mehrstufig
mit relativen
(Direct Costing)
(Fixkostendeckungsrechnung)
Einzelkosten
Bei der einstufigen Rechnung, die auch als Direct Costing bezeichnet wird, werden lediglich die variablen Kosten berücksichtigt und die Fixkosten ausgeklammert.
Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
Die einstufige Rechnung findet vor allem bei der Optimierung des kurzfristigen Produktionsprogramms in einem Unternehmen Anwendung. Hierbei wird die kurzfristige Preisuntergrenze ermittelt, indem festgestellt wird, ob der Preis größer oder gleich den variablen Stückkosten ist.
Die langfristige Preisuntergrenze ergibt sich, wenn man vergleicht, ob der Preis größer oder gleich den gesamten Stückkosten zusätzlich der Fixkosten ist.
Ist ein Unternehmen nach dieser Berechnung nicht vollständig ausgelastet, so können zusätzliche Aufträge angenommen werden. Die Entscheidung über die Aufträge erfolgt mithilfe der einstufigen Rechnung und der Ermittlung der Preisuntergrenzen. Durch dieses Verfahren kann das kurzfristige Produktionsprogramm optimiert werden.
Kostenrechnungssysteme
Kostenrechnungssysteme gehen von einer unterschiedlichen Basis der Kosten aus. Hierbei wird differenziert zwischen der Istkosten-, der Normalkosten- und der Plankostenrechnung.
Bei der
Istkostenrechnung
werden nur die
tatsächlich vorhandenen Kosten berücksichtigt.
Die
Normalkostenrechnung
hingegen geht von Durchschnittskosten aus, die aus den Vergangenheitswerten abgeleitet werden.
Kostenrechnungssysteme
Vollkostenrechnung
Normalkostenrechnung
Plankostenrechnung
Istkostenrechnung
Teilkostenrechnung
Normalkostenrechnung
Plankostenrechnung
Istkostenrechnung
Die Plankostenrechnung hingegen berücksichtigt erwartete oder zukünftige Kosten, die durch eine Schätzung ermittelt werden. Bei der Normalkostenrechnung kann von Verrechnungspreisen ausgegangen werden oder von normalisierten Kostensätzen oder Kalkulationsätzen. Die Plankostenrechnung wird untergliedert in
eine starre Plankostenrechnung,
eine flexible Plankostenrechnung und
eine Grenzplankostenrechnung.
Verständnisfragen
Haben Sie alles verstanden? Mit den folgenden Fragen können Sie das Gelernte schnell prüfen:
Durch welche Kosten unterscheiden sich Deckungsbeitrag III und IV?
durch erzeugnisfixe Kosten
durch Kostenstellenfixkosten
durch bereichsfixe Kosten
durch Unternehmensfixkosten
Was ist ein Synonym für Fixkostendeckungsrechnung?
Prozesskostenrechnung
Direct Costing
mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
Gewinnschwellenanalyse
Welche Größen liegen der Normalkostenrechnung zugrunde?
Ist-Werte
Planwerte
Durchschnittswerte
Soll-Werte
5Die Investitionsrechnung
Die Investitionsrechnung ermöglicht es, den Nutzen und die Rentabilität einer Investition zu ermitteln. Sie dient zudem der Entscheidungsunterstützung.
Neben ökonomischen Faktoren kommen auch andere Aspekte wie rechtliche, technologische und ökologische Gesichtspunkte zum Tragen, die die Entscheidung für oder gegen eine Investition beeinflussen.
Eine Investition ist eine Umwandlung von Kapital in Sachoder Finanzvermögen.
Finanzmathematisch gilt eine Investition als der gesamte Zahlungsstrom von Ein- und Auszahlungen. Grundsätzlich wird zwischen statischen und dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung differenziert.
Statische Ansätze
beruhen auf den Erfolgsgrößen der Kostenrechnung, wobei Durchschnittswerte zugrunde gelegt werden. In der betrieblichen Praxis führt diese Vereinfachung zu Ungenauigkeiten.
Bei den
dynamischen Verfahren
erfolgt eine stärkere Differenzierung, bei der einzelne Perioden betrachtet werden. Der Barwert einer Investition wird mit dem Barwert der Einnahmen verglichen. Hierfür verwendet man die Verfahren der Auf- und Abzinsung.
Investitionsarten:
Investitionen
Immaterielle Investitionen
Finanzinvestitionen
Sachinvestitionen
Ersatzinvestition
Rationalisierungsinvestition
Erweiterungsinvestition
sonstige Investitionen
Bei den Ersatzinvestitionen kommt es nur darauf an, ein bereits vorhandenes Objekt durch Investitionen zu ersetzen. Eine solche neue Investition kann unter Umständen kostengünstiger sein, als das alte Objekt beizubehalten. Darüber hinaus kann der technologische Fortschritt erfordern, dass einzelne Maschinen oder Anlagen durch technologisch neuere ersetzt werden.
Bei den Rationalisierungsinvestitionen steht die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens im Mittelpunkt. Der Rationalisierungseffekt wird meist durch Ersatzinvestitionen bewerkstelligt.
Erweiterungsinvestitionen dienen dazu, das Potenzial des Unternehmens und die Produktionskapazitäten zu erhöhen, um Engpässe zu vermeiden. Durch zusätzliche Investitionsobjekte wird die Effektivität und Effizienz der Fertigung und der Dienstleistungen beträchtlich erhöht.
Die Investitionsrechnung selbst wird untergliedert in Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung und jene der Unternehmensbewertung.
Die Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung werden weiter aufgeschlüsselt in statische Verfahren und dynamische Verfahren.
Zu den statischen Verfahren zählen
die Gewinnvergleichsrechnung,
die Kostenvergleichsrechnung,
die Rentabilitätsrechnung und
die Amortisationsrechnung.
Die dynamischen Verfahren werden systematisiert in
die Kapitalwertmethode,
die interne Zinsfußmethode und
die Annuitätenmethode.
Im Rahmen des Controlling kann auch eine Bewertung des Unternehmens vorgenommen werden, um dessen Leistungsund Wettbewerbsfähigkeit zu bestimmen. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren in der Betriebswirtschaftslehre, die weit verbreitet sind.
Eine dieser Methoden ist der Zukunftserfolgswert, der auf einem subjektivem Bewertungsansatz basiert. Dabei wird der zukünftige Erfolg als Zukunftserfolgswert zusammengefasst.
Traditionelle Verfahren der Unternehmensbewertung sind das Ertragswertverfahren, das Substanzwertverfahren und das Mittelwertverfahren. Beim Ertragswertverfahren werten die Zinsgewinne des Unternehmens ermittelt. Als Zukunftserfolgswert wird der Kalkulationszinsfuß für risikofreie Anlagen zugrunde gelegt. Dieser Ansatz ist abhängig von der jeweiligen Rechtsform des Unternehmens, der Größenklasse sowie der Branche.
Verständnisfragen
Haben Sie alles verstanden? Mit den folgenden Fragen können Sie das Gelernte schnell prüfen:
Was sind Ansätze in der dynamischen Investitionsrechnung?
Kapitalwertmethode
Amortisationsrechnung
Annuitätenmethode
Wie sind Beispiele für Sachinvestitionen?
Erweiterungsinvestitionen
Rationalisierungsinvestitionen
Finanzinvestitionen
immaterielle Investitionen
Ersatzinvestitionen
Welcher Ansatz der Unternehmensbewertung beruht auf dem Reproduktionswert?
Ertragswertverfahren
Substanzwertverfahren
Mittelwertverfahren
6Das strategische Controlling
Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Umsetzung ist die Strategiedefinition, die für jedes Unternehmen unerlässlich ist. Beim Strategieprozess geht es darum, eine Strategie zu entwickeln, die differenziert den Rahmenbedingungen und den spezifischen Charakteristika des Unternehmens entspricht.
Funktionen von Zielen
Steuerungsfunktion
Orientierungsfunktion
Motivationsfunktion
Beurteilungsfunktion
Kontrollfunktion
Filterfunktion
Magnetfunktion
Rückkopplungsfunktion
Die SWOT-Analyse
Die SWOT-Analyse ist eine Methode, um bei Unternehmen die Stärken und Schwächen zu ermitteln. Sie dient als Instrument zur Strategieentwicklung. Das Akronym SWOT steht für die englischen Begriffe
S
trengths (Stärken),
W
eaknesses (Schwächen),
O
pportunities (Chancen) und
T
hreats (Risiken).
Das Life Cycle Costing
Aus dem Lebenszyklusmodell wurde ein eigenes Controlling- Instrument entwickelt, das als Life Cycle Costing (LCC) oder auf Deutsch als Lebenszykluskostenrechnung bezeichnet wird.
Dabei wird der gesamte Prozess bei der Herstellung eines Produkts beleuchtet und die Kosten, die in den einzelnen Phasen anfallen, werden umfassend analysiert.
Bei den Kosten wird zwischen zeitlichen und sachlichen Aspekten differenziert.
Die
sachlichen Kriterien
thematisieren das herzustellende Objekt,
während die
zeitlichen Aspekte
die Struktur der Phasen und die Dauer untersuchen.
Neben den Produktionskosten (auch Produktentwicklung, Design, Verpackung, Logistik, Kundenservice) werden auch Kosten für das Recycling und die Entsorgung berücksichtigt.
Die Portfolioanalyse
Bei der Portfolioanalyse erfolgt eine Positionierung innerhalb eines Quadrantensystems. Berücksichtigt werden Aspekte wie der Produktlebenszyklus sowie der Marktlebenszyklus. Die Portfolioanalyse unterscheidet bestimmte Bereiche, in denen das Unternehmen eingeordnet wird. Hierfür gibt es so genannte Matrizen, die der Veranschaulichung dienen.
Die Vier-Felder-Matrix betrachtet vorwiegend das Marktwachstum und den relativen Marktanteil, der sich aus dem Quotienten von dem Marktanteil des Unternehmens und dem Marktanteil des stärksten Wettbewerbers ergibt.
Ein weiteres Instrument des strategischen Controlling ist die Produkt-Markt-Matrix, die nach dem Erfinder auch Ansoff-Matrix oder Z-Matrix genannt wird. Sie dient der Strategieselektion. Die Ansoff-Matrix differenziert zwischen vorhandenen und neuen Produkten. In einer zweiten Dimension berücksichtigt sie die Märkte und die Intensität der Marktdurchdringung.
Ein weiteres Hilfsmittel der Portfolioanalyse im Rahmen des strategischen Controlling ist das McKinsey-Portfolio, das auch den Namen Marktattraktivitäts-Wettbewerbsstärken-Portfolio oder Neun-Felder-Portfolio trägt.
Die Balanced Scorecard
Die Balanced Scorecard (auf Deutsch: „Ausgewogenes Kennzahlensystem“) ist ein Controllinginstrument, das für verschiedene Bereiche zur Steuerung des Unternehmens komplexe Kennzahlen zur Verfügung stellt.
Dabei werden verschiedene Bereiche des Unternehmens mit einbezogen, die auch qualitative Aspekte wie Kundenzufriedenheit widerspiegeln.
Durch einen Soll-Ist-Vergleich soll festgestellt werden, wie hoch der Zielerreichungsgrad ist. Die Kennzahlen fungieren als Indikatoren für den Erfolg eines Unternehmens und stellen eine Rückmeldung für das Management dar.
Shareholder Value und Stakeholder Value
Der Shareholder Value betrachtet das Unternehmen aus der Sicht des Kapitalmarktes und strebt eine Erhöhung des Wertes für den Anteilseigner an. Im Vordergrund stehen daher Rentabilitätskennzahlen. Besonders häufig zum Einsatz gelangen
der Discounted Cashflow
(DCF)
und
das Konzept des Economic Value Added
(EVA).
Der Stakeholder-Value-Ansatz fokussiert sich auf die so genannten Anspruchsgruppen. Hierzu gehören neben den Mitarbeitern und Führungskräften auch Kunden, Anteilseigner, Lieferanten und Geschäftspartner.
Wissensmanagement und Wissensbilanz
Eine Wissensbilanz (im Englischen: intellectual capital statement) ist eine Methode, um das Wissenspotenzial eines Unternehmens zu erfassen und zu bewerten. Das Wissen der Mitarbeiter wird als eine strategisch äußerst bedeutsame Ressource aufgefasst, die maßgeblich zum Unternehmenserfolg beiträgt. Das Wissensmanagement ist auf der operativen Ebene angesiedelt, während die Wissensbilanz die strategische Dimension beleuchtet.