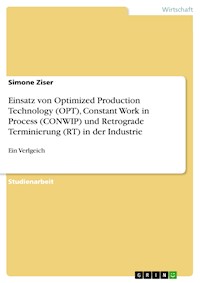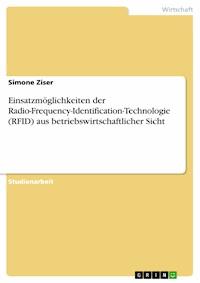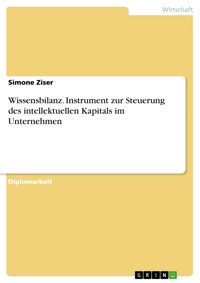
Wissensbilanz. Instrument zur Steuerung des intellektuellen Kapitals im Unternehmen E-Book
Simone Ziser
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 1,8, Frankfurt University of Applied Sciences, ehem. Fachhochschule Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Management des 20. Jahrhundert war geprägt durch die arbeitsteilige Betriebsführung nach Frederic Taylor. Der effiziente Einsatz der klassischen Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital, führte zu beachtlichen Erfolgen und hoher Produktivität. Die heutige Gesellschaft ist von einer zunehmenden Dynamik geprägt. Die Globalisierung, die Technologisierung und die Digitalisierung ermöglichen neue Produkte, neue Dienstleistungen und neue Geschäftsmodelle. Die Ressource Wissen wird nun als vierter Produktionsfaktor zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor und steckt unter anderem in Kompetenzen, Führungsstrukturen, Prozessen, Informationen über Kunden und Lieferanten usw., kurz: im intellektuellen Kapital. Der Wert dieses Wissens spiegelt sich auch im Unternehmenswert wider. Dieser besteht, besonders bei Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, sowie bei Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, nur noch zu einem sehr geringen Anteil aus materiellen Vermögenswerten. Dennoch betrachtet die übliche Finanzbilanz, als Ausweis der unternehmerischen Werte, zum Großteil nur das materielle Vermögen. Das intellektuelle Kapital eines Unternehmens bestimmt mehr und mehr dessen Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Es hat großen Einfluss auf die gesamte Wertschöpfungskette und dieser wird sich in Zukunft noch verstärken. Durch den wachsenden Anteil von Wissen an der Wertschöpfung muss diese Ressource noch gezielter in der Unternehmenssteuerung berücksichtigt werden. Werkzeuge wie Wissens-, Change- und Qualitätsmanagement sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungsmanagement stehen der Unternehmensführung zur Steuerung und Optimierung des jeweiligen Anwendungsbereichs zur Verfügung. Doch wie lassen sich die meist knappen Ressourcen im Unternehmen sinnvoll allokalisieren? Das „Bilanzieren von Wissen“ soll Abhilfe schaffen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Bilanz im traditionellen Sinne, wie die Finanzbilanz mit Ausweis der Aktiva und Passiva, sondern um ein Instrument zur Identifizierung, Darstellung, Messung und Bewertung von intellektuellem Kapital. Eine Wissensbilanz beschäftigt sich speziell mit den nur schwer greifbaren Werten und versucht diese zu quantifizieren und damit steuerbar zu machen. Im Zuge der Wissensbilanzierung bestehen bereits einige Ansätze, die sich aber nur teilweise zur Steuerung eignen. Dies soll in der folgenden Arbeit näher untersucht und anhand einer bestehenden Methode dargestellt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzei chnis
Inhaltsverzei chnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung und Aufbau der Arbeit
1.1. Einleitung
1.2. Aufbau der Arbeit
2. Grundlagen zur Unternehmensführung und -steuerung
2.1. Unternehmensführung
2.2. Unternehmenssteuerung
2.2.1. Planungs- und Kontrollsystem
2.2.2. Steuerungssystem
3. Charakterisierung des intellektuellen Kapitals
3.1. Definition und Begriff des intellektuellen Kapitals
3.2.1. Humankapital
3.2.2. Strukturkapital
3.2.3. Beziehungskapital
3.3. Eigenschaften des intellektuellen Kapitals
3.3.1. Positive Eigenschaften
3.3.2. Negative Eigenschaften
3.4. Notwendigkeiten zur Steuerung des intellektuellen Kapitals
3.4.1. Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnologie
3.4.2. Globalisierung
3.4.3. Struktureller Wandel zur Informations- und Wissensgesellschaft
4. Charakterisierung der Wissensbilanz
4.1. Beweggründe und Notwendigkeiten der Wissensbilanzierung
4.2. Begriff und Definition der Wissensbilanz
4.3. Einsatzmöglichkeiten und Zielsetzungen der Wissensbilanz
4.3.1. Berichts- und Kommunikationsinstrument
4.3.2. Managementinstrument
4.3.3. Dilemma zwischen Kommunikations- und Managementinstrument
4.4. Ansätze zur Messung und Bewertung des intellektuellen Kapitals
4.4.1. Deduktiv-summarische Ansätze
4.4.2. Analytisch-induktive Ansätze
4.5. Probleme der Wissensbilanzierung
5. Steuerungsinstrument „Wissensbilanz-Made in Germany"
5.1. Grundlagen zur Wissensbilanz-Made in Germany
5.2. Planungs- und Kontrollsystem
5.2.1. Beschreibung der Ausgangssituation
5.2.2. Identifikation der Einflussfaktoren
5.2.3. Bewertung des intellektuellen Kapitals
5.2.4. Messung des intellektuellen Kapitals
5.3. Steuerungssystem
5.3.1. Erfassung der Wechselwirkungen
5.3.2. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
5.3.3. Ableitung von Maßnahmen
5.3.4. Erstellung der Wissensbilanzdokumente
5.4. Abschließende Beurteilung
5.4.1. Theoretische Beurteilung
5.4.2. Praktische Beurteilung
6. Ausblick
7. Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb.1: Klassifikationen; Alwert (2005b)
Abb. 2: Indikatorenklassen; North (1999)
Abb. 3: Wissensbilanz; North (1999)
Abb. 4: Wissensbilanzmodell nach Koch/Schneider; Koch et al. (2008)
Abb. 5: Vorgehensmodell des AKWB; Alwert et al. (2005f)
Abb. 6: Erstellungsschritte zur Wissensbilanz; eigene Darstellung
Abb. 7: Wissensbilanzmodell des AKWB; Alwert et al. (2005f)
Abb. 8: Vereinfachtes Fischgrätdiagramm; Bornemann et al (2004)
Abb. 9: QQS-Bewertung; eigene Darstellung
Abb. 10: QQS-Portfolio; eigene Darstellung
Abb. 11: QQS-Balkendiagramm; eigene Darstellung
Abb. 12: Indikatorendefinition; eigene Darstellung
Abb. 13: Wirkungszusammenhänge erfassen; eigene Darstellung
Abb. 14: Wirkungsnetz mit Generatoren; eigene Darstellung
Abb. 15: Potential-Portfolio; eigene Darstellung
Abb. 16: Einbettung der Wissensbilanz; Bornemann/Reinhardt (2008)
Abb. 17: Beispiel Regelkreis mit Zeitverzögerung; Alwert (2005b)
Abb. 18: Zukünftiger Nutzen; Arbeitskreis Wissensbilanz et al. (2006a)
Abb. 19: Nutzen Wissensbilanz; Arbeitskreis Wissensbilanz et al. (2006b)
Abb. 20: Bewertung Wichtigkeit; Arbeitskreis Wissensbilanz et al. (2006b)
Abb. 21: Bewertung Methode; Arbeitskreis Wissensbilanz et al. (2006b)
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung und Aufbau der Arbeit
1.1. Einleitung
Das Management des 20. Jahrhundert war geprägt durch die arbeitsteilige Betriebsführung nach Frederic Taylor. Der effiziente Einsatz der klassischen Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital, führte zu beachtlichen Erfolgen und hoher Produktivität. Die heutige Gesellschaft ist von einer zunehmenden Dynamik geprägt. Die Globalisierung, die Technologisierung und die Digitalisierung ermöglichen neue Produkte, neue Dienstleistungen und neue Geschäftsmodelle. Die Ressource Wissen wird nun als vierter Produktionsfaktor zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor und steckt unter anderem in Kompetenzen, Führungsstrukturen, Prozessen, Informationen über Kunden und Lieferanten usw., kurz: im intellektuellen Kapital.
Der Wert dieses Wissens spiegelt sich auch im Unternehmenswert wider. Dieser besteht, besonders bei Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, sowie bei Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, nur noch zu einem sehr geringen Anteil aus materiellen Vermögenswerten. Dennoch betrachtet die übliche Finanzbilanz, als Ausweis der unternehmerischen Werte, zum Großteil nur das materielle Vermögen.
Das intellektuelle Kapital eines Unternehmens bestimmt mehr und mehr dessen Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Es hat großen Einfluss auf die gesamte Wertschöpfungskette und dieser wird sich in Zukunft noch verstärken. Durch den wachsenden Anteil von Wissen an der Wertschöpfung muss diese Ressource noch gezielter in der Unternehmenssteuerung berücksichtigt werden.
Werkzeuge wie Wissens-, Change- und Qualitätsmanagement sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungsmanagement stehen der Unternehmensführung zur Steuerung und Optimierung des jeweiligen Anwendungsbereichs zur Verfügung. Doch wie lassen sich die meist knappen Ressourcen im Unternehmen sinnvoll allokalisieren?
Das „Bilanzieren von Wissen" soll Abhilfe schaffen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Bilanz im traditionellen Sinne, wie die Finanzbilanz mit Ausweis der Aktiva und Passiva, sondern um ein Instrument zur Identifizierung, Darstellung, Messung und Bewertung von intellektuellem Kapital. Eine Wissensbilanz beschäftigt sich speziell mit den nur schwer greifbaren Werten und versucht diese zu quantifizieren und damit steuerbar zu machen. Im Zuge der Wissensbilanzierung bestehen bereits einige Ansätze, die sich aber nur teilweise zur Steuerung eignen. Dies soll in der folgenden Arbeit näher untersucht und anhand einer bestehenden Methode dargestellt werden.
1.2. Aufbau der Arbeit
2. Grundlagen zur Unternehmensführung und -steuerung
2.1. Unternehmensführung
Die Unternehmensführung beinhaltet sämtliche Aufgaben zur zielorientierten Gestaltung und Lenkung eines Unternehmens. Im Rahmen der Unternehmensführung wird grundsätzlich zwischen strategischer und operativer Unternehmensführung unterschieden.
Das strategische Management ist auf die langfristige Entwicklung bestehender und die Erschließung neuer Erfolgspotentiale ausgerichtet und legt die dafür erforderlichen Strategien fest. Eine Strategie ist ein geplantes Bündel an Maßnahmen zur Positionierung im Wettbewerb und zur Gestaltung der dazu erforderlichen Ressourcenbasis. Die strategische Unternehmensführung beschreibt die hierfür erforderlichen Ziele, Leistungspotentiale und Vorgehensweisen. Ziel hierbei ist es, für das Unternehmen Wertbewerbsvorteile zu generieren und so die Überlebens- und Entwicklungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.[1]
Das operative Management erstreckt sich in der Regel über einen kurzen Zeitraum (ca. 1 Jahr) und befasst sich mit der Planung, Steuerung und Kontrolle der laufenden Aktivitäten eines Unternehmens, um die bestehenden Erfolgspotentiale effizient zu nutzen. Hierzu werden auf Basis des strategischen Planungs- und Kontrollsystems detaillierte Ziele und Maßnahmen in den einzelnen Funktionsbereichen erarbeitet, umgesetzt und aufeinander abgestimmt. Hauptziel des operativen Managements ist es, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens sicherzustellen.[2]
Im Lauf der Zeit haben sich die Managementansätze stets verändert. Die Grundkonzepte des modernen strategischen Managements werden durch die Ansätze der markt-, ressourcen-, und wertorientierten Unternehmensführung wiedergegeben.
Die marktorientierte Unternehmensführung basiert auf dem theoretischen Ansatz der Industrieökonomie. Danach erklären sich Wettbewerbsvorteile aus der Positionierung eines Unternehmens in seiner Umwelt. Im Rahmen der marktorientierten Unternehmensführung werden die globale Umwelt, Branche, Märkte, Kunden und Konkurrenten analysiert. Aus der Entdeckung von Chancen und Risiken sowie der Gegenüberstellung von Stärken und Schwächen des eigenen Unternehmens werden strategische Maßnahmen abgeleitet.[3]
Nach Porter[4] bestehen folgende grundlegende Wettbewerbsstrategien:
Kostenführerschaft: standardisierte Produkte zu niedrigem Preis Differenzführerschaft: einzigartige Produkte zu höheren Preisen Konzentration: Produkte für bestimmte Abnehmergruppen